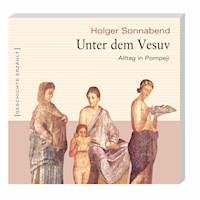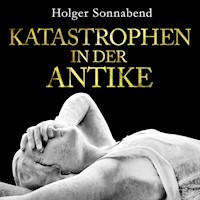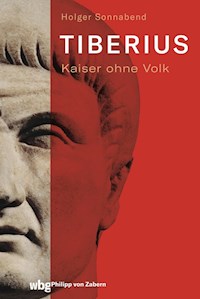Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte bietet zu den Themen "Fremde" und "Fremdsein" ein großes Reservoir an Erlebnissen, Erfahrungen, Erkenntnissen, Erfolgsgeschichten und Problemfällen. Das gilt auch und besonders für die Antike. Sie ist für uns das "nächste Fremde" (Uvo Hölscher), nicht im zeitlichen, sondern im kulturellen und mentalen Sinn: fremd genug, um unsere Denkgewohnheiten infrage zu stellen, und nahe genug, um für uns auch heute noch von Bedeutung zu sein. Das Buch stellt kompakt, anschaulich und fundiert recherchiert dar, wie die uns kulturell und mental so nahestehenden Menschen der Antike mit Fremden umgegangen sind. Dabei ergibt sich ein breites Spektrum an Sichtweisen und Einstellungen, das von Verfolgung, Vertreibung und Ausgrenzung bis zu Toleranz und Integration reicht. Inhaltlich konzentriert sich das Buch auf die Griechen und Römer, mit einem zeitlichen Bogen, der sich vom achten Jahrhundert v. Chr., der Frühzeit der Griechen, bis zum fünften Jahrhundert n. Chr., dem Ende des Weströmischen Reiches, erstreckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HOLGER SONNABEND
FREMDE UNDFREMDSEIN IN DERANTIKE
ÜBER MIGRATION, BÜRGERRECHT,GASTFREUNDSCHAFT UND ASYL BEIGRIECHEN UND RÖMERN
INHALT
Prolog:Bereicherung oder Bedrohung?Eine antike Diskussion über Fremde in Rom
I. Griechenland
1. Besuch bei Polyphem: Gastfreundschaft im antiken Griechenland
2. Fremde willkommen? Griechen unterwegs
3. Wir und die Anderen – Konzepte des Fremdseins
4. Griechen und Barbaren
5. Exotische Fremde – Ethnografie und Mythos
6. Leben mit Fremden – Leben als Fremde
7. Unter göttlichem Schutz: Asyl bei den Griechen
8. Fremde unerwünscht? Vertreibungen in Sparta
9. Karikatur oder Realität? Fremde in den Komödien des Aristophanes
II. Hellenismus
1. Aufbruch in neue Welten: Alexander der Große
2. Der Hellenismus: Staat und Gesellschaft
3. Alexandria – Schlaglicht auf einen antiken Schmelztiegel
4. Neue Trends: Philosophie, Religion und Kunst
5. Die Entdeckung der Welt
III. Rom
1. Fremde in Rom: Moderne und antike Stimmen
2. Rechtsstatus, soziale Akzeptanz, steile Karrieren
3. Bewundert, gefürchtet, gehasst: Pyrrhos und Hannibal
4. Kleopatra – Die Römer und die Griechin vom Nil
5. Wunderland Ägypten
6. Weltstadt Rom
7. Die Juden von Rom
8. Umjubelte Fremde: Gladiatoren und Wagenlenker
9. Von Traian bis Elagabal: Fremde auf dem römischen Kaiserthron
10. Berühmte Schriftsteller, die aus der Fremde kamen
11. Bürgerrecht für alle
12. Der Limes: Treffpunkt der Kulturen … und die traurige Geschichte des Syrers, der an der Donau Militärdienst leistete
13. Grenzerfahrungen
14. Die Völkerwanderung und der Untergang des Römischen Reiches
15. Blick nach vorn: Byzanz
Bilanz
Wichtige Forschungsliteratur
Verzeichnis der zitierten Quellen
Bildnachweis
Panorama der Ruinen des Forum Romanum von den Kapitolinischen Museen aus betrachtet, 2012
PROLOG: BEREICHERUNG ODER BEDROHUNG? EINE ANTIKE DISKUSSION ÜBER FREMDE IN ROM
Rom an einem Tag des Jahres 48 n. Chr. Der Sitzungssaal des römischen Senats auf dem Forum Romanum ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Das ehrwürdige Gremium der Senatoren diskutiert über eine brisante Frage. Die Gemüter sind erhitzt, die Emotionen kochen hoch, noch mehr als üblich. Es geht um einen Antrag, eingebracht von prominenten Persönlichkeiten aus Gallien. Schon lange ist das heutige Frankreich Teil des Römischen Reiches. Es war 100 Jahre zuvor von dem berühmten Feldherrn Iulius Caesar in seinem nicht minder berühmten »Gallischen Krieg« unterworfen worden. Inzwischen haben viele Bewohner des Landes das römische Bürgerrecht erhalten. Rom ist großzügig, wenn es darum geht, Fremde zu römischen Bürgern zu machen – nicht aus einer humanitären Grundhaltung heraus, sondern weil die Regierenden der Ansicht sind, dass ein Staat sich besser lenken lässt, wenn die Bewohner das Gefühl haben, gleichberechtigt zu sein. So sind viele Menschen, die im Römischen Reich leben, zwar von der Herkunft her Syrer, Ägypter, Griechen oder Germanen, doch im rechtlichen Sinne sind sie Römer – Herkunftsfremde und Rechtsrömer in einer Person.
Integration ist in Rom politisch gewollt. Doch was jetzt, im Jahre 48 n. Chr., auf der Tagesordnung des Senats steht, geht vielen, insbesondere den Vertretern der alten Adelsfamilien, entschieden zu weit. Der Antrag der Gallier lautet: Wir verlangen Zugang zu den hohen politischen Ämtern. Weil in Rom mit dem Amt traditionell auch der Anspruch auf einen Sitz im Senat verbunden ist, stünde ihnen damit auch der Weg in die Regierung offen. Gallier in römischen Schlüsselpositionen? Gallier als Konsuln, Praetoren, Tribunen? Viele Senatoren, die sich einiges auf ihren Stammbaum einbilden, verfallen in einen Zustand der Schockstarre, bevor sie heftig zu protestieren beginnen. Die Vorstellung, im Senat einen gallischen Sitznachbarn zu haben, und möge er auf dem Papier auch Römer sein, bereitet ihnen eine gehörige Portion Bauchschmerzen. Die Sache ist so wichtig, dass sie dem Kaiser vorgetragen wird. Die Kritiker fassen ihm gegenüber ihre Bedenken zusammen:
»Italien ist nicht so heruntergekommen, dass es seiner Hauptstadt nicht selbst einen Senat zur Verfügung stellen könne.«
»Früher sind die verwandten Völker mit geborenen Römern zufrieden gewesen, und man braucht sich der alten Republik doch nicht zu schämen.«
»Sogar jetzt noch wird an die Vorbilder erinnert, die entsprechend der alten Sitte römisches Wesen, um Tapferkeit und Ruhm bemüht, geschaffen haben.«
»Erfreuen sollen sich die Gallier an der Bezeichnung ›Bürger‹. Die Insignien der Senatoren und die Ehrenzeichen der hohen Beamten dürfen sie nicht zum Gemeingut machen.«
Was sagt der Kaiser zu diesen Argumenten? Der Kaiser merkt: Es gibt kein wirkliches sachliches Argument. Wir brauchen sie nicht, heißt es von den Kritikern, und: Das haben wir noch nie so gemacht. Die Senatoren aus Italien fürchten offenbar die Konkurrenz und ihre politischen Privilegien. Sie berufen sich auf eine abstrakte, aber zentrale römische Institution, den mos maiorum, die »Sitte der Vorfahren«. Was früher richtig war, kann heute nicht falsch sein.
Der Kaiser, dem die Gegner diese Argumente vortragen, heißt Claudius. Seit sieben Jahren im Amt, ist er als Nachfolger des berüchtigten Caligula bemüht, einen soliden, sachlichen Regierungsstil zu pflegen. Was er den versammelten Senatoren sagt, wissen wir ganz genau – dank einer Inschrift mit dem Text der Rede, die sich in Lyon, dem antiken Lugdunum, befindet und die von den glücklichen Galliern aufgestellt wurde, um die Ausführungen des Kaisers für alle Zeiten zu dokumentieren (Corpus Inscriptionum Latinarum 13,1668). Der Kaiser ergreift das Wort. Auch er spricht von der Vergangenheit, deutet sie aber ganz anders. Verschnörkelt und holprig im Stil, wie es seine Art ist, aber in der Sache unmissverständlich führt er aus:
»Ich bitte euch, daran zu denken, wie viele Neuerungen in dieser Stadt eingeführt wurden.
Einstmals hatten Könige diese Stadt in ihrem Besitz. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Herrschaft über sie Nachfolgern aus ihrem Haus zu übertragen. Fremde traten an ihre Stelle und sogar Ausländer, sodass Numa, der aus dem Sabinerland kam, auf Romulus folgte. Er war uns zwar benachbart, aber war damals ein Mann von auswärts. […]
Sicher führte man einen neuen Brauch ein, als der vergöttlichte Augustus, mein Großonkel, und mein Onkel Tiberius Caesar den Willen äußerten, die gesamte Blüte der Kolonien und Landstädte von überall her, das heißt die besten und wohlhabendsten Männer, sollte in diesem Senat einen Sitz erhalten. […]
Wie? Ist uns nicht ein Senator aus Italien lieber als einer aus den Provinzen? … Meiner Ansicht nach darf man nicht einmal Menschen aus den Provinzen zurückweisen, sofern sie nur das Ansehen der Kurie erhöhen können. […]
Wenn jemand bei den Galliern auf den Umstand schaut, dass sie dem vergöttlichten Iulius Caesar in einem zehnjährigen Krieg zu schaffen machten, dann möge er zugleich ihre 100-jährige unerschütterliche Treue dem entgegenstellen und ihren Gehorsam, der in vielen Krisen von uns mehr erprobt worden ist.«
Die Lehre, die wir aus der Vergangenheit ziehen müssen, lautet nach Ansicht des Kaisers: Fremde haben für Rom zu allen Zeiten Gutes bewirkt. Er führt große Namen ins Feld, als Zeugen dafür, dass Rom schon immer offen für fremde Menschen war: Romulus, den mythischen Stadtgründer und ersten König von Rom; Numa (Pompilius), den zweiten König von Rom; Augustus, den ersten römischen Kaiser; Tiberius Caesar, den zweiten Kaiser.
Die Worte des Kaisers geben den Ausschlag. Die Mehrheit der Senatoren beschließt, dass die fremden Gallier Spitzenämter bekleiden und in den Senat von Rom aufgenommen werden dürfen. Zwar sind nicht alle, die zustimmen, wirklich überzeugt. Aber es kann der eigenen Karriere nichts schaden, dem Kaiser einen Gefallen zu erweisen.
Die Argumente der Skeptiker hat der römische Historiker Tacitus in einem Standardwerk zur Geschichte der frühen römischen Kaiserzeit überliefert (Annalen 11,23). An gleicher Stelle (24–25) präsentiert er die inschriftlich erhaltene Rede des Kaisers Claudius in einer etwas freieren Bearbeitung und legt ihm dabei eine noch fremdenfreundlichere Haltung in den Mund, als sie der Kaiser ohnehin schon hatte:
»Meine Vorfahren, deren ältester, Clausus, ein geborener Sabiner, zugleich in die Bürgerschaft Roms und unter die Familien der Patrizier aufgenommen worden ist, mahnen mich, nach den gleichen Grundsätzen bei der Staatsführung zu verfahren, indem ich hierherhole, was sich irgendwo hervorgetan hat.
Was anderes wurde den Spartanern und Athenern trotz ihrer militärischen Übermacht zum Verhängnis, dass sie Besiegte, weil sie fremdstämmig waren, ausgrenzten? […]
Da besaß doch der Gründer unseres Staates, Romulus, so viel Weisheit, dass er die Mehrzahl der Volksstämme am selben Tag als Feinde und dann als Bürger behandelte. […]
Fremde haben über uns geherrscht. Den Söhnen Freigelassener Staatsämter zu übertragen, ist nicht, wie sehr viele meinen, etwas Neues, sondern war schon früher beim Volk üblich. […]
Da die Gallier schon durch Sitten, Bildung und Verschwägerung mit uns vermischt sind, mögen sie ihr Gold und ihre Schätze lieber hierher zu uns bringen als für sich allein zu behalten. […]
Alles, Senatoren, was man heute für uralt hält, ist einmal neu gewesen. […] Einbürgern wird sich auch die jetzige Regelung, und was wir heute durch Vorbilder verteidigen, wird einst zu den Vorbildern gehören.«
Die Aufnahme der Gallier in den römischen Senat ist ein markantes Beispiel für eine positive Einstellung gegenüber Fremden in der Antike. Die Gegner der Aufnahme waren Vertreter der einheimischen Eliten, die durch den Eintritt von Fremden in die politischen Führungszirkel um ihre Macht und ihre Privilegien fürchteten. Sie hatten aber keine Chance, ihre Wünsche durchzusetzen. Kaiser Claudius als oberste Autorität entschied anders. Er hatte keine humanitären Motive. Ihm ging es um den Nutzenaspekt. Er schätzte das wirtschaftliche und politische Potenzial der Fremden. Und er hoffte, in den Fremden Verbündete zu finden, weil sie ihm zu Dank verpflichtet waren. Sie konnten ihm das mitunter schwierige Geschäft des Regierens erleichtern, wenn sie sich im Senat für ihn einsetzten. Der historische Berichterstatter Tacitus, sonst nicht unbedingt ein Freund von Fremden, argumentierte nicht staatspolitisch, sondern in eigener Sache. Seine Familie stammte wahrscheinlich aus Gallien, und er war zu einer späteren Zeit selbst Mitglied des römischen Senats. Die Haltung des Kaisers Claudius bedeutete für ihn eine Unterstützung und Legitimierung der eigenen politischen Position.
Seine positive Haltung gegenüber Fremden brachte Claudius viel Kritik ein, auch später noch, nach seinem Tod, wie eine eigenartige Quelle aus der Regierungszeit seines Nachfolgers Nero dokumentiert. Sie stammt aus der Feder Senecas, Neros einflussreichem Berater, der dank dieser Tätigkeit im direkten Umfeld der Macht Millionär wurde und in der Attitüde des stoischen Philosophen seine nicht ganz so begüterten Zeitgenossen für die Idee zu begeistern versuchte, das höchste Glück in Genügsamkeit und Askese zu sehen. Ein paar Monate nach Neros Herrschaftsantritt 54 n. Chr. veröffentlichte Seneca eine Satire mit dem Titel Apocolocyntosis. In dieser genialen Verballhornung der Praxis, römische Kaiser nach ihrem Tod durch die Apotheose, die Entrückung zu den Göttern, zu ehren (der Titel bedeutet »Verkürbissung«), hat sich der verstorbene Kaiser Claudius vor den himmlischen Göttern zu verantworten. Doch zunächst muss die Seele den Körper verlassen, sie findet aber keinen Ausgang. Schuld daran ist die Schicksalsgöttin Clotho. Sie möchte dem Kaiser noch etwas Zeit geben, »bis er auch noch die paar Leutchen, die übrig geblieben sind, mit dem Bürgerrecht beschenkt hätte«. Erklärend sagt der Erzähler an dieser Stelle: »Claudius hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, alle Griechen, Gallier, Spanier, Britannier in der Toga zu sehen.« Clotho fährt fort: »Aber da nun laut Beschluss noch einige Ausländer als Saatgut für später bleiben sollen und du befiehlst, es solle so sein, so sei’s denn.« (3,3) Etwas später tritt die Göttin Febris auf. Sie ist für Krankheiten zuständig, insbesondere für fiebrige Infekte. Ihr Heiligtum befand sich in Rom auf dem Palatin, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Residenz des Kaisers. Insofern war sie Expertin für alles, was den – häufig kränkelnden – Claudius betraf. Und nun betreibt sie Aufklärung. Claudius – ein Römer? Nein, er ist in Lugdunum (heute Lyon) geboren, er ist also »ein lupenreiner Gallier«, und »deswegen hat er auch, wie es sich für einen Gallier gehört, Rom eingenommen«. Ein tiefer Griff in die Geschichte: 387 v. Chr. hatten Gallier die Stadt Rom gestürmt. Und nun lud der »Gallier« Claudius seine »Landsleute« dazu ein, im Senat Platz zu nehmen. Bei dieser Argumentation interessierte es nicht, dass Claudius in Wirklichkeit einer alten Römerfamilie entstammte. Dass er in Lyon geboren wurde, war reiner Zufall, weil sein Vater Drusus zu diesem Zeitpunkt dort in militärischer Mission seine Zelte aufgeschlagen hatte.
Die hohe Politik folgt eigenen Gesetzen, auch, wenn es um Fremde geht. Anders sieht es im normalen Alltag aus. Das Rom der Kaiserzeit war ein Schmelztiegel der Völker und Kulturen. Mehr als eine Million Menschen lebten in der Hauptstadt des Imperiums. Viele von ihnen kamen aus dem Osten der Mittelmeerwelt – aus Griechenland, Anatolien, Persien, Judäa, Syrien, Ägypten.
Iuvenal mag die Fremden nicht. Vor allem die aus dem Orient sind ihm zuwider. Iuvenal ist Dichter. Daher hat er die Gelegenheit, seiner Aversion gegen die Fremden ein breiteres Forum zu verschaffen. Er schreibt Satiren. In Rom handelt es sich dabei, anders als im heutigen Verständnis, um eine spezielle dichterische Form und nicht um eine mit pointierten Zuspitzungen arbeitende Kunstgattung. Was er sagt, meint er auch so. Seine Passion sind die Verhältnisse in der Großstadt Rom – der Alltag, die Menschen, ihre Sorgen und Nöte in der Kaiserzeit, zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr.
In der dritten Satire geht es um die Fremden. Ein Freund namens Umbricius ist des Treibens in der Hauptstadt überdrüssig und sehnt sich nach Ruhe und Entspannung. Er will den Moloch Rom verlassen und sich in das anmutige Cumae am Golf von Neapel zurückziehen. Gegenüber seinem Freund Iuvenal präzisiert der Großstadtmüde seine Motive für die Flucht.
Ihn stört viel – die Betriebsamkeit, der Lärm, die Geschäftemacher, die Gefahr von einstürzenden Häusern und Bränden, die Schlaflosigkeit, der Verkehr. Vor allem aber stören ihn die vielen Fremden (Sat. 3, 58 ff.).
»Welches Volk heute bei unseren Reichen am beliebtesten ist und vor wem ich vor allem die Flucht ergreife, will ich eilends bekennen, und Scheu soll mich nicht hindern: ich vermag nicht, ihr Mitbürger, das griechische Rom zu ertragen. Freilich, welchen Teil der Hefe bilden schon die Achäer?
Schon längst ist der syrische Orontes in den Tiber gemündet und hat mit sich geführt die Sprache, die Sitten, die schrägen Saiten samt dem Tibiabläser sowie die einheimischen Trommeln und die Mädchen, die man heißt, sich beim Circus feilzubieten: auf denn zu ihnen, die ihr eine ausländische Hure mit ihrer bunten Mitra schätzt!
Dein Bauer von einst, Bürger, zieht die schnellen Schleicher an und trägt an ölglänzendem Hals die Siegermedaillen.
Der eine verließ das hochgelegene Sikyon, der andere wieder Amydon, dieser Andros, jener Samos, ein weiterer Teil Tralles oder Alabanda, sie streben zum Esquilin oder zu dem nach der Weide benannten Hügel, um das Herzstück der großen Häuser zu werden und deren Herren.
Ihr Geist ist flink, die Dreistigkeit verwegen, die Rede stets parat und brausender als die des Isaeus. Gib an, für wen du ihn hältst, jede Art Mensch hat er mit sich zu uns gebracht: Grammatiker, Rhetor, Geometer, Maler, Masseur, Wahrsager, Seiltänzer, Arzt, Zauberer, auf alles versteht sich ein hungerndes Griechlein, in den Himmel wird er, befiehlst du es, sich erheben.«
Der Text enthält, neben römischen Lokalitäten wie dem Circus Maximus, wo die Wagenrennen stattfanden, dem Esquilin, einem der Sieben Hügel Roms, und dem Viminal, dem »nach der Weide benannten Hügel«, viele Fremdbegriffe: Achäer als Synonym für die Griechen, den Orontes (der antike Name des Flusses Nar el Asi), in Rom Inbegriff für Syrien; die Tibia, ein orientalisches Blasinstrument; die Mitra, ein orientalisches Kopfband; Isaeus für einen damals sehr bekannten Syrer, der in Rom als Stegreifredner auftrat.
Der syrische Orontes ist in den Tiber gemündet – eine berühmte Metapher: Der syrische Fluss hat sich nicht nur mit dem römischen Fluss vermischt, er hat ihn sogar verdrängt. Zielscheibe des Zorns sind die »Griechen« – unter diesem Sammelbegriff werden alle Menschen vereint, die aus dem Osten kommen. Nachdem Alexander der Große die griechische Welt bis zum Indus ausgedehnt hatte, war die griechische Kultur eine Weltkultur geworden. Griechen lebten in Anatolien, Ägypten, Syrien, bildeten mit der einheimischen Bevölkerung eine mal mehr, mal weniger homogene neue Kultur.
Wer kam nach Rom? Gelegenheitsarbeiter, Musiker, Prostituierte, Zauberer, Masseure – wenn man Umbricius Glauben schenken will, alles Tätigkeiten, die nach römischem Empfinden in der Skala geachteter Berufe nicht ganz weit oben rangierten. Aber warum sind sie gekommen? »Um das Herzstück der großen Häuser zu werden und deren Herren«. Sie biedern sich, so der Vorwurf, bei den Reichen und Mächtigen an, um, so der weitergehende Vorwurf, diese in Zukunft zu beerben. Die Einheimischen, so die Furcht des Umbricius, werden das Nachsehen haben.
Politiker waren für Fremde, Normalmenschen waren gegen Fremde. Geht diese einfache Gleichung auf, wenn man die Verhältnisse in der Antike betrachtet? Die beiden kontrastiven Fälle aus der römischen Kaiserzeit zeigen schon einmal den Rahmen dessen auf, was an Positionen möglich war. Sind die Menschen von Natur aus so gepolt, dass sie Fremde entweder als Gefahr oder als Bereicherung empfinden? Oder sind dafür die Verhältnisse, Umstände, Bedingungen, Situationen verantwortlich?
Die Antike, lautet ein viel zitierter Satz des Altertumsforschers Uvo Hölscher, ist das uns »nächste Fremde«. Bessere Voraussetzungen, etwas über das Verhältnis zu Fremden und zum Fremden zu erfahren, kann es eigentlich nicht geben. Natürlich meinte Hölscher damit nicht die zeitliche Nähe. In dieser Hinsicht hat die Antike wenig Chancen, Aktualität für sich beanspruchen zu dürfen. Gemeint war der Satz in kultureller und mentaler Hinsicht. Die Antike ist fremd genug, um unsere Denkgewohnheiten und unsere Verhaltensweisen kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls auch infrage zu stellen. Und sie ist nahe genug, um für uns heute auch noch relevant zu sein. Was Umbricius über die Migranten aus Syrien sagte, ist nicht exklusiv antik, sondern gehört, wie man weiß, auch heute zum verbalen Repertoire derjenigen, die mit dem Zuzug von Fremden Probleme haben. Da ist die Antike uns sehr nahe, ebenso, wenn dafür geworben wird, Zuwanderung als Bereicherung zu empfinden. Fremd ist sie wiederum dann, wenn man die unterschiedlichen politischen Systeme in Betracht zieht oder auch die religiösen Verhältnisse. In der Antike wurde niemand wegen seiner religiösen Einstellung an den Pranger gestellt. Juden und später Christen wurden verfolgt, aber nicht wegen ihres Glaubens.
Zusammen mit den Griechen bilden die Römer das Rückgrat der antiken Geschichte. Griechen und Römer stehen deshalb auch im Mittelpunkt der Darstellung – wohl wissend, dass es auch ergiebig sein kann, die Rolle der Fremden etwa bei den Ägyptern, den Babyloniern, den Persern oder anderen antiken Kulturen unter die Lupe zu nehmen. Entscheidend für die Konzentration auf die Klassiker Griechenland und Rom ist die Quellenlage. Quellen mit Aussagen und Informationen über die Einstellung zu Fremden fließen sehr üppig, sowohl was schriftliche als auch bildliche Darstellungen angeht. Sie ermöglichen es, ein umfassendes und zugleich anschauliches Bild zum Thema »Fremde und Fremdsein in der Antike« zu zeichnen.
I.
GRIECHENLAND
1. Besuch bei Polyphem: Gastfreundschaft im antiken Griechenland
»Schon bei Homer heißt es …« lautet eine gern verwendete Formulierung, wenn es darauf ankommt, etwas als sehr alt und doch auch bereits wichtig zu etikettieren. Mit Recht: Denn mit Homer, dem ersten Dichter der Griechen, beginnt die Geschichte der europäischen Literatur. Über die gesamte Antike hinweg zählte er zu den populärsten, am meisten bewunderten und gelesenen Autoren. Alexander dem Großen diente er bei seinem Feldzug gegen die Perser und bei der Eroberung Asiens als Nachtlektüre. Bei den Römern war, jedenfalls in den Kreisen der Gebildeten, die Kenntnis der Werke Homers Pflicht.
In einem merkwürdigen Kontrast zu Homers Ruhm steht der Umstand, dass über ihn als Person so gut wie nichts bekannt ist. Der erste und größte Dichter der Griechen ist bis heute, trotz mancher, auch sehr gewagter, Versuche der Identifizierung, ein Phantom geblieben. In der Antike stritten gleich sieben Städte um das Privileg, Homers Geburtsort gewesen zu sein, wobei am Ende das griechische Smyrna, das heutige Izmir in der östlichen Türkei, am erfolgreichsten Argumente für sich sammelte. Als Troja vor einiger Zeit in akademischen Kreisen für heftige Streitigkeiten sorgte, konnte sogar die – freundlich formuliert – gewagte These Beachtung finden, Homer sei kein Grieche gewesen, sondern ein anatolischer Schreiber in assyrischen Diensten. Solche Spekulationen können angestellt werden, weil der bekannteste Autor der Antike zugleich der unbekannteste Autor der Antike ist.
Immerhin kann man seine beiden Hauptwerke, die Ilias und die Odyssee, relativ genau datieren (wobei es wiederum berechtigte Zweifel gibt, ob der unter dem Namen Homer bekannte Dichter wirklich als Autor beider Werke gelten kann): Sie stammen aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr., genauer: aus der Zeit um 720 v. Chr. Sie gehen zurück auf ältere, mündlich tradierte Stoffe und wurden in der Zeit Homers erstmals schriftlich fixiert – gleich nachdem die Griechen von den Phöniziern deren Schrift übernommen hatten. Weil die beiden Epen die frühesten literarischen Quellen der griechischen Geschichte darstellen, sind sie auch die frühesten Schriftquellen für den Umgang der Griechen mit Fremden.
Der Trojanische Krieg
Die Ilias ist das Epos des Trojanischen Krieges. Dessen Ablauf kann kurz so zusammengefasst werden: Fürsten und Adlige aus ganz Griechenland schließen sich zu einer Militäraktion gegen die Stadt Troja zusammen – auch Ilion genannt, daher der Titel Ilias. Hintergrund ist der Raub der Helena, der Frau des Herrschers von Sparta, die der trojanische Königssohn Paris in seine Heimatstadt entführt hatte. Die Belagerung dauert zehn Jahre und endet mit der Eroberung und Plünderung Trojas durch die Griechen.
Die Ilias behandelt nicht den ganzen Krieg. Dank der mündlichen Überlieferung konnte dessen Ablauf beim Publikum als bekannt vorausgesetzt werden. Homer schildert die letzten 51 Tage, im Mittelpunkt steht der Zorn des besten griechischen Kriegers Achill, der, weil er sich von dem Oberbefehlshaber Agamemnon in seiner Ehre getroffen fühlt, in einen vorübergehenden Kampfstreik tritt, um am Ende wieder dominant und entscheidend in das kriegerische Geschehen einzugreifen. Der Trojanische Krieg, so wie ihn Homer schildert, ist keine historische Realität, sondern Fiktion. Den historischen Hintergrund bilden Raub- und Plünderungszüge, die mykenische Griechen um 1200 v. Chr. in den östlichen Mittelmeerraum unternahmen. Auch Ilion/Troja geriet auf diese Weise in das Visier jener kriegerischen, nach der Burg Mykene auf der nördlichen Peloponnes bezeichneten Kultur. Homer schildert die Ereignisse aus der Rückschau, fast fünf Jahrhunderte später, mit der Konsequenz, dass er auch Zustände und Verhältnisse seiner eigenen Zeit in die Vergangenheit projiziert. Manches, was er als mykenisch ausgibt, gehört in seine eigene Gegenwart. Der Trojanische Krieg spielt sich nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund der Vorstellungswelt der homerischen Zeit ab.
Die Ankunft von Helena und Paris in Troja, dargestellt von links nach rechts: Paris, Helena, Aphrodite, Troilos und Priamos, Ausschnitt einer rotfigurigen Vasenmalerei, apulisch, um 430/330 v. Chr.
Diese Feststellung hilft, ein merkwürdiges Phänomen zu erklären. Denn der Krieg, den die Griechen bei Homer gegen die Trojaner führten, war nicht ein Krieg von Griechen gegen Fremde, sondern ein Krieg unter Griechen. Die Trojaner heißen Priamos, Hektor, Paris oder Andromache – alles griechische Namen. Historisch korrekt wären luwische Namen gewesen. Denn die im Nordwesten der heutigen Türkei angesiedelten Trojaner waren nicht, wie bei Homer beschrieben, gewissermaßen Griechen 2.0. Sie gehörten zur Völkerfamilie der in Anatolien und Nordsyrien beheimateten Luwier, die wiederum mit den Hethitern verwandt waren.
Warum also machte Homer aus den Trojanern Griechen? Weil es zu seiner Zeit, also im 8. Jahrhundert v. Chr., noch nicht die definitive Einteilung der Welt in Griechen auf der einen und Barbaren auf der anderen Seite gab. Und außerdem spielt sich die Handlung der Ilias in den höheren Kreisen der Könige, Fürsten und Aristokraten ab. Die Trojaner repräsentieren in dem Epos jene Werte und Ideale, die auch die vornehmen Griechen für sich in Anspruch nahmen. Die Ilias liefert ein Szenario an heldenhaften Menschen mit heldenhaften Tugenden. In dieses Schema passten Fremde aus Anatolien nicht hinein. Ihnen traute man nicht zu, so vornehm wie die Griechen zu sein, und so wurden aus Luwiern Griechen.
Mit Odysseus auf großer Fahrt
Auch das zweite, Homer zugeschriebene Werk, die Odyssee, spielt nicht wirklich in der Zeit, in die es vom Dichter versetzt worden ist. Die Odyssee ist die Geschichte des griechischen Trojakämpfers Odysseus, im Epos als listenreich apostrophiert, was der König von Ithaka vor Troja eindrucksvoll unter Beweis stellte, als ihm die Idee mit dem Trojanischen Pferd kam. Nach dem Ende des Krieges aber zog er sich den Zorn der Götter zu, die seine Heimreise blockierten und ihn zu zehn Jahre dauernden Irrfahrten auf dem Meer verurteilten, bei denen er viele teils haarsträubende Abenteuer zu bestehen hatte. Odysseus ist der literarische Prototyp des Fremden. Die Situationen, in die er während der Irrfahrten gerät, zeigen die realen Gefahren, Risiken, aber auch Chancen des Fremdseins in der Zeit Homers auf, als die Griechen sich aufmachten, die Küsten des Schwarzen Meeres und des Mittelmeeres zu erkunden, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Diese sogenannte Große Kolonisation, die in der Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. einsetzte, führte die Griechen bis weit in das westliche Mittelmeergebiet, bis nach Sizilien, Südfrankreich und Spanien. Anlass genug, jenes Seemannsgarn zu produzieren und zu verbreiten, das in der Odyssee zu den Abenteuern eines einzigen Protagonisten komprimiert wird.
In vielen Szenen bekommt Odysseus zu spüren, was es heißt, ein umherreisender Fremder zu sein – mit negativen, aber auch positiven Folgen. So kommt er in das Land der Phaiaken. Sie leben glücklich auf einer einsamen Insel. Odysseus strandet dort als Schiffbrüchiger. Ohne, dass er sich zu erkennen gibt, wird er vom König und dessen Tochter freundlich empfangen. Die Bevölkerung aber ist misstrauisch, sie meidet den Fremden. Die Erklärung liefert die Göttin Athene. Sie gibt Odysseus den Rat, sich von den Menschen fernzuhalten (7,31 f.): »Blicke niemanden an, noch frage jemanden. Denn sie dulden die Fremden nicht gern.«
Das Volk hat keine Erfahrung mit Fremden. Jeder, der nicht zur Gemeinschaft gehört, wird ausgegrenzt. Dahinter steht die für archaische Gesellschaften typische Haltung, im Fremden den Träger und Verbreiter unheimlicher, unbekannter Kräfte zu sehen. So kapselt man sich lieber ab. Der König und seine Tochter sind Repräsentanten einer schon etwas weiteren Entwicklungsstufe. Sie pflegen die Tugend der Gastfreundschaft, jedoch nicht aus humanitären Motiven heraus, sondern, weil sie die Vorstellung haben, durch freundliche Aufnahme diese negativen Kräfte des Fremden zu bändigen. Bezeichnend für dieses Stadium im Umgang mit Fremden ist die Tatsache, dass die Bezeichnung für »Fremder« und »Gast« identisch ist. Für beide verwenden die Griechen den Begriff xenos. Davon ist das heute allgegenwärtige Wort Xenophobie abgeleitet, meist unpräzise als »Fremdenhass« übersetzt. Genauer ist die Übersetzung »Fremdenangst«.
Die therapeutische Funktion der Gastfreundschaft bei der Überwindung von Ressentiments gegenüber Fremden illustriert eine weitere Episode in der Odyssee. Sie gibt zudem Einblick in die ritualisierte Form der Kontaktaufnahme zu dem Fremden. Als Odysseus endlich in die Heimat Ithaka zurückkehrt, verkleidet er sich zur Vorsicht als Bettler. Nicht einmal sein alter Sauhirt Eumaios erkennt ihn in dieser Aufmachung. Doch er bittet ihn in seine bescheidene Hütte, versorgt ihn mit Brot und Wein. Odysseus will sich bedanken, doch der Sauhirt will keinen Dank (14,56–58): »Es wäre ein Unrecht, einen Fremden zu missachten, auch wenn er noch geringer wäre als du: Sie alle kommen von Zeus.«
Ein neuer Gedanke: Der Fremde erhält eine Schutzgarantie, denn er steht unter göttlichem Schutz. Kein Geringerer als der oberste Gott Zeus persönlich ist jene Instanz, die diesen Schutz gewährleistet. In dieser Eigenschaft wird er von den Griechen Zeus Xenios genannt. Wer einen Fremden nicht freundlich aufnimmt, achtet den Gott nicht und begeht einen religiösen Frevel. Nicht umsonst wählt Homer für diese Szene einen Sauhirten und einen (verkleideten) Bettler. Die Pflicht zur gastlichen Aufnahme gilt auch gegenüber Menschen, die in der sozialen Skala nicht ganz oben rangieren. Und der Sauhirt Eumaios gehört zwar nicht zu den Repräsentanten der Oberschicht, hält sich aber selbstverständlich an die Regeln der Gastfreundschaft. Sie sind allgemein verbindlich.
Dass es auch ganz anders laufen kann, zeigt eine dritte Episode aus der Odyssee. Odysseus landet an einer Küste, die von den riesenhaften, grobschlächtigen Zyklopen bewohnt wird. Einer von diesen einäugigen, unzivilisierten Gestalten ist Polyphem, ein Sohn des Gottes Poseidon. Odysseus kommt mit seinen Begleitern in die Höhle des Zyklopen, und dieser verstößt nun eklatant gegen alle Regeln des göttlich garantierten Gastrechts. Der Riese weiß nicht, was sich gehört, er ist unfreundlich und sorgt nicht für seine Gäste. Als er grob fragt, mit wem er es eigentlich zu tun hat, erteilt ihm der erboste Odysseus eine verbale Lektion in Sachen Gastfreundschaft gegenüber Fremden (9,269–271): »Habe Respekt vor den Göttern! Wir Armen flehen dich um Hilfe an. Ist doch Zeus der Rächer für Schutzflehende und Fremde – Zeus Xenios, der die Fremden, die man achten muss, begleitet.«
Den Riesen beeindrucken diese Worte nicht. Im Gegenteil: Er verschließt die Höhle mit einem Felsen und frisst, bevor er sich zur Ruhe legt, zwei der Gefährten des Odysseus. Spätestens jetzt ist diesem klar, dass der Zyklop kein primärer Verfechter der hehren Prinzipien der Gastfreundschaft ist. Dank seines nie versiegenden Listenreichtums gelingt es ihm, sich und seine Gefährten aus der Gefahr zu befreien. Der einäugige Zyklop wird geblendet und bleibt in ohnmächtiger Wut zurück. Die Lehre, die von der Polyphem-Geschichte ausgehen soll: So ergeht es dem Ungeheuer (und wer so handelt, kann eigentlich nur ein Ungeheuer sein), weil es das heilige Gesetz der Gastfreundschaft verletzt.
Die Blendung des Polyphem durch Odysseus und seine Gefährten, schwarzfigurige Malerei auf einer Schale aus Kyrene, 6. Jh. v. Chr.
Ein anderes Gesetz gibt es in dieser frühen Phase der griechischen Geschichte noch nicht. Es gibt keine Rechtssätze, die den Umgang mit Fremden regeln. So muss der Gott Zeus einspringen, in dessen Obhut sich die Fremden begeben und dabei hoffen, dass die Menschen, denen sie in der Fremde begegnen, sich diesem göttlichen Gesetz ebenfalls verpflichtet fühlen.
2. Fremde willkommen? Griechen unterwegs
Homers Odysseus repräsentiert mit seinen fiktiven (Irr-)Fahrten über das Meer die historischen Fahrten, die 200 Jahre lang, zwischen 750 und 550 v. Chr., Griechen aus dem Mutterland zu fremden Gestaden führten. Man hat sich angewöhnt, diese massenhafte Migration als »Große Griechische Kolonisation« zu bezeichnen. Dieser Begriff ist insofern missverständlich, als die Wanderungsbewegungen der Griechen nichts mit Kolonialismus im modernen Sinn zu tun hatten. Die Griechen kamen nicht, um zu erobern und zu unterwerfen, sondern um eine neue Heimat zu finden.
Die Gründe, aus denen so viele Griechen die gewohnte Umgebung verließen und die Beschwernisse einer Reise, die häufig ins Ungewisse führte, auf sich nahmen, waren vielfältig. Eine Zunahme der Geburten und damit verbundene Ernährungsengpässe sowie Landnot mögen in einzelnen Fällen eine Rolle gespielt haben, waren als Motive zur Auswanderung jedoch nicht so gravierend, wie man früher angenommen hat. Wichtiger waren wirtschaftliche und handelspolitische Gründe. Die Migranten erhofften sich in der Fremde eine Verbesserung ihrer Lebenssituation und spekulierten auch auf die reichen Märkte im Mittelmeerraum und im Schwarzmeergebiet. Unter ihnen befanden sich auch reine Abenteurer, die, auf welche Weise auch immer, ihr Glück in der Fremde suchten.
Schließlich verließen viele ihre Heimat wegen politischer und sozialer Unruhen. Griechenland bestand damals aus vielen, Poleis genannten Stadtstaaten. Die Polis war die zentrale politische Organisationseinheit – ein Personalverband mit einem urbanen Zentrum und einem agrarischen Umland, politisch autonom und frei. Konflikte innerhalb des regierenden Adels oder zwischen Armen und Reichen führten zu Destabilisierung der Verhältnisse. Die Sieger blieben, die Verlierer gingen. Sie schlossen sich wie diejenigen, die wirtschaftliche Motive hatten, einer der vielen Auswanderergruppen an, die sich in dieser Zeit auf den Weg machten. Um einen zuvor bestimmten, aus der Adelsschicht stammenden Anführer scharten sich meist junge Männer, 100 bis 200 an der Zahl, die gemeinsam ein oder mehrere Schiffe charterten und in See stachen.
Die Reise gestaltete sich nicht als eine reine Fahrt ins Blaue. Die Kapitäne wussten, wohin sie wollten. Dafür sorgte die zentrale Auskunftsinstanz in Delphi, wo eine Pythia genannte Priesterin als orakelndes Sprachrohr des Gottes Apollon den Migranten Hinweise auf geeignete Zielorte gab. Wie üblich, geschah dies in einer eher nebulösen, zweideutigen Formulierung, die im Falle eines Scheiterns des Unternehmens dem Orakel die Möglichkeit zu der Versicherung gab, die Pythia sei falsch verstanden worden.
Das göttliche Votum war nicht nur deswegen wichtig, weil sich die Auswanderer den Segen für ihre Unternehmungen verschaffen wollten. Es war zugleich ein Argument in den Zielgebieten. Denn die Plätze, die die Neuankömmlinge für ihre neue Heimat aussuchten, waren nicht immer frei. Dort, wo es gute Häfen, fruchtbare Böden und eine ausreichende Wasserversorgung gab, waren sie häufig schon besetzt. Die Einheimischen waren daher nicht nur begeistert über den Zuzug von Fremden, sondern sahen in ihnen auch Konkurrenten. Um Widerstände zu beseitigen, konnte der Verweis auf göttlichen Ratschluss hilfreich sein. Und dazu verfügte man über die Waffe des Mythos. Mit ihm konnten die Griechen alles erklären. Eine Allzweckwaffe war der umtriebige Heros Herakles, der viel unterwegs gewesen war und von dem die Griechen behaupteten, er habe das Land, um das es ging, schon früher einmal in seinen Besitz genommen, und daher gehöre es ohnehin den Griechen.
Nicht immer ließen sich die Indigenen von solchen Argumenten überzeugen. So kam es im Rahmen der griechischen Kolonisation häufig zu Auseinandersetzungen, die in der Mehrzahl damit endeten, dass die Zuwanderer die Einheimischen unterwarfen, versklavten oder vertrieben. Das war zum Beispiel auf Sizilien der Fall, das zu den bevorzugten Siedlungsgebieten der Griechen gehörte. Bei der Gründung der Stadt Syrakus an der Ostküste der Insel wurden die ansässigen Sikuler besiegt und hatten als Heloten Frondienste für die neuen Herren zu leisten. Ähnlich verhielt es sich auf der Insel Pithekoussai, dem heutigen Ischia. Besonders perfide war der Umgang der fremden Kolonisten mit den ihnen fremden Bewohnern in Süditalien. Sie kamen aus der griechischen Landschaft Lokris und nahmen ein Territorium ins Visier, das sich im Eigentum der Sikuler befand. Hier weiß der gewöhnlich gut unterrichtete griechische Historiker Polybios (12,6) Erstaunliches zu berichten – journalistisch korrekt in indirekter Rede, weil er die Information aus zweiter Hand erhalten hat:
»Damals, als sie bei ihrer Ankunft in Italien die Sikuler im Besitz des Landes fanden, das sie jetzt selbst bewohnen, wären jene so in Schrecken geraten, dass sie sie in ihrer Angst aufnahmen. Sie hätten nun mit den Sikulern ein Übereinkommen geschlossen, mit ihnen Freundschaft zu halten und gemeinsam mit ihnen das Land zu bewohnen, solange ihr Fuß die Erde beträte und sie den Kopf auf den Schultern trügen. Bei der Ableistung des Eides aber hätten die Lokrer auf die Sohlen ihrer Schuhe Erde gelegt und unter dem Gewand auf ihrer Schulter Knoblauchköpfe versteckt und so den Eid geleistet. Dann hätten sie die Erde aus den Schuhen entfernt, die Knoblauchköpfe weggeworfen und nicht lange danach, als sich die Gelegenheit bot, die Sikuler aus dem Land vertrieben.«
Geschickter stellten es die Bewohner von Libyen an. Kolonisten aus Thera (Santorin) suchten nach einem geeigneten Platz, wo sie sich niederlassen konnten. Nach einigen Schwierigkeiten gründeten sie die Stadt Kyrene. Im Zusammenhang mit der Gründungsgeschichte dieser Stadt berichten antike Quellen davon, dass die Fremden für ihre Stadt zunächst einen anderen Platz gewählt hatten. Diesen Ort bewohnten sie, wie es bei dem griechischen Historiker Herodot (4,158) heißt, sechs Jahre:
»Im siebten Jahr aber boten Libyer ihnen an, sie an eine bessere Stelle zu führen, und gewannen sie dafür, fortzuziehen. Die Libyer ließen sie also von dort aufbrechen und führten sie nach Westen. Am schönsten Platz, damit ihn die Hellenen nicht zu sehen bekämen bei ihrem Zug, führten sie sie nachts vorbei, nachdem sie vorher die Wegstunden berechnet hatten. Dieser Platz hieß Irasa. Und sie führten sie an eine Quelle, von der es hieß, sie gehöre Apollon, und sprachen: ›Männer aus Hellas, hier ist gut sein, hier nehmt eure Wohnung. Denn hier hat der Himmel Löcher.‹«
Die Griechen nahmen das Angebot dankend an, nicht ahnend, dass sie nur den zweitbesten Platz erhalten hatten. Und die Libyer freuten sich, dass die Fremden nun keine weiteren Begehrlichkeiten an Land entwickeln würden. Die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung ist natürlich nicht über jeden Zweifel erhaben – im Gegenteil. Aber sie zeigt immerhin, dass eine solche Konstellation im Umgang mit Fremden, die man nicht eingeladen hatte zu kommen, prinzipiell denkbar war. Andere Beispiele zeigen, dass sich zwischen den Bewohnern und den Zugezogenen Prozesse abspielten, die man mit dem modernen Begriff der »Akkulturation« bezeichnen kann, worunter man im Allgemeinen die Angleichung und Anpassung unterschiedlicher Kulturen versteht. Dabei kam es nicht zu Auseinandersetzungen, Versklavung oder Vertreibung. Vielmehr lebten die Einheimischen mit den fremden Siedlern nicht völlig harmonisch, aber doch konfliktfrei zusammen. Wie es aussieht, haben die Einheimischen dabei mehr von den Fremden übernommen als umgekehrt die Fremden Impulse von den Indigenen aufnahmen. So übernahm die Urbevölkerung die religiösen Praktiken der Zugezogenen, indem sie deren Götter verehrten. Beigaben in den Gräbern beweisen, dass viele auch den griechischen Lebensstil adaptierten oder wenigstens imitierten. Man benutzte griechische Salben, um in Sachen Kosmetik mit den Fremden mithalten zu können; übte sich im Wurf von Diskus und Speer, um wie die Griechen Sport zu treiben; trank den Wein aus griechischen Mischkrügen, wie die Griechen bei den Trinkgelagen, die diese vornehmer als Symposien zu bezeichnen pflegten.
Die mit Abstand schönste aller Geschichten wurde in Marseille geschrieben. Die heutige französische Millionenstadt an der Küste des Mittelmeeres ist, wie viele andere Städte in Frankreich auch, eine Gründung der Griechen. Es war um 600 v. Chr., schon eher gegen Ende der Großen Kolonisation, als Griechen aus der Stadt Phokaia hier landeten und eine Siedlung mit dem Namen Massalia anlegten. Phokaia gehörte zu den Griechenstädten, die schon um 1000 v. Chr. entstanden waren, als ionische Griechen die Küsten Kleinasiens besiedelt hatten. Ihre ursprüngliche Heimat lag im mittleren Griechenland. Was die Seefahrer aus Phokaia anlockte, waren der Reichtum an Rohstoffen, insbesondere Zinn, und die Aussicht auf lukrativen Handel mit den keltisch-ligurischen Bewohnern. Auf der Suche nach einem geeigneten Handelsstützpunkt fiel ihnen das Gebiet um die Mündung der Rhone ins Auge – mit einem guten, durch eine Felsbucht geschützten Naturhafen. Es gab jedoch eine kleine Schwierigkeit: Der so perfekte Ort war schon besetzt, er gehörte zum Territorium eines einheimischen keltischen Fürsten, der über das Volk der Segobrigier herrschte. Wie würden die Platzhirsche auf die Ankunft der Fremden reagieren?
»Anführer der Flotte waren Simos und Protis. Und so wandten sie sich also an den König der Segobrigier mit Namen Nannus, in dessen Gebiet sie eine Stadt zu gründen beabsichtigten, und baten ihn um Freundschaft. Zufällig war er an diesem Tag gerade damit beschäftigt, die Hochzeit seiner Tochter Gyptis auszurichten, die er nach der Stammessitte den beim Gastmahl auserwählten Schwiegersohn auf der Stelle zur Frau zu geben vorhatte. Als nun alle Kandidaten zur Hochzeit geladen waren, wurden auch die Griechen als Gastfreunde zur Tafel gebeten. Als nun die junge Frau in den Saal geführt und vom Vater aufgefordert wurde, demjenigen, den sie zum Ehemann wähle, das Wasser zu reichen, da hatte sie für alle anderen keinen Blick mehr, sondern wandte sich allein den Griechen zu und reichte Protis das Wasser. So wurde er aus einem fremden Gast sofort zu einem Schwiegersohn, und er bekam von seinem Schwiegervater den Platz für die zu gründende Stadt. So wurde also Massalia gegründet, nahe der Mündung der Rhone in einer tief ins Land geschnittenen Bucht. Die Ligurer aber waren neidisch auf das Geschehen in der Stadt und plagten die Griechen durch unablässige Kriege. Diese jedoch arbeiteten sich durch erfolgreiche Abwehr aller Gefahren zu einem solchen Glanz empor, dass sie nach ihrem Sieg über die Feinde in den dabei eingenommenen Gebieten viele Kolonien anlegten.«
So beschreibt eine spätere Quelle (Iustin 43) die Vorgänge bei der Gründung von Marseille. Gerne würde man glauben, dass sich alles ganz genauso abgespielt hat, zumindest, was die so romantisch zustande gekommene Hochzeit von Gyptis und Protis betrifft. Indes ist es die undankbare Aufgabe einer tendenziell eher nüchternen historischen Analyse, die Fiktion von der Realität zu trennen. Und da ist festzuhalten, dass die Erzählung in dieser Form legendär ist. Es handelt sich um eine typische retrospektive Gründungsgeschichte, reich und fantasievoll ausgeschmückt, geeignet, im Wettbewerb der besten Gründungsgeschichten gut abzuschneiden. Sie ist jedoch, wie alle Mythen und Legenden, nicht völlig aus der Luft gegriffen. Sie beruht auf dem historischen Faktum, dass die Gründung von Marseille das Ergebnis des Zusammenwirkens von Einheimischen und Fremden gewesen ist. Über die Gründe für die Harmonie kann man indes nur spekulieren. Wahrscheinlich versprachen sich beide Seiten wirtschaftliche Vorteile. Die Griechen konnten ungestört ihre Handelsaktivitäten betreiben, und die Kelten wurden mit griechischen Waren beliefert.
Massalia entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten zu einer blühenden, prosperierenden Stadt. Sie dehnte ihr Territorium nach Osten aus, auf Kosten der dortigen ligurischen Stämme. Wenn die Quelle behauptet, die Ligurer seien auf die Griechen neidisch gewesen und hätten deswegen mit ihnen oft Krieg geführt, so ist dies die griechische Lesart. In Wirklichkeit dürften sie sich gegen die Bestrebungen gewehrt haben, von den Griechen okkupiert zu werden. Jedenfalls gründeten die Griechen von Massalia aus weitere bekannte Städte wie Nikaia (das heutige Nizza) und Antipolis (das heutige Antibes).
Massalia als Bollwerk in einer barbarischen Umgebung
»Massalia wird umwohnt von übermütigen Völkern und derweil der barbarische Nachbar mit grausigen Riten schreckt, hält fest die Siedler-Stadt der Phokäer inmitten waffenstarrender Völker an Sitten und Göttern der Heimat.«
Silius Italicus, Punica 15, 169–172
Die Gründungslegende von Marseille bringt auch Licht in das Dunkel eines Problems, das in den Forschungen zur griechischen Kolonisation eine prominente Rolle spielt. Die Kolonisten der ersten Stunde waren Männer, meist junge Männer. Es ist unmittelbar einsichtig, dass die von ihnen gegründeten Städte nur dann eine Zukunftsperspektive hatten, wenn zu der Bevölkerung auch Frauen gehörten. An Bord waren Frauen jedenfalls nicht, wenn die Schiffe auf der Suche nach Land unterwegs waren. Holten die Siedler die Frauen aus Griechenland nach, wenn sie sich für einen Platz entschieden hatten? Oder heirateten sie einheimische Frauen? Im Fall von Massalia herrscht wünschenswerte Klarheit: Gyptis und Protis stehen für die Praxis, dass die Griechen Ehen mit einheimischen Frauen schlossen, was der Integration ohne Frage sehr förderlich war. Aber so war es wohl nicht immer. Im Zusammenhang mit der Gründung von Milet in Kleinasien durch ionische Griechen schildert es Herodot (1,146) als ungewöhnlich, dass die Siedler einheimische Frauen heirateten und hat dabei auch eine merkwürdige Geschichte parat:
»Die aber vom Prytaneion in Athen auszogen und meinten, sie seien die vornehmsten unter den Ioniern, die brachten keine Frauen mit in ihre neue Siedlung, sondern nahmen karische Frauen, deren Eltern sie zuvor erschlagen hatten. Und um dieses Totschlags willen machten es sich die Frauen zum Gesetz und setzten einen Schwur darauf und gaben ihn weiter an ihre Töchter, niemals mit ihren Männern zu essen noch ihren Mann beim Namen zu rufen, weil sie ihre Väter und Männer und Kinder umgebracht und nach solcher Tat sie selber zu ihren Frauen gemacht hatten.«
Dass die Zugewanderten die Eltern ihrer künftigen Frauen erschlugen, macht nur Sinn, wenn sich diese geweigert hatten, ihnen ihre Töchter zur Frau zu geben. Aber, so bleibt zu hoffen, vielleicht handelt es sich auch bloß um eine Legende, die erfunden wurde, um den so stolzen und selbstbewussten Athenern zu schaden.
3. Wir und die Anderen – Konzepte des Fremdseins
Wer ist eigentlich ein Fremder? Wann bezeichnen wir einen anderen Menschen als Fremden? – Wenn man ihn nicht kennt? Wenn er anders aussieht? Wenn er anders spricht?
Die Griechen haben sich diese Fragen auch gestellt. Sie beantworteten sie jedoch nicht mit einer Definition des Fremden. Sie suchten vielmehr nach Kriterien für sich selbst, um sich dann von jenen abzugrenzen, die nicht diesen Kriterien entsprachen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. formulierte der griechische Historiker Herodot die klassische Definition dessen, was aus Griechen Griechen macht (8,144): »Wir haben die gleiche Abstammung, die gleiche Sprache, die gleiche Religion und die gleichen Lebensformen.«
Das bedeutet im Umkehrschluss: Fremde haben eine andere Abstammung, eine andere Sprache, eine andere Religion und andere Lebensformen.
Abstammung
Woher sie kamen und von wem sie abstammten, wussten die Griechen – die sich meistens Hellenen nannten – selbst nicht so genau. Immerhin wussten sie, dass es sie nicht schon immer gegeben hatte. So sagt der athenische Historiker Thukydides im 5. Jahrhundert v. Chr. (1,2): »Es ergibt sich nämlich, dass, was heute Hellas heißt, nicht von alters her fest besiedelt gewesen ist, sondern dass es früher Völkerwanderungen gab und die einzelnen Stämme leicht ihre Wohnsitze verließen unter dem Druck der jeweiligen Übermacht.«
Später, als sie sich dann nach einer langen Phase der Formierung gefunden hatten und eine ethnische oder zumindest kulturelle Einheit bildeten, waren die Griechen bemüht, sich eine gemeinsame Herkunft zu verschaffen. Beliebt war das Mittel, eine Abstammung von Göttern, Heroen oder fiktiven Stammvätern zu konstruieren und damit Identität zu erzeugen. Verbreitet war der Mythos von einem Stammvater Hellen, auf den über seine Söhne und Enkel letztlich alle Griechen – oder besser: Hellenen – zurückgegangen sein sollen. Eine für die Griechen typische Art der Rekonstruktion: Ortsnamen, Personennamen oder Völkernamen wurden gerne vom völlig fiktiven Namensgeber abgeleitet, hinter dem man sich scharte, um zu einer Identität zu finden und sich von anderen abzugrenzen.
Ein wichtiges Element von Zugehörigkeit und Identität waren bei den Griechen die Phylen und Phratrien. Die Phyle wird im Allgemeinen etwas altertümlich mit »Stamm« oder »Sippe« übersetzt. Diese Verbände entstanden in den Zeiten der großen Wanderungen der nachmykenischen Zeit, als sich die Stadtstaaten formierten. Sie bildeten das Fundament der für die Griechen der klassischen Zeit charakteristischen Poleis. Niemals aber vergaßen die Griechen ihre stammesmäßige Herkunft.
Die Phratrie, etymologisch abgeleitet von dem griechischen Wort für »Bruder«, bildete, als Unterabteilung einer Phyle, einen Zusammenschluss von Personen, die sich familiär miteinander verbunden fühlten. Dabei handelte es sich um Großfamilien, die mehrere hundert Köpfe zählen konnten. Diese Clans waren eng miteinander verbunden, feierten gemeinsame Feste, heirateten untereinander und halfen sich in allen wichtigen Angelegenheiten. Die wichtigste Veranstaltung war das jährlich stattfindende Apaturia-Fest in Athen. Hier demonstrierten die Mitglieder der Phratien ihre Zusammengehörigkeit und ihren Zusammenhalt. Das Fest dauerte drei Tage und bot viele Attraktionen. Die jungen Männer, Epheben genannt, wurden zeremoniell in die Gemeinschaft der Erwachsenen eingeführt, indem man ihnen das Haar schor. Gleichzeitig wurden die im abgelaufenen Jahr geborenen Kinder in die Großfamilie aufgenommen. Per Eid oder Opfer bezeugten dabei die jeweiligen Väter, dass die Kinder aus einer legitimen Ehe mit einer Athenerin stammten.
Fremde, die diesem Spektakel zusahen, fühlten sich dabei nicht gerade perfekt integriert. Im Gegenteil: Nichts konnte ihnen deutlicher vor Augen führen, dass sie nicht dazugehörten. Die Griechen bildeten aus ihrer Sicht eine verschworene, exkludierende Gemeinschaft.
Sprache
Nicht alle Griechen verstanden sich untereinander problemlos. Es gab verschiedene Dialekte, die eine Kommunikation erschwerten. Und doch waren sie eine einheitliche Sprachfamilie. So fungierte die Sprache als ein wesentliches Element bei der Frage, wer zu den Griechen gehörte und wer nicht. Wer nicht Griechisch sprach, war ein »Barbar« – so das lautmalerische Etikett, das die Griechen, stolz auf die Ästhetik ihrer Sprache und den Reichtum an Vokalen, all jenen anhefteten, die Klänge benutzten, die sich in ihren Ohren wie kakophonisches Kauderwelsch anhörten.
Zum Glück waren die Griechen keine Sprachwissenschaftler. Denn wenn die Sprache ein Faktor war, der Griechen von Nichtgriechen trennte, hätten sie auch die frühen Kreter nicht für Griechen halten dürfen. Auf Kreta entstand um 2000 v. Chr. die minoische Kultur, die erste europäische Hochkultur, benannt nach dem sagenhaften König Minos, der, wie die Griechen überzeugt waren, im Palast von Knossos residierte. Die Griechen waren stolz, schon so früh so bedeutend gewesen zu sein und vereinnahmten die minoische Kultur retrospektiv als Anfang und Ausgangspunkt ihrer eigenen Kultur. In Wirklichkeit waren die Minoer keine Griechen, denn sie sprachen, wie ihre Linear A genannte Schrift beweist, nicht Griechisch, sondern eine vorgriechische Sprache.
Religion
»Ich bringe Opfer für Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apollon, Artemis, Athene, Ares, Aphrodite, Hermes, Hephaistos und Hestia.« Ein Grieche, der diesen Satz sagte, war ein vorbildlicher Grieche. Denn er erwies allen wichtigen Göttinnen und Göttern seine kultische Reverenz. Die zwölf Göttinnen und Götter, die weit oben auf dem Olymp thronten, waren in religiöser Hinsicht das Maß aller Dinge.
Der bärtige Zeus der Griechen mit den Widderhörnern Amuns, römische Marmorbüste des Zeus-Ammon aus der Oase Siwa, 120–160 n. Chr., Metropolitan Museum of Art
Die Sympathiewerte der Griechen waren bei den anderen Völkern nicht so hoch, wie sie es sich selbst vorstellten. Bei vielen waren sie im Gegenteil sehr unbeliebt. Das lag vor allem daran, dass sie der Meinung waren, sie seien in allen Bereichen die Besten. Schlimmer noch: Sie waren in den meisten Bereichen auch die Besten. Aus dieser überlegenen Grundhaltung heraus waren sie auch der Ansicht, dass es neben ihren Göttern keine anderen Götter gebe. Die Götter anderer Völker, so ihre Vorstellung, müssten die griechischen Götter sein, nur mit einem anderen Namen. Das Fremde wurde unter griechischen Vorzeichen interpretiert. So setzten sie etwa den ägyptischen Gott Amun mit ihrem obersten Gott Zeus gleich und nannten ihn Zeus-Ammon. Insofern war die Religion in der Praxis kein wirklich trennendes Element zwischen den Griechen und den Fremden. Die »Barbaren« mussten eben nur einsehen, dass ihre Götter in der Realität die Götter der Griechen waren.
Lebensformen
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. unternahm Herodot, dem die Definition dessen, was einen Griechen und implizit einen Fremden ausmacht, zu verdanken ist, eine Reise nach Ägypten. Von dieser Reise hat er einen umfangreichen Bericht vorgelegt, den er im zweiten Buch seiner Historien veröffentlichte. Er tauchte in die fremde Welt ein und notierte gewissenhaft alles, was ihm dabei auffiel (2,35).
»Sie haben sich in fast allen Bereichen Gewohnheiten und Sitten zurecht gelegt, die denen anderer Menschen gerade entgegen gesetzt sind. So gehen die Frauen bei ihnen auf den Markt und handeln, die Männer aber sitzen zu Hause und weben. Und beim Weben schlagen die anderen den Einschlag nach oben, die Ägypter nach unten. Lasten tragen die Männer auf den Köpfen, die Frauen auf den Schultern. Die Frauen lassen Wasser im Stehen und die Männer im Hocken. Ihre Notdurft verrichten sie in den Häusern und sagen dazu, was unanständig, aber notwendig ist, solle man im Verborgenen tun, was aber nicht unanständig ist, vor aller Augen. Keine Frau versieht Priesterdienste, weder bei einem Gott noch bei einer Göttin, sondern nur Männer, bei allen Göttern und Göttinnen. Die Söhne brauchen ihre Eltern nicht zu ernähren, wenn sie keine Lust haben, aber die Töchter müssen es, auch wenn sie keine Lust haben.«
Alles anders als bei uns, lautet die Botschaft, die Herodot vermitteln will. Nicht alle seiner teils skurrilen Behauptungen halten einer kritischen Betrachtung stand. Wichtiger aber ist der Maßstab, den er anlegt. Er spricht von »anderen Menschen« und meint damit in erster Linie die Griechen. Bei ihnen konstatiert er gemeinsame Formen der Gestaltung des alltäglichen Lebens, mit denen sie sich von den Fremden unterscheiden. Natürlich gehen bei uns die Männer zur Arbeit und die Frauen sitzen zu Hause und arbeiten. Die Söhne kümmern sich um die Eltern, nicht die Töchter.
Tatsächlich – und nicht nur in der durchaus polemischen Auseinandersetzung mit den Gewohnheiten und Praktiken anderer Völker – kann man bei den antiken Griechen eine sie spezifisch prägende Alltagskultur feststellen. Das gilt etwa auch für die Art und Weise des Wohnens, die Kleidung, die Gestaltung des sozialen Lebens, die Grabsitten, das berufliche Leben.
Wie sieht ein Spartaner aus?
Im 2. Jahrhundert v. Chr., als Rom Führungsmacht in Griechenland geworden war, unternahmen die Bewohner von Korinth, in übereifriger Umsetzung römischer Vorgaben, eine Razzia gegen alle Spartaner, die sich gerade in ihrer Stadt aufhielten. Sie griffen jeden auf, »den sie sicher als einen Spartaner erkannten oder den sie wegen des Haarschnittes, wegen des Schuhzeugs, der Kleidung oder des Namens wegen für einen Spartaner hielten.«
Pausanias 7,14,2
Die vier Säulen Abstammung, Sprache, Religion und Lebensformen schufen auch bereits im zeitgenössischen Bewusstsein Identität. Das Fremde konstituierte sich aus dem Gegensatz zum Eigenen. Dieselben vier Säulen kreierten, wenn sie nicht vorhanden waren, Alterität, wie man dieses Phänomen in den modernen Sozialwissenschaften nennt. Keine Identität ohne Alterität, keine Alterität ohne Identität – so lautet eine Botschaft aus der Antike. Erst als die Griechen merkten, dass sie Griechen waren, konnten sie die Fremden als Fremde identifizieren.
Oder in den Worten des klugen Thukydides (1,3): Die frühen Griechen hatten »für die Barbaren noch keinen Begriff, weil auch die Hellenen, wie ich meine, noch nicht unter einem gegensätzlichen Namen zusammengefasst waren.«
Jedenfalls gilt die Erkenntnis, dass Identität und Alterität sich gegenseitig bedingen, für das Verhältnis von Völkern. Individuell fremd hingegen konnte man, wie der Blick auf die Anfänge der griechischen Geschichte gezeigt hat, auch schon sein, als es die Barbaren-Typologie noch nicht gab.
4. Griechen und Barbaren
Das 5. Jahrhundert v. Chr. war die »klassische« Zeit der Griechen. Hier vollbrachten sie jene viel bestaunten Höchstleistungen in Politik, Kultur und Wissenschaft, die ihnen den bis heute anhaltenden und niemals verblassenden Ruf der ersten großen Zivilisation Europas einbrachten. Sich mit den Griechen zu befassen, schließt automatisch die Verpflichtung ein, sie zu bewundern. Dafür sorgten in der Neuzeit berühmte Antikenfreunde wie der Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann, der im 18. Jahrhundert mit Bezug auf die Kunst der Griechen das eindrucksvolle Bild der »edlen Einfalt und stillen Größe« prägte – eine Charakterisierung, mit der die Griechen selbst allerdings wenig hätten anfangen können, sahen sie doch die im Übrigen original bunten Kunstwerke nicht als überzeitlich-entrückte Artefakte, sondern als hoch lebendige, auch politisch kontextualisierte Gegenstände an. Aber da die Griechen nun einmal als vorbildlich galten, wurde diese exzeptionelle Position auch auf viele andere Lebensbereiche ausgedehnt.
Die Griechen waren politisch vorbildlich: Sie waren es, die die erste Demokratie der Weltgeschichte gründeten, im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen. Während alle anderen Staaten und Völker von Monarchen oder Adligen regiert wurden, bestimmte in Athen das Volk – allerdings mit Ausnahme der Frauen, Sklaven und auch der Fremden, die keine Mitwirkungsrechte hatten. Die Griechen waren philosophisch vorbildlich: Griechische Gelehrte machten sich tiefschürfende Gedanken über Gott, die Welt, den Staat, den Menschen und hinterließen den späteren Europäern einen wahren Schatz an Ideen, Gedanken, Prinzipien, Impulsen. Die Griechen waren literarisch vorbildlich: Im alten Griechenland entstanden unsterbliche Werke, Tragödien wie Komödien, Epen, Gedichte, Dramen. Die Griechen waren architektonisch vorbildlich: Ihre Architekten setzten mit ihren genialen Bauwerken Maßstäbe – Tempel, Gymnasien, Stadien, Marktplätze, Wohngebäude. Noch heute kann man an vielen Orten diese Meisterleistungen bewundern.
Die Griechen haben sich diese Wertschätzung natürlich auch ehrlich und redlich verdient. Sie waren sich ihrer Bedeutung und ihrer Qualitäten bewusst. Sie wussten, wie gut sie waren, und entwickelten ein an Arroganz grenzendes Selbstbewusstsein, dass in der Vorstellung gipfelte, es gebe kein anderes Volk und keine andere Kultur auf der Welt, die es mit ihnen aufnehmen könne. Eine solche Haltung ist, wie man zugeben muss, grundsätzlich nicht geeignet, anderen Völkern, Kulturen, Nationen mit Respekt und Achtung zu begegnen, ihre Leistungen und Errungenschaften zu schätzen und zu würdigen.
Das war bei den Griechen nicht immer so gewesen. In der Frühzeit waren sie anders gestrickt. Als sie die Bühne der großen Geschichte betraten, waren sie neugierig und lernwillig. Sie gingen mit offenen Augen in die Welt hinaus, begierig zu erfahren, wie die Welt funktionierte und wie die Welt beschaffen war. Insbesondere hatten es ihnen die hochentwickelten Kulturen des Orients angetan – in Ägypten, Anatolien, Mesopotamien. Ex oriente lux, sagten später die Lateiner: »Das Licht kommt aus dem Orient« – ein Satz mit einem hohen Wahrheitsgehalt.
Die Minoer auf Kreta, die um 2000 v. Chr. eine blühende Zivilisation hervorbrachten, profitierten entscheidend von Impulsen, die sie aus Ägypten und aus dem innovativen Mesopotamien empfingen. Auch die kriegerischen Mykener, die der griechischen Geschichte danach ihren Stempel aufdrückten, pflegten enge Kontakte zu den Völkern des östlichen Mittelmeerraumes und des Vorderen Orients. Nach dem Zusammenbruch der mykenischen Macht folgte eine längere Phase des Stillstands, die man gerne und etwas dramatisch als die »Dunklen Jahrhunderte« zu bezeichnen pflegt. Zum Glück wussten die damaligen Griechen nicht, dass sie in einer dunklen Zeit lebten. Sie werden sie auch nicht als so dunkel empfunden haben wie spätere Historiker und Archäologen. Richtig ist aber, dass zwischen 1100 und 800 v. Chr. die kulturelle Entwicklung nicht mehr den vorherigen Standards entsprach. Das gilt für die materielle Kultur, die wirtschaftlichen Strukturen, die Außenbeziehungen. Die Griechen der Dunklen Jahrhunderte verlernten die Schrift, die in den mykenischen Palästen zur Regulierung der Verwaltung gedient hatte.
Nach 800 v. Chr. tauchen die Griechen wieder aus der Isolation auf. Es entfalten sich neue, stadtstaatliche Strukturen. Die Große Kolonisation führt sie in die große, weite Welt hinaus. Sie treiben umfangreichen Handel, lernen wieder neue Ideen und Technologien kennen. Von den Phöniziern, die vom Libanon aus ein mediterranes Handelsimperium aufbauten, übernehmen sie die Schrift, die bis heute die Grundlage des griechischen Alphabets bildet. Die ionischen Naturphilosophen um Thales von Milet ließen sich bei ihren revolutionären Lehren über die Natur und den Kosmos von Erkenntnissen inspirieren, die babylonische Wissenschaftler gewonnen hatten. Jedoch blieb es nicht nur bei der reinen Übernahme: Die Griechen waren in der Lage, aus diesen Ideen etwas zu machen, sie im ständigen Austausch, aber auch im gegenseitigen Wettbewerb, weiterzuentwickeln.
Im 5. Jahrhundert v. Chr., der »klassischen« Zeit, war es mit der Offenheit für das Andere und mit der Bereitschaft zu lernen, vorbei. Die Griechen hielten sich für die Größten und grenzten sich von der übrigen Welt ab. Jetzt waren auch die fremden Völker, denen man so viel zu verdanken hatte, nur noch »Barbaren«. Der Begriff an sich war nicht neu. Erstmals taucht er in den Epen Homers auf. In der Ilias