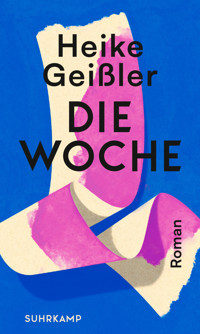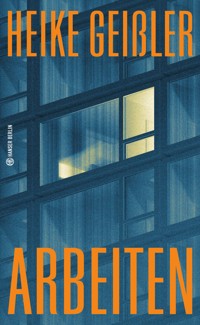
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Hanser Berlin LEBEN
- Sprache: Deutsch
Was ist ein Mensch wert? Wie ermessen sich Nutzen und Kosten einer Person? Heike Geißler denkt über den Sinn der Arbeit nach, über ihre Allgegenwärtigkeit, über materielle und unsichtbare Arbeit, über Geben und Nehmen, Gewinner und Verlierer. Der Arbeit auf der Spur, beobachtet sie ihr Umfeld und kommt mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch: mit den Handwerkern, die in ihrer Wohnung die Fenster ersetzen, dem Lieferboten, einer chronisch kranken Freundin und mit ihren eigenen Eltern. Bald verdichten sich ihre Beobachtungen zu einem Panoptikum modernen Arbeitens, das die tiefen Gräben zwischen Überleben und Wachstum aufzeigt. Heike Geißler, Tochter einer ostdeutschen Arbeiterfamilie, zweifache Mutter und systemkritische Autorin, widmet sich der Arbeit in ihrer üblichen Manier: politisch, poetisch, radikal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Was ist ein Mensch wert? Wie ermessen sich Nutzen und Kosten einer Person? Heike Geißler denkt über den Sinn der Arbeit nach, über ihre Allgegenwärtigkeit, über materielle und unsichtbare Arbeit, über Geben und Nehmen, Gewinner und Verlierer. Der Arbeit auf der Spur, beobachtet sie ihr Umfeld und kommt mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch: mit den Handwerkern, die in ihrer Wohnung die Fenster ersetzen, dem Lieferboten, einer chronisch kranken Freundin und mit ihren eigenen Eltern. Bald verdichten sich ihre Beobachtungen zu einem Panoptikum modernen Arbeitens, das die tiefen Gräben zwischen Überleben und Wachstum aufzeigt. Heike Geißler, Tochter einer ostdeutschen Arbeiterfamilie, zweifache Mutter und systemkritische Autorin, widmet sich der Arbeit in ihrer üblichen Manier: politisch, poetisch, radikal.
Heike Geißler
ARBEITEN
Hanser Berlin
Meinen Eltern gewidmet
Liebe Arbeitswelt,
ich bin umgänglich, rücksichtsvoll, manchmal mürrisch oder verzweifelt. Ich helfe gern. Es fällt mir schwer, mich zurückzuziehen, mich nicht angesprochen zu fühlen. Ich nehme einige Dinge persönlich und kann einen bevormundenden Tonfall nicht leiden, genau genommen auch nicht verkraften. Sowieso kann ich viele Dinge nicht sonderlich gut verkraften, vor allem jene, die mich fragen lassen: Warum um alles in der Welt handelt jemand so? Jetzt! In dieser Zeit! Warum um alles in der Welt trifft jemand diese katastrophale unternehmerische oder personelle Entscheidung? Will jemand eine andere Gruppe, zum Beispiel auch mich, verhöhnen, ausschließen, durch vermeintlich starke Entscheidungen erziehen?
Liebe Arbeitswelt, ich bin immer auf der Hut.
Ich plaudere auch gern und lasse mich bereitwillig ablenken. Ich halte die Ablenkung und das Abschweifen mittlerweile für ein wesentliches und sinnvolles Werkzeug. Ich neige zur Langsamkeit, aber bin plötzlich wieder so schnell, dass alle denken, ich sei sonderbar und rede Unfug. In mir kann man eine zuverlässige Kollegin, Kollaborateurin haben, eine, die immer mit Respekt behandelt werden will und andere mit Respekt behandelt. Choleriker*innen oder Patriarchen, seien sie auch verborgen hinter zeitgenössischem Vokabular und Habitus, erkenne ich nahezu sofort und respektiere sie nicht. Denn ein cholerisches oder patriarchalisches Verhalten an den Tag zu legen, ist schlichtweg diskreditierend. Ich zucke zusammen, wenn Choleriker*innen schreien, und fürchte ihre Ausbrüche, ich fürchte auch das Machtgehabe der Patriarchen, aber ich kann nicht anders, als sie spüren zu lassen, dass ich von ihrem Verhalten nichts halte. Dafür strafte man mich regelmäßig ab, aber keine Strafe verfing dauerhaft. Ich versuche, immer so zu leben, dass keine Strafe mich erwischt.
Das beschreibt mich grob. Ich bewerbe mich hier um keine Stelle, aber es gibt mich, und solange Du, sogenannte Arbeitswelt, Dir keine Mühe gibst, rundum menschenfreundlich und dem Leben zugewandt zu werden, kann ich Dir, Arbeitswelt, und den auf Dich vorbereitenden Strukturen nicht vertrauen.
Vielen Dank.
Ich, Arbeiterkind, Schlüsselkind, aufgewachsen mit Formeln wie Ohne Fleiß kein Preis oder Langes Fädchen, faules Mädchen und Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, bin manchmal sehr arbeitsam, aber immer lieber faul. Ich entdecke da etwas, das sich wohl als Müßiggang bezeichnen lässt, und möchte sagen, dass ich eigentlich gerade sehr gern faul wäre. Dass ich wirklich gut damit leben könnte, auf dem Sofa zu liegen, zu lesen, einzuschlafen, etwas zu schauen, zu telefonieren, abzuwarten, was so passiert.
Ich denke, wären mehr Leute faul (und es ist ja nicht nur Faulheit, aber dazu später), dann ginge es der Welt bedeutend besser. Wären mehr Leute so desinteressiert an Expansion, Wachstum und am Konsum, wie ich es bin, wäre die Welt ein angenehmer Ort.
Arbeit!
Hauptsache, man hat Arbeit, sagt mein Vater immer noch, obwohl er mittlerweile Rentner ist. Sicherheit, sagt mein Vater.
Mein Leben bot die meiste Zeit eher Unsicherheit in vielen Facetten, aber es mangelte mir selten an Gewissheit. Ich versuche zu arbeiten und zu leben, wie ich es für richtig halte. Ich versuche auf eine Weise zu arbeiten, bei der sich die Arbeit nicht nach Mühsal und Plage anfühlt. Als sogenanntes Arbeiterkind und ehemalige Jung- und Thälmannpionierin lernte ich früh, dass alle, die der Arbeit vorzugsweise fernblieben, zu verachten oder wenigstens kritisch zu beäugen waren. Zu kritisieren war in jedem Fall, dass sie eine Art Betrug an allen, die redlich arbeiteten, begehen, an allen, die die Arbeit der Arbeitsvermeider*innen an deren Stelle zu erledigen hatten. Oder, wie es jetzt erzählt wird: die Geld kriegen, ohne was zu tun, während die, die arbeiten, von ihrem Lohn nicht leben können.
Arbeit ist ein vielstimmiges Thema, ein Lebensthema sowieso. Wir alle verbringen unsere Leben auf die eine oder andere Weise arbeitend, wir alle können viel über unsere und die Arbeit anderer Leute erzählen. Die globale Gemeinschaft redet währenddessen über KI, über die mögliche und nötige Kontrolle neuer Techniken und Chancen, und Dietmar Dath schreibt: »Wer ›die KI‹ sagt, ist schon reingefallen. Denn das klingt, inklusive grammatisches Geschlecht, als ginge es um eine neue Kollegin. Stattdessen hat das Kapital hier eine sehr clevere Art gefunden, bereits vorhandene Kolleginnen und Kollegen so zu vernetzen, dass sie die in jeder Vernetzung liegende Chance zum solidarischen kollektiven Handeln gar nicht mehr erkennen können.«1
Diese Gegenwart, wie ist sie also?
In Frankreich ging gerade der Prozess gegen die Vergewaltiger von Gisèle Pelicot zu Ende. Die Vergewaltiger — deren unterschiedliche Berufe immer wieder mit einer gewissen Faszination aufgezählt wurden, wohl um zu belegen, dass durch alle Schichten hindurch, durch alle Klassen, in allen Bildungsgraden tatsächlich Vergewaltiger zu finden sind —, diese Vergewaltiger wurden alle zu Haftstrafen verurteilt. Gisèle Pelicot wurde, seit sie sich entschied, den Prozess in die Öffentlichkeit zu tragen, zu Recht bewundert und gefeiert. Sie ist ein Wunder, man muss sie preisen und würdigen, man muss dafür sorgen, dass sich Strukturen nicht gegen Opfer wenden, dass Opfer sich nicht hinter ihrer Verletzung, Beschämung und seelischen Vernichtung verbergen müssen, sondern ungeachtet all ihrer Wunden den Weg ins Offene suchen können.
Auch das ist Arbeit.
Im Wohnzimmer steht ein Weihnachtsbaum, den ich mit meinem jüngeren Sohn nach Hause geschleppt habe. Normalerweise holen wir unseren Weihnachtsbaum vom Weihnachtsmarkt, wo die Bäume nach der finalen Schließung am 23. Dezember verschenkt werden. Sie sind oft erstaunlich gut. Dieses Jahr aber wollten wir schon früher einen Baum. F und ich zogen an einem kalten, regnerischen Sonntag los, niemand sonst wollte mit. Wir entschieden uns für ein großes Exemplar, größer als wir, sicherlich zwei Meter fünfzig hoch. Eine stachelige Fichte. Wir schleppten sie nach Hause, stützten sie beim Tragen mit unseren Hüften, sie zerstach uns die Beine. Wir setzten immer wieder ab, aber fühlten uns stolz und stark. Die Fichte steht zwischen den beiden Wohnzimmerfenstern und trinkt jeden Tag fast zwei Liter Wasser. Zugleich nadelt sie, sobald man sie berührt. Es wird jeden Tag schlimmer. Eine Berührung, Nadeln fallen, als würden sie wasserlachengleich von einem Markisendach nach unten geschüttet.
Es ist wärmer als erwartet, manchmal zum Glück kalt oder zum Glück nicht so warm. Elon Musk twittert, nur die AfD könne Deutschland retten. Seine politische Agenda scheint eine privatwirtschaftliche zu sein, und ich will mir keine Gedanken über ihn machen. Sowieso will ich nicht mehr an Leute denken, deren Handeln ich als schrecklich, rücksichtslos und menschenfeindlich erachte. Die Welt ist voll von diesen Leuten, sie liegen im Trend und haben die Vorhänge der Höflichkeit zerrissen. Deren Handeln erzeugt Katastrophen, erzeugt in mir und anderen Ängste, Schmerzen, Arbeit. Christian Lindner bietet Elon Musk ein Treffen an, wirbt für die FDP. Friedrich Merz geriert sich als ein Herrscher, wie er im Buche steht. Das Buch, das ihm als Quelle dient, ist zweifellos ein altes, überholtes, in dem Menschen nicht als gleichberechtigt gedacht werden.
Unter diesem Text liegt ein Brummen, das ist der sonore Ton des Potenzierens, als würden alle Dinge, von deren Näherkommen sich seit Jahren lesen und hören lässt, nun auf einmal ihr nächstes und viel gewaltigeres Level erreichen. (Sie tun es, oder?) Während ich immer langsamer werde, während ich gar keine Lust mehr auf das Tempo der Welt habe, auf die Katastrophendichte, die Newsfrequenz, die Ansprachen allerorten, die Kaufaufforderungen und Wachstumsdiktate, erlebe ich ringsum rapide erhöhte Geschwindigkeit. Ich lese vom »beschleunigten Klimawandel.«2 Das ist keine Überraschung mehr, und trotzdem würde ich das lieber nicht lesen.
In den USA wird ein Manager einer Krankenversicherung erschossen und, anders als noch vor ein paar Jahren, wird über die Tat im Wesentlichen nicht sachlich berichtet, sondern es wird viel Verständnis, sogar Begeisterung geäußert. Der mutmaßliche Täter wird gefeiert, das mag auch an seinem Aussehen liegen. Michael Moore, der streitbare und kämpferische Filmemacher, heißt den Mord nicht gut, aber teilt mit: »Die Wut ist zu 1000 Prozent gerechtfertigt. Es ist längst überfällig, dass die Medien darüber berichten. Sie ist nicht neu. Sie hat lange gekocht. Und ich werde sie nicht beruhigen oder die Menschen bitten, den Mund zu halten. Ich möchte diese Wut anfachen.«3
Grenzen sind gefallen. Nicht die der Nationalstaaten, die werden auf kriegerische Weise diskutiert, gesichert, strapaziert. Hingegen fallen moralische Grenzen, Grenzen des Anstands und der Beschränkung. Die Herrschenden agieren ungehemmt, und es ist dieser Spruch, der schon immer zutraf, überdeutlich wahr geworden: Geld regiert die Welt. Hemmungen und Zurückhaltung scheinen in Verruf geraten zu sein. Die Hemmung, auch noch die menschenverachtendste Meinung zum Ausdruck zu bringen, die Hemmung, jedwede Ressource auszubeuten und alles und alle als mögliche Ressource zu betrachten. Der Ablenkungsbedarf von der Wirklichkeit ist enorm, die Ablenkungsmöglichkeiten sind es auch.
Robin Detje schreibt: »Ich weiß nicht, wie man das zulässige Ausmaß der Furcht nach einem Ereignis wie der Wiederwahl Trumps berechnen soll. Ich weiß auch nicht, wer solche Maßstäbe setzt. Vermutlich sind es Männer, die Macht als Gewaltherrschaft verstehen und die Welt regieren. Für sie beweist Macht sich in der Ausübung von Gewalt gegen Schwächere, und nur wer Gewalt gegen Schwächere verspricht, wird in einer Demokratie gewählt. Ich gehe deshalb davon aus, dass gar keine Furcht erlaubt ist, denn Furcht ist für diese Männer Schwäche, und wer Schwäche zeigt, wird eher zum Opfer von Gewalt.«4
Bruchstücke der Gegenwart, die ich als mal mehr, mal weniger bedrohlich empfinde.
Es ist Arbeit, die Gegenwart wahrzunehmen, es ist Arbeit, nicht in Groll und Panik zu verfallen, es ist Arbeit, bei Verstand zu bleiben. Es ist Arbeit, die zu sehen, die nicht den Grundtakt vorgeben, die aber mitschwingen müssen, weil sie keine Wahl haben. Es ist Arbeit, sich zu beruhigen, innezuhalten, auf konstruktive Gedanken zu kommen, die zu suchen, die sie haben: die tröstenden Ablenkungen und die guten Ideen.
Alles ist Arbeit.
Von meinem Arbeitszimmerfenster aus überblicke ich einen Platz. Der Platz wird gerahmt von einer Mischung aus sanierten Gründerzeithäusern und Plattenbauten, die — entworfen als Teil eines städtebaulichen Experiments, das erst nach der Wende abgeschlossen wurde — versuchen, die Formen der Altbauten zu übernehmen, die angetäuschte Spitzdächer und Erker haben. Die Gehwege mussten, da die Produktion in den Fabriken mit dem eingeläuteten Ende der DDR nicht mehr funktionierte, zum Teil aus im Baumarkt gekauften Steinen gebaut werden. Im Zentrum des Platzes liegt eine eingezäunte Grünfläche, aus der zweimal im Jahr der Müll entfernt wird, deren Pflanzen einmal im Jahr gelbe Blüten zeigen und anschließend beschnitten werden. In der Grünfläche stehen zwei Fechterfiguren, die ich zwar täglich sehe, aber trotzdem nicht beschreiben könnte. Ich kann hingegen die Menschen beschreiben, die an und um die Figuren herum arbeiten. Die Gärtner*innen zum Beispiel oder jene Restauratorin, die an einem Spätsommertag mit ihrem Fahrrad samt Anhänger kam, die Leiter ablud, über das Zäunchen auf die Grünfläche trug und vor einer der Skulpturen abstellte. Sie bepinselte die Skulptur an manchen Stellen mit einer Flüssigkeit, die sie einer an der Leiter befestigten Dose entnahm. Während ich sie beobachtete, dachte ich, wie Arbeit oder Handlungen, die nach Arbeit aussehen und in Arbeitskleidung verrichtet werden, eine erstaunlich gute Tarnung für Akte der Sabotage, Demontage oder des Diebstahls sein können und so oft schon waren. In diesem Fall jedoch nicht. Sie bearbeitete kleine Schäden, bereitete die Sandsteinskulpturen für den Winter vor. An einem Tag die eine Figur, am nächsten die andere.
Auf dem Platz sehe ich Umzüge, sehe die Fahrzeuge der unterschiedlichen Paketlieferdienste. Ich sehe Taxis, in letzter Zeit immer häufiger Notärzte und Rettungswagen. Ich sehe Menschen, die im Gehen telefonieren; manche erwecken den Anschein, mit einer Freundin oder Verwandten zu plaudern, andere hingegen wirken emsig, arbeitsam, erledigen etwas auf dem Weg, was vielleicht nicht warten kann. Aber was eigentlich kann nicht warten? Ich sehe die Lieferdienstfahrer, ich sehe Gruppen, die sich dort versammeln, wo ein Rest des ehemaligen Künstlerhauses mit seinem goldenen Schriftzug dem Platz eine Einfassung gibt. Ich sehe Kinder zur Schule gehen und zurückkommen, ich höre, wie ein Nachbar mit seinen Kindern schimpft, weil sie zu langsam sind oder eines zu schnell, eines viel zu langsam. Manchmal schimpft er so energisch, dass ich mich verstecken möchte und mich zugleich daran erinnere, wie herausfordernd es ist, mit kleinen Kindern irgendwo pünktlich zu erscheinen. Wie man es trotzdem fast jeden Tag schafft. Ich sehe und höre Eile. Ich sehe Leute, die mit dem eingeschweißten Assiettenessen aus der Konsumfiliale an der Hauptstraße kommen und den Platz überqueren. Ich sehe den weißen Transporter des Schauspielhauses, eine Seite ist mit dem Motto der aktuellen Spielzeit bedruckt: Immer wieder jetzt. Ich sehe und höre Autos rasen, ich sehe eine Fahrerin eine Stelle an ihrer metallic-grünen G-Klasse berühren und aus verschiedenen Blickwinkeln begutachten. Nachher kommt sie mit ihrem Partner zurück, zeigt ihm die aus meiner Perspektive unsichtbare, aber wohl schadhafte Stelle.
Der Platz ist Teil dieser Welt, Teil der Arbeitswelt sowieso, und ich schaue immer gern auf die andere Straßenseite auf den Plattenbau, in dem ich mal wohnte. Die erste Wohnung, die wir als Familie hatten, bis sie zu klein wurde und wir umzogen, im neuen Haus dann aber fast sofort entmietet wurden und mit viel Glück eine Wohnung gegenüber unserem alten Haus in vertrauter Umgebung fanden. Ich sehe die Eingangstür, sehe den Nachbar I. im Erdgeschoss in seiner Küche stehen: I., der einen immer viel zu genau anschaut und viel zu nah kommt, den ich jetzt, da wir keine Nachbarn mehr sind, nicht mehr grüße, um nicht in ein Gespräch gelockt zu werden, dem ich manchmal, um seinen mir immer anzüglich vorkommenden Blicken zu entwischen, im großen Bogen ausweiche, wenn wir uns entgegenkommen. Da drüben jedenfalls geht gerade Frau B., sie verlässt das Haus. Auch sie ist eine ehemalige Nachbarin, die erst ihre Mutter, dann ihren Vater pflegte. Zur Pflege ihres Vaters kam die Pflege der Nachbarin Frau F. hinzu, die nie um eine steile These und eine Tirade gegen die über ihr wohnende Nachbarin Z. verlegen war und deren Tochter und Sohn nicht zu Besuch kommen und sich kümmern wollten und das auch nicht mussten, weil Frau B. sich ja kümmerte. Frau B., gelernte Buchbinderin, nach der Wende arbeitslos geworden, hatte, wie so viele, diese Maßnahme, jene Maßnahme absolviert und kennt Aufopferung und schlechte Bezahlung sehr gut. Sie arbeitete irgendwann nach einer Umschulung als Hauswirtschaftshilfe und ist nun schon eine Weile in einer Arztpraxis als Helferin beschäftigt. Wenn wir uns begegnen, reden wir. Immer steht sie aufrecht, immer trägt sie eine schmale Handtasche über der linken Schulter.
Am frühen Morgen sehe ich das Auto des Pflegedienstes im Halteverbot stehen, weil kein anderer Parkplatz frei ist. Ich sehe die Mitarbeiterin aussteigen, am Haus gegenüber klingeln. Wenn ich das nächste Mal ans Fenster trete, ist das Auto immer schon wieder weg.
Wird es draußen dunkel, sehe ich die Fernseher der Leute. An diesem Platz treffen mittlerweile, seit die meisten Altbauten vor fünfzehn Jahren zu Prunkbauten saniert wurden, unterschiedliche Gesellschaftsschichten aufeinander. Hier wohnen Neureiche, konventioneller Wohlhabende, dazu jene, die so zurechtkommen, dass es irgendwie in Ordnung ist und für den Moment reicht, und jene, die wenig haben, zu wenig, um abgesichert zu sein.
Arbeitende Menschen. Und sogenannte arbeitslose Menschen, aber als ob es die noch gäbe.
Ich lese: »Du machst Sachen, die nicht dein Job sind, nicht Teil deiner Tätigkeitsbeschreibung, für die du nicht qualifiziert bist, und du tust Dinge, die früher der Job anderer Kolleg*innen waren. Wenn du arbeitslos bist, lassen sie dich weiter schuften, und jemand anderes wird daran verdienen. Nach der Arbeit kommt Schattenarbeit, und die war auch mal eines anderen Job und Lebensunterhalt. Du tippst deine Zugreisedaten ein, scannst Barcodes, verpackst Lebensmittel. Es ist egal, welchen Beruf du angibst. Jeder und jede ist Verkäufer, Schaffnerin, Bedienung, Reisebüro und Bankdirektorin.«5
Nach einer Weile der Beschäftigung mit dem Thema Arbeit sehe ich kaum noch etwas anderes. Als fiele es mir jetzt erst auf, dass doch alles, alles aus Arbeit entsteht, dass also in alles, alles Arbeit geflossen ist und fließt. Glaubt man der Bibel, stimmt diese Aussage umso mehr. Auch Gott