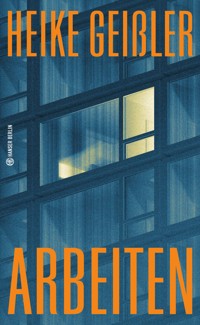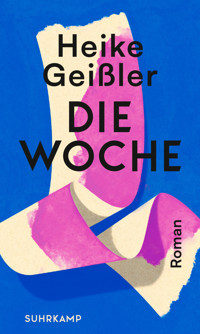17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wo überall sitzt die Menschenfeindlichkeit?
Ein Mädchen steht vor der Schwimmlehrerin und bettelt, endlich in die Fortgeschrittenengruppe zu dürfen. Dabei kann sie nur am Beckenrand ohne Leine gut schwimmen. Die Lehrerin ist gnadenlos, das Mädchen verzweifelt.
Dreißig Jahre später ist Heike Geißler erwachsen und noch immer verzweifelt – aber entschlossen, sich diesem Gefühl zu stellen: Wo ist der Fehler – in Geschlechterrollen, Heroismus, Militarisierung? Was fehlt? Wo sitzt die Menschenfeindlichkeit noch überall? Im Sprechen, im politischen Handeln. In den Landesparlamenten, nicht nur in Ostdeutschland. Sie wehrt sich gegen Rechtsextremismus, feindselige Strukturen und unaushaltbare Verhältnisse. Und übt einen neuen Ansatz, einen anderen Blick. Um daraus Trost und Mut zu schöpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Heike Geißler
Verzweiflungen
Essay
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2873.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: nach Entwürfen von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78249-1
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Quellen
Informationen zum Buch
Verzweiflungen
Dieses Buch enthält einen Witz. Jetzt, da mir einfällt, so zu beginnen – also von der Verzweiflung zuerst einmal abzulenken –, weiß ich allerdings nicht, wo er steht, ich weiß nur, ich habe einen Witz aufgenommen. Der Witz, den ich jetzt nicht wiedergeben könnte, ist kein besonderer Witz, er ist auch nicht lang oder ausgefeilt. Vermutlich ist er noch nicht mal ausgesprochen witzig. Er ist so einer, den man irgendwie schon sehr oft gehört hat, in etwa so einer:
Fritzchen geht um die Ecke.
Was fehlt?
Der Witz.
(Das ist natürlich nicht der Witz, den ich meine.)
Ich möchte über die Verzweiflung ja gar nicht sagen, dass sie mich im Griff hat, aber ich vermute, es ist tatsächlich so. Ich möchte, wie gesagt, intuitiv von der Verzweiflung ablenken, aber nun sind wir hier, und nun fange ich an.
Verzweiflung mitschreiben, Verzweiflung fixieren, Verzweiflung auf- und niederschreiben, niederringen.
Ganz so, als wäre sie die Gegnerin.
Die Notwendigkeit, zurückzublicken auf Verzweiflung, auf Momente, in denen ich verzweifelt war oder die Verzweiflung von Freund*innen, Nachbar*innen oder völlig Fremden mitbekam. Ich schrieb auf, was ich fühlte, was ich beobachtete, um meine Verzweiflung zu beruhigen, um sie zu beerdigen, manchmal. Aber die Verzweiflung, das wissen alle, die sie kennen, ist eine Unsterbliche, eine energische Wiedergängerin, ein expandierendes Gewächs mit Fadenwurzeln aus Garn, Spucke oder Schleim.
Der Wunsch, das Verzweiflungsgewächs aus seinem Habitat zu rupfen, reißen oder locken, ihm seine Versorgung zu entziehen und es in einem Karton, einer Lagerhalle, in einem Buch zu verstauen.
Der Wunsch, eine Art Inventur durchzuführen.
Diese Lust auf einen abschließenden Rückblick, die Lust darauf, ein Ende zu schreiben, ein Ende der Verzweiflung, ein Ende der Anlässe, verzweifelt zu sein.
Ich will die Verzweiflung verwandeln in konstruktive oder alberne Handlungen, in Nicht-Verzagen, in Einspruch, gern auch in Märchen oder Gold.
Søren Kierkegaard, der hier auch auftauchen wird, schrieb: »So heißt also krank zum Tode sein nicht sterben können, doch nicht so, als wäre noch Hoffnung auf Leben, nein, die Hoffnungslosigkeit ist, daß selbst die letzte Hoffnung, der Tod, nicht besteht. Wenn der Tod die größte Gefahr ist, hofft man auf das Leben, wenn man aber die noch schrecklichere Gefahr kennenlernt, hofft man auf den Tod. Wenn also die Gefahr so groß ist, daß der Tod die Hoffnung geworden ist, dann ist die Verzweiflung die Hoffnungslosigkeit, nicht einmal sterben zu können.«
Besser, man spricht den Tod gleich an. Besser, man lässt den Tod gleich ein.
Der Tod ist anwesend. Das Tödliche sowieso.
Besser, man spricht alles an, was ansonsten droht, ein Subtext zu werden, sich zwischen die Wörter zu drängen oder in die Wörter selbst.
Besser, ich sage gleich, was ich zwar lieber nicht sagen möchte, was sich aber permanent in meine Gedanken wirft, an lose Assoziationen hängt, sich mir mitten im Satz in den Weg stellt.
Und das hier ist keine Pose. Das ist eine Notwendigkeit.
Ich atme also tief durch, versuche, das Folgende schnell hinter mich zu bringen, und teile mit, dass ich ab ungefähr vierzig dachte, ich könnte unvergewaltigt durchs Leben kommen.
Das hat aber nicht geklappt.
Ich staune selber und würde das gern ignorieren. Ich würde auch gern die Stadt wieder besuchen können, in der es passierte. Obwohl, das stimmt nicht. Will ich nicht. Weg die Stadt, weg die ganze große Stadt, weg aus meinen Möglichkeiten. Ich ringe nicht um die Stadt, ich ringe auch nicht darum, das Kleid, das ich trug, wieder tragen zu können. Ich mochte das Kleid, bevor es passierte, sehr, ich hatte es ein wenig ermäßigt bekommen, weil eine kleine Stelle der Reißverschlussnaht offen war und ich zustimmte, sie selber zu nähen. Ich würde das Kleid gern einfach wegschmeißen können, aber so spitz kriege ich meine Finger nicht, dass ich es wieder berühren kann, dass ich ihm seine Bedeutung zugestehen kann, indem ich es wegwerfe, und ich will die Sache auch nicht anhand des Kleides austragen. Das Kleid ist nebensächlich. Ich habe ein Kleid im Schrank, das Zeuge ist, ich habe eine Stadt im Sinn, in die ich nicht mehr fahren kann, weil ich schon Atemnot bekomme, wenn der Zug sich der Stadt nur nähert, wenn als nächster Halt ihr Name genannt wird. Erst wenn der Zug die Stadt verlassen hat, kann ich wieder ruhiger atmen.
Es reicht, an Kleid und Stadt zu denken, um mich schlingern zu lassen, erstarren zugleich. Ich werde, wie man so sagt, zu Stein und behaupte aus energischem, extra schwer verwitterndem Stein zu sein, aber ich bin eher aus Sandstein gemacht: Alle meine Formen zerfließen unter dem Einfluss von Wetter und Zeit. Ich verkrafte es und verkrafte es zugleich nicht, auf diese mich vergewaltigende Art beschrieben worden zu sein, ich wünschte, ich könnte den Ort der Niederschrift, diese Stellen meines Hirns, meines Körpergedächtnisses, aussparen, extrahieren, an einem gesonderten Ort aufbewahren und eines Tages gesondert betrachten, aber sie drängen ständig darauf, dabei zu sein.
Ich schreibe das ganz ohne Gefühl. Und es wird ja auch niemand erwarten, dass ich das Ereignis nachbilde, dass ich die Verzweiflung in Anbetracht der Erkenntnis, dass das, was geschehen war, als Vergewaltigung bezeichnet werden muss, anschaulich mache. Dass ich ausführlicher werde. Was hier steht genügt.
Ich kann das Gelände meiner Zerstörung schlecht erfassen.
Es ist vorhanden.
Es sollte nicht vorhanden sein.
Und nach den Jahren, in denen ich dachte, der Penis ist ja in Ordnung, okay, sogar sehr gut und fantastisch, dachte ich dann: Ich will euch einfach nicht mehr sehen.
Penisse zu Pflugscharen!
Penisse zu carrier bags!
Mehr will ich dazu nicht sagen. Nur:
Ich bin nicht unvergewaltigt durch mein Leben gekommen, ich werde folglich nicht unvergewaltigt durch mein Leben gekommen sein.
Sophie Collins zitiert in small white monkeys Denise Riley: »Woran ich dabei denke, […] ist das Gefühl, eine Aura der Lüge auszustrahlen, und an die dazugehörige Angst, dass man mir nicht glaubt.«
Hélène Cixous schreibt: »Ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, wenn ich das Wort ›Wahrheit‹ verwende. In dem Moment, in dem ich ›Wahrheit‹ sage, erwarte ich, dass die Leute fragen: ›Was ist Wahrheit?‹ ›Gibt es Wahrheit?‹ Stellen wir uns vor, sie existiert, daher existiert auch das Gefühl.«
Ich stecke an diesem Punkt fest, an dem ich weiß, was mir passiert ist, es aber nicht wahrhaben möchte und deshalb manchmal denken will, das sei mir alles nicht passiert, und deshalb manchmal denke: Das ist mir nicht passiert.
Und weiter: »Vielleicht bedeutet die Annäherung an das, was wir Wahrheit nennen, zumindest ›entlügen‹, nicht zu lügen. Unser Leben ist ein Gebäude aus Lügen. Wir müssen lügen, um zu leben. Aber um zu schreiben, müssen wir versuchen, zu entlügen, uns die Lügen zu verwehren. Irgendetwas macht das Gehen in Richtung Wahrheit und das Sterben fast zu Synonymen. Es ist gefährlich, in Richtung Wahrheit zu gehen. Wir können nicht darüber lesen, wir können sie nicht ertragen, wir können sie nicht aussprechen; wir denken, dass man erst in der allerletzten Minute weiß, was man sagen wird, obwohl wir nie wissen, wann diese letzte Minute sein wird.«
Ach ja, ich hatte ja vom Tod gesprochen, oder den Tod angesprochen, da war ich.
Tod! Ich versuche, die Wahrheit zu sagen.
Tod, ich bekomme das Wort Wahrheit kaum noch über die Lippen.
Tod, ich mag neben der Wahrheit auch die guten, schönen Lügen sehr.
Die Lügen der Gegenwart sind jedoch katastrophal. Sie sind menschenverachtend, profit- und machtorientiert, engstirnig, tendenziell tödlich. Und oft sehr langweilig und durchschaubar kalkuliert. Die jetzige ist keine Zeit für gute, schöne, prächtige, magische Lügen. Für wilde, aber harmlose, lustige Lügen.
Ich lebe offenbar in einer Zeit, in der ich nie leben wollte.
Brutal, kriegerisch, ideologisch, verbissen, seltsamer Humor. Ich will wegrennen und lebe vielleicht nur noch in geschützten Ecken. Ich bin immerzu schockiert und kann mich an die Kanonade von schlechten Nachrichten und Feindseligkeit weder gewöhnen, noch kann ich resignieren.
Ich lache aus Verzweiflung, und ich freue mich und lache umso energischer über die einfachsten Sachen, die aber nur vermeintlich einfach sind.
Das ist lustig.
Wenn Clown Grock mit seiner Ziehharmonika auftritt und auf den Stuhl springt, aber die Sitzfläche durchbricht, sodass er also im Stuhl steht, an den Beinen eingefasst wie ein wuchernder Busch, dessen Zweige nicht brechen oder zu weit in den Weg ragen sollen, und wenn er sich kurz sammelt, dann aber weiter Ziehharmonika spielt, um schließlich aus dieser Position hochzuspringen: Das ist lustig, und viel mehr noch. Wie nach oben gezogen, nimmt der große Grock auf der Stuhllehne Platz, schlägt die Beine übereinander, der rechte Fuß steht auf der Einfassung der Sitzfläche. Er spielt.
Ich denke an den Hochseilakrobaten Karl Wallenda inmitten seiner Löffelsammlung, über die ich nichts weiß, die ich nur kenne, weil es dieses Foto gibt, das ihn an einem runden Couchtisch zeigt, vor sich in Kreisen ausgelegte Löffel, die ausgehend von einem größeren Vorlegelöffel strahlenförmig zum Rand des Tisches fließen. Unterschiedlichste Löffel: Mokkalöffel, Teelöffel, Zuckerlöffel, wenige Suppenlöffel suggerieren eine Bewegung, als entsprängen der Mitte mit dem Vorlegelöffel immer neue Löffel, der Vorlegelöffel serviert Löffel aus einem großen Vorrat.
Karl Wallenda wollte seine Laufbahn beenden, aber machte doch weiter. Er sagte: »Ich bin so verdammt einsam auf dem Boden.« 1978, im Alter von 73 Jahren, zeigte er seine letzte Hochseilnummer. Ein 37 Meter hohes Seil war zwischen den beiden Türmen des Condado Plaza Hotels im puerto-ricanischen San Juan gespannt. Es gab starke Winde an diesem Tag, man hätte die Vorführung absagen müssen, auch war das Seil nicht ausreichend gesichert. Karl Wallenda fiel weit nach unten auf ein Taxi: kein Schrei, kein Rudern der Arme.
Und ich weiß nicht: Bin ich auch so verdammt einsam auf dem Boden? Bin ich mitsamt der Gegenwart und allen, die ich kenne, aus der Hand eines Gottes gefallen oder geworfen worden, an den ich nicht einmal glaube?
Ich kann das nicht beantworten, weil es vielleicht die falsche Frage ist.
Aber das konnte ja wirklich niemand wissen (außer einem eventuellen Gott vielleicht), dass mir die ganze Weltlage in die Quere kommt. Mir, die ich wie die meisten ein Leben führe, das immer weniger stabil wirkt und durch die politisch und ökonomisch Mächtigen relativ leicht, unangekündigt und sehr anschaulich beeinträchtigt, unterbrochen, beendet werden kann. Das konnte doch niemand rechtzeitig in meine Ideen der Zukunft einpreisen und mich und alle, die ich kenne und mag, ansatzweise darauf vorbereiten, dass die einstigen Dystopien Realität sind und werden, dass uns die Weltlage in jedweder Hinsicht massiv in die Quere kommt. Ohnehin möchte ich nicht vorbereitet sein.
Die Gruppe derer, die nicht immun, sondern zu beeindrucken, zu beeinträchtigen sind, ist riesig, aber augenscheinlich nicht maßgeblich, und sie steht mit offenem Mund und staunt die Ereignisse an. Auch das eher innerlich als äußerlich, denn wer hat schon Zeit für Erstaunen und Schock.
Man kann natürlich gar nicht von einer einheitlichen Gruppe sprechen, zu unterschiedlich sind ihre Mitglieder, zu unterschiedlich auch den Gefährdungen ausgesetzt. Die Gruppe setzt sich aus all jenen zusammen, die den Gefährdungen nichts mehr entgegensetzen können, und jenen, die noch vorsorgen, sich ablenken, sparen, nach einer Krankheit halbwegs genesen und sich wenigstens teilweise wehren oder von Schäden erholen können. Ich gehöre Letzteren an und betrachte die anderen mit Empathie und Furcht gleichermaßen. Denn wie Kateryna Mishchenko in Erste Gedanken an Heilung am Beispiel der Kriegsgeflüchteten schreibt: »Im Raster der Zeit erscheinen Kriegsgeflüchtete als Gäste aus der befürchteten negativen Zukunft. Die erzwungene Reduktion auf das nackte Leben, ihre in Frage gestellte Existenz verleiht diesen Menschen den Status von Rückständigen. Je näher sie der Front sind, desto vergangener wirken der menschliche Körper und der Frieden als eine verkörperte Idee.
Die Zeit wird so fürchterlich verschwendet.«
Wie nah die befürchtete Zukunft ist.
Wie da die befürchtete Zukunft ist.
Und wie viel Furchtraum noch möglich.
Auf der Erde das Verzweiflungsland, das ich bewohne, dessen Einwohnerin ich geworden bin; es ist voll hier, wenngleich der Eindruck täuschen könnte. Ich bin durchsichtig geworden in diesem Land, das es überall gibt. Ich kann deshalb nicht überzeugend zeigen, wie zerschlissen und zerfranst ich bin, ich trete auf als verwischte Spur, als ausgeblichenes Bild, als wie von unten rufendes Wesen: Hallo! Viele Grüße von einer unsichtbaren Fetzenmamsell.
Wer sehen will, kann sehen, wie es um mich steht.
Ja, ich zerfranse und zerfalle unter tausend Dingen.
Und dann bin ich in tausend Teile zerfallen. Ich sage es so, denn es klingt besser, als dass ich zerfiel, zerbrach, dass ich keinen klaren Kopf mehr hatte. Ich dachte: Tausend Teile, das ist eine Menge, aber man kann sie wieder zusammensetzen.
Im Flur ein Karton mit tausend blassbunten Flummis. Sie sind der Vorrat für ein Stück, das ich geschrieben habe, das ich mit meiner Freundin und Kollegin C inszenieren und aufführen werde. Wir träumten von zehntausend Flummis, aber leisteten uns nur tausend, die mir in Hundertersäckchen nach Hause geliefert wurden. Die Kinder und ich öffneten Tüte um Tüte, wir warfen die Flummis mit aller Kraft auf den Boden. Das Ziel war es, sie drei Mal die Decke berühren zu lassen, was nicht gelang. Nachher war der Boden schmierig von den Flummis, fettig. Wer auf Socken ging, kam an manchen Stellen überraschend ins Rutschen.
Wenn uns jemand fragt, worum es im Stück gehen wird, improvisieren wir. Was wir nicht sagen, aber wissen: Am Ende fallen die Flummis alle auf einmal aus dem Bühnenhimmel. Und das zu wissen ist so banal wie tröstlich.
Es lag mir nie, kaputt zu sein.
Eigentlich heule und klage ich vor Schreck, Überforderung, Stress und Angst. Ich heule und klage den ganzen Tag und überall. Unsichtbar und dezent. Hauptsächlich innerlich. Ich schreie innerlich einen zehrenden, kläglichen und schauerlichen Ton.
Ich finde diesen Ton angebracht, aber man wird ihn nicht von mir hören. Ich würde mich genieren, würde meinen, das sei der falsche Moment, es liege ein letztlich wohl doch unerheblicher Anlass vor, nicht Anlass genug jedenfalls, um jetzt und hier zu schreien, zu brüllen wie ein Tier. Ich würde relativieren, bis es mir sogar selbst unangebracht vorkäme, so zu schreien: laut, energisch, lange genug, um nicht mit einer kurzen Schreckensäußerung verwechselt zu werden, die dann überginge in Gelächter, weil es ja doch keinen Anlass für diesen Schreck gab.
Ich eile innerlich schreiend den vermeintlichen und tatsächlichen Schrecken davon, ich werde selten laut, ich entwische höflich, das ist meine Fortbewegungsart.
Jemand sagte mir mal, ich sollte mir vielleicht dringend einen anderen Sport suchen, schlug mir also, während ich da an ihm vorbeihuschte, einen besseren Ausgleich vor.
Na von mir aus, dachte ich, widersprach nicht, aber wunderte mich: Man kann ja alles verkennen und für ein durch Sport regulierbares Problem halten.
Ich schreie also nicht. Ich gehe ein, irgendwie. Ich verkümmere auf stumme Art, das ist das berühmte Ersticken an allem, was eigentlich rausmuss, aber nicht raus kann. Die Verzweiflung macht mir den Körper kaputt, sie macht mich nervös, gierig nach Ablenkung und Betäubung.
Das hier ist eine Rettungsmaßnahme.
Die Verzweiflung ist die Welt, die Arbeit und die Aufgabe, die ich nicht lösen kann. Sie ist die Route, deren Verlauf ich nicht kenne.
Sie entspringt dem Alltag und der Vorstellung, der Alltag wäre die letzte Rettung, wäre das letzte Schauspiel, das ich noch aufführen kann und aufführen müsste, um nicht zu zerspringen.
Die Verzweiflung ist manchmal das Schlafzimmer eines überforderten, sich liebenden Paares mit zwei Kindern. Ich komme nicht umhin, es nahezu ungeschönt zu beschreiben.
Das Zimmer war mal ein geteiltes Kinderzimmer, dann räumten wir um, jedes Kind bekam sein eigenes Zimmer und wir ein neues Schlafzimmer, in dem vieles, das meiste davon eigentlich nur vorübergehend, seinen Platz finden musste: Kleiderschränke, Besenschränke (ohne Besen darin, aber mit Leuchtmitteln, Putzschwämmen und Dingen für den Verkauf auf dem Flohmarkt, an dem ich dann doch nie teilnehme), einer großen Truhe, deren massives Holz an den Seiten gebrochen ist. Die Truhe ist voll mit Decken, zum Beispiel meiner Häschendecke: rosa mit weißen dicklichen Häschen darauf, sie ist bei mir, seit es mich gibt. Darin liegen auch die Kamelhaardecken (angeblich Kamelhaar), die meine Mutter kurz nach der Wende für einen Monatslohn bei einer dieser Werbeveranstaltungen erwarb, wo die Kaffeegäste den Raum erst unkompliziert verlassen durften, nachdem sie etwas gekauft hatten.
Wir bewahren auch das Werkzeug im Schlafzimmer auf, Stoffe und Nähmaschine, dabei nähe ich nie. Eine ungenutzte und zum Verkauf bestimmte Kinderwerkbank, die auf dem quadratischen Freiraum zwischen unseren Kleiderschränken steht und, will man den eigenen öffnen, in Richtung des andern Kleiderschranks geschoben werden muss.
Auf der Kinderwerkbank liegt immer ein Haufen gewaschener Kleidung; immer liegen zu viele Kleidungsstücke herum, und sowieso sind zu viele im Schrank. Dazu die Haufen abgelegter Kinderkleidung, die verschenkt, entsorgt oder zum Kleidercontainer gebracht werden muss.
Inmitten der Stapel und Säcke stehen große Tüten und Kisten mit Kostümen: Tiermasken, bedruckte Jumpsuits, Oberteile mit LED-Beleuchtung. Auf die Frage nach dem von mir bevorzugten Kleidungsstil reagiere ich am liebsten mit einer Verkleidung. Mein Fliegenkostüm ist jedenfalls eines der schönsten, kleidsamsten Stücke, die ich besitze, eine Mischung aus Kleinem Schwarzen und Daunenanorak. Die Flügel biegen sich etwas lasch über die Schultern nach vorn.
Das Schlafzimmer ist also ein Zimmer, das eher als Abstellraum genutzt wird. Kisten hier, Kisten dort. Verpackungen, Kartons, die man vielleicht noch braucht. Eine Sammlung Schleifenbänder, die nie aufgewickelt sind, bunte lose Schlangen, die ich nicht entwirren will. Ein Bestand an Fußballschuhen des jüngeren Sohnes, eine Autobiographie in Fußballschuhen, von denen ich mich nicht trennen kann. Ein Stapel mit mal verschwenderisch und mal akribisch bemalten Leinwänden. Nie abgekratzt und übermalt, immer wurde eine neue begonnen, Kinderbilder, die ich beim Aufräumen vorgeblich übersehe, damit ich mich nicht entscheide, sie doch noch zu entsorgen. Die Kiste mit den Anfängen des Familienstammbaums. Ein Projekt aus der Corona-Zeit, als wir versuchten, Zeit zu überbrücken, als ich dachte, vielleicht taucht noch ein Reichtum auf, etwas, das sich von irgendwem erben lässt. Ich suchte auch diese entfernte Verwandte, die aufgrund ihres hohen Gewichts auf Jahrmärkten im Erzgebirge ausgestellt wurde. Man hatte mir von ihr erzählt, aber ich fand keine Spuren zu ihr.
Im Zimmer das Bett mit seinen tückisch breiten Beinen, unter dem ich mich einmal versteckte, weil ich nicht wusste, wie ich sonst mit einer schlechten Nachricht umgehen soll. Dort bin ich noch. Im Zimmer die alten Topfpflanzen, die ich sterben lassen will, nur sterben sie nicht.
Im Regal das Nähkästchen meiner Oma väterlicherseits, die ich, wie alle meine Verwandten, nicht sehr gut kannte, die ich über ihr Nähkästchen auch nicht besser kennenlerne. Ich erinnere mich an den Spiegelschrank in ihrem Schlafzimmer, wo meine Cousinen und ich bei Familienfeiern spielten. Eines Tages klopfte jemand gegen die Heizung, um mitzuteilen, dass es zu laut war. Aber ich, das Mädchen, dem alles Schreckliche vorstellbar war, aus dem die Frau wurde, die sich alles Schreckliche vorstellen kann, dachte, jemand habe an die Scheibe geklopft, jemand habe dort im fünften Stock des Altneubaus gegen das Fenster geklopft. Ich rannte aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer meiner Mutter in die Arme, die sich beruhigend über mich beugte. Die Atemluft reichte immer nur für ein einzelnes Wort:
Da!
Hat!
Jemand!
Ans!
Fenster!
Geklopft!
Und niemand verstand diese Möglichkeit, dass jemand groß genug sei, um – ohne sich weiter bemühen zu müssen – im fünften Stock an die Scheibe zu klopfen und vier spielende Kinder zu maßregeln. Und niemand hielt es für möglich, dass ein Mensch ohne Hilfsmittel fliegen könnte, um vier spielenden, hauptsächlich kichernden Kindern durch ein Klopfen gegen das Schlafzimmerfenster im fünften Stock mitzuteilen, dass sie zu laut seien. Und es zog auch niemand in Betracht, dass diese sich beschweren wollende Person einen gehörigen Aufwand betreiben musste, um das zu schaffen: im fünften Stock an ein Fenster klopfen (draußen keine Feuerleiter, kein Etagenbalkon, auch keine Möglichkeit, einfach vom Dach nach unten zu reichen), um vier hauptsächlich kichernde Cousinen zu maßregeln.
Niemand folgte mir in meinen Annahmen.
Niemand hielt das für möglich.
Ich hörte mein Herz schlagen, ich hatte Sorge, dass mein Kinderherz den Schreck nicht verkraften würde, dass es aufhören würde zu schlagen. Ich halte es immer noch für möglich, dass irgendwer, ob nun tatsächlich oder im übertragenen Sinne, sehr viel Aufwand betreibt, um kichernde Cousinen zu maßregeln, zu unterbrechen, zur Ruhe zu bringen.
Beispielsweise kichernde Cousinen.
Ich sehe den Aufwand, der betrieben wird, um Störungen, Unterbrechungen, Zerstörungen, Diffamierungen, körperliche und seelische Verletzungen zu verteilen.
Manchmal sehe ich nichts als diesen Aufwand.
Das Schlafzimmer hat dunkle Rollos, die am Abend das helle Licht von den Restaurants auf der anderen Seite des Hinterhofs draußen halten. Der Blick aus dem Zimmer zeigt drei Wäschespinnen, einen Wäscheplatz, viele Mülltonnen, die gute Hälfte in einem Zaunkäfig, der Rest auf einem nicht eingezäunten Platz. Rechts sieht man die Balkone der Plattenbauten aus der Wendezeit, gegenüber und links Gründerzeithäuser. Jeden Morgen hustet ein Mann minutenlang würgend Schleim ab, oft sind Tauben zu hören.
Es gibt einen schief gewachsenen Sauerkirschbaum, dessen Krone über den Müllcontainerkäfig reicht. Bis vor wenigen Jahren gab es bedeutend mehr Bäume, sie mussten einem Parkhaus weichen, dessen Dach wurde begrünt, inmitten der Flechten einige aufschießende, ursprünglich nicht vorgesehene Pflanzen.
Meine Verzweiflung ist
mein Alptraumort
meine Werkseinstellung
eine Unbekannte
mein Wunschort
eine Sorge
ein Glaubensprojekt
eine Zumutung
eine Stetigkeit
eine Menge an Fragen
ein Ruf
ein Brief
noch ein Brief
eine Unverständlichkeit
eine Notlage
ein Kontrastprogramm
eine Kollision
ein Teufelsspruch
ein Märchen
eine Bewegung in alle Richtungen zugleich
ein Gebirge
eine Gabe
eine Vorstufe
ein Ende
ein Anfang
eine Schnittstelle in eine Zukunft
eine Schnittmenge mit einer guten Idee
eine Größe
ein politischer Faktor
ein Streckennetz
ein rigider Unfall
Meine Verzweiflung ist tückisch und schwül, eines der Moore, vor denen man mich in der Kindheit warnte: Dort kommst du nie wieder raus!
Meine Verzweiflung ist schnittig und kalt, eher Auto als Küchenmesser, manchmal eher Zivilklage als Privatträne.
Meine Verzweiflung ist die Mitteilung an mich, dass ich zu spät dran bin, immer, egal, wie sehr ich mich um Pünktlichkeit, um Voreiligkeit bemüht habe.
Meine Verzweiflung räumt mir die vollen Teller vom Tisch und behauptet, da sei nie etwas gewesen, ich hätte nie konkret genug gekocht, hätte niemals eine wirkliche Mahlzeit zubereitet.
Meine Verzweiflung ist eine ruppige Ärztin, die mich zum Aderlass bittet und sagt: Doch, das machen wir jetzt wieder so. Sie ist ein Wald, aber ich weiß mich in Wäldern jetzt zu bewegen. Ich erschrecke nicht mehr vor der Überzahl der Bäume, vor den Mythen, den Märchen, der Dunkelheit und den Fährten.
Meine Verzweiflung ist ein wilder Ritt.
Meine Verzweiflung ist ein Zuhause. Ich verkümmere, wenn ich ausgehe, ich weiß nicht, was das soll.
Die Verzweiflung ist allhier.
Die Verzweiflung kippt mich aus den Relativierungen aller Ereignisse in meine eigenen Wunden.
Die Verzweiflung entsteht aus dem Auseinanderklaffen von Vorstellung und Wirklichkeit, aus dem Erkennen der Wirklichkeit. Und ich erinnere mich daran, wie das Flugzeug sich fast schon im Landeanflug befand und ich schon froh war und es nicht erwarten konnte, endlich wieder zu leben, kleiner konnte ich das nicht denken, da zeigte der Bildschirm vor mir eine Flughöhe von 0 m an, dabei waren wir noch deutlich hoch in der Luft, Berlin nicht zu sehen. Ich konnte das nicht in Übereinstimmung bringen, ich hielt die Anzeige auf dem Bildschirm für eine Meldung aus der allernächsten Zukunft, von dem sich anbahnenden Absturz, für die Info eines verzweifelten Piloten, der nun schon in großer Nüchternheit eine kleine letzte Botschaft absetzte: 0 m. Ich wollte sein wie Gertrude Stein, die die Landschaft von oben beschrieb, oder wie Ingeborg Bachmann, die die Landschaft von oben beschrieb, oder wie ungefähr jede Person auf Instagram, die Blicke aus Flugzeugen postete, aber ich war jene, die manisch minütlich die Uhrzeit notierte und sich auf einen Absturz vorbereitete, diskret, denn ich wollte niemanden beunruhigen und mich nicht blamieren.
Meine Verzweiflung reißt mich entzwei und ruft: Vertraue mir. Sie ist eine mir anfangs keinesfalls vertrauenswürdig scheinende Unordnung. Sie ist eine Zumutung, aber wird zu einem Prozess der Umordnung, Neuordnung: Ich werde ganz anders. Aber so ging es nicht los.