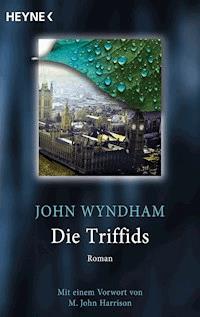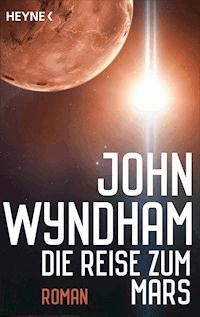2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eine Waffe gegen den Tod
Auf der Suche nach einem Antibiotikum hat Francis Saxover, der Chef eines Biochemie-Forschungszentrums, eine Entdeckung gemacht, die alle bisherigen Errungenschaften und Großtaten der modernen Medizin weit in den Schatten stellt. Das Lichenin, aus einer seltenen Flechtenart gewonnen, ist das Medikament, von der die Menschheit seit Anbeginn der Geschichte träumt. Es ist das Lebenselixier, das Mittel gegen den Tod, denn es verlangsamt den Alterungsprozess und erhöht die Lebenserwartung. Jeder, der sich der Lichenin-Behandlung unterzieht, wird praktisch unsterblich. Aber die Lebensverlängerung hat ihre Probleme. Die Unsterblichkeitsdroge ist knapp, und nur wenige Menschen können in den Genuss der Behandlung kommen. Das Geheimnis der Unsterblichkeit muss also um jeden Preis gewahrt werden, um ein weltweites Chaos zu verhindern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Ähnliche
JOHN WYNDHAM
ÄRGER MIT DER UNSTERBLICHKEIT
Roman
Das Buch
Auf der Suche nach einem Antibiotikum hat Francis Saxover, der Chef eines Biochemie-Forschungszentrums, eine Entdeckung gemacht, die alle bisherigen Errungenschaften und Großtaten der modernen Medizin weit in den Schatten stellt. Das Lichenin, aus einer seltenen Flechtenart gewonnen, ist das Medikament, von der die Menschheit seit Anbeginn der Geschichte träumt. Es ist das Lebenselixier, das Mittel gegen den Tod, denn es verlangsamt den Alterungsprozess und erhöht die Lebenserwartung. Jeder, der sich der Lichenin-Behandlung unterzieht, wird praktisch unsterblich. Aber die Lebensverlängerung hat ihre Probleme. Die Unsterblichkeitsdroge ist knapp, und nur wenige Menschen können in den Genuss der Behandlung kommen. Das Geheimnis der Unsterblichkeit muss also um jeden Preis gewahrt werden, um ein weltweites Chaos zu verhindern.
Der Autor
John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris wurde am 10. Juli 1903 in der Nähe von Birmingham, England, geboren und besucht im Laufe seiner Schulzeit verschiedene Internate. Nach seinem Abschluss arbeitete er unter anderem als Landwirt, Grafiker und Werbefachmann, bevor er sich ab 1931 dem Schreiben widmete. Er ist einer der wichtigsten Science-Fiction-Autoren Englands und benutzte eine Reihe von Pseudonymen, darunter auch Lucas Parkes und John Beynon. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Verschlüsselungsexperte für das Royal Corps of Signals und nahm an der Landung in der Normandie teil. Nach dem Krieg wandte er sich, inspiriert und angespornt vom Erfolg seines Bruders Vivian Beynon Harris, erneut dem Schreiben zu. 1951 landete er mit Die Triffids einen Bestseller, dem sechs weitere Romane folgten. Zahlreiche seiner Werke wurden verfilmt, darunter auch Die Triffids und Das Dorf der Verdammten
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Titel der Originalausgabe
TROUBLE WITH LICHEN
Aus dem Englischen von Brigitte Kraus
Überarbeitete Neuausgabe
Copyrightzeile aus dem Original
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat
Prolog
Der Abschied war wundervoll.
Der kleine Chor, ganz in Weiß, schimmernde Goldnetze auf dem Haar, sang mit der süßen Trauer gefallener Engel.
Als er geendet hatte, herrschte Totenstille in der überfüllten Kirche, und durch die dumpfe Luft wogte der Duft von Tausenden von Blumen.
Den Sarg krönte eine Blütenpyramide. An den vier Ecken standen die Wachen in fließenden Seidengewändern, Goldnetze auf den gesenkten Köpfen, gekreuzte Goldbänder über der Brust, jede mit einem vergoldeten Palmwedel in der Hand, wie aus Marmor gemeißelt.
Der Bischof überquerte geräuschlos den leeren Raum vor der Kanzel und bestieg sie langsam. Sorgfältig schlug er sein Buch auf, hielt einen Augenblick inne und hob den Kopf.
»… unsere geliebte Schwester Diana … ihr unvollendetes Werk, dem nun keine Vollendung mehr wird … Ironie des Schicksals kein Begriff, der dem Willen des Allmächtigen gerecht wird … Er gibt und nimmt von uns … wenn Er den Ölbaum, den er uns gegeben, von uns nimmt, bevor er Frucht getragen, so obliegt es uns, sich seinem Willen zu beugen … Gefäß seiner Eingebung … Hingabe an ihre Aufgabe … Seelenstärke … Änderung des Verlaufs der Menschheitsgeschichte … Der Leib deiner Dienerin Diana …«
Die Augen der Versammlung, mehrere Hunderte von Frauen und ein paar vereinzelter Männer, hefteten sich auf den Sarg. Langsam setzte er sich in Bewegung. Blüten lösten sich und rollten auf den Teppich. Unerbittlich schwankte der Sarg vorwärts. Gedämpftes Orgelspiel begann. Erneut erhoben sich hell und rein die Chorstimmen. Die Vorhänge bauschten sich zu beiden Seiten des Sarges und schlossen sich hinter ihm.
Das Geräusch angehaltenen Atems, ein oder zwei Schluchzer, das weiße Gesprenkel von Taschentüchern …
Als sie die Kirche verließen, wurden Zephanie und Richard von ihrem Vater abgedrängt. Sie wandte sich um und erblickte ihn ein paar Meter hinter sich. Zwischen die Frauen eingekeilt wirkte er größer, als er war. Sein gutgeschnittenes Gesicht war vollkommen ausdruckslos. Es sah nur müde aus – er schien die Vorgänge um sich herum gar nicht wahrzunehmen.
Draußen waren noch mehr Frauen. Hunderte, denen es nicht gelungen war, einen Platz in der Kirche zu ergattern. Viele weinten. Ihre mitgebrachten Blumen bildeten einen breiten, leuchtenden Streifen rechts und links der Kirchentür, so dass die Herauskommenden sich gezwungen sahen, zwischen dem Blumenteppich zu gehen.
Eine Stange ragte aus der Menge, die ein großes Crux ansata trug. Es war ganz aus weißen Lilien, von denen eine schwarze Riesenschleife flatterte.
Zephanie zog Richard aus dem Gedränge und überblickte die Szene. Ihre Augen waren feucht, aber nichtsdestotrotz spielte ein kummervolles Lächeln um ihren Mund.
»Armer Liebling Diana«, sagte sie. »Denk nur, wie sie das amüsiert hätte.«
Sie nahm ihr Taschentuch und tupfte sich kurz die Augen.
Dann meinte sie: »Komm! Machen wir, dass wir Daddy finden und dann nichts wie weg von hier.«
Aber es war wirklich ein wunderschönes Begräbnis.
Die New-Record berichtete:
»… Frauen aller Gesellschaftsschichten und aus allen Teilen Englands waren zusammengekommen, um Diana Brackley die letzte Ehre zu erweisen. Viele fanden sich kurz nach Sonnenaufgang ein, um sich denen anzuschließen, die die ganze Nacht vor den Friedhofstoren kampiert hatten.
Als die lange Nachtwache endlich durch das Eintreffen einer feierlichen, blumenüberladenen Prozession belohnt wurde, sprengten die Zuschauerinnen fast den Polizeikordon.
Tränenüberströmt und wehklagend ließen die Trauernden den Zug an sich vorüberziehen.
Seit der Beerdigung Emily Davisons war London nicht mehr Zeuge eines solchen von Frauen einer Frau gezollten Tributes.«
Und dann fand sich, da die New-Record immer um äußere Genauigkeit bemüht ist, folgende Fußnote:
»Die Beerdigung Emily Wilding Davisons fand am 14. Juni 1913 statt. Sie war eine Suffragette und starb an den Folgen der Verletzungen, die sie sich zugezogen hatte, als sie sich während des am 4. Juni selbigen Jahres abgehaltenen Derbys vor das Pferd des Königs warf.«
Kapitel 1
Die Halle war ausgeräumt und der Boden auf Hochglanz gebracht worden. Irgendjemand hatte die Wände durch hier und da angebrachte Efeubüschel verschönt und noch jemand anderes hatte gedacht, ein bisschen Lametta könnte dem düsteren Grün nicht schaden. Die Tische waren zusammengestellt worden, weiß gedeckt und dienten als Büfett, das sich unter belegten Brötchen, Kuchen- und Würstchenplatten, Krügen voll Zitronen- und Orangensaft, Blumenvasen und einigen Teemaschinen bog. Dem Auge bot der Raum eine wildbewegte Szenerie. Das Ohr wurde selbst aus einiger Entfernung an Stare in der Abenddämmerung erinnert.
St. Merryn's High hielt seine Jahresschlussfeier.
Miss Benbow, Mathematik, ließ ihre Augen, während sie einem langatmigen Bericht über die von Aurora Treggs jungem Hund an den Tag gelegte Intelligenz zuhörte, durch den Raum schweifen und merkte sich diejenigen vor, mit denen sie im Laufe des Abends noch sprechen wollte. Am Saalende erblickte sie Diana Brackley, für einen Augenblick allein. Diana gehörte auf alle Fälle zu denen, die Lob verdienten, und so wartete sie eine Atempause in Auroras wasserfallartigem Vortrag ab, machte eine Bemerkung über den erstaunlichen Scharfsinn des Hundes und stand auf.
Auf ihrem Weg durch die Halle betrachtete sie Diana plötzlich mit den Augen eines Fremden. Kein Schulmädchen mehr, sondern eine attraktive, junge Frau. Wahrscheinlich lag es am Kleid. Ein einfaches, dunkelblaues Tuchkleid, das man, bevor man es nicht richtig ansah, überhaupt nicht bemerkte. Es war nicht teuer – Miss Benbow wusste, dass es nicht teuer sein durfte – aber es hatte Stil. Diana hatte Geschmack in Kleidern, und sie besaß das gewisse Etwas, das ein Kleid für drei Pfund wie eines für zwanzig aussehen lässt. Eine Gabe, dachte Miss Benbow kummervoll, die nicht zu verachten ist. Und, spann sie ihre Gedanken weiter, ihr Aussehen war ein Teil dieser Gabe. Nicht hübsch. Hübsche Mädchen sind wie Frühlingsblumen – lieblich, aber es gibt halt so viele Frühlingsblumen. Niemand, der einen gewissen Blick sein eigen nennen konnte, konnte Diana hübsch nennen …
Achtzehn, gerade achtzehn war Diana damals. Ziemlich groß und schlank und gerade. Ihr Haar war ein dunkles Kastanienbraun mit roten Lichtern. Die Linie von Stirn und Nase konnte fast klassisches Ebenmaß für sich beanspruchen. Den Mund hatte sie leicht geschminkt. Sanft geschwungen und dekorativ, sagte er nichts über Diana aus, aber er konnte bei Gelegenheit voller Charme lächeln, und er lächelte nicht zu oft. Ihre grauen Augen waren es allerdings, die man sofort bemerkte und denen man sich nicht entziehen konnte; nicht nur, weil es sehr schöne Augen waren, wundervoll geschnitten und weit auseinanderliegend, sondern weil sie eine solch in sich ruhende Gelassenheit ausstrahlten.
Mit einer Art Überraschung, denn sie hatte Diana immer nur als Geist und weniger als Materie betrachtet, gewahrte Miss Benbow, dass Diana zu, was man in der Jugend ihrer Eltern als Schönheit bezeichnet hatte, herangewachsen war.
Diesem Gedanken folgte ein Glücksgefühl, ausgelöst dadurch, dass Miss Benbow sich selbst gratulierte. Denn in einer Schule wie St. Merryn's High lehrt und erzieht man nicht nur ein Kind, man führt einen Dschungelkrieg um es. Je gutaussehender und liebenswürdiger ein Mädchen ist, um so schlechter stehen im allgemeinen seine Überlebenschancen.
Die Werbetrommeln für Sackgassen-Jobs werden eifrig gerührt, Schmetterlinge mit Banknotenflügeln gaukeln in Reichweite, Bazillen von Filmen und Illustrierten vergiften die Luft, die Netze früher Heirat werden gesponnen, beschränkte Mütter mischen sich ein, kurzsichtige Väter erscheinen polternd auf der Bildfläche und über allem das spöttische Raunen: »Was zählt das alles, solange sie glücklich ist … Was macht es …«
So ist man schon berechtigt, beim Anblick derer, die man um diese Gefahren herumgelotst hat, einigen Stolz zu empfinden.
Aber dann musste sich Miss Benbow zur Ordnung rufen, da sie unverdientes Lob für sich in Anspruch nahm.
Diana hatte wenig Schutz erfordert. Die Fährnisse hatten sie nicht angefochten. Die Versuchungen überging sie, als ob es ihr nie in den Sinn gekommen wäre, dass sie es auch darauf anlegen könnte, sie zu verführen. Sie erinnerte an einen Reisenden, der durch eine interessante Gegend fährt. Ihr Bestimmungsort war noch ungewiss, aber er lag sicherlich in der Ferne, und dass irgendjemand damit zufrieden sein sollte, die Reise so früh abzubrechen und an einem Rasthaus am Weg oder einem primitiven Dorf haltzumachen, setzte sie in Erstaunen. Nein, es freute einen, dass Diana so gut abgeschnitten hatte, aber allzu verdient hatte man sich nicht darum gemacht. Sie hatte hart gearbeitet und Erfolg gehabt. Das einzige, das man sich wünschen konnte, obwohl es, da man ansonsten mit trägen und konformistischen Kindern zu kämpfen hatte, fast sündhaft erschien, war, dass sie ein wenig – nun, weniger individualistisch wäre …
Miss Benbow hatte die Halle fast durchquert, und Diana hatte sie schon gesehen.
»Guten Abend, Miss Benbow.«
»Guten Abend, Diana. Ich möchte dir ganz herzlich gratulieren. Es ist großartig, einfach großartig. Wir alle haben erwartet, dass du gut abschneiden würdest – wären schrecklich enttäuscht gewesen, wenn es weniger als gut gewesen wäre. Aber das – nun, es ist besser, als ich für dich zu hoffen wagte.«
»Vielen Dank, Miss Benbow. Aber es ist nicht nur mein Verdienst. So weit wäre ich nicht gekommen, wenn nicht alle mir so geholfen und mich angeleitet hätten.«
»Dafür sind wir hier. Aber wir stehen auch in deiner Schuld, Diana. Selbst heutzutage trägt ein Stipendium sehr zum Ansehen einer Schule bei, und deines ist eines der besten, das St. Merryn's jemals verliehen wurde. Ich nehme an, du weißt das.«
»Miss Fortindale schien wirklich sehr erfreut.«
»Sie ist mehr als erfreut. Wir alle sind es.«
»Danke, Miss Benbow.«
»Und deine Eltern sind natürlich auch hocherfreut?«
»Ja«, antwortete Diana mit einem Hauch Reserve. »Daddy freut sich sehr. Er ist froh, dass ich nach Cambridge komme, weil er selber gern dort studiert hätte. Wenn ich das Stipendium nicht gewonnen hätte, wäre Cambridge nicht zur Debatte gestanden und es wäre nur« – im rechten Augenblick fiel ihr ein, dass Miss Benbow an der Universität London ihr Examen gemacht hatte, und sie verbesserte sich zu »– eine von den Redbricks in Frage gekommen.«
»Einige der Redbricks leisten sehr gute Arbeit«, bemerkte Miss Benbow mit leichtem Tadel.
»O ja, natürlich. Nur, wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann kommt es einem wie eine Art Versagen vor, wenn man dann etwas anderes tun muss, nicht wahr?«
Miss Benbow ließ sich nicht auf diese Betrachtungsweise ein.
»Und deine Mutter? Sie ist wahrscheinlich auch sehr stolz auf deinen Erfolg?«
Diana sah ihr mit diesen grauen Augen ins Gesicht, die einen zu durchdringen schienen.
»Ja«, meinte sie zögernd, »das ist sie.«
Miss Benbows Augenbrauen gingen in die Höhe.
»Ich wollte sagen, dass Mama sehr stolz auf mich sein müsste«, erklärte Diana.
»Aber sicher ist sie das«, protestierte Miss Benbow.
»Sie gibt sich Mühe. Sie war wirklich sehr süß«, sagte Diana. Sie heftete ihre Augen auf Miss Benbow. »Warum halten Mütter nur Betttauglichkeit für so viel respektabler als Gescheitheit?«, fragte sie. »An sich sollte man das Gegenteil erwarten.«
Miss Benbow blinzelte. Die Unterhaltung drohte verfänglich zu werden, aber sie stellte sich.
»Ich denke, dass man für ›respektabel‹ ›verständlich‹ einsetzen sollte. Im großen und ganzen ist die Welt des Geistes für Mütter ein Buch mit sieben Siegeln, und sie wissen nichts damit anzufangen. Aber natürlicherweise halten sie sich auf dem anderen Gebiet alle für Autoritäten, die mit Rat und Tat beistehen können.«
»Aber ›respektabel‹ spielt irgendwie mit hinein«, entgegnete sie mit leichtem Stirnrunzeln.
Miss Benbow schüttelte den Kopf.
»Verwechselst du nicht Respektabilität und Konformismus? Der elterliche Wunsch, dass Kinder ihnen vertraute Wege einschlagen, ist nur natürlich.« Sie zögerte und fuhr dann fort: »Ist dir noch niemals der Gedanke gekommen, dass die Tochter, die eine Karriere dem Leben ihrer hausbackenen Mutter vorzieht, damit insgeheim ihre Mutter kritisiert? Im Grunde sagt sie: ›Das Leben, Mutter, das du führst, mag dir genügen, aber mich befriedigt es nicht.‹ Nun, Mütter schätzen das – genau wie alle anderen Leute – nicht sehr.«
»So habe ich es noch nicht betrachtet«, gab Diana gedankenvoll zu. »Sie glauben, dass Mütter im Stillen darauf hoffen, dass ihre Töchter in ihrer Karriere Schiffbruch erleiden und damit beweisen, dass ihre Mütter doch recht gehabt haben.«
»Jetzt lässt du deiner Phantasie aber die Zügel schießen, Diana.«
»Ja, schon – aber es folgt doch daraus, nicht, Miss Benbow?«
»Ich glaube nicht, dass es uns einen Gewinn bringt, wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen. Wohin fährst du in den Ferien, Diana?«
»Nach Deutschland. Ich wäre eigentlich lieber nach Frankreich gegangen, aber Deutschland ist, glaube ich, nützlicher.«
Darüber unterhielten sie sich eine Weile. Dann gratulierte ihr Miss Benbow zum zweiten Mal und wünschte ihr alles Gute für die Universität.
»Ich bin für alles schrecklich dankbar. Ich bin so froh, dass Sie sich alle so gefreut haben. Aber es ist komisch«, setzte sie hinzu, »ich hätte gedacht, dass eigentlich jede betttauglich ist, wenn sie es darauf anlegt. Deshalb verstehe ich nicht, warum …«
Aber Miss Benbow ging nicht darauf ein.
»Oh!«, rief sie aus, »da ist Miss Taplow. Ich weiß, dass sie darauf brennt, mit dir zu sprechen. Komm!«
Als sie Diana zu Miss Taplow geschleust hatte und diese etwas müde Glückwünsche anbrachte, drehte sich Miss Benbow um und fand sich Brenda Watkins gegenüber, deren neuer Verlobungsring allen nur möglichen Stipendien offensichtlich den Rang ablief. Hinter sich hörte sie Diana sagen:
»Nur eine Frau und sonst nichts zu sein, kommt mir wie ein Sackgassen-Job vor, Miss Taplow. Er enthält keine Aufstiegsmöglichkeiten – außer, wenn man ihn als Kokotte oder so etwas Ähnliches betreibt …«
»Ich verstehe einfach nicht, woher sie es hat«, bemerkte Mrs. Brackley mit ratlosem Gesichtsausdruck.
»Von mir bestimmt nicht«, antwortete ihr Mann. »Ich habe mir manchmal gewünscht, dass ein bisschen Gescheitheit in der Familie läge, aber meines Wissens war das nie der Fall. Aber abgesehen davon, ich halte die Frage, woher sie es hat, für nicht wichtig.«
»Ihre Intelligenz meine ich gar nicht. Vater muss etwas los gehabt haben, oder er hätte nicht so viel Geld in der Baubranche verdient. Nein, ich meine – vielleicht könnte man es als Unabhängigkeit bezeichnen … die Art, Fragen zu stellen. Dinge, die man einfach nicht in Frage stellt.«
»Und dabei auf recht originelle Antworten kommen, wie ich von Zeit zu Zeit feststelle«, warf Mr. Brackley ein.
»Es ist eine Art Ruhelosigkeit«, fuhr Malvina Brackley hartnäckig fort. »Junge Mädchen werden natürlich ruhelos – das erwartet man –, aber, nun, meiner Meinung nach ist das nicht die gewöhnliche Art Ruhelosigkeit.«
»Keinen Freund«, sagte Mr. Brackley geradeheraus und traf damit den Nagel auf den Kopf. »Mache dir darüber keine Sorgen, meine Liebe, das kommt schon noch!«
»Aber es wäre normaler. Ein gutaussehendes Mädchen wie Diana …«
»Wenn sie wollte, könnte sie gerade genug Freunde haben. Sie müsste nur lernen, albern vor sich hin zu kichern und nicht Sachen zu sagen, die erschrecken.«
»Oh, Diana ist keine Besserwisserin, Harold.«
»Ich weiß, dass sie keine ist. Aber sie halten sie für eine. Wir haben hier eine sehr einfallslose Nachbarschaft. Diese Leute kennen nur drei Typen von Mädchen: Die sportliche Kameradin, die Kicherliese und die Besserwisserin. Es ist schlimm genug, dass wir unter so kulturlosen Leuten leben müssen, aber sicher möchtest du nicht, dass sie mit einem dieser Dummköpfe anfängt.«
»Nein, natürlich nicht. Nur, dass …«
»Ich verstehe. Es wäre normaler. Meine Liebe, als wir das letzte Mal mit Miss Pattison sprachen, prophezeite sie uns eine glänzende Karriere für Diana. Glänzend sagte sie, und das bedeutet nicht normal. Du kannst nicht alles haben.«
»Es ist wichtiger für sie, dass sie glücklich wird, als dass sie Karriere macht.«
»Jetzt stellst du aber fast die gefährliche Behauptung auf, dass alle Leute, die du normal nennst, auch glücklich sind. Da machst du es dir aber zu einfach. Schau sie dir doch nur an! … Nein, wir können dankbar sein, von Herzen dankbar, dass sie sich nicht für einen dieser Dummköpfe entschieden hat. Da erwartet sie keine glänzende Zukunft – und, wenn man es genauer betrachtet, auch den Dummkopf nicht. Zerbrich dir nicht den Kopf! Sie macht schon ihren Weg. Was sie braucht, ist die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern.«
»Da war die jüngste Schwester meiner Mutter, meine Tante Annie«, sagte Mrs. Brackley versonnen. »Sie war eigenartig.«
»Warum, was war los mit ihr?«
»Oh, so habe ich es nicht gemeint. Nein, sie kam 1912 ins Gefängnis, oder war es 1913, weil sie am Piccadilly Feuerwerkskörper losgelassen hatte.«
»Warum in aller Welt denn das?«
»Sie warf sie zwischen die Beine der Pferde und verursachte ein solches Chaos, dass sie den Verkehr von der Bond Street bis zu Swan und Edgars lahmlegte, und dann kletterte sie auf ein Omnibusdach und schrie ›Wahlrecht für Frauen‹, bis die Polizei sie festnahm. Sie bekam einen Monat Gefängnis dafür. Die Familie schämte sich in Grund und Boden.
Sobald sie wieder auf freiem Fuß war, warf sie einen Backstein durch ein Fenster in der Oxford Street und wurde zwei Monate eingesperrt. Ihre Gesundheit war nicht die beste, als sie entlassen wurde, da sie in einen Hungerstreik getreten war, und so wurde sie zu meiner Großmutter aufs Land geschickt. Aber irgendwie schaffte sie es, nach London zu kommen und Mr. Balfour mit einem Glas Tinte zu bombardieren, so dass sie wieder eingesperrt wurde, und diesesmal setzte sie fast einen Flügel vom Holloway Gefängnis in Brand.«
»Eine unternehmungslustige junge Frau, deine Tante, aber mir geht nicht auf …«
»Sie war eben eine ungewöhnliche Person. Und so hat es Diana vielleicht von der Seite meiner Mutter.«
»Ich bin nicht sicher, was Diana von deiner militanten Tante haben soll, meine Liebe, und offen gesagt, es interessiert mich auch über die Tatsache hinaus, dass wir beide dieses Wunderwerk irgendwie vollbracht haben, nicht. Wir haben exzellente Arbeit geleistet.«
»Natürlich haben wir das, Harold, Liebster. Wir haben jedes Recht, auf sie stolz zu sein. Es ist nur, dass – nun, dass ein glänzendes Leben nicht immer das glücklichste ist, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht. Du und ich wissen, dass man glücklich sein kann, ohne glänzend begabt zu sein. Wie es ist, sehr begabt zu sein und was man sich dann zum Glücklichsein wünscht, übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber ich weiß, dass es jemanden glücklich machen kann. Mich, zum Beispiel – und aus einem durch und durch egoistischen Grund. Seit sie ein kleines Mädchen war, hat es mich bedrückt, dass ich keine gute Ausbildung für sie erschwingen konnte. Die Leute von St. Merryn's sind gute Lehrer, da gibt es nichts, aber es ist doch nicht dasselbe wie eine wirklich erstklassige Schule. Als dein Vater starb, hielt ich es für möglich. Ich ging zu den Anwälten und legte ihnen den Sachverhalt klar. Sie bedauerten, aber ließen sich nicht erweichen. Die Bestimmungen waren eindeutig, behaupteten sie. Das Geld würde bis zu ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr von ihnen verwaltet. Es dürfte nicht angerührt, noch Anleihen darauf aufgenommen werden, nicht einmal für ihre Erziehung.«
»Das hast du mir nie erzählt, Harold.«
»Warum sollte ich es euch erzählen, bevor ich nicht wusste, ob es möglich war. Und es war nicht durchführbar. Weißt du, Malvina, das war der schlimmste Streich, den uns dein Vater gespielt hat. Dass er dir nichts hinterließ, hat uns nicht gewundert. Aber unserer Tochter vierzigtausend Pfund vermachen und das Geld so festlegen, dass sie in den Jahren, wo es am wichtigsten für sie wäre, keinerlei Nutzen davon hat! Gott sei Dank, Diana hat für sich selbst getan, was er nicht für sie tun wollte. Sie hat, ohne es zu wissen, dem alten Hund tüchtig eins ausgewischt.«
»Harold, Liebster …!«
»Ich weiß, ich weiß, meine Liebe. Aber es ist wirklich … Ich denke jetzt nicht mehr oft an diesen bösartigen alten Geizkragen, aber wenn ich es tue …«
Er brach ab und ließ seine Blicke über das kleine Wohnzimmer gleiten. Es war mittlerweile ein bisschen schäbig, aber gemütlich. Aber das ärmliche, winzige Halbreihenhaus in einer Straße, wo ein Haus wie ein Ei dem anderen glich … Das überfüllte Vorortviertel … Das beengte Leben … Der tägliche Kampf, mit einem Gehalt auszukommen, das ständig den Preisen hinterherhinkte … So wenige von den Dingen, nach denen sich Malvina sehnen musste und die er ihr so gegönnt hätte …
»Bereust du es noch immer nicht?«, fragte er.
»Nein, Liebling, überhaupt nicht.«
Er zog sie hoch und setzte sich mit ihr in den großen Armstuhl. Sie lehnte den Kopf an seine Schulter.
»Nein«, sagte sie ruhig. »Ich hätte nicht glücklicher werden können, wenn ich irgendwelche Stipendien gewonnen hätte.«
»Liebling, die Menschen sind sehr verschieden. Mir kommt es so vor, als ob wir doch nicht ganz so gewöhnlich wären. Wie viele von den Leuten, die du in dieser Straße kennst, können aufrichtig von sich sagen: ›Ich bereue nichts.‹«
»Es muss ein paar geben?«
»Ich glaube nicht, dass es allzu oft vorkommt. Und wie sehr du es auch anderen Menschen wünschst, du kannst es nicht für sie bewerkstelligen. Und außerdem, Diana ist dir nicht sehr ähnlich – mir übrigens auch nicht. Der Himmel weiß, wem sie ähnlich ist. So hat es gar keinen Sinn, sich Sorgen zu machen und sich zu überlegen, was du machtest, wenn du an ihrer Stelle wärst. Glänzend, behaupteten sie. Nun, alles, was wir tun können, ist, unsere Tochter auf ihre Weise ›glänzen‹ zu lassen – und sie zu unterstützen, natürlich.«
»Harold, sie weiß nichts von dem Geld?«
»Sie weiß, dass da etwas Geld existiert. Sie hat sich nicht nach dem Betrag erkundigt. Ich musste sie nicht anlügen. Ich habe so etwas von drei- oder vierhundert Pfund dahergeredet. Es erschien mir klüger.«
»War es auch; ich muss nur daran denken, wenn sie mich nach dem Geld fragt.
Harold, ich glaube, du hältst mich für sehr dumm, aber was macht ein Chemiker eigentlich? Diana hat mir erklärt, dass es nicht dasselbe wie ein Apotheker ist und da war ich schon froh, aber sehr klar hat sie sich nicht ausgedrückt.«
»Klarer kann ich es dir auch nicht machen. Wir fragen sie besser noch einmal. Ja, die Rollen haben sich verkehrt – wir haben das Stadium erreicht, wo sie uns erklärt.«
Was ein Chemiker tut, sollte nicht mehr allzu wichtig für die Brackleys werden, denn Diana sattelte in ihrem ersten Universitätsjahr auf Biochemie um, und was ein Biochemiker tut, war nicht in ihrer Mutter Kopf zu bringen.
Der Grund für diesen Wechsel lag in einem Vortrag, gehalten von der Mid-Twentieth Society über Evolutionäre Entwicklung in kürzlich veränderter Umgebung. Der Titel klang nicht sehr aufregend und Diana wusste hinterher nicht mehr, was sie veranlasst hatte, diesen Vortrag zu besuchen. Aber er sollte den Kurs ihres Lebens bestimmen.
Der Vortragende war ein gewisser Francis Saxover, SC.D., F.R.S., eine Zeitlang Professor für Biochemie an der Universität von Cambridge, der in weiten Kreisen als intellektueller Abtrünniger galt. Er stammte aus einer Familie aus South Staffordshire, die, nach Generationen der Kleinkrämerei, plötzlich um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eine bemerkenswert unternehmerische Ader in sich entdeckte. Diese Ader, die so günstig mit dem Klima der Zeit und der immensen industriellen Entwicklung zusammenfiel, hatte die Saxovers an neue Herstellungsmethoden herangeführt, sie expandieren und zu einem beachtlichen Familienvermögen kommen lassen.
Und sie war auch in den folgenden Generationen nicht versiegt. Sie blieben mit neuen Verarbeitungsprozessen und modernen Betriebsführungsmethoden im Vormarsch und stiegen sogar in die Plastikindustrie ein, als sie in ihr einen schnell größer werdenden Rivalen für Töpfereiwaren und Porzellan erkannten. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts waren sie immer noch erfolgreich.
In Francis jedoch hatte der Unternehmergeist eine andere Richtung eingeschlagen. Er war zufrieden gewesen, das Geschick des Familienkonzerns in die Hände seiner zwei älteren Brüder zu legen und seiner eigenen Bestimmung zu folgen, die ihren abschließenden Höhepunkt in einer Professur finden sollte. So zumindest hatte er es sich gedacht.
Es trat jedoch der Umstand ein, dass die Gesundheit seines Vaters, Joseph Saxovers, in seinen späten Fünfzigern bedenklich nachließ. Auf diese Entdeckung hin hatte Joseph, ein weitblickender Mann, keine Zeit verloren, die volle Verantwortung seinen zwei älteren Söhnen zu übergeben. Er hatte dann viel Zeit der ihm verbleibenden acht oder neun Jahre seines Lebens dem faszinierenden Hobby gewidmet, Mittel und Wege auszusinnen, die der Gefräßigkeit des Finanzamtes einen Riegel vorschoben. Gewisse Skrupel hatten ihn daran gehindert, sich auf diesem Feld genauso gut zu schlagen wie manche Leute der Konkurrenz, aber er war doch findig genug gewesen, um die Behörden zu veranlassen, nach seinem Tod eine Anzahl interessanter Lücken für Nachahmer zu stopfen.
Als Ergebnis dieser Bemühungen fand sich Francis wesentlich wohlhabender, als er erwartet hatte und wurde unruhig. Es war, als ob die Saxover-Ader beim Gedanken an brachliegendes Kapital lebendig würde. Nach einem zunehmend ruhelosen Jahr gab er sein wissenschaftliches Eremitendasein auf.
Mit einer Handvoll tüchtiger Assistenten gründete er eine eigene Forschungsanstalt und machte sich daran, seine Ansicht zu belegen, dass Entdeckungen, im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, noch nicht die alleinige Domäne einer Unzahl von Forschern, die in halbmilitärischen Formationen für riesige Gesellschaften arbeiteten, geworden waren.
Darr House Developments, wie die Gesellschaft einfacherweise nach dem Besitz, den er dafür gekauft hatte, genannt wurde, bestand nun seit sechs Jahren. Das war nicht nur fünf Jahre länger, als die meisten seiner Freunde prophezeit hatten, sondern sie schien auch einen vielversprechenden Start gemacht zu haben. Sie hatte bereits mehrere Patente entwickelt, die bedeutend genug waren, um die Aufmerksamkeit einiger großer Chemiehersteller zu erregen – und vielleicht ein bisschen Neid unter früheren Kollegen. Sicherlich enthielt die Vermutung, dass der Besuch Francis' weniger dem Wunsch nach Belehrung als dem nach Rekrutierung seines Stabes entsprang, ein Gramm Bosheit.