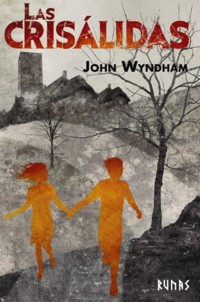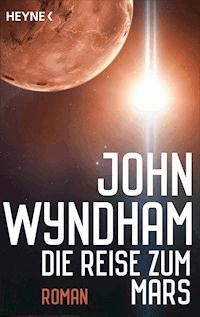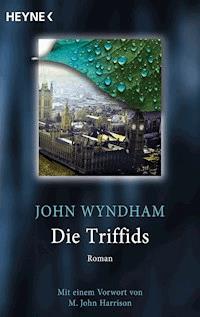
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jahrhundertelang hat der Mensch die Natur ausgebeutet – nun ist der Tag der Abrechnung gekommen ...
Nach einem Kometenschauer über London ist nichts mehr so, wie es einmal war: Blind und hilflos irren die Menschen durch eine gespenstische und zerstörte Stadt. Die wenigen Glücklichen, die noch sehen können, schließen sich zusammen und verlassen London. Doch in der postapokalyptischen Welt lauert eine neue Gefahr: riesige, menschenfressende Pflanzen – die Triffids ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Das Buch
Ein Kometenschauer über London hat alles Leben zum Erliegen gebracht. In dieser gespenstischen Stille lauern riesige wandelnde Pflanzen, die Triffids, auf die plötzlich erblindeten Menschen. Überall bricht Chaos aus, die Normalität, wie man sie kannte, ist außer Kraft gesetzt. Mit einem peitschenartigen Giftstachel bewehrt, machen sich die neuen Herrscher der Erde daran, die Menschheit auszurotten. Doch eine kleine Gruppe von Menschen, die durch Zufall ihr Augenlicht bewahrt haben, nimmt den Kampf gegen die Kreaturen auf …
Einer der großen Klassiker der Science Fiction und zugleich einer der bedeutendsten Katastrophenromane des 20. Jahrhunderts. Mit Sinn für Spannung und realistische Details schickt John Wyndham den Leser durch ein apokalyptisches Szenarium, das überaus aktuelle Züge trägt: Der Mensch hat rücksichtslos in die Natur eingegriffen – und die Natur wendet sich gegen ihn.
Der Autor
Der Autor
John Wyndham wurde 1903 in Knowle, Warwickshire, geboren. Er versuchte sich in den verschiedensten Berufen, ehe er 1925 damit begann, Kurzgeschichten und Romane zu schreiben, die das Überleben in Extremsituationen zum Thema haben. Er gilt heute als einer der einflussreichsten englischen Science-Fiction-Autoren. John Wyndham starb 1969 in Petersfield.
Titel
John Wyndham
Die Triffids
Roman
Mit einem Vorwortvon M. John Harrison
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Titel der englischen OriginalausgabeTHE DAY OF THE TRIFFIDSAus dem Englischen von Hubert GreifenederÜberarbeitet von Inge Seelig
Vollständige Neuausgabe 03/2012Copyright © 1951 by John WyndhamCopyright © 2012 des Vorworts by M. John HarrisonCopyright © 2012 der deutschen Ausgabe und Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, ZürichSatz: C. Schaber Datentechnik, WelsISBN 978-3-641-07682-5V002www.heyne-magische-bestseller.de
Vorwort von M. John Harrison
Vorwort
von M. John Harrison
1949: John Wyndham Parkes Lucas Benyon Harris, ein Autor bis dahin nicht sonderlich erfolgreicher Romane, die er als »Abenteuergeschichten von galaktischen Gangstern« beschreibt, kommt zu dem Schluss, dass er etwas stärker auf die Gegenwart Bezogenes schreiben will. Indem er sich vom US-amerikanischen Pulp-Markt abwendet, seinen Namen zu John Wyndham vereinfacht und sich als Thema eine Katastrophe in einer wiedererkennbaren nahen Zukunft wählt, rehabilitiert er nicht nur seinen eigenen Namen, sondern das Medium der Science Fiction gleich mit.
Der Katastrophenroman reitet auf der Welle zeitgenössischer Ängste, indem er sie als bereits eingetretene Katastrophe betrachtet. Nachdem Wyndham sich neu erfunden hatte, schlüpfte er aus seinem Kokon und fand sich in einem Zeitalter voll neuartiger Ängste wieder. Gewaltige Veränderungen standen ins Haus: Der Krieg hatte den Engländern gezeigt, dass ihr kostbarster Besitz – eine stabile Gesellschaftsordnung, ein ruhiges Leben, verlässliche Kommunikations- und Versorgungswege – innerhalb von sechs Monaten erodiert und durch Unsicherheit, Ausfälle und Verknappung ersetzt werden konnte; die Macht wurde dem Vorkriegs-Mittelstand aus den Händen genommen (ein Ereignis, das in den großen englischen Filmen von Michael Powell und Emeric Pressburger zugleich beklagt und gefeiert wird) und einer bürokratischen Infrastruktur übertragen – und dort verblieb sie auch nach dem Krieg.
Diese Verschiebung, die nicht nur die politische Oberfläche betraf, sondern tiefer ging, wurde von technologischen Entwicklungen begleitet und ermöglicht. In einigen Fällen – etwa bei der Entdeckung des Penicillins – erschienen diese Entwicklungen überaus vorteilhaft. In anderen Fällen – so bei der Anwendung neuer Technologien in der Landwirtschaft, durch die das Landleben des Viktorianischen Zeitalters endgültig zugrunde gerichtet wurde – war weniger deutlich, ob es sich um einen wünschenswerten Wandel handelte. Überhaupt keine Vorzüge waren dort zu erkennen, wo neue Entwicklungen in der Ballistik, Kybernetik und Kernphysik zusammentrafen und das erschufen, was zur Schlüsselbedrohung der darauf folgenden vier Jahrzehnte werden sollte: die Möglichkeit eines Atomkriegs. In den Elendswintern der unmittelbaren Nachkriegsjahre, überschattet von einer Wissenschaft, die sie nicht mehr verstanden, und ohne den Trost religiöser oder imperialer Gewissheiten, verkrochen sich die Engländer in ihren schlecht beheizten Häusern und fragten sich, was die Zukunft wohl bringen würde. Und es war John Wyndhams genialer Verdienst, ihnen eine Möglichkeit zu eröffnen, über ihre Lage nachzudenken.
»Die Triffids« beginnt mit einer vielschichtigen Metapher für einen Stromausfall in Kriegszeiten. Am nächtlichen Himmel tauchen geheimnisvolle grüne Lichter auf, die die Menschen erblinden lassen – wahrscheinlich rühren sie von der unbeabsichtigten Zündung einer Superwaffe im Orbit her. Bill Masen, der sich gerade von einer Operation erholt, von der er befürchtet hat, dass sie ihn das Augenlicht kosten würde, nimmt seinen Verband ab und stellt fest, dass die Welt über Nacht dem Chaos anheimgefallen ist. »Dies sind private Aufzeichnungen«, erklärt er zu Beginn des zweiten Kapitels. »Vieles von dem, was sie enthalten, ist für immer verschwunden, dennoch kann ich hier nur die Worte gebrauchen, die wir für diese verschwundenen Dinge hatten, ich sehe keine andere Möglichkeit.« Seinen Worten liegt eine vielschichtige Ironie zugrunde: Bill Masen steht für die alte, verlässliche Welt, aber seine Augen sind sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne offen für das Neue. Schon bald durchlebt er, stellvertretend für die Leser, einen der großen politischen Albträume der Nachkriegsjahre: den Zusammenbruch von Gesellschaft und Infrastruktur.
In langen Reihen stolpern die Blinden durch eine brennende Stadt mit defekter Kanalisation. Eine von ihnen erklärt, dass es sie am meisten erschreckt habe, »dass die Welt, die wir für völlig sicher gehalten haben, einfach so untergegangen ist«. Nichts funktioniert mehr. Das Essen wird knapp. Niemand weiß, was zu tun ist. Jeder hat eine andere Vision von der postapokalyptischen Zukunft, und viele sind bereit, um die Verwirklichung der ihrigen zu kämpfen. Sehende Opportunisten beuten die Blinden aus, und die Blinden nehmen sich ihrerseits sehende Sklaven, um ihr Augenlicht zu ersetzen.
Unterdessen machen die Triffids Jagd auf sie alle.
Diese großen, giftigen und offenbar intelligenten Pflanzen sind aus Wyndhams Vorkriegslaufbahn mit herübergestolpert. Ursprünglich sind sie das Ergebnis eines experimentellen russischen Zuchtprogramms, das zur Herstellung billiger Öle gedacht war. Jetzt nutzen sie die Katastrophe, um ihre Wurzeln aus der Erde zu lösen und Menschen zu jagen. Es ließe sich einwenden, dass man sich kaum etwas weniger Bedrohliches vorstellen kann als eine vernunftbegabte Pflanze, die »wie auf Krücken« umherschlurft. Aber mit einem Triffid-Stich ist nicht zu spaßen, denn mit seinem Stachel kann er »eine tödliche Ladung Gift verspritzen, wenn er auf bloße, ungeschützte Haut trifft«. Außerdem sind es nicht die vergleichsweise absurden Spezialeffekte, aufgrund derer »Die Triffids« auch sechzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch ein wichtiges Buch ist. Es ist die Art, wie der Roman die beiden unterschwelligen Ängste unserer Zivilisation anspricht, insbesondere die der städtischen Zivilisation: nämlich erstens, dass sie untergehen könnte; und zweitens, dass sie vielleicht doch nicht untergeht. Unsere diesbezüglichen Gefühle sind ein Dialog der Angst. Konzernbestimmte Infrastrukturen erhalten unsere Nahrungsmittelversorgung aufrecht, und die bauliche Umgebung sorgt für unsere Sicherheit, aber gleichzeitig bevormunden uns diese Dinge, engen uns ein und stellen einen massiven Eingriff ins »Natürliche« dar.
Heutzutage drehen sich unsere Ängste eher um ökologische Themen – Umweltverschmutzung, vom Menschen verursachte globale Erwärmung, das Wuchern der Städte, der endgültige Verlust des bürgerlichen Landlebens –, und an diesem Punkt zeigt sich das Beharrungsvermögen der Triffids als Bild: 1951 wie heute sind sie eine treffende Metapher für eine Lebensweise, die uns, wie Bill Masen, erst blind für unser Handeln macht und uns anschließend zwingt, mit der Zukunft zurechtzukommen, die wir selbst herbeigeführt haben.
M. John Harrison zählt zu den bedeutendsten britischen Science-Fiction-Autoren der Gegenwart. Zuletzt sind im Wilhelm Heyne Verlag seine Romane »Licht«, »Nova« sowie »Die Centauri-Maschine« erschienen.
Die Triffids
DIE TRIFFIDS
1 Das Ende beginnt
1
Das Ende beginnt
Wenn ein Tag, von dem man eigentlich weiß, es ist ein Mittwoch, sich von Anfang an so anhört wie ein Sonntag, ist irgendetwas faul.
Dieses Gefühl hatte ich bereits beim Aufwachen. Aber als ich schließlich ein wenig klarer denken konnte, wurde ich unsicher. Immerhin sprach einiges dafür, dass ich mich irrte und nicht alle anderen – auch wenn ich nicht verstand, wie es dazu kommen konnte. Ich wartete mit leisen Zweifeln weiter. Doch kurz darauf bekam ich meinen ersten objektiven Beweis – in der Ferne schlug eine Uhr, und in meinen Ohren klang es wie acht. Ich horchte genau und argwöhnisch hin. Kurz darauf setzte eine andere Uhr ein, ein lauter, entschiedener Ton. Gemächlich schlug sie unleugbar acht. Da wusste ich, dass etwas nicht stimmte.
Dass ich das Ende der Welt verpasste – nun, das Ende jener Welt, wie ich sie beinahe dreißig Jahre lang gekannt hatte –, war schierer Zufall: wie Überleben es häufig ist, wenn man es genauer bedenkt. Es ist nun einmal der Fall, dass stets ziemlich viele Menschen im Krankenhaus liegen, und ungefähr eine Woche zuvor hatte das Zufallsprinzip auch mich dazu bestimmt. Ebenso gut hätte es auch eine Woche früher sein können – in welchem Falle ich dies jetzt nicht schriebe; ich wäre gar nicht da. Doch der Zufall wollte nicht nur, dass ich zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus lag, sondern auch, dass meine Augen, sogar mein ganzer Kopf, mit Bandagen umwickelt waren – und deshalb muss ich dem, der auch immer diesen Zufall befehligt hat, dankbar sein. Zum gegebenen Zeitpunkt war ich jedoch einfach nur übel gelaunt und fragte mich, was zum Teufel los sei, denn ich hielt mich bereits lange genug dort auf, um zu wissen, dass in einem Krankenhaus neben der Oberschwester die Uhr das Allerheiligste ist …
Ohne Uhr wäre dieser Ort einfach nicht funktionsfähig. Jede Sekunde blickt jemand darauf, bei Geburt, Tod, der Medikamentenausgabe, bei Mahlzeiten, Licht, Gespräch, Arbeit, Schlaf, Ruhe, Visite, Ankleiden, Waschen – und bis dato hatte sie bestimmt, dass jemand mich genau drei Minuten nach sieben Uhr zu waschen und zurechtzumachen hatte. Das war einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich mein Einzelzimmer zu schätzen wusste. In einem Mehrbettzimmer hätte diese unangenehme Prozedur eine ganze unnötige Stunde früher begonnen. Doch heute schlugen hier Uhren verschiedenster Verläßlichkeit aus allen Richtungen unablässig acht – und immer noch war niemand aufgetaucht.
So wenig ich die morgendliche Waschzeremonie mochte, und so vergeblich mein Vorschlag gewesen war, dabei auf Hilfe zu verzichten, wenn man mich nur ins Badezimmer führte, war das Ausbleiben jedweder Hilfe doch äußerst beunruhigend. Außerdem ging diese Zeremonie normalerweise dem Frühstück kurz voraus, und ich hatte Hunger.
Möglicherweise hätte mich dies an jedem Morgen bedrückt, doch dieser Tag, dieser Mittwoch, der 8. Mai, war für mich ein besonderer Tag. Mein Interesse, die tägliche Routine und den ganzen Wirbel hinter mich zu bringen, war doppelt so groß wie sonst, denn es war der Tag, an dem man mir meine Bandagen abnehmen wollte.
Ich tastete eine Weile herum, bis ich den Klingelknopf fand, und ließ ganze fünf Sekunden lang das Geschepper ertönen, um ihnen zu zeigen, was ich von ihnen hielt.
Während ich die ziemlich ungehaltene Reaktion abwartete, die ein solches Getöse hervorrufen würde, horchte ich weiter.
Draußen hörte sich der Tag inzwischen noch falscher an, als ich gedacht hatte. Die Geräusche, die er machte oder eben nicht machte, klangen sogar noch sonntäglicher als der Sonntag selbst – und ich war inzwischen wieder der absolut sicheren Meinung, dass Mittwoch war, was immer auch passiert sein mochte.
Das St.-Merryns-Krankenhaus lag an einer Hauptstraße, nahe einer verkehrsreichen Kreuzung; weshalb man es da hingebaut hatte und die Nerven der Patienten dieser dauernden Belastung aussetzte, habe ich nie herausgefunden. Weniger empfindsamen Kranken mochte der ununterbrochene Verkehrslärm das Gefühl geben, auch in ihren Betten dem Leben nahe zu bleiben. Üblicherweise donnerten die Busse Richtung Westen in hohem Tempo hier vorbei, um an der Ecke noch die Grünlichtphase zu erwischen; Bremsenkreischen und Salven von Auspuffknallern zeugten regelmäßig davon, dass sie es wieder einmal nicht geschafft hatten. Sobald die Ampel die Kreuzung freigab, heulten die Motoren hochtourig auf, um die anschließende Steigung zu nehmen. Und hin und wieder hörte man ein Krachen und Splittern, gefolgt von allgemeinem Stillstand – für jemanden in meiner Lage besonders quälend, weil ich das Ausmaß des Unfalls nur aus der Heftigkeit der Flüche erraten konnte. Als Patient des St.-Merryns-Krankenhauses konnte man sich weder tagsüber noch nachts der Illusion hingeben, der Alltagstrubel sei zum Erliegen gekommen, nur weil man selbst vorübergehend aus dem Verkehr gezogen war.
Aber die Stille an diesem Morgen war befremdlich. Sie hatte etwas Beunruhigendes und Geheimnisvolles. Kein Räderknarren, kein Motorenlärm, überhaupt kein Fahrgeräusch. Keine Hupe war zu hören, nicht einmal der Hufschlag eines der seltenen Pferde, die noch zuweilen vorbeiklapperten. Auch nicht das Getrappel der Menge. Und es war doch die Zeit, wo alles zur Arbeit ging.
Je länger ich horchte, umso seltsamer und unheimlicher wirkte diese Lautlosigkeit. Innerhalb von schätzungsweise zehn Minuten gespannten Horchens unterschied ich fünf Paare von schlürfenden, zögernden Schritten, drei Stimmen, die in der Ferne Unverständliches riefen, und das hysterische Weinen einer Frau. Kein Taubengurren, kein Spatzengezwitscher. Nichts. Nur das Sirren des Windes in den Drähten …
Ein unheimliches Gefühl beschlich mich, ein Grauen, wie ich es manchmal als Kind empfunden hatte, wenn ich Schreckensgestalten in den finsteren Winkeln des Schlafzimmers wähnte; wenn ich nicht wagte, einen Fuß auf den Boden zu setzen aus Furcht, etwas könnte unter dem Bett hervorlangen und mein Bein packen; wenn ich mich nicht einmal traute, nach dem Lichtschalter zu tasten, weil die Bewegung dieses Etwas womöglich veranlassen würde, mich anzuspringen. Ich musste dieses Grauen niederkämpfen, wie ich es einst als Kind niedergekämpft hatte. Und es war jetzt nicht leichter als damals. Noch immer waren die elementaren Ängste da und warteten auf eine günstige Gelegenheit, um mich unterzukriegen, und beinahe wäre es ihnen geglückt: bloß weil meine Augen verbunden waren und der Verkehr stillstand …
Als ich mich ein wenig beruhigt hatte, versuchte ich es mit Vernunft. Warum steht der Verkehr still? Nun, normalerweise, weil die Straße wegen Reparaturarbeiten gesperrt ist. Ganz einfach. Sie würden jeden Moment mit Pressluftbohrern anrücken, ein ganz besonderer Ohrenschmaus für Langzeitpatienten. Aber das Problem mit der Vernunft war, dass sie sich nicht so schnell zufriedengab. Sie brachte mich sofort darauf, dass es auch in der Ferne keinerlei Verkehrsgeräusche gab, kein Zugpfeifen, kein Tuten eines Schleppers. Einfach nichts – bis die Uhren Viertel nach acht schlugen.
Die Versuchung, einen Blick zu wagen, einen einzigen, kurzen Blick, um zu sehen, was los war, war ungeheuer groß. Aber ich wehrte sie ab. Die Sache war nämlich gar nicht so leicht. Ich trug nicht einfach nur eine Binde vor den Augen, sondern einen komplizierten Verband. Aber vor allem hatte ich Angst. Nach einer Woche vollkommenen Blindseins scheut man jedes Risiko. Gewiss, man wollte mir heute den Verband abnehmen, doch das würde nicht bei hellem Tageslicht geschehen, und die endgültige Entscheidung hing vom Ergebnis der Untersuchung ab. Das war mir natürlich nicht bekannt. Mein Sehvermögen war vielleicht für immer geschädigt. Vielleicht konnte ich überhaupt nicht mehr sehen. Ich wusste es nicht …
Fluchend drückte ich auf den Klingelknopf und verschaffte mir damit kurzfristig Erleichterung.
Niemand kam. Mit der Unruhe wuchs auch der Zorn. Schlimm genug, wenn man auf fremde Hilfe angewiesen ist, schlimmer noch, wenn diese Hilfe ausbleibt. Ich verlor langsam die Geduld. Ich musste etwas tun.
Wenn ich durch den Flur brüllte und die Hölle heraufbeschwor, würde schon jemand auftauchen, und sei es nur, um mir die Meinung zu sagen. Ich schlug die Decke zurück und stieg aus dem Bett. Ich hatte das Zimmer, in dem ich lag, nie gesehen, glaubte aber nach dem Gehör gut genug orientiert zu sein; dennoch war es gar nicht leicht, die Tür zu finden. Ich hatte eine ganze Menge unerwarteter Hindernisse zu überwinden, stieß mir eine Zehe wund, auch das Schienbein bekam etwas ab, ehe ich mein Ziel erreichte. Ich öffnete die Tür und schrie in den Flur hinaus: »Hallo! Frühstück auf Zimmer achtundvierzig!«
Einen Augenblick lang blieb alles still. Dann brach der Tumult los. Es war, als schrien Hunderte auf einmal, ich verstand kein Wort. Ich fühlte mich wie in einem Albtraum. War ich noch im St.-Merryns-Krankenhaus? Oder hatte man mich, während ich schlief, in eine Irrenanstalt geschafft? Dieses Geschrei konnte nicht von normalen, vernünftigen Menschen kommen. Hastig schlug ich die Tür zu und tappte in mein Bett zurück. Das Bett erschien mir in diesem Augenblick als der einzig sichere Zufluchtsort in einer unbegreiflich gewordenen Welt. Von der Straße herauf gellte ein Schrei, er klang wild, verzweifelt und erschreckend. Dreimal zerriss er die Stille. Und ich glaubte ihn noch zu hören, als er längst verhallt war.
Das Grauen überwältigte mich. Ich fühlte, wie mir unter dem Verband der Schweiß auf die Stirn trat. Ich wusste nun, etwas Furchtbares war im Gange, etwas Entsetzliches. Ich konnte meine Verlassenheit und Hilflosigkeit nicht länger ertragen. Ich musste Klarheit haben über das, was um mich herum vorging. Ich tastete nach den Bandagen und hatte die Finger schon an den Sicherheitsklammern, als ich innehielt …
Und wenn nun die Behandlung erfolglos geblieben war? Wenn sich, nachdem der Verband entfernt war, herausstellte, dass ich noch immer nicht sehen konnte? Das wäre noch schlimmer, tausendmal schlimmer …
Mir fehlte der Mut, womöglich herauszufinden, dass sie meine Sehkraft nicht hatten retten können. Und wenn doch – könnte ich meine Augen schon gefahrlos dem Licht aussetzen?
Ich ließ die Hände sinken und legte mich zurück. Ich war wütend über mich selbst und über das Krankenhaus und fluchte hilflos vor mich hin.
Erst nach einer Weile war ich wieder fähig, vernünftig zu denken; aufs Neue grübelte ich über eine mögliche Erklärung. Ich fand keine. Doch mehr und mehr festigte sich in mir die Überzeugung, dass Mittwoch war, was immer sonst geschehen sein mochte. Denn der Vortag war ungewöhnlich gewesen. Und dass seither nur eine einzige Nacht vergangen war, das konnte ich beschwören.
Radioberichten zufolge hatte am Dienstag, den 7. Mai, eine Meteoritenwolke, der Überrest eines Kometen, die Erdbahn gekreuzt. Möglich. Millionen glaubten es jedenfalls. Ich kann es weder bezeugen, noch das Gegenteil beweisen. Ich war nicht in der Lage zu sehen, was geschah; aber ich machte mir meine eigenen Gedanken. Mein Anteil an dem Ereignis beschränkte sich aufs Zuhören; ich hatte im Bett gelegen und mir den ganzen Abend die Augenzeugenberichte über ein Himmelsphänomen anhören müssen, das als das ungewöhnlichste seit Menschengedenken bezeichnet wurde.
Seltsam war, dass vorher noch niemand ein Sterbenswort über den angeblichen Kometen oder Kometenrest gehört hatte.
Warum die Radioübertragung stattfand, weiß ich nicht; ohnedies war jeder, der gehen, humpeln oder getragen werden konnte, draußen oder an den Fenstern, um das großartigste Gratisfeuerwerk aller Zeiten zu bewundern. Auf mich wirkte die Sendung deprimierend, ich fühlte mit grausamer Klarheit, was es hieß, nicht sehen zu können. War die Behandlung erfolglos geblieben, dann schien es mir fast besser, ein Ende zu machen, als so weiterzuleben.
Schon tagsüber war gemeldet worden, dass man in der vorangegangenen Nacht rätselhafte grüne Blitze und Lichterscheinungen über Kalifornien beobachtet hatte.
Dann kamen aus dem ganzen pazifischen Raum Berichte über einen grünen Lichtregen, der die Nacht erhellt hatte, ungeheure Meteoritenschwärme waren gefallen, manchmal, so hieß es, in einer solchen Anzahl, dass es schien, als stürze der Himmel herab; und er stürzte ja auch wirklich herab, wie sich später herausstellte.
Als die Nacht westwärts rückte, hielt das Funkeln am Himmel unvermindert an. Schon vor dem Einbruch der Dunkelheit wurden vereinzelt grüne Lichtblitze sichtbar. In den Sechs-Uhr-Nachrichten kündigte der Radiosprecher ein herrliches Schauspiel an, das man keinesfalls versäumen sollte. Er erwähnte auch, dass das Himmelsphänomen den Kurzwellenempfang störe, aber der Langwellensender mit der laufenden Berichterstattung davon unbeeinträchtigt sei, ebenso wie der Fernsehempfang. Es hätte dieser Aufforderung gar nicht bedurft. Im Krankenhaus waren alle so aufgeregt, dass sich wohl niemand dieses Schauspiel hatte entgehen lassen – außer mir.
Als sei es mit den Radioübertragungen nicht genug, musste ich, als die Schwester mit dem Abendessen kam, auch ihren Augenzeugenbericht über mich ergehen lassen.
»Der Himmel ist voller Sternschnuppen«, sagte sie. »Alle hellgrün, ein förmlicher Regen. Die Leute haben dabei ganz fahle Gesichter. Alles ist auf den Beinen. Manchmal ist es taghell, nur die Farben sind anders. Und manchmal ist das Licht so grell, dass es einem in den Augen wehtut. Aber der Anblick ist wunderbar. Etwas noch nie Dagewesenes, heißt es. Schade, dass Sie es nicht sehen können.«
»Schade«, antwortete ich etwas kurz.
»Wir haben die Vorhänge zurückgezogen, damit alle hinaussehen können«, fuhr sie fort. »Sie hätten einen wunderbaren Ausblick von hier aus, ohne Ihren Verband.«
»Aha«, sagte ich.
»Aber draußen muss es noch viel schöner sein. In den Parks und auf den Grünanlagen sollen Tausende zusammengeströmt sein, um den Himmel zu beobachten. Und auf jedem Flachdach stehen Leute und schauen nach oben.«
»Was glauben Sie, wie lange das noch weitergeht?«, fragte ich geduldig.
»Ich weiß es nicht, aber es soll schon nicht mehr so hell sein, wie es anderswo war. Doch selbst wenn Ihr Verband schon heute abgenommen worden wäre, hätten wir Ihnen nicht erlauben können zuzuschauen. Sie müssen Ihre Augen anfangs noch schonen, und manche Blitze sind sehr grell. Sie – oh!«
»Was ›oh‹?«, fragte ich.
»Das war so hell – das ganze Zimmer war in grünes Licht getaucht. Wie schade, dass Sie das nicht sehen konnten.«
»Sie sagen es«, stimmte ich zu. »Jetzt seien Sie so gut und lassen mich allein.«
Ich versuchte Radio zu hören, aber auch da gab’s die gleichen »Ahs« und »Ohs«, umrahmt von blödem Gequatsche über das »wundervolle Schauspiel« und das »einzigartige Phänomen«, bis ich schließlich das Gefühl hatte, die ganze Welt feiere eine Party, und ich sei als Einziger nicht dazu eingeladen.
Ich hatte nicht die Wahl, auf einen anderen Sender umzuschalten, denn das Krankenhaus bot nur ein Radioprogramm an, nach dem Motto Friss, Vogel, oder stirb. Etwas später kam die Durchsage, dass die Erscheinung im Abflauen sei. Der Sprecher empfahl Eile, denn wer dieses Schauspiel versäumt habe, würde es sein Leben lang bedauern.
Es war, als sollte mir die Überzeugung eingehämmert werden, dass ich um das Hauptereignis meines Lebens gekommen sei. Schließlich reichte es mir, und ich schaltete ab. Das Letzte, was ich hörte, war, dass das Phänomen nun schnell dahinschwand und wir uns binnen weniger Stunden wahrscheinlich außerhalb seiner Laufbahn befinden würden.
Das alles war unzweifelhaft am Abend zuvor geschehen – denn wäre es länger hergewesen, hätte ich zum Beispiel noch viel hungriger sein müssen, als ich es ohnehin war.
Was aber war dann passiert? Hatten sich das Krankenhauspersonal und die ganze Stadt von der nächtlichen Aufregung noch nicht erholt, lagen alle noch in den Federn?
Da wurden meine Überlegungen unterbrochen, denn das Konzert der Uhren aus nah und fern setzte ein.
Ich läutete wieder. Und wartete. Vom Flur her kam ein unbestimmtes Geräusch, es hörte sich an wie ein Wimmern, Schlurfen und Tappen, hie und da übertönt von fernen Rufen.
Aber niemand kam.
Ich wurde rückfällig. Die Schrecken und Albtraumgestalten der Kindheit waren wieder um mich.
Nein, ich bin kein Hasenfuß und Geisterseher, wirklich nicht … Die verdammten Binden um die Augen und die Schreie im Flur waren schuld, dass meine Nerven versagten. Das Grauen hatte mich gepackt – und wenn es dich erst einmal gepackt hat, wird es immer mächtiger. Schon jetzt war ich über das Stadium hinaus, wo sich die Gespenster noch durch Pfeifen oder Singen vertreiben ließen.
Zuletzt lief es auf die Frage hinaus: Was fürchtete ich mehr, die Gefährdung meines Augenlichts durch die vorzeitige Abnahme des Verbands oder die Finsternis und die wachsende Angst?
Ich weiß nicht, welche Entscheidung ich ein, zwei Tage früher getroffen hätte – wahrscheinlich letztlich die gleiche –, an diesem Morgen durfte ich mir wenigstens sagen: »Verflucht noch mal, viel Schaden kann ich doch nicht anrichten, wenn ich meinen Verstand gebrauche. Der Verband sollte ja heute herunter. Ich will es riskieren.«
Ich halte mir zugute, dass ich noch Verstand genug besaß, den Wundverband nicht einfach wild herunterzureißen. Ich hatte genügend Selbstkontrolle, um den Vorhang zuzuziehen, bevor ich die Sicherheitsklammern löste.
Sobald ich die Binden abgewickelt hatte und merkte, dass ich im Dämmerlicht sehen konnte, fühlte ich eine Erleichterung wie nie zuvor in meinem Leben. Doch nachdem ich mich vergewissert hatte, dass wirklich kein finsteres Wesen unter dem Bett oder anderswo lauerte, klemmte ich als Erstes einen Stuhl mit der Rückenlehne unter den Türgriff. Allmählich gewann ich meine Fassung zurück. Eine ganze Stunde ließ ich mir Zeit, um mich an das Tageslicht zu gewöhnen. Dann stellte ich fest, dass ich so gut sah wie früher; schnelle Erste Hilfe und die Kunst der Ärzte hatten mir das Augenlicht gerettet.
Aber noch immer kam niemand.
Im unteren Fach des Nachtkästchens fand ich vorsorglich eine dunkle Brille bereitgelegt. Vorsichtshalber setzte ich sie auf, ehe ich ans Fenster trat. Ich gewahrte ein, zwei Passanten, die auf eine wunderliche, ziellose Art dahinzuwandern schienen. Was mir aber sogleich weit mehr auffiel, war die klare Sicht, die Schärfe der Umrisse auch des fernen Dächerpanoramas. Und dann entdeckte ich, dass nirgends Rauch aufstieg, kein Schornstein qualmte weit und breit …
Meine Kleider fand ich fein säuberlich in den Schrank gehängt, und als ich mich angezogen hatte, fühlte ich mich sofort dem Normalzustand näher. Ein paar Zigaretten waren noch im Etui. Ich zündete mir eine an. Langsam wurde ich ruhiger und verstand schon gar nicht mehr, warum ich eben noch so von Panik erfüllt gewesen war.
Es ist heute nicht leicht, sich in jene Tage zurückzuversetzen. Wir müssen uns jetzt vor allem auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Aber damals gab es so viel Routine, alles war so miteinander verknüpft. Jeder von uns trug an seinem Platz seinen kleinen Anteil zu dem großen Ganzen bei, und man konnte leicht Gewohnheiten und Gebräuche mit Naturgesetzen verwechseln – umso verwirrender war es deshalb, als plötzlich all diese Routine zusammengebrochen war.
Wer sein ganzes Leben in einer bestimmten Ordnung zugebracht hat, stellt sich nicht in fünf Minuten völlig um. Wenn ich auf unser damaliges Leben zurückblicke, finde ich es nicht nur erstaunlich, sondern regelrecht erschütternd, was wir alles über unser Alltagsleben nicht wussten und worum wir uns nicht kümmerten. Ich wusste zum Beispiel so gut wie nichts darüber, wie ich zu meiner Nahrung kam, woher das Wasser aus der Leitung stammte, wie die Stoffe meiner Kleidung hergestellt und genäht wurden, welche Bedeutung das Abwassersystem der Städte für die Gesundheitsvorsorge hatte. Unser Leben war bestimmt durch ein Netz von Spezialisten, die alle ihre jeweilige Arbeit mehr oder weniger effizient ausführten und dies auch von anderen erwarteten. Deshalb war es für mich so unvorstellbar, dass der Betrieb des Krankenhauses vollständig zusammengebrochen sein sollte. Irgendwo würde irgendwer schon die Zügel in der Hand halten – nur hatte dieser Jemand leider das Zimmer 48 völlig vergessen.
Als ich die Tür öffnete und in den Flur hinausspähte, musste ich jedoch feststellen, dass, was immer auch geschehen war, keineswegs nur den Patienten des Einzelzimmers Nummer 48 betraf.
Es war in dem Moment niemand zu sehen, obwohl ich aus der Ferne ein durchdringendes Stimmengemurmel hörte. Auch das Geräusch schlurfender Schritte drang zu mir her, und gelegentlich hallte eine lautere Stimme durch die Flure, doch das war nichts im Vergleich zu dem Lärm, vor dem ich vorhin meine Tür zugeknallt hatte. Diesmal rief ich nicht. Ich schritt vorsichtig hinaus – warum vorsichtig? Ich weiß es nicht. Irgendetwas veranlasste mich dazu.
Es war schwierig, in dem hallenden Gebäude zu erraten, woher die Laute kamen. Auf der einen Seite endete der Flur vor einer verdunkelten Glastür, hinter der sich der Schatten eines Balkongeländers abzeichnete; ich schlug daher die entgegengesetzte Richtung ein.
Als ich um eine Ecke gebogen war, hatte ich den Seitentrakt mit den Einzelzimmern verlassen und befand mich in einem breiten Gang.
Auch hier schien es auf den ersten Blick leer, dann aber gewahrte ich eine Gestalt, die sich aus dem Schatten hervorbewegte. Es war ein Mann in dunkler Straßenkleidung, nach dem weißen Mantel zu schließen, den er darübertrug, einer der Krankenhausärzte – seltsam war nur die Art, wie er tappend an der Wand entlangschlich.
»Herr Doktor«, sprach ich ihn an.
Er zuckte zusammen. Sein Gesicht war grau und angstvoll, als er sich mir zuwandte. »Wer sind Sie?«, fragte er unsicher.
»Mein Name ist Masen«, antwortete ich. »William Masen. Ich bin Patient auf Zimmer 48. Ich möchte mich nur erkundigen, warum …«
»Sie können sehen?«, unterbrach er mich rasch.
»Sicher. So gut wie früher«, erklärte ich. »Alles ist wunderbar geheilt. Da niemand gekommen ist, mir den Verband abzunehmen, habe ich es selbst getan. Schaden, glaube ich, habe ich dabei nicht angerichtet. Ich habe …«
Wieder unterbrach er mich. »Bitte, führen Sie mich zu meinem Zimmer. Ich muss sofort telefonieren.«
Ich begriff nicht gleich, es war alles so verwirrend gewesen, seit ich an jenem Morgen aufgewacht war.
»Wo ist Ihr Zimmer?«, fragte ich.
»Fünfter Stock, Westtrakt. Mein Name steht an der Tür – Doktor Soames.«
»Gut«, sagte ich überrascht. »Wo sind wir jetzt?«
Verärgert und angespannt schüttelte er den Kopf.
»Wie, zum Teufel, soll ich das wissen?«, sagte er bitter. »Sie haben Augen. Machen Sie sie auf, verdammt noch mal. Sehen Sie denn nicht, dass ich blind bin?«
Es war ihm nicht anzusehen. Er schien mich mit weit offenen Augen anzublicken.
»Warten Sie hier eine Minute«, sagte ich. Ich schaute mich um. Gegenüber dem Lift war eine große 5 an die Wand gemalt. Ich ging zurück und sagte ihm das.
»Gut. Fassen Sie meinen Arm«, wies er mich an. »Sie wenden sich, von der Lifttür kommend, nach rechts und biegen dann in den ersten Gang nach links ab. Meine Tür ist die dritte.«
Ich befolgte seine Anweisungen. Unterwegs begegneten wir niemandem. Im Zimmer führte ich ihn zum Schreibtisch und übergab ihm den Apparat. Er horchte eine Weile. Dann tastete er nach der Hörergabel und rüttelte ungeduldig daran. Langsam wich der gereizte und gequälte Ausdruck aus seinem Gesicht. Er sah nur noch müde aus – sehr müde. Er legte den Hörer auf den Tisch. Ein paar Augenblicke stand er reglos und schien vor sich die Wand anzustarren. Dann wandte er den Kopf.
»Es ist zwecklos – die Leitung ist tot. Sind Sie noch da?«, fügte er hinzu.
»Ja«, antwortete ich.
Seine Finger tasteten die Schreibtischkante entlang.
»In welcher Richtung stehe ich jetzt? Wo ist das verdammte Fenster?«, fragte er mit erneut aufflackernder Gereiztheit.
»Sie brauchen sich nur umzudrehen«, sagte ich.
Er tat es und ging mit vorgehaltenen Händen darauf zu und befühlte sorgfältig Brett und Rahmen. Dann trat er einen Schritt zurück. Ehe ich erkannte, was er vorhatte, war er mit voller Wucht nach vorn gesprungen und hinausgestürzt …
Ich sah nicht hinunter. Es war der fünfte Stock.
Als ich wieder imstande war, mich zu bewegen, konnte ich mich nur in den Sessel fallen lassen. Auf dem Schreibtisch lag eine Schachtel Zigaretten, ich zündete mit flatternden Händen eine an. So blieb ich ein paar Minuten sitzen, um den Schock etwas verebben zu lassen. Dann verließ ich das Zimmer und ging zu der Stelle zurück, wo ich ihm begegnet war. Ich fühlte mich noch ganz schwach und elend, als ich hinkam.
Am Ende dieses breiten Ganges war eine Tür mit einem Oval aus Fensterglas in Augenhöhe. Ich rechnete damit, dort jemanden anzutreffen, den ich vom Schicksal des Doktors unterrichten könnte.
Ich öffnete die Tür. Es war ziemlich dunkel in dem Raum. Offensichtlich hatte man die Vorhänge nach dem nächtlichen Schauspiel zugezogen – und sie waren noch immer geschlossen.
ENDE DER LESEPROBE