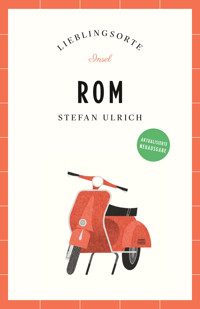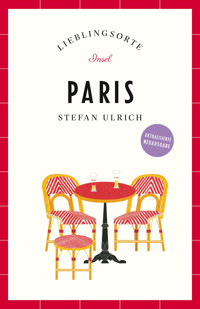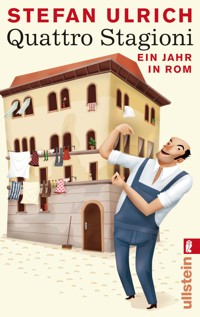13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stefan Ulrich sitzt im August allein im brütendheißen Rom, seine Familie ist bei den Großeltern in Bayern. Damit ihn nicht der Blues erwischt, macht er Pläne für das kommende Jahr: Ganz Italien möchte er bereisen, jede Region besuchen von Südtirol bis Sizilien. Und auch Molise, den etwas vergessenen Landstrich ganz im Süden des Stiefels. Was er auf seinen Reisen alles erlebt, schildert er gewohnt augenzwinkernd und voller Liebe zu Bella Italia. Und natürlich kommen auch der Hausmeister Filippo, die Kinder Bernadette und Nicolas, die Meerschweinchen der Familie und der wunderbare Palazzo in Rom nicht zu kurz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Stefan Ulrich sitzt im August allein im brütendheißen Rom, seine Familie ist bei den Großeltern in Bayern. Damit ihn nicht der Blues erwischt, macht er Pläne für das kommende Jahr: Ganz Italien möchte er bereisen, jede Region besuchen von Südtirol bis Sizilien. Und auch Molise, den etwas vergessenen Landstrich im Süden der Abruzzen. Was er auf seinen Reisen alles erlebt, schildert er gewohnt augenzwinkernd und voller Liebe zu Bella Italia. Und natürlich kommen auch der Hausmeister Filippo, die Kinder Bernadette und Nicolas, die Meerschweinchen der Familie und der wunderbare Palazzo in Rom nicht zu kurz.
Der Autor
Stefan Ulrich wurde 1963 in Starnberg geboren. Nach seinem Jurastudium arbeitete er als Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München. Im August 2005 zog er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Rom um. Von dort berichtete er als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung über Rom, Italien und den Vatikan. Seit Sommer 2009 lebt Stefan Ulrich mit seiner Familie in Paris.
Von Stefan Ulrich ist in unserem Hause bereits erschienen:
Quattro Stagioni – Ein Jahr in Rom
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage März 2010
6. Auflage 2011
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010
Umschlaggestaltung und Gestaltung des
Vor- und Nachsatzes: Sabine Wimmer, Berlin
Titelillustration: © Isabel Klett
Satz: LVD GmbH, Berlin
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
eBook ISBN 978-3-548-92005-4
Für Annette, Franziska und Julius
Eins
Seit Stunden treibt der scirocco die Wellen gegen die Küsten Roms. Der Wüstenwind wirbelt den sandigen Untergrund auf, das Meer sieht aus wie ein frisch gepflügter Acker. Beim Hinausschwimmen klatschen mir die sandbraunen Wogen ins Gesicht, und das badewannenwarme Salzwasser dringt mir in Mund und Nase. Ich reibe meine Schwimmbrille aus. Doch das Meer ist zu trüb, um sehen zu können. Wahrscheinlich werde ich gleich mit einer der handgranatengroßen Quallen kollidieren, die immer wieder an den Strand treiben, um dort von kleinen Jungs mit Stöckchen durchlöchert zu werden und dann in der Sonne zu verdampfen. Ab und an streift etwas Weiches, Unförmiges meine Backen oder meine Brust. Ich zucke zusammen, meine, den Schmerz zu spüren, den die milchig weißen, gallertartigen Tiere mit ihren nesselnden Tentakeln bereiten. Aber es sind nur losgerissene Wasserpflanzen, die mich da berühren. Richtig vergnüglich ist das Schwimmen trotzdem nicht. Doch Sport muss sein, wenigstens einmal in der Woche.
Nach einer Stunde habe ich genug. Ich torkele an den Strand und lasse mich in den vulkanschwarzen Sand des Badeörtchens Marina di San Nicola sinken. Die Sonne sticht auf mich ein, obwohl sie nur noch zwei, drei Handbreit über dem Horizont schwebt. Kaum aus dem Meer, schwitze ich schon wieder. Außerdem spüre ich einen Sonnenbrand im Gesicht. Antonia, meine Frau, behauptet immer, ich sei eher der hellhäutige Typ und müsse mich besonders gut einschmieren. Ich selber fühle mich dagegen als Südländer, jedenfalls im Geiste, und verschmähe die Schutzcremes. Auch mein Rücken fängt nun an zu brennen. Womöglich hat ja doch Antonia recht. Ich blicke mich um. Vielleicht kann mir jemand mit ein ganz klein wenig leichter Sonnenmilch aushelfen – von Südländer zu Südländer sozusagen? Aber die wenigen anderen Badegäste haben sich schon verzogen. Was will ich eigentlich noch hier?
August in Rom. Wer es sich irgendwie leisten kann, der ist jetzt nicht in der Kapitale und schon gar nicht an den mäßig schönen Stränden vor der Stadt. Die wahren Römer tummeln sich nun im kristallklaren Meer vor Apulien, Sizilien oder, am liebsten, Sardinien. Leider habe ich meinen Jahresurlaub – natürlich auf Sardinien! – schon hinter mir. Jetzt muss ich mitten im August in der Stadt ausharren und mithelfen, die sommerleeren Seiten jener süddeutschen Zeitung zu füllen, die mich vor drei Jahren als Italien-Korrespondent hierher geschickt hat.
Mein Handy klingelt. Unwillig ziehe ich es aus der Badetasche. Ich schaue auf das Display, um zu überprüfen, wer stört, doch ich sehe nur zwei dampfende Cappuccino-Tassen. Meine Tochter Bernadette hat also wieder einmal den Hintergrund des Displays verstellt. Zugegeben, das sieht hübsch aus mit den Tassen, nur lassen sich so die Nummern der Anrufer nicht mehr erkennen. Außerdem weiß ich nicht, wie man die Dinger wieder verschwinden lässt.
»Pronto«, melde ich mich.
»Hallo, Liebling«, antwortet eine Frauenstimme. »Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich versuche seit einer geschlagenen Stunde, dich zu erreichen.«
»Ich war im Meer, Sport treiben«, sage ich müde.
»Du warst schwimmen! Wie schön für dich! Mein Gott, hast du’s gut«, seufzt die Frauenstimme. »Bei uns regnet es mal wieder in Strömen. Und es ist saukalt.«
Die Stimme gehört zu Antonia. Sie verbringt den August mit unseren beiden Kindern Bernadette und Nicolas bei unseren Verwandten in Ottobrunn und Tutzing bei München. Wie jedes Jahr, seit wir in Rom sind. Warum sollten die drei auch den Hochsommer in unserer brütend heißen Altbauwohnung im Stadtteil Prati zwischen dem Vatikan und dem Tiber ausharren und mir dabei zusehen, wie ich am Schreibtisch Artikel verfasse? Da schwimmen sie lieber im Starnberger See oder radeln mit Eltern und Schwiegereltern oder vielmehr Großeltern von Biergarten zu Biergarten.
So weit die Theorie. In der Praxis regnet es dann leider oft in Bayern. Antonia erwähnt bei jedem unserer täglichen Telefonate, wie gut ich es doch in Rom hätte und dass es albern sei, wenn ich mich über die Hitze beklagte. Ich erwidere dann: »Du weißt ja gar nicht, was du redest. Jedenfalls wäre ich heilfroh, auch nur einen einzigen Tag bei Weißbier, Nieselregen und 12,5 Grad verbringen zu dürfen.«
Diesmal verkneife ich mir den üblichen Dialog. »Ja, ich hab’s gut«, seufze ich und streiche vorsichtig über meine knallroten Schultern.
Antonia kann offensichtlich hellsehen. »Hast du dich auch gut eingeschmiert? Mit der 50er-Creme?«, fragt sie inquisitorisch. »Du weißt doch, was für ein hellhäutiger Typ du bist.«
»Ja, ja, ich habe mich eingecremt«, lüge ich ohne Schuldgefühle. Schließlich ertrage ich auch mannhaft, ohne zu klagen, den Schaden.
»Das glaube ich dir nicht«, sagt Antonia. »Aber du bist selber schuld, wenn du in ein paar Jahren aussiehst wie ein alter Komodowaran.«
»Was? Papa hat einen Waran gefangen?«, höre ich Nicolas im Hintergrund rufen. Er ist acht Jahre alt und gerade, ganz buchstäblich, tierisch drauf.
Antonia lacht. »Ich gebe ihn dir mal«, sagt sie.
»Hallo, Papa«, sagt Nicolas. »Wo hast du denn den Waran gefangen?«
»Nirgends. Ich sehe nur bald aus wie ein Waran.«
»Weil du dich nie eincremst«, meint Nicolas. »Dummer Papa! Übrigens, weißt du was?«
»Ja?«
»Darf ich dir mal was sagen?«
»Ja, klar.«
»Wenn ich groß bin, will ich Förster werden. Im Bayerischen Wald und in Rom. Dann fang ich dir einen Waran. Tschüs, Papa.«
Nicolas gibt unvermittelt den Hörer an seine Schwester Bernadette weiter. »Papa, geht’s dir gut in Rom? Und kümmerst du dich auch anständig um meine Meeris?« Ihre vier Meerschweinchen, die auf unserem Balkon in Rom leben, sind Bernadettes ganz große Lieblinge.
»Aber sicher, mein Schatz! Sie bekommen jetzt bei der Hitze jeden Morgen eine Extraportion frisches Gemüse.«
»Da bin ich froh, Papa. Aber nimm sie auch immer wieder mal aus dem Käfig und spiel mit ihnen. Wenn ich nicht da bin, brauchen sie ganz viel Trost. So, jetzt muss ich aufhören, es gibt Abendessen bei der Oma. Tschüs!«
Ich streife mir Shorts und ein T-Shirt über und gehe zu einer Bar am Anfang des Strandes. Die Terrasse über dem Meer ist leer. Die junge Frau im kurzen Rock und Bikini-Oberteil will gerade schließen.
»Avrebbe ancora una birra per me, per piacere?« – »Könnte ich bitte noch ein Bier haben?«, frage ich höflich in meinem akzentfreien Italienisch.
Die junge Frau zieht die Brauen nach oben. »È tedesco?« – »Sie sind Deutscher?« Woher sie das weiß? Wegen meiner Größe und meiner blauen Augen? Oder doch eher wegen meines nordmännischen Sonnenbrandes?
»Si«, gebe ich widerstrebend zu. Schließlich plagt auch mich immer noch der typisch deutsche Tick, im Ausland partout nicht als Deutscher enttarnt werden zu wollen.
»È bavarese« – »Sie sind aus Bayern«, stellt die Frau nun kategorisch fest.
Wie sie denn das herausgefunden habe, will ich nun wissen. »Weil Sie genauso Italienisch sprechen wie il Santo Padre.«
Nun kann ich mir zugutehalten, dass Papst Benedikt XVI. ein exzellentes Italienisch spricht, jedenfalls grammatikalisch. Seinen weichen süddeutschen Akzent finden die Römer allerdings drollig. Besonders gefällt es ihnen, wenn er »gioia« sagt, was »Freude« bedeutet. Er spricht »gioia« so weich aus, dass man meint, einen Germknödel durch die Luft rollen zu sehen. Der Heilige Vater mag bekanntlich österreichische Süßspeisen.
Neulich war ich bei einem befreundeten italienischen Journalisten zum Abendessen eingeladen, bei dem auch ein Vize-Direktor des Staatsfernsehens Rai dabei war. Wir diskutierten über Politik und über den Vatikan. Auf einmal sah mich der Rai-Journalist nachdenklich an und fragte höflich: »Gibt es in deutschen Schulen und Sprachschulen eigentlich keinen Phonetikunterricht?«
»Wieso? Wie meinen Sie das?«, antwortete ich verwundert.
»Also, ich meine: Lernt man dort keine Aussprache? Nehmen Sie zum Beispiel mal den Papst. Er spricht eigentlich gut Italienisch. Aber einige Ausdrücke klingen bei ihm so seltsam.«
»Welche zum Beispiel?«
»Na ja«, der Vize-Direktor unterdrückte ein Grinsen, »der Papst möchte in seinen Ansprachen oft vom ›bene comune‹ reden – vom ›Gemeinwohl‹. Er spricht es aber immer wie ›pene comune‹ aus. Das bedeutet etwas ganz anderes, wenn Sie verstehen, was ich meine, und das klingt für uns Italiener seltsam, sehr seltsam! Dass ihm das keiner sagt!«
Was soll ich also davon halten, wenn die Barfrau meine Italienischkünste mit denen Benedikts vergleicht? Und muss ich auf mein Bier verzichten, nur weil ich das »r« in »birra« nicht richtig rollen kann?
Muss ich natürlich nicht. Die Frau zapft mir ein Glas, das in der Hitze sofort beschlägt. Ich setze mich auf die Terrasse, beobachte, wie die glutrote Sonnenscheibe das Meer küsst und dann darin versinkt. Dabei nehme ich einen kräftigen Schluck von dem eiskalten Bier und ertappe mich bei dem Gedanken: »Eigentlich hab ich es ganz gut.«
Müde, aber zufrieden laufe ich den abendlichen Strand entlang und dann zwischen den Dünen hindurch zum Parkplatz. Da Antonia und die Kinder unser Auto mit nach Deutschland genommen haben, habe ich mir zu einem Ferienpreis im Internet bei einer großen internationalen Autovermietung ein Fahrzeug gemietet. Damit, so mein Plan, könnte ich am Abend, nach der Arbeit, aus der Stadt herausfahren und noch ein bisschen im Meer schwimmen. Eigentlich wollte ich nur irgendeinen kleinen Fiat. Doch als ich eines Abends im Büro der Autovermietung vorbeikam, übergaben mir die größtmögliche Inkompetenz verstrahlenden, aber dekorativen Mitarbeiterinnen einen schicken nachtblauen Alfa Romeo.
»Wir haben keinen kleinen Fiat mehr, und da dachten wir, das ist doch eine schöne Überraschung für Sie«, säuselte eine der signorine.
Ich freute mich über mein Glück, sah meinen Glauben ans Gute im Autovermieter bestätigt und verblüffte zunächst einmal unseren Hausmeister Filippo, der im Hochsommer, wenn alle anderen Mieter verreist sind, der ungekrönte Kaiser unseres Palazzo, vulgo Mehrfamilienhauses, im bürgerlichen bis feinen Stadtteil Prati ist.
»Dottor Uuulrik, Sie haben ja ein neues Auto«, rief Filippo, als wir uns in der Tiefgarage des Palazzo trafen. »Und was für eines! Einen Alfa Romeo, noch dazu ein neues Modell! Um das reißen sich derzeit alle in Rom!«
Nun weiß ich, dass es Filippo schon seit langem wunderlich findet, warum der signor Uuulrik gewöhnlich einen alten, schäbigen Volkswagen fährt, obwohl er doch meint, sich eine Wohnung in diesem ehrbaren Palazzo leisten zu können. Nicht, dass die Römer etwas gegen Volkswägen hätten, im Gegenteil. Deutsche Autos gelten – wie deutsche Gesundheitsschuhe – als schick. Ein New Beatle, oder zumindest ein Smart, sollte es aber schon sein. Und ein neuer, sportlicher Alfa Romeo, den ein Deutscher fährt, ist natürlich noch besser. Schließlich demonstriert er so die Anerkennung des transalpinen Barbaren für italienische Eleganz, italienische Rasanz und italienische Wertarbeit – und zwar genau in dieser Reihenfolge.
So wunderte es mich nicht, als Filippo nun mehrmals »Complimenti!« schrie, mir auf die Schulter klopfte und drei Mal mit der Zunge schnalzte – sein Zeichen höchster Anerkennung.
Leider musste ich unseren Hausmeister aufklären, dass ich weiterhin den alten Volkswagen besaß und es sich bei dem Alfa Romeo lediglich um einen Mietwagen handelte, für den ich wunderbarerweise nur den Preis eines Fiat Punto bezahlte.
In diesem Moment stieß Filippo einen Schreckensschrei aus und deutete auf den rechten Kotflügel und die Beifahrerseite. »Was ist denn da passiert?«, rief er vorwurfsvoll, als hätte ich gerade einen Ferrari Testarossa geschrottet.
Tatsächlich. Tür und Kotflügel waren eingedrückt und verschrammt, dabei war das Auto in meinem Übernahmeprotokoll als »schadensfrei« bezeichnet. Offensichtlich hatten mir die säuselnden signorine der internationalen Autovermietung da etwas untergejubelt. Ich hatte es nicht gemerkt, müde und froh über den günstigen Preis, wie ich war. Im Nachhinein schwante mir, dass ich mich damit noch inkompetenter verhalten hatte als die Inkompetenz verstrahlenden Damen der Mietwagenfirma. Naivität wird in Italien bestraft – nicht immer, aber immer mal wieder. Ein Niederlassungsleiter derselben Firma, mit dem ich später in Rom über den Fall sprach, meinte lakonisch: »Das sieht meinen Kolleginnen ähnlich.« Dabei bedachte er mich mit einem Blick, als wollte er sagen: »Vecchio deficiente tedesco« – »Du armer deutscher Narr.«
Dellen hin, Inkompetenz her: Als ich an diesem Abend zum Schwimmen nach Marina di San Nicola fuhr, setzte mein nachtblauer Alfa Romeo wie ein Panther über die Via Aurelia. Eigentlich halte ich mir ja einiges darauf zugute, mir nichts aus Autos zu machen. Doch der Unterschied zu unserem grauen, verbeulten Familien-Passat mit den von Kekskrümeln und Schokoladeflecken gesprenkelten Sitzen und den überall herumliegenden verschrammten Kinderkassetten wurde mir schon angenehm bewusst. Irgendwie schienen mich die anderen Fahrer im Feierabendverkehr auf einmal mit Respekt zu behandeln – Luxus erregt in Italien, anders als in Deutschland, nicht Neid, sondern Achtung. Während der Durchschnitts-Deutsche das Bedürfnis hat, »die da oben« zu sich herunterzuziehen, versucht der Durchschnitts-Italiener, darin dem Durchschnitts-Amerikaner ähnlich, zu »denen da oben« hinaufzuklettern.
Ich weiß: Das sind jetzt ganz üble Klischees, die einem Journalisten, der differenzieren sollte, schon gar nicht anstehen – doch angesichts der Hitze plädiere ich auf mildernde Umstände.
In solchen Gedanken treibend, erreiche ich meinen mitternachtsblauen Alfa Romeo, erfreue mich an seinem Anblick, ignoriere seine demolierte Seite, öffne den Kofferraum, werfe meine Badesachen hinein, lasse mich zufrieden auf den Fahrersitz fallen und führe den Zündschlüssel ins Schloss, um dem Raubtier Beine zu machen. Ich freue mich darauf, in einer halben Stunde zu Hause im Palazzo in Rom anzukommen und mich auf den Balkon zum Innenhof zu setzen, um die Sommernacht zu genießen.
Allein – der Panther springt nicht an. Er faucht, stöhnt und röchelt nicht einmal, sondern gibt lediglich ein dürres »Klick, Klick« von sich, als schalte sich gerade sein Herzschrittmacher ab. Ich probiere es einmal, drei Mal, zehn Mal, bin erst erstaunt, dann verärgert, dann wütend. Jetzt muss ich schon bei dieser Affenhitze – als einziger Mensch weit und breit – in Rom ausharren, jetzt zahle ich auch noch Geld für ein Mietauto, und dann das! Ich blicke mich um. Die Nacht senkt sich über die Pinien und Oleanderbüsche der Gärten mit ihren weiß getünchten Ferienvillen. Das Meer rauscht, die Zikadenmännchen spielen zum Liebestanz auf, und der Mond lugt höhnisch zwischen den dürren Wedeln einer Palme hervor, denen der Palmrüssler, ein bösartiger, kleiner Schädling, der sich im ganzen Mittelmeerraum breitmacht, den Saft geraubt hat. Dieser Palmrüssler könnte alsbald unser ganzes Bild vom Süden, vom Mediterranen zerstören, aber daran kann ich momentan auch nichts ändern.
Ich muss erst mal meinen Ärger herunterwürgen und die Bedienungsanleitung des Alfa Romeo unter dem Steuerrad hervorkramen. Unter einer funzeliggelben Laterne fange ich an zu lesen. Das Handbuch ist in einem Italienisch verfasst, das meine Sprachkenntnisse auf eine harte Probe stellt. Natürlich hätte ich es auch auf Deutsch nicht verstanden. Immerhin entnehme ich den Ausführungen, dass die Zündung mit einer Wegfahrsperre versehen ist, die nur mit dem entsprechenden Schlüssel deaktiviert werden kann. Dieser Zündschlüssel dürfe keinesfalls nass werden, sonst sei das Auto nicht mehr zu starten. Woher soll ein Mensch, der einen Passat aus dem vergangenen Jahrtausend fährt, so etwas wissen! Mir schwant: Womöglich war es ein Fehler, den Zündschlüssel in einer Tasche meiner Badeshorts eine Stunde lang beim Schwimmen im Meer mitzuwässern? Ich fand das sehr clever, weil mir so keiner den Schlüssel am Strand entwenden konnte. Warum hat mich auch keiner aufgeklärt! »Typisch Italien«, knottere ich vor mich hin. »In den USA müssen Verbraucher sogar darüber informiert werden, dass Mikrowellen nicht zum Trocknen nasser Katzen geeignet sind!«
So denke ich mich ein wenig in Rage und rufe dann ehrlich erbost mit meinem Mobiltelefon die Service-Nummer an, die auf dem Anhänger des Zündschlüssels steht. »Pannen-Weltservice Italien« steht darauf. Sieben Mal ertönt das Freizeichen, dann sagt eine Automatenstimme: »Unsere Service-Plätze sind derzeit leider alle belegt. Bitte haben Sie etwas Geduld. Sie werden umgehend mit dem nächsten frei werdenden Mitarbeiter verbunden. Legen Sie bitte nicht auf, sonst verlieren Sie Ihre Vorrangstelle.« Dann ertönt aufmunternder Italo-Rock alla früher Adriano Celentano, der immer wieder von der Ansage unterbrochen wird. Nach 17 Minuten lege ich auf. Es ist nun stockdunkel. Ab und an kommen Herrchen vorbei, die ihre Hundchen spazieren führen. Mensch und Tier beäugen misstrauisch, was dieser nur halb bekleidete Ausländer in Badeschlappen mit den salzverfilzten Resthaaren und dem finsteren Gesichtsausdruck an diesem eleganten mitternachtsblauen Alfa Romeo zu suchen hat.
Ich bin dennoch versucht, um ein Starterkabel zu bitten. Doch das wäre sinnlos, wegen der Wegfahrsperre, so viel Technik ist mir vertraut. Also fange ich an, den Schlüssel zu zerlegen, Sand und Meerwasser herauszupusten, ihn mit einem Taschentuch liebevoll trockenzureiben, als sei es der wiedergefundene Siegelring meines Urgroßvaters, alles wieder zusammenzusetzen und es erneut zu probieren. Allein, der Panther macht nur »Klick«. Ich könnte nun versuchen, eine offene Bar zu finden, was um diese Zeit unter der Woche nicht gerade einfach ist. Und dann? Ein Taxi für sehr viel Geld nach Rom nehmen? Um am nächsten Morgen wieder per Taxi zurückzufahren, obwohl ich doch einen Grundsatzartikel über die Quallenplage an den Stränden Roms schreiben soll? Ausgeschlossen. Ich rufe wieder den Pannen-Weltservice Italien an. »Unsere Service-Plätze sind derzeit leider alle …«
Nach 19 Minuten meldet sich eine entzückende Frauenstimme: »Pannen-Weltservice Italien. Hier spricht Valeria. Was kann ich für Sie tun?«
»Ein kaltes Weißbier und eine Hängematte«, will ich antworten. Aber was heißt Weißbier auf Italienisch? Birra bianca? Birra da grano? Klingt irgendwie uncool. Also entscheide ich mich für Sachlichkeit. Ich schildere mein Problem, dass ich mit meinem mitternachtsblauen Panther mitten in der Pampa weit vor Rom festsitze, Hunger habe, todmüde bin und dringend Hilfe brauche, und zwar subito.
Die signora klingt wirklich mitfühlend. »Sie haben hier beim römischen Büro des Pannen-Weltservice Italien angerufen. Für Pannen außerhalb Roms bin ich aber leider, leider nicht zuständig. Da müssten Sie unsere Leitstelle in Mailand anrufen. Bitte wählen Sie dafür die Nummer …« Sie rasselt gefühlte 25 Zahlen herunter.
»Können Sie mich denn nicht verbinden?«, frage ich.
»Das geht derzeit nicht. Leider. Soll ich die Nummer wiederholen, damit Sie mitschreiben können?«
»Ich habe nichts zu schreiben bei mir.«
Die Stimme klingt jetzt nicht mehr so entzückend, eher etwas ungeduldig, nach jemandem, der sich endlich wieder dem Lackieren seiner Fingernägel zuwenden möchte. »Es tut mir wahnsinnig leid, aber dann kann ich Ihnen nicht helfen, vecchio deficiente.«
Sie sagt nicht wirklich »vecchio deficiente« – »alter Blödmann«, aber sie denkt es, das spüre ich. Ich sehe sie vor mir, die signora, mit ihrem gelangweilten Barbie-Lächeln an ihrem öden nächtlichen Call-Center-Schreibtisch irgendwo in einem Bürohaus in Rom. Was fällt dieser Spinatwachtel (ich denke nicht wirklich »Spinatwachtel«, aber ich könnte es denken!) eigentlich ein? Da bekommt man erst ein Schrottauto untergeschoben, und dann wird man auch noch als alter Blödmann beschimpft! Ich sage in möglichst mürrischem Ton:
»Senden Sie mir die Nummer halt als SMS aufs Handy!«
»Ich bedaure, aber dazu sind wir nicht autorisiert«, flötet signora Valeria schadenfroh.
»Warum zum Teufel haben Sie einen Pannen-Service, wenn Sie einem nicht aus der Patsche helfen können?«
»Wir verstehen Ihren Ärger, und wir sind untröstlich«, säuselt Valeria.
Sie klingt jetzt richtig höhnisch. Was habe ich ihr nur getan?
»Und?«, frage ich.
»Und was?«, fragt Valeria, als sei zwischen uns ohnehin schon alles gesagt.
Ich resigniere. »Va bene. Sprechen Sie mir die Nummer noch mal ganz langsam vor. Ich will probieren, sie mir zu merken.«
Nach mehreren Versuchen fühle ich mich so weit. Ich danke Valeria für ihre gütige Hilfe, lege auf und tippe die Nummer hastig in mein Mobiltelefon. Ein Wunder geschieht. Nach kurzem Freizeichen meldet sich eine andere signora.
»Pannen-Service Italien, hier spricht Pamela, was kann ich für Sie tun?«
Ich beschreibe erneut mein Problem und erkläre, wo ich mich genau befinde.
»Sie sind am Strand?«, fragt Pamela lauernd wie ein Kriminalkommissar vor der entscheidenden Fangfrage. »Ist da vielleicht Ihr Schlüssel nass geworden?«
»Ci mancherebbe!«, rufe ich entrüstet. »Das fehlte gerade noch. Das würde doch die Wegfahrsperre ruinieren.« Dies ist ja auch nicht gelogen.
»So ist es«, bestätigt Pamela. »Wenn der Schlüssel nicht nass wurde, könnte ein Funkmast in der Nähe die Elektronik stören. … Da ist kein Funkmast? … Tja, wie auch immer. Ich versuche, unseren Abschleppdienst zu erreichen und Ihnen ein Ersatzauto zu besorgen.«
»Wiiirklich?«, schreie ich so ungläubig, wie einen drei Jahre Erfahrung mit italienischen Service-Centern machen.
»Aber natürlich«, sagt Pamela, als sei das selbstverständlich. »Ich rufe Sie an, sobald ich etwas herausbekommen habe.«
»Versprochen?«, frage ich zaghaft.
»Versprochen, signore!«
Wirklich kompetent, diese Pamela.
Um es kurz zu machen: Bald darauf fällt mein Handy aus. Der Akku ist leer, obwohl ich das Gerät nicht einmal mit zum Schwimmen genommen habe. Nach einigen kräftigen deutschen Flüchen und weiteren merkwürdigen Blicken passierender Herrchen und Hundchen suche ich eine Bar, von der aus ich telefonieren kann. Natürlich weiß ich die Nummer von Pamela nun nicht mehr, sie ist ja auf dem Handy gespeichert. Also rufe ich wieder den Pannen-Weltservice in Rom an, lande erneut bei Valeria, notiere mir die Nummer diesmal auf einem Bierdeckel der Bar, kontaktiere noch einmal Pamela, höre mir ihre Vorwürfe an, warum ich nicht ans Handy gegangen sei, und erfahre schließlich, dass leider, leider kein Ersatzauto zur Verfügung stehe, es sei halt Nacht und Ferienzeit. Aber immerhin, »und das ist die gute Nachricht, signor Uuulrik«, habe sie einen Pannen-Service erreichen können, der meinen Alfa Romeo abschleppen werde. Ich solle einfach bei dem Wagen bleiben und ein wenig Geduld haben, spätestens in ein paar Stunden sei der Pannenwagen da.
Ich habe viel Geduld, ganz viel Geduld. Da ich früher mal autogenes Training gemacht habe, sage ich mir das nun vor und erreiche so, nicht vor Wut in den Kotflügel des Mitternachtsblauen zu treten. O nein! Ich bin ruhig, ganz ruhig und entspannt. Hungrig auch, das schon. Und kühl wird mir so barfüßig und in meinen Shorts nach dem langen Schwimmen im Meer. Die Bar hat nun allerdings geschlossen. Außerdem muss ich bei meinem waidwunden Auto warten. Doch die Nacht ist wirklich schön, ganz schön. Die salzige Luft des Meeres weht herüber, die Zikaden singen immer noch, und langsam gehen in den Villen die letzten Lichter aus. Ich werde nun tatsächlich ganz ruhig und entspannt. Tolle Sache, das autogene Training. Meine Gedanken lösen sich von dem mitternachtsblauen Alfa Romeo, vom leeren Handy, von Service-Centern, Abschleppdiensten, Valeria und Pamela.
Erinnerungen tauchen zwischen den dunklen Pinienstämmen und aus den Ligusterhecken auf wie Szenen eines Traums. Erinnerungen an den Sommer vor drei Jahren, als wir vier – Antonia, Bernadette, Nicolas und ich – nach Rom zogen. Ich denke an die Schwierigkeiten, auf die wir damals in meiner Traumstadt stießen. An den Schmutz und die Motten in der Wohnung, die Kämpfe mit der Telefonfirma, die endlosen Stunden, ja Tage in Meldebehörden und Akkreditierungsämtern, an die schweißtreibende Suche nach einem pinguino, einer mobilen Klimaanlage, an die rührende Hilfe von Filippo und Federica, unserem Hausmeisterehepaar, die amüsanten Erlebnisse mit der weit verzweigten Vermieterfamilie namens Cornetti in unserem Palazzo, an die ersten italienischen Freunde, spannende Dienstreisen von Sizilien bis in die Lombardei, den denkwürdigen Erwerb italienischer Meerschweinchen und Aquarienfische, die Begegnungen mit einem geheimnisvollen Etrusker-Forscher, eine skurrile Reise im Flugzeug des Papstes, an Urlaubsfahrten und an all die Besuche von Verwandten und Freunden aus Deutschland in unserem Palazzo in Prati.
»Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«, das ist von Hermann Hesse, und genau so ging es uns damals auch. Die heißen Augustnächte auf der Terrasse, die ungewohnten Geräusche im Haus, der allnächtliche Gecko auf dem Balkon, der fliegende Fischhändler und der wuselnde Friseursalon an der Ecke, die nächtlichen Katzen auf der Straße, das erste Tartufo-Eis auf der Piazza Navona, das Schlaraffenland des Feinkostladens Franchi in der Via Cola di Rienzo, der Blick vom Orangengarten des Aventin-Hügels über die abendliche Stadt hinweg bis hinüber zur Kuppelkrone des Petersdoms, ein duftendes cornetto in der Bar am Morgen, danach die Zeitung und ein erster Schwatz mit dem Verkäufer in seinem überquellenden Kiosk – und dann der eher faule Zauber des römischen Großstadtverkehrs, der Bürokratie, der Hitze, des Lärms, der stinkenden Müllcontainer und abgefackelten Autos auf den Straßen, der beschissenen, pardon, von Hunden verunreinigten Bürgersteige vor unserem Palazzo, der Bettler vor den Kirchen und der Bretterbehausungen im Dickicht des Tiber-Ufers, die die damals achtjährige Bernadette so verstörten.
Dann war da natürlich noch das Meer, das alles, wirklich alles aufwiegt. Immer wieder, wenn wir an unseren Lieblingsstränden vor Rom ankamen, sahen wir uns in die Augen und gestanden uns: »Haben wir’s gut.« Denn dies war kein Urlaubs-Meer mit Strand, Sonne und Salzwasser pauschal für 14 Tage, sondern ein Vor-der-Haustüre-Meer, das wir mit dem Auto in 20, 25 Minuten erreichen konnten, wann immer uns der Sinn danach stand: auf einen Cappuccino am frühen Samstagmorgen, auf einen Teller fritto misto am Sonntagmittag oder auf ein erfrischendes Abendbad nach einem heißen Arbeitstag unter der Woche. Da lag es, das Meer, blau und freundlich, unbegrenzt und vor allem immer so wunderbar verfügbar für uns Münchner Binnenländer.
In früheren Zeiten hatten wir nach jedem Sommerurlaub wehmütig Abschied nehmen müssen von dieser nassblau rauschenden Unendlichkeit. »Bis nächstes Jahr«, haben wir gemurmelt, während die Wellen unsere Füße im Sand versinken ließen. Dann drehten wir dem Meer für ein Jahr tapfer den Rücken, setzten uns ins vollgekofferte Auto und fuhren davon über Apennin und Seealpen, durch die Poebene und den Brenner hinauf nach Norden. Nun, da wir in Rom lebten, mussten wir nicht mehr Abschied nehmen vom Meer. Wir spürten seinen Atem bis in die Stadt hinein und meinten, sein Rauschen noch im Schlaf zu hören.
Und dann? Dann schlich sich, allmählich, ganz langsam, klammheimlich fast, die Routine in unser römisches Leben, wie Nebel, der aus einer Wiese steigt. Das vollzog sich irgendwann zwischen unserem zweiten und dritten Jahr in Rom. Ich rechnete nun schon damit, der alten signora Cornetti unten im Garten des Palazzo zu begegnen und ihren Erzählungen aus der Familiengeschichte zu lauschen. Ich erwartete jeden Mittwochvormittag Teodoro, den Tabakgeruch verströmenden Fischverkäufer mit seinem Weidenkorb voller Goldbrassen, Seezungen, Miesmuscheln und Krebsen, am Eingang unserer Wohnung. Wir wunderten uns nicht mehr über Sommernächte mit 28 Grad um Mitternacht, über tollkühne Vespamädchen und elegante motorini-Manager im Stadtverkehr, die Taschendiebbanden in den Bussen und das strahlende Morgenlicht auf den Barockkuppeln. Der Blick aus Bernadettes Zimmer auf die Laterne des Petersdoms wurde zur Gewohnheit. Die Kinder begannen, an den Wochenenden zu murren, sie wollten »nicht schon wieder« ans Meer. Antonia fand die langen Schlangen und die grotesken bürokratischen Prozeduren in der Bank und auf dem Postamt auch nicht mehr so originell wie am Anfang und hörte auf, darüber Tagebuch zu führen. Auch ich ertappte mich dabei, wie ich innerlich seufzte: »Nicht schon wieder«, wenn meine Zeitung zum x-ten Male einen Artikel über den flamboyanten Premierminister Silvio Berlusconi bestellte.
Ich blicke mich um, fühle, horche: nächtliche Palmen und Pinien, subtropische Gärten, Salz auf der Haut und Meeresrauschen. Wie viel bedeutet mir das alles immer noch? Zwar ärgere ich mich gerade maßlos über ein verrecktes Auto, aber im Grunde ist mir natürlich auch jetzt völlig klar, wie gut ich es eigentlich habe.
Ich schaue auf die Leuchtziffern meiner Uhr. Es geht gegen Mitternacht. Wie viele Sommer werde ich noch als Korrespondent in Rom erleben können? Noch zwei, noch drei? Und was möchte ich in dieser Zeit noch mitbekommen von Italien? Ich denke darüber nach, wie ich der Routine entkommen könnte. Wie sich der Zauber des Anfangs wiederbeleben ließe. Ich schließe die Augen und versuche mir Italien vorzustellen. Langsam zoome ich von dem kleinen Badeort bei Rom weg, um das ganze lange Land mit all seinen Kontrasten zu sehen, von den Gletschern des Adamello über die Weinhügel des Chianti und die Inseln des Golfs von Neapel bis zum Feuer speienden Ätna und zu den orientalischen Märkten Palermos. Eine ganze Welt in einem Land, 20 Regionen, von Südtirol bis Sizilien, so verschieden wie die Völker eines Kontinents. Wie wäre es, all diese Regionen in einem Jahr zu bereisen, von diesem Sommer bis zum nächsten? Und so Italien in all seinen Facetten zu erleben?
Während ich mir das so vorstelle, merke ich, wie mich wieder Neugierde packt, so wie damals, vor drei Jahren, als wir nach Rom aufbrachen, und die Lust, einfach loszufahren. Da fällt mir der Mitternachtsblaue wieder ein, der sich neben mir störrisch verweigert, nur weil ich seinen Schlüssel womöglich zu lange gebadet habe. Sei’s drum. Die Idee ist geboren. Wenn Jules Verne in 80 Tagen um die Welt reiste, kann ich in 365 Tagen kreuz und quer durch Italien fahren. In Sardinien waren wir ja gerade im Juli in den Sommerferien, das könnte man bereits als Region Nummer eins gelten lassen. Als Nächstes wäre dann …
Plötzlich schrecke ich aus meinen Plänen auf. Zwei weiße Scheinwerfer leuchten mir mitten ins Gesicht, ein massiges Fahrzeug rollt auf mich zu und stoppt erst, als ich gerade in die Hecken hechten will. Es ist das Abschleppauto. Ein kleiner, drahtiger Mann um die 60 im Arbeitsoverall springt aus dem Fahrerhaus und geht auf mich zu. »Signor Uuulrik?«, fragt er. Dann lässt er sich den Zündschlüssel geben, um doch mal lieber selber nachzuprüfen. Zum Glück macht mein Alfa Romeo auch jetzt nur: »Klick. Klick.« Der Mechaniker schaut auf den dicken schwarzen Griff des Schlüssels und bemerkt die feinen weißen Salzspuren darauf. »Aha, Sie haben den Autoschlüssel nass gemacht«, sagt er.
Es klingt nicht vorwurfsvoll, sondern nur wie eine Feststellung. Dennoch will ich das Thema jetzt nicht weiter vertiefen. Ich knie mich rasch vor den Mitternachtsblauen und tue so, als würde ich nach der Öse für das Abschleppseil suchen. Dann helfe ich dem Mechaniker, das Auto auf den Abschleppwagen zu verfrachten. Er bedankt sich und macht Anstalten, davonzufahren.
»Und was wird aus mir?«, rufe ich entsetzt. Ich sehe mich schon hier draußen übernachten, allein unter Palmrüsslern.
Der Mann hält inne. »Aus Ihnen?«, fragt er gleichgültig, als sei das gegenüber dem Schicksal des Alfa Romeo nun wirklich drittrangig.
»Aber ja – ich muss nach Hause, nach Rom. Können Sie mir nicht ein Taxi rufen?«
Der Mann blickt auf seine Uhr und macht »Ts, Ts, Ts«. »Ein Taxi? Um diese Zeit? Hier draußen? Das wird schwierig. Steigen Sie ein, ich nehme Sie mit zu unserer Werkstatt, dort probieren wir dann, ein Taxi zu bekommen.«
Dummerweise liegt die Werkstatt nicht Richtung Rom, sondern noch zehn Kilometer weiter weg in einem Gewerbegebiet unterhalb einer alten Etruskerstadt. Auf dem Hof angekommen, rast ein Kettenhund mit räudigem Fell auf mich zu. Er will bestimmt spielen. Es ist jetzt gegen zwei Uhr. Der Mond glotzt auf den gekiesten Hof. Der Mechaniker und der Kettenhund inspizieren den mitternachtsblauen Alfa Romeo. »Oje«, murmelt der Mechaniker mit ehrlichem Bedauern. »Was ist denn da passiert? Da ist ja die ganze rechte Seite eingedrückt.«
Der Kettenhund sagt nichts, schaut mich aber ein wenig skeptisch von unten herauf an. Ich weiß, was er denkt: »Vecchio deficiente.«
»Mieser Köter«, denke ich zurück und erkläre dem Mechaniker, dass ich den Wagen schon so bekommen habe, dass aber die signorine der Autovermietung den Schaden nicht im Übergabeformular eingetragen haben.
»Das muss ich trotzdem aufnehmen«, sagt der Mann und schreibt etwas auf ein Formblatt. Italiener können nachts um zwei ganz schön einen auf bürokratisch machen. Immerhin kommt er nicht mehr auf den Schlüssel zu sprechen. Stattdessen ruft er einen Kumpel an, der bald darauf mit seinem Taxi in den Hof einbiegt.
»Ich bin Andrea«, stellt sich der Taxifahrer vor und bittet mich, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. »Das da ist Mara«, sagt Andrea und deutet nach hinten. Ich drehe mich um. Dort lümmelt eine junge Frau mit blondierten, leicht derangierten Haaren und einer mitternachtsschwarzen Sonnenbrille. Der Mond scheint auch wirklich grell. Mara hat die nackten Füße auf die Nackenstütze ihres Freundes gelegt, es sind hübsche Füße, klein und fest. Ihr Kopf hängt nach hinten und sucht am Handgriff der Türe Halt. Sie murmelt etwas von »nachts um zwei aus dem Bett gerissen« und dass sie um diese Zeit eigentlich Besseres zu tun habe. Ich überhöre ihren Vorwurf und frage Andrea, ob es ihm denn nichts ausmache, um diese Zeit im Einsatz zu sein.
»In diesem Fall nicht«, antwortet er. »Bei der langen Strecke und mit den hohen Nachtzuschlägen lohnt sich das für mich.«
Da bin ich ja beruhigt. Wir rasen über die Schnellstraße, vorbei an Schirmpinien, Stoppelfeldern, dunklen Hügeln. Das Taxameter rast auch. Andrea erzählt mir, er sei eigentlich Römer, aber da Mara die Stadt überfordere, wohnten sie eben draußen in der kleinen, ruhigen Etruskerstadt. Wir fahren nun auf der Via Aurelia Richtung Rom. Ich drehe mich um und frage Mara, warum sie Rom nicht möge.
Sie deutet mit dem Kopf nach draußen. Wir passieren gerade eine Parkbucht. Zwischen gärungsprallen Müllsäcken, zerfledderten Zeitungen und Glasscherben stehen zwei schwarze Mädchen im Mondlicht. Sie tragen hochhackige Schuhe und halblange pinkfarben leuchtende Leggings, haben ihre kräftigen Kehrseiten der Straße zugewendet und wackeln langsam mit den Hüften, während wir vorbeifahren. »Rom ist schmutzig und vulgär«, schnaubt Mara und blickt nach vorn zu ihrem Freund. »Und die Römer sind Rüpel.«
Andrea widerspricht, während er im Rückspiegel den beiden Mädchen nachschaut. Mara klopft ihm mit ihren Zehen gegen den Hinterkopf. Er nähert sich bedrohlich der Leitplanke, zieht das Taxi aber rechtzeitig auf die Fahrspur zurück. Die beiden fangen an zu streiten. Über Rom. Pro und Kontra. Andrea sagt, Rom sei die schönste Stadt der Welt, das fänden alle, und wer das nicht begreife, der sei bekloppt. Mara sagt, Rom sei eine Schlampe, das wüssten doch auch alle. Ein Sammelsurium von Ruinen, korrupten Politikern und verdreckten Straßen. Bei ihr oben in Norditalien sei dagegen alles sauber und ordentlich, und sie wisse selbst nicht, welcher Teufel sie geritten habe, dass sie hier unten im mezzogiorno, im tiefen Süden, quasi in Afrika, ausharre. Während die beiden streiten, fallen sie immer mehr in ihren Dialekt. Andrea spricht sein breites, verwaschenes Römisch, während Mara in einen seltsamen Singsang verfällt, der an die Melodie des Schwyzerdütsch erinnert, nur eben mit italienischen Vokabeln. Ich kenne dieses Idiom und weiß, wo es gesprochen wird. So nehme ich jetzt eiskalt Rache für all die Male, wenn mir Italiener auf den Kopf zusagten, ich stamme aus Bayern, weil ich so spräche wie Benedikt.
Ich räuspere mich, um die beiden zu unterbrechen, und frage dann gedehnt: »Vieni da Padova?« – »Du kommst aus Padua?«
Mara nimmt vor Überraschung ihre Brille ab. »Woher weißt du das?«
»Weil du so sprichst wie ein Schweizer Gardist«, sage ich.
Mara ist beleidigt. Andrea grinst. Wir schweigen. Ich lehne mich zurück und schließe die Augen. Warum fällt mir jetzt Sardinien ein? Ach ja, wegen dem Schwyzerdütsch.
Zwei
Fast drei Jahre lang haben die Römer vergeblich versucht, uns vier nach Sardinien zu locken, wie die Sirenen Odysseus auf ihre Insel. Die Römer besangen Sardiniens »karibische Strände«, die rundgeschliffenen Felsen »wie auf den Seychellen« und die Unterwasserwelt »alla Mauritius«. Sie demonstrierten damit ganz beiläufig auch noch ihre Weltläufigkeit, schließlich war ihre Stadt Caput Mundi, das Haupt der Welt. Wir dagegen kamen lediglich aus der bayerischen Landeshauptstadt und kannten weder die Karibik noch die Seychellen oder Mauritius, und der Gedanke, das alles auf einmal zu entdecken, noch dazu im nahen Sardinien, war durchaus verlockend.
Doch wir wollten trotzdem nicht hören. Antonia und ich argwöhnten, auf Sardinien könne man »nur baden«. Wir alle, auch Bernadette und Nicolas, unternehmen nach einigen Tagen am Strand gerne mal etwas und machen Ausflüge. Unsere Kinder akzeptieren es sogar, ab und an ein halbes Dutzend Barockkirchen zu besichtigen, solange es nicht zu viele werden. Schließlich haben wir die beiden von kleinst auf abgehärtet.
Bernadette etwa konnte kaum laufen, als wir sie schon in die römische Ruinenstadt Aquileia bei Grado schleppten. In der Kathedrale liefen wir auf Laufstegen aus Plexiglas über das größte frühchristliche Mosaik Europas. Unter uns waren allerlei aus kleinen, bunten Steinen zusammengesetzte Fische, Krustentiere und Wasservögel zu sehen. Bernadette beugte sich fasziniert nach unten, zeigte auf einige Enten und brüllte verzückt durch die Kirche: »Mama, Papa – Quak, Quak.« Das war der Beginn ihrer Liebe zur abendländischen Kulturgeschichte.
Nicolas setzte dagegen historisch noch etwas früher ein. Er fand es bereits im Kindergartenalter schaurigschön, mit uns durch etruskische Felsengräber in den Tuffsteinschluchten rund um Rom zu streifen. Allerdings musste ich ihm versprechen, dass keine Skelette mehr in den Gräbern lagen. Wenn er irgendwo auf unseren Wanderungen in Latium ein paar Tonscherben fand, klaubte er sie sorgfältig auf, um sie dann mit einer alten Zahnbürste zu reinigen und in seinem winzigen zitronengelben Rucksack nach Hause zu tragen. »Die sind von den Etruschken«, flüsterte er mir zu, während er sie in seinem Zimmer hinter dem Bett versteckte.
Ausschließlich zu baden war also für uns alle nichts. Deswegen fuhren wir zunächst lieber nach Sizilien oder Apulien in Urlaub. Doch die Römer ließen nicht locker mit ihrem Sardinien. Besonders hartnäckig zeigten sich unsere Freunde Sergio und Paola, deren kleiner Sohn Alessio, Ale genannt, der beste Freund von Nicolas ist. »Wenn ihr nicht auf Sardinien gewesen seid, wisst ihr nicht, was das Meer ist«, versicherte uns Sergio immer wieder. »Meint ihr, wir Römer würden ständig dorthin fahren, wenn es nicht wunderbar wäre?«
Sergio und Paola wollten partout, dass wir in diesem Sommer mit ihnen kämen. Paolas Eltern hatten ein Ferienhaus an der Costa Rei im Südosten der Insel. »Dort fahren wir diesen Sommer wieder alle hin«, schwärmte Paola, »mit meinen Eltern und Schwiegereltern, Onkeln, Tanten, Cousins, Cousinen, einigen befreundeten Familien und ganz vielen Kindern. Es ist toll dort. Riesige Strände voller netter Leute aus Rom. Da treffen sich dann alle wieder, und es gibt jede Menge riesiger Pizzerien und Cafés und Tanzlokale, und für die Kinder Poolspiele mit Animation und jeden Abend Kinderdisco mit Showeinlagen, auch mit Karaoke, am Freitag und Samstag sogar bis Mitternacht. Das ist wirklich klasse für die ragazzi.«
Paola bemerkte meinen fragenden Blick und schüttelte energisch ihren Lockenkopf: »Das ist nicht ›nur baden‹ dort auf Sardinien, wie ihr immer behauptet. Da gibt es auch jede Menge Freizeitkultur und«, sie warf mir einen schrägen Blick zu, »im Hinterland sogar ein paar Hinkelsteine aus der Urzeit.« Sie meinte die Nuraghen, diese geheimnisvollen, kegelförmigen Festungstürme eines vorchristlichen Hirtenvolkes, die überall auf Sardinien zu finden sein sollen.
»Ihr müsst einfach mitkommen«, fiel ihr Sergio ins Wort, »es wird euch bestimmt gefallen.« Dann kam sein Killer-Argument: »Ihr wollt doch richtige Römer sein, oder?«
Auch Ale benzte natürlich, da er mit Nicolas in den Buchten Sardiniens seine Playmobil-Boote ausprobieren und, wie er sagte, »U-Boot-Krieg spielen« wollte.
Allein, Antonia und ich hatten Zweifel, ob wir wirklich im Urlaub ALLE wiedertreffen wollten, die wir unter dem Jahr in Rom sahen, so nett wir sie auch fanden. Schließlich hatten wir früher, als wir noch in München lebten, unsere Urlaube auch nicht mit ALLEN lieben Freunden und Verwandten auf einem Haufen verbracht. Um ganz ehrlich zu sein, genossen wir es in den Ferien bisweilen sogar, zu zweit und später zu viert zu sein. Aber das ist den Mitgliedern einer römischen Großfamilie nicht wirklich zu vermitteln. Bizarr musste es Paola und Sergio auch erscheinen, dass es nicht unser Traum vom Urlaubsglück ist, uns von der Ankunft bis zum Kofferpacken von Animateuren, Fitnesstrainern und Surflehrern bespaßen zu lassen.
Mir dagegen läuft es noch heute kalt die Ohren herunter, wenn ich mich eines Urlaubs an der Adria erinnere: Unsere idyllische Ferienanlage am Monte Conero südlich von Ancona wurde unablässig von dem bambini-Hit »Il coccodrillo come fa?« (»Wie macht das Krokodil?«) malträtiert. Vom Frühstück bis Mitternacht, wenn die ersten der kleinsten italienischen bambini ins Bett sollten, verfolgten uns das Nil-Reptil und seine lautstarken Freunde – il cane (der Hund), il gatto (die Katze), l’asinello (das Eselchen), la mucca (die Kuh), la rana (der Frosch) und la pecora (die Ziege). Ein lehrreiches Lied, das muss man eingestehen. »Wie macht der Hund?«, heißt es darin, und alle Zuhörer schreien …? Richtig: »Bau! Bau!« (»Wau! Wau!«) Und so weiter und so fort, bis zur Ziege – »Beee!« (»Mäh!«).
Natürlich taten die lustigen Animateure ihr Bestes, die ganze Anlage ständig zum Mitsingen zu ermuntern. Und natürlich war das alles sehr interessant für uns Ausländer, die auf diese Weise lernten, dass italienische Esel »Hi! Ho!« brüllen. Das Krokodil erwies sich dabei als am angenehmsten. Es quäkte, muhte und schrie nicht, sondern machte nur lautlos schnapp, schnapp, was die Animateure mit den entsprechenden Bewegungen ihrer Unterarme imitierten.
Zermürbt flohen wir von der Adria auf die andere Seite der Halbinsel, nach Principina al Mare am Thyrrenischen Meer. Als wir durch die lauschige, würzig duftende pineta Richtung Meer fuhren, atmeten wir durch. Wir waren dem Krokodil entkommen. Endlich Urlaubsruhe. Wir stellten die Koffer in unsere Ferienwohnung und spazierten ans Ufer. Doch als wir den langen, breiten Strand betraten, tobte da gerade eine Beach-Party. Jung und Alt hüpften in der Abendsonne und brüllten »Bau! Bau!«, »Beee!« und »Hi! Ho!«.
Wir hatten bei der Ferienplanung in diesem Frühjahr den Verdacht, ein Urlaub mit Sergio, Paola und ihrem reizenden Clan auf Sardinien könnte allzu coccodrillo-artig geraten. Daher beschlossen wir, alleine zu fahren. Wir mussten zu allerlei Notlügen greifen, um unseren römischen Freunden das verständlich zu machen. Ich erzählte Sergio und Paola, wir hätten erst im letzten Moment gebucht und nur noch Unterkünfte in anderen Teilen Sardiniens gefunden. Außerdem hätte ich geträumt, an der Costa Rei in einen giftigen Seeigel zu steigen. Italiener gelten bekanntlich als abergläubisch. Mein Sohn Nicolas aber hörte mir zu und sagte: »Papa, warum lügst du?« Zum Glück können Sergio und Paola kaum Deutsch.
An einem dieser brutheißen römischen Julitage, an denen die Pilger auf den Pflastersteinen des Petersplatzes Spiegeleier braten könnten, fuhren wir los. Unser Passat war so bepackt, dass kaum Sonnenlicht ins Wageninnere fiel, jedenfalls nicht auf die Rücksitze, wo Bernadette und Nicolas saßen. Traditionsgemäß gab es auf den ersten Kilometern eine lebhafte Debatte, warum unser Auto so voll war. Bernadette behauptete, es läge an der umfangreichen Fischfangausrüstung, die Nicolas über Wochen aus alten Beständen im Keller zusammengestellt hatte – Blinker, Bleie, Spulen, Ruten, Senknetze, Kescher und was man halt sonst noch so braucht als acht Jahre alter Fischer am Meer. Antonia argwöhnte, ich hätte wohl wieder einmal meine halbe Italien-Bibliothek mitgenommen. Dabei waren in meinem Lektürekoffer allenfalls zehn bis zwölf Kunst-, Landschafts- und Wanderführer über Sardinien, ein Stapel Landkarten, einige wenige ausgewählte Bildbände, ein bisschen was über Flora und Fauna des Mittelmeers und seiner Inseln im Allgemeinen, eine Grundausstattung sardischer Romane und noch ein paar unerlässliche Standardwerke wie die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter in sieben Bänden von Ferdinand Gregorovius, die ich in jeden Urlaub mitnehme, weil ich noch nie dazu gekommen bin, sie zu lesen.
»Hast du wieder den Gregorovius dabei?«, fragte Antonia treffsicher.
»Ja, aber nur die Taschenbuchausgabe«, antwortete ich.
»Es ist nicht zu fassen!«, fand meine Frau. Womöglich missfiel es ihr, dass ich die edle Ganzleinen-Ausgabe zu Hause gelassen hatte.
»Und du«, schlug ich zurück. »Hast du auch deine pasta, die Nudeln, mitgenommen?«
»Wieso sollte ich denn Nudeln nach Sardinien mitnehmen?«
»Na ja, du nimmst ja bisweilen auch Spaghetti aus München nach Rom mit«, konnte ich mir nicht verkneifen.
»Das sind Dinkelnudeln aus biologischem Anbau, die bekomme ich in Rom nur schwer«, antwortete Antonia – als ob das eine Rechtfertigung wäre. Dinkelnudeln gegen Gregorovius!
Wir fuhren schweigend weiter. Die Fähre sollte am frühen Nachmittag von Civitavecchia aus ablegen, das ist nur eine knappe Autostunde nördlich von Rom. Wir waren zeitig losgekommen. Normalerweise ist es kein Problem, um diese Zeit über die Via Aurelia aus der Stadt zu fahren. An diesem Samstag aber schon. Wir steckten im Stau.
»Ausgerechnet heute«, stöhnte ich und trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad.
»Sei doch nicht so nervös«, sagte Antonia.
»Ich bin nicht nervös.«
»Bist du schon.«
»Du musst es ja wissen.«
Bernadette und Nicolas riefen dazwischen, sie wollten nun eine Kassette hören.
»Welche denn?«, fragte ich.
»Pumuckl«, verlangte Nicolas.
»Nein, nicht schon wieder Pumuckl, lieber Bibi Blocksberg«, rief Bernadette. Im Nu lagen sich die beiden in den Haaren, auch wörtlich genommen.
»Stefan, sorg doch mal für Ordnung«, stöhnte Antonia.
Es war, trotz Klimaanlage, stickig im Wagen, und wir waren jetzt, Anfang Juli, alle erschöpft, von Schule und Arbeit und den vergangenen heißen Hochsommerwochen in unserem Palazzo in der römischen Innenstadt. Ich hatte überhaupt keine Lust auf eine lange Pumuckl-Bibi-Blocksberg-Debatte und griff daher zur Atomwaffe. Ich öffnete das Kassettenfach und drohte: »Einigt euch – oder wir hören Paolo Conte!«
Die hintere Reihe in unserem Passat erstarrte vor Schreck. Ich selbst mag den singenden, summenden, brummenden, trötenden und komponierenden Rechtsanwalt aus Asti ja sehr gerne, diesen ein wenig schrägen Jazzbarden mit der Whiskey-Stimme und dem Alter-Schwerenöter-Blick. Seine romantisch-dadaistischen Lieder wie »Sotto le stelle del Jazz« hatten mir geholfen, von Italien zu träumen, als ich noch in Deutschland lebte. Meine Kinder aber empfanden Paolo Contes Songs als entsetzlich – ja als albernes, amelodisches Liedgut einer unverständlichen Erwachsenenwelt.
»Tröööt, Tröööt!«, brüllten sie voll Abscheu, wenn ich Paolo Conte auflegen wollte.
Die Drohung damit wirkte auch diesmal. Bernadette und Nicolas einigten sich sofort auf Benjamin Blümchen. »Töröööö!«, dachte ich bei mir.
Als wir nach wenigen Umwegen an der richtigen Mole in Civitavecchia ankamen, waren erst einige Hundert ebenfalls übervoll bepackte Autos da. Sie standen in ordentlichen Schlangen vor einer gigantischen, hochhaushohen Fähre, die bedrohlich ausgesehen hätte, wenn sie nicht mit beinahe ebenso großen Comic-Figuren bemalt gewesen wäre. Ein schwitzender, schnauzbärtiger Seemann mit bratpfannengroßen Pranken reichte uns gegen Vorzeigen der Reservierung unsere Tickets und prophezeite, wir würden in zwei Stunden einschiffen. Der Hafen war heiß. Das Meer spendete keinen Hauch einer Brise.
Endlich verschluckte uns das Schiff. Wir stiegen aus dem benzingeschwängerten Bauch über schmale Eisentreppen empor. Nicolas und Bernadette waren begeistert. Es gab ein Geschäft mit T-Shirts und Spielwaren, Restaurants und Bars und, auf dem Oberdeck, sogar einen runden Swimmingpool. Im brühwarmen Wasser planschten kleine Kinder wie Frösche in einem Tümpel. Die italienischen Großfamilien hatten bereits die meisten Tische um den Tümpel belegt, doch wir fanden auch noch ein Plätzchen. Dann kam der Fahrtwind, und es wurde richtig angenehm. Wir legten uns auf Liegestühle, stützten die Füße auf die Reling, lauschten der Gischt und stellten uns vor, wir seien Kreuzfahrtpassagiere. Die Fahrt dauerte acht Stunden. Wir sahen Delfine vor unserer Fähre springen und vertrieben uns die Zeit mit pizzette und tramezzini von der Bar, Lemon Soda und Cappuccino – okay, zwei, drei prosecchi waren auch dabei.