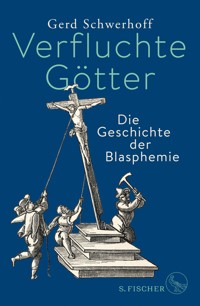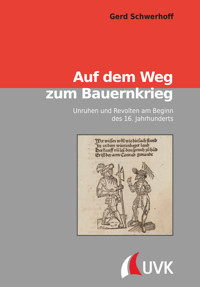
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven
- Sprache: Deutsch
Vor dem "großen" Bauernkrieg von 1525 gab es im Alten Reich eine Vielzahl von Unruhen, Aufständen und Revolten. Am bekanntesten sind die "Bundschuh"-Verschwörungen und die Bewegung des "Armen Konrad" in Württemberg im Südwesten, deren Bedeutung bis heute teilweise falsch eingeschätzt wird. Auch in den Städten gab es damals eine regelrechte Aufstandskonjunktur, die bislang kaum vergleichend erforscht wurde. Das Buch gibt einen Überblick zu diesen Phänomenen und stellt die Verbindung zur Reformation her, die insofern eine neue Phase einläutet, als sie den vormals fragmentierten Bewegungen eine gemeinsame Richtung gab. Schließlich wird der Bogen bis zum Beginn des Bauernkriegs geschlagen. Auf diese Weise werden Kontinuitäten und Brüche ebenso sichtbar wie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den "Voraufständen" und dem Bauernkrieg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[1]Auf dem Weg zum Bauernkrieg
[2]Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven
Herausgegeben von Carola Dietze · Joachim Eibach · Mark HäberleinGabriele Lingelbach · Ulrike Ludwig · Dirk Schumann · Gerd Schwerhoff
Band 43
Wissenschaftlicher Beirat: Norbert Finzsch · Iris GareisSilke Göttsch · Wilfried Nippel · Gabriela Signori · Reinhard Wendt
Gerd Schwerhoff
[3]Auf dem Weg zum Bauernkrieg
Unruhen und Revolten am Beginn des 16. Jahrhunderts
[4]Umschlagabbildung: Wer wissen wœll wie die sach stand || Jtz in dem würtenbeger land || Der kauff vñ leß den spruch z°u hãd || Er ist der arm Conrad genandt || Mainz 1514; Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Germany, Signatur Yg 6719
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381121823
© UVK Verlag 2024‒ Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Satz: typoscript GmbH, WalddorfhäslachCPI books GmbH, Leck
ISSN 1437-6083ISBN 978-3-381-12181-6 (Print)ISBN 978-3-381-12182-3 (ePDF)ISBN 978-3-381-12183-0 (ePub)
[5]Inhalt
1
Einleitung
2
Das Reich um 1500
2.1
Epochenumbruch oder Kontinuität?
2.2
Die Formierung der Ständegesellschaft
2.2.1
Adel
2.2.2
Bauern
2.2.3
Bauern und Herren
2.2.4
Bürger
2.3
Das Zeitalter der Herrschaftsverdichtung
2.3.1
Reich, Territorien und Länder
2.3.2
Reichsreform und Landfrieden
2.4
Die unabgegoltene Reform von Klerus und Kirche
2.4.1
Türhüter der ewigen Seligkeit
2.4.2
Laikales Selbstbewusstsein
2.4.3
Die ausgebliebene Erneuerung
3
Eine Welt in Unruhe
4
Bundschuh und Armer Konrad
4.1
Von den Anfängen nach Schlettstadt 1493
4.2
Bruchsal 1502
4.3
Freiburg 1513
4.4
Der Arme Konrad von 1514
4.4.1
Das Herzogtum Württemberg
4.4.2
Erste Phase: Initiierung und Ausweitung im Mai
4.4.3
Zweite Phase: Proteste und Beschwerden
4.4.4
Ergebnisse und Fehlstellen des Landtages
4.4.5
Letzte Phase: Verweigerungen, Proteste und Niederlagen
4.4.6
Strafen und Folgen
4.4.7
Zur Einordnung
4.5
Ein Bundschuh am Oberrhein 1517?
4.5.1
Das alte Narrativ
4.5.2
Dekonstruktion einer Geschichte
4.5.3
Ausklang und Einordnung
5
Städtische Protestkonjunktur um 1512/3
5.1
Ein kursorischer Überblick
5.2
Das Beispiel Köln 1512/13
5.3
Vergleichende Einordnungen
6
Ritterliche Fehdelust in Zeiten des Landfriedens
6.1
Prototypen niederadliger Selbstbehauptung
6.2
‚Raubritter‘, Fehdeunternehmer oder politischer Akteur?
6.3
Karriere und Fall Sickingens
6.4
Die Absberg-Kampagne 1523
7
Die Reformation als Katalysator sozialer Proteste
7.1
Reform oder radikaler Protest?
7.2
Resonanzen im Adel
7.3
Städtische Unruhen und Reformation
7.3.1
Das Beispiel Augsburg
7.3.2
Das Beispiel Mühlhausen
7.4
Reformation und sozialer Protest auf dem Land
7.4.1
Von Forchheim nach Nürnberg
7.4.2
Zehntproteste im Zürcher Landgebiet
8
Stadtunruhen 1525: An der Peripherie des Bauernkriegs
8.1
Das Beispiel Frankfurt 1525
8.2
Das Beispiel Köln 1525
9
Auf dem Weg zum Bauernkrieg?
Abbildungsverzeichnis
Quellen- und Literaturverzeichnis
Register (Orte und Personen)
[7]1Einleitung
Darstellungen und Deutungen des Bauernkriegs von 1525 betonen seit jeher, dass dieser größte kontinentale Massenaufstand in Europa vor 1789 eine jahre- oder gar jahrzehntelange „Vorgeschichte“ in Gestalt zahlreicher kleinerer Unruhen hatte. Exemplarisch und emblematisch steht dafür die Bewegung des „Bundschuh“ im Südwesten des Reiches, dem insbesondere im Argumentationshaushalt der klassischen Überblicksdarstellung von Günther Franz eine zentrale Funktion zukam.1 Im Umfeld des fünfhundertjährigen Bauernkriegsjubiläums ist die historische Forschung gegenwärtig herausgefordert, gängige Interpretationen zu überprüfen und ggf. zu erneuern.2 Damit scheint auch ein frischer Blick auf die vorangegangenen Unruhen angezeigt. Hier stellt sich die Forschungslage gegenwärtig extrem uneinheitlich dar. Einerseits haben die Jubiläen der vergangenen Jahre neue Forschungsaktivitäten angeregt, etwa in Bezug auf die Bundschuh-Verschwörungen oder, mehr noch, auf den Armen Konrad. Andererseits wird die städtische Aufstandskonjunktur um 1512 immer noch nicht als ein übergreifendes Phänomen wahrgenommen und gewürdigt. Weiterhin hat die Lutherdekade zu einer Vielzahl von Veröffentlichungen zur frühen Reformation geführt, dabei allerdings den Protest- und Aufruhraspekt der Reformation vergleichsweise wenig berührt. Manche Forschungsdesiderate sind wohl – immer noch – der Tatsache zuzuschreiben, dass wir uns am Anfang des 16. Jahrhunderts gewissermaßen im Niemandsland zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit bewegen: Zwar steht die Periodisierungsgrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit seit Generationen in der Kritik; aber sie ist eben immer noch eine zentrale Demarkationslinie, entlang derer die historischen Subdisziplinen ihre Claims abstecken.
Im Zuge der Entstehung einer umfassenderen neuen Darstellung über das Bauernkriegsgeschehen3 schien es deswegen angebracht, dessen Vorgeschichte systematisch zu sichten. Herausgekommen ist keine integrale Gesamtgeschichte, sondern eine längere essayistische Zwischenbilanz, die erzählerische und analytische Elemente kombiniert. Zum Teil leistet sie nicht mehr, als unseren [8]Kenntnisstand aufzurufen und bestehende Forschungslücken deutlicher zu markieren. Insofern will sie ein besseres Sprungbrett für künftige Detailforschung bieten. Die Darstellung will darüber hinaus eine Grundlage schaffen, um den Bauernkrieg einordnen zu können, konkret um Gemeinsamkeiten und Wirkungszusammenhänge mit seinen „Voraufständen“ aufzuzeigen, aber auch seine zweifellos bestehenden Eigen- und Einzigartigkeiten besser herauszuarbeiten. Der Text bietet keine originäre, gar archivalische Quellenarbeit und beansprucht keine empirische Originalität. Wenn vor dem Hintergrund seiner Interpretationen und Gewichtungen der Bauernkrieg besser verständlich wird, hat er sein Ziel erreicht.
Die Darstellung wird mit einer Skizze zur Situation im Reich um 1500 eröffnet, die die wichtigsten Problemlagen der Zeit verdeutlichen soll: die Spannungslagen der sozialen Welt, die sich gerade in der Zeit um 1500 von einer Ständegesellschaft „an sich“ in eine Ständegesellschaft „für sich“ transformierte; die wohlbekannte Vielgestaltigkeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, dessen Reform um 1500 viele Menschen beschäftigte, wobei sich Schritte in Richtung Staatsbildung eher auf der Ebene der Landesherrschaften vollzogen; und die Lage einer Kirche, die vor allem von den gewachsenen Erwartungen selbstbewusster Laien unter Reformdruck gesetzt wurde. Nach einem kurzen Rundumblick auf die zahlreichen spätmittelalterlichen Unruhen, die sich quer durch Europa ereigneten, konzentriert sich die Darstellung dann zunächst auf die Bundschuh-Verschwörungen und den Armen Konrad im deutschen Südwesten. Die städtische Aufstandskonjunktur um 1512 bildet einen zweiten Schwerpunkt. Unter vorläufiger Ausblendung der Reformation erfolgt dann ein knapper Blick auf die „Ritterbewegungen“ jener Jahre und auf die fürstlichen Reaktionen darauf. Schließlich soll verdeutlicht werden, wie die Reformation ab 1517 auch den sozialen Protest in der Stadt und auf dem Land befeuerte und damit z.T. alte Aufstandsmotive überdeckte; diese blieben gleichwohl virulent und verbanden sich mit den Impulsen der evangelischen Bewegung. Bis an den Bauernkrieg selbst heran führt ein letztes Kapitel über die Stadtunruhen des Jahres 1525, die nicht in einen direkten organischen Zusammenhang mit dem großen Aufstandsgeschehen gebracht werden können. Eine knappe thesenartige Bilanz in Hinblick auf den Bauernkrieg beschließt die Darstellung.
„Unruhen und Revolten“ – die Begriffe im Untertitel besitzen wenig terminologische Trennschärfe. Jenseits provisorischer, nicht vollkommen befriedigender Definitionen4 lässt sich das damit umrissene terminologische Feld (zu [9]dem weitere Begriffe wie „Aufstände“, „Empörungen“ oder „Rebellionen“ zu zählen sind) vor allem in der Abgrenzung nach zwei Seiten hin näher bestimmen. Indem es um kollektive Aktionen von kleineren oder größeren Gruppen von Menschen mit einer besonderen Sichtbarkeit geht (die sich z.B. in der Erwähnung in erzählenden Quellen niederschlagen kann), unterscheiden sie sich einmal von diffuseren Handlungen des „Widerstandes“ im Alltag, die auch von einzelnen Personen getätigt werden konnten.5 Auf der anderen Seite gibt es eine deutliche Differenz zu „Revolutionen“, unbeschadet der Tatsache, dass der Revolutionsbegriff lange Zeit, und bisweilen bis in die jüngere Vergangenheit hinein, unbefangen als Synonym für „Aufstand“ oder „Bewegung“ benutzt worden ist.6 Heute empfiehlt es sich, den Revolutionsbegriff für schnelle und nachhaltige Umwälzungen der gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse zu reservieren; für die Zwecke des vorliegenden Buches scheidet er deswegen aus.7
Wesentlich an Qualität gewonnen hat das Buch durch die sorgsame Lektüre und die zahlreichen weiterführenden Hinweise von Mark Häberlein – herzlichen Dank für diesen kollegialen Freundschaftsdienst! Bedanken möchte ich mich für Hinweise und Unterstützung bei der Fertigstellung des Manuskripts überdies bei Matthias Bähr, bei meiner Frau Astrid Schwerhoff und bei Stefan Selbmann vom Verlag UVK.
Franz, Bauernkrieg, S. 92 ff. Seine gründliche und grundlegende Darstellung bleibt trotz allen ideologischen Ballasts unverzichtbar. Eine Nutzung der (digital verfügbaren) ersten Auflage von 1933 ist deshalb geboten, weil sie wesentliche Details bietet, die in den späteren gekürzten Ausgaben weggefallen sind.
Schwerhoff, Heroic Narrative.
Schwerhoff, Der Bauernkrieg.
Blickle, Unruhen, S. 5, sieht in Unruhen z.B. Protesthandlungen von Untertanen einer Obrigkeit mit vornehmlich politischer Natur. Beide Merkmale scheinen bestreitbar. Andere Erörterungen sparen das Begriffsproblem weitgehend aus, vgl. die Beiträge in Holbach/Weiss, Städtische Konflikte, oder Rauscher/Scheutz, Stimme der ewigen Verlierer.
Vgl. die Beiträge in Häberlein, Devianz. Hier spielt auch der Begriff „Konflikt“ eine große Rolle, der hilfreich sein kann, wenn z.B. damit bestimmte analytische Konzepte aufgerufen werden, der aber noch ein viel größeres Feld von Phänomenen aufruft.
Wenn z.B. Kaser, Bewegungen, S. 34, von den „städtischen Revolutionen“ zwischen 1509 und 1514 spricht.
Für den aktuellen Stand der Debatte z.B. Nitschke/Hachtmann, Revolution; vgl. näher für den Bauernkrieg Schwerhoff, Bauernkrieg, S. 580 ff.
[10]2Das Reich um 1500
2.1Epochenumbruch oder Kontinuität?
Als Papst Alexander VI. am Weihnachtsabend 1499 mit einem silbernen Hämmerchen die Pforte der Petersbasilika eröffnete und damit das Heilige Jahr 1500 einläutete, war das kein epochemachendes Ereignis.8 Heilige Jahre gab es damals bereits seit zwei Jahrhunderten. In Anlehnung an die biblischen Jubeljahre (Lev 25) versprachen die Päpste seither zu diesem Anlass allen Rompilgern einen vollständigen Ablass ihrer zeitlichen Sündenstrafen. Dass es sich dabei um eine Jahrhundertschwelle handelte oder gar um die ‚Halbzeit‘ des zweiten Jahrtausends seit Christi Geburt, spielte – anders etwa als beim Hype um das Jahr 2000 – im Bewusstsein der Zeitgenossen keine Rolle. Bezeichnend war die träge Umsetzung des Jubiläumsablasses, dessen finanzieller Ertrag für einen Kreuzzug gegen die Türken verwendet werden sollte: Datiert ist die entsprechende päpstliche Bulle erst auf den 5. Oktober 1500; die Verkündigung durch Kardinallegat Peraudi im Reich zog sich gar bis zum Frühjahr 1503 hin.9
Zur Epochenwende machte das Jahr 1500 bekanntlich erst rund zweihundert Jahre später Christoph Cellarius mit seiner 1702 erschienenen Historia universalis, in der er die Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit einteilte. Entscheidende Zäsuren sah der hallische Geschichtsprofessor in der Eroberung von Konstantinopel 1453 und in der Reformation ab 1517, aber aus didaktisch-pragmatischen Gründen wählte er die runde Zahl 1500. Bis heute stehen wir, bei aller Kritik an dieser holzschnittartigen Einteilung und an ihrer eurozentrischen Perspektive, im Banne seiner Entscheidung.
Erfunden wurde das Konzept einer Epochenzäsur allerdings nicht von Cellarius, sondern von den Gelehrten des Spätmittelalters.10 Bereits 1341 hatte der Literat und Altertumsliebhaber Francesco Petrarca die ‚alte‘ und die ‚neue‘ Zeit einander gegenübergestellt, wobei er die jüngere Vergangenheit als [11]‚finstere‘ Epoche deutlich abwertete – das Klischee vom ‚dunklen‘ Mittelalter deutet sich hier bereits an. Im 15. und 16. Jahrhundert verfestigte sich dann eine solche Sichtweise im Zuge der Renaissance, der ‚Wiedergeburt‘ bzw. ‚Wiederbelebung‘ der antiken Kultur bei den Humanisten, also bei denjenigen Gelehrten, die vor allem die studia humanitatis betrieben: Grammatik, Rhetorik, Poetik, Geschichte und Moralphilosophie. So differenzierte z.B. 1469 der italienische Bischof Giovanni Andrea Bussi, vormaliger Sekretär des Kardinals Nikolaus von Kues, zwischen der Antike, der mittleren Zeit und „unserer Zeit“, hatte also bereits den Eindruck, in einem neuen Zeitalter zu leben. Als Inbegriff jenes neuen, emphatischen Epochenbewusstseins gilt der briefliche Ausruf des Humanisten-Ritters Ulrich von Hutten über die Blüte der Gelehrsamkeit und die darniederliegende Barbarei: „O saeculum, o litterae … Oh Jahrhundert, oh Wissenschaften! Es ist eine Lust zu leben …“. Nicht nur in den hohen Gefilden lateinischer Gelehrsamkeit, sondern auch in volkssprachlichen Texten stößt man um 1500 auf ein „emphatisches Jetztzeitbewusstsein“.11
Dieses Bewusstsein speist sich nicht zuletzt aus den Erfahrungen vielfältiger Krisen, in der Bildung und in der politischen Ordnung ebenso wie in Kirche und Frömmigkeit. Neben Gegenwartseuphorie und Zukunftsoptimismus hatten deshalb um 1500 auch düstere Prophetien und Endzeitvisionen Konjunktur. Am bekanntesten ist die 1488 publizierte Prognosticatio des Johannes Lichtenberger, die Zeitdiagnostik, astrologische Weissagung und Endzeitprophetie in sich vereinte und bis 1530 zahlreiche Auflagen in lateinischer, italienischer und deutscher Sprache erlebte.12 Nacheinander betrachtet er das gegenwärtige und künftige Schicksal der Kirche als das ‚Schifflein Petri‘, Gegenwart und Zukunft des Reiches sowie die Lage der gemeinen Laien. Auch die Feinde der Christenheit vergisst er nicht: die Türken, die er als Vorläufer des Antichristen betrachtet, ebenso wie die Juden, die von den Höhen ihres Reichtums gestürzt und bis ans Ende der Welt gehasst würden.13 Für die nähere Zukunft nach Anbruch des neuen Jahrhunderts prophezeit Lichtenberger Aufstände des gemeinen Volkes, die er zwar nicht gutheißt, für die er aber erstaunlich konkrete Ursachen benennt: Unwetter, Missernten und Teuerung ebenso wie Münzverschlechterungen und Steuererhöhungen.14 Lichtenberger blieb nicht allein. 1508 folgte der Astrologe, Arzt und Theologe Johann Grünpeck, ein vom späteren Kaiser Maximilian I. gekrönter Hofpoet, mit seinem „Spiegel der natürlichen, himmlischen und prophetischen Sehungen aller Trübsalen“.15[12]Die Konjunktion der Sterne, himmlische Wunderzeichen und biblische Prophezeiungen waren der Stoff, aus dem Grünpeck seine Ermahnung an die Vertreter aller Stände komponierte. Die Schrift war mit dramatischen Holzschnitten Nürnberger Meister aus der Dürerschule bebildert, die „unmittelbar an Ängste des Betrachters vor Krieg und Gewalt, Naturkatastrophen oder ‚Vor-Zeichen‘ der Apokalypse am Himmel“ appellierten.16 Insbesondere Kirche und Geistlichkeit stehen im Zentrum der Katastrophen, gezeigt werden z.B. eine auf den Kopf gestellte Kirche, das sinkende Schifflein Petri oder das Töten von Geistlichen vor der Kulisse eines brennenden Kirchengebäudes.
Abb. 1: Johann Grünpeck, Spiegel der Sehungen aller Trübsalen, 1508, Titelblatt
Ob das Jahr 1500 einen Epochenwandel oder gar eine Epochenzäsur markiert, hängt nicht in erster Linie von der Wahrnehmung der Zeitgenossen ab. Rückblickend stellt sich vor allem die Frage, ob um 1500 gewichtige historische Geschehnisse oder Prozesse zu verzeichnen sind. Um 1700 sah Cellarius vor allem in der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen unter Sultan Mehmed II. einen historischen Einschnitt, was im Rahmen seines ungebrochen christlichen Weltbildes durchaus plausibel war. 1453 endete die lange, (ost-)römisch-griechische Tradition christlicher Herrschaft im östlichen Mittelmeerraum endgültig; das muslimisch geprägte Osmanenreich rückte bedrohlich an die lateinische Christenheit heran. Auch retrospektiv ist die symbolische Bedeutung dieses Einschnitts kaum zu bestreiten. Ob damit eine wirkliche Zäsur verbunden war, ist angesichts des geschrumpften byzantinischen Herrschaftsgebietes eine andere Frage. Letztlich ging die westliche Christenheit schnell wieder zur Tagesordnung über.17 Hochfliegende Kreuzzugspläne zerschlugen sich meist, und bezeichnend ist, dass es über die Verteilung des durch die Ablasskampagne nach 1500 eingenommenen Gelder zwischen Maximilian I. und dem päpstlichen Legaten Peraudi zu einem heftigen Streit kam.18 Die Auseinandersetzung zwischen der europäischen Christenheit und dem expansiven Osmanischen Reich sollte sich in den folgenden Jahrhunderten allerdings zu einem Dauerbrenner entwickeln.
Als im wahrsten Sinne epochemachend gilt dagegen noch heute das andere von Cellarius als bedeutender Wendepunkt betrachtete Ereignis, der Thesenanschlag Martin Luthers von 1517 (mag er nun buchstäblich stattgefunden haben oder nicht) als Initialimpuls der Reformation. Abweichungen vom römischen Monopolanspruch hatte es zwar auch im Mittelalter gegeben, nun aber sollte sich mit den lutherischen und reformierten Bekenntnissen eine dauerhafte Alternative etablieren. Religiöse Pluralisierung in bisher unbe[13]kanntem Ausmaß war die Folge – dazu später mehr. Mindestens zwei weitere Ereigniskomplexe sind überdies geeignet, die Hypothese eines nachhaltigen Umbruchs vom Mittelalter zur Neuzeit zu stützen. Der eine verbindet sich mit der Jahreszahl 1492, dem Jahr, als der Genuese Christoph Kolumbus im Auftrag der katholischen Könige den Seeweg nach Indien suchte und dabei einen Erdteil erreichte, der – unbeschadet früherer Erkundungen durch die Wikinger – bislang noch nicht in den Wahrnehmungshorizont Europas gerückt war. Dass [14]damit ein welthistorisch ungemein bedeutender Prozess, der freilich bereits früher begann, entscheidend beschleunigt wurde, bedarf keiner großen Erläuterung: Die globale Expansion Europas mit seinen Kolonialreichen prägt die Welt bis heute. Allerdings war diese Prägung um 1500 erst in Ansätzen für einige wenige Menschen erkennbar – für die alltägliche europäische Lebenswelt hatte sie noch wenig Relevanz. Das galt erst recht für ein politisches Gebilde wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation „mit einem schwachen Zentrum und ohne unbestrittene Schwerpunktbildung“, das auf kolonialem Feld keine Rolle spielte.19 Immerhin war es mit dem Kartographen Martin Waldseemüller ein Bewohner dieses Reiches, der 1507 in seiner Cosmographia den inzwischen als Kontinent identifizierten Erdteil (nach dem Entdecker Amerigo Vespucci) als America bezeichnete und der dessen westliche Küstenlinien erstmals (weitgehend hypothetisch) auf der beiliegenden Karte bzw. den Erdglobussegmenten einzeichnete.20
Dem Werk von Waldseemüller, erschienen in einer hohen Auflage von rund 1000 Stück, wird ein hoher Einfluss auf die europäische Gelehrtenwelt zugeschrieben. Damit verweist es auf den anderen Komplex, der heute als bestimmend für einen Epochenumbruch gilt: den Buchdruck. Spätestens seit dem Beginn des digitalen Zeitalters gilt der Eintritt in die ‚Gutenberg-Galaxis‘ (McLuhan) als markantestes Charakteristikum der Neuzeit. Allerdings war mit der Erfindung des Buchdrucks (bei näherer Betrachtung eine ingeniöse Kombination verschiedener Produktionsstufen, in deren Zentrum die standardisierte Massenproduktion einzelner Bleilettern steht) durch Johannes Gutenberg in Mainz zunächst nur ein erster Schritt zur Entfaltung einer neuen medialen Kultur getan. Zeitgenossen wie Enea Silvio Piccolomini, der nachmalige Papst Pius II., rühmten zunächst das schöne und ebenmäßige Schriftbild des neuen Produktes.21 Kaiser Maximilian I. machte sich gerade diesen Aspekt als Auftraggeber ästhetisch hochwertiger Werke für ein elitäres Publikum zunutze, um seine Gedächtnispolitik zu etablieren.22 Erst allmählich drang das große Potential der neuen Druckmedien für die Ausweitung der Massenkommunikation ins allgemeine Bewusstsein. Und nur schrittweise entfalteten sich neben dem gedruckten Kodex, dem Buch, andere druckmediale Genres wie die kürzeren Flugschriften oder die bebilderten Flugblätter. Sie sollten die Zeit der Reformation und des Bauernkriegs entscheidend prägen.23
[15]Das Ende des oströmischen Reiches von Byzanz, die Erfindung des Buchdrucks, der Beginn von europäischer Expansion und religiöser Pluralisierung – all diese Stichworte legen es nahe, die Zeit um 1500 tatsächlich als tiefen historischen Einschnitt zu verstehen. Aber auch eine andere Sicht auf diese Zeit ist möglich, nämlich eine, die die ‚vormodernen‘ Kontinuitäten zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit betont und tiefgreifende Veränderungen erst mit der Zeit um 1800 ansetzt, als die Industrialisierung begann und sich im Zeichen naturrechtlicher Gleichheitsvorstellungen moderne Gesellschaften und Nationalstaaten formten. Jener Perspektive zufolge war die Vormoderne gekennzeichnet durch vorwiegend ländliche Lebensformen mit begrenzter Produktivität und einer ständisch bestimmten Gesellschaft, in der alle Glieder je nach Geburt einen sehr unterschiedlichen Rang einnahmen. Die Forschung hat hierfür das Konzept ‚Alteuropa‘ entwickelt.24 Die nachfolgende Skizze zu den Hauptmerkmalen der Epoche wird erweisen, dass beide Perspektiven, Kontinuität und Erneuerung, ihre Berechtigung haben, je nachdem, welchen Aspekt der damaligen Gesellschaft man in den Blick nimmt. Erst in der Zusammenschau ergeben sie ein vollständiges Bild.
2.2Die Formierung der Ständegesellschaft
Ungleichheit war das zentrale Ordnungsprinzip des menschlichen Zusammenlebens im alten Europa. In der Ständegesellschaft wurde den Menschen entsprechend ihrer Herkunft und ihrem sozialen Rang ein unterschiedliches Maß an Rechten und Anerkennung zuteil. Stand, so definierte noch 1744 ein Lexikonartikel, sei nichts anderes „als die Beschaffenheit eines Menschen, wodurch er von andern unterschieden wird“; in Ansehung dieses Unterschieds genieße nicht jeder Mensch „durchgängig einerley Rechte“, sondern „einer vielmehr immer andere“.25 Nach dem Vorbild der von Gott geschaffenen kosmischen Ordnung, in der alle Gestirne ihren rechten Platz am Firmament hatten, wurde auch die menschliche Gesellschaft als ein hierarchisches Ordnungsgefüge begriffen, an dem grundlegende Veränderungen nicht vorgesehen waren.26 In vielerlei Hinsicht herrschte das Bild einer dualistisch angelegten sozialen Gliederung, stets gab es privilegierte Menschen, die herrschen, und [16]abhängige, die gehorchen mussten: Männer und Frauen27, Eltern und Kinder, Herren und Knechte, Kleriker und Laien, oder ganz generell Zugehörige und Außenstehende. Jede und jeder besaß nach dieser Vorstellung einen bestimmten Platz in der menschlichen Gemeinschaft und (meist) ein bestimmtes Maß an ständischer Ehre. Für diese soziale Ortsbestimmung jeder und jedes Einzelnen war insbesondere ein im Mittelalter von Kirchenleuten entwickeltes Deutungsschema bedeutsam, dass auch um 1500 noch ausgesprochen einflussreich war: die Dreiteilung der Gesellschaft in ‚Beter‘ (oratores), also die Geistlichen, die für das Seelenheil aller Menschen zuständig waren, ‚Krieger‘ (bellatores), mithin Adlige, die sich um den Schutz der Menschen kümmern sollten, und schließlich Arbeiter (laboratores), eigentlich die Bauern, von deren Arbeitserträgen letztlich alle lebten.28
Moderne Beobachter sind dem hier skizzierten Modell einer ‚vormodernen‘ Gesellschaft oft gefolgt und haben es scharf vom Typus der modernen Klassengesellschaft abgesetzt, die nach Einkommenschancen und Vermögen geschichtet ist. Das ist durchaus zweckmäßig, um den angesprochenen Graben deutlich zu machen, der uns von der Welt um 1500 trennt. Aber wir sollten es mit der Differenzmarkierung nicht übertreiben. Vor allem ist zu beachten, dass es sich bei der gerade skizzierten Vorstellung um ein zeitgenössisches Schema für die Deutung der Wirklichkeit handelt – ein wirkmächtiges Schema durchaus, das aber keinesfalls mit der Wirklichkeit selbst verwechselt werden darf. Dabei birgt diese Deutung dennoch, wie vor allem Otto Gerhard Oexle herausgearbeitet hat, eine wichtige, früher gerne übersehene Pointe: Das oben skizzierte Modell gesellschaftlicher Dreiteilung lässt sich zwar einerseits ohne große Mühe auf eine klare Dichotomie von ‚Oben‘ und ‚Unten‘ reduzieren; andererseits eröffnet es dem Betrachter eine modernere, funktional geprägte Sicht: Alle drei Stände sind aufeinander angewiesen, keiner kann – die Logik des Seelenheils vorausgesetzt – ohne den anderen existieren.
Darüber hinaus waren bereits für viele Zeitgenossen die Grenzen eines solchen Modells erkennbar. Schon zur Entstehungszeit bildete es die soziale Wirklichkeit kaum vollständig ab, und das gilt erst recht für die weitere historische Entwicklung. So fügten sich die Stadtbürger nur mit Mühe in das Schema – mag der Adlige auch keine Probleme gehabt haben, die Stadtbewohner zusammen mit den Bauern als gemeinsamen Stand zu sehen, der sich von seiner Hände Arbeit ernähren musste, so entsprach diese Vorstellung doch [17]keineswegs dem Selbstbild vieler Bürger. Und was ist mit den vielen Außenseitern, den Tagelöhnern und Vaganten, die aus dem Ständemodell vollkommen herausfielen? Neue Modelle versuchten, der immer komplexer werdenden Wirklichkeit gerecht zu werden: Bereits im 16. Jahrhundert sollte sich die Zahl der Stände in den einschlägigen Beschreibungen vervielfachen.29 Dass Einkommen und Vermögen, ebenso wie heute, ein großer Treiber der Verschiebung des Ständegefüges insgesamt waren, ist offensichtlich. Auch konnte dieser Faktor die ständische Zugehörigkeit einzelner Menschen verändern, denn soziale Mobilität, oft allerdings über mehrere Generationen hinweg, war in der Ständegesellschaft durchaus eine weit verbreitete Realität – es war keineswegs eine starre Kastengesellschaft.30 Mit der Veränderung der sozialen Realität wuchs phasenweise auch die Kritik bzw. die Selbstkritik an und in einzelnen Ständen.
Für eine systematische Einordnung solcher Beobachtungen könnte es sich anbieten, an den den programmatischen „Versuch“ über die Formierung der frühneuzeitlichen Gesellschaft anzuknüpfen, den Richard van Dülmen bereits 1981 veröffentlichte.31 Darin skizzierte er sehr komprimiert den frühneuzeitlichen Vergesellschaftungsprozess im Schnittpunkt von ökonomischer Modernisierung und Herrschaftsverdichtung. Nur vorübergehend hätten diese Entwicklungen zu einer sozialen Auflockerung und einer stärkeren sozialen Mobilität geführt, längerfristig dagegen in eine „rigid festgeschriebene und erstmals auch herrschaftlich abgesicherte Ständeordnung“ gemündet. Es sei zu einer „Verhärtung der Ständegesellschaft“ gekommen, „in der jede Gruppe und jeder einzelne erstmals eine klar definierte Rolle zugewiesen bekam, der er sich bei Verlust von Ehre und Privileg fügen musste“.32 Viele Urteile van Dülmens sind in ihrer Zuspitzung zumindest diskussionswürdig; über manches ist die Forschung inzwischen hinweggegangen. Wertvoll und in seiner Tragweite noch nicht wirklich erschlossen scheint aber die Beobachtung, dass es sich bei dieser ‚herrschaftlich abgesicherten Ständeordnung‘ um eine neue Erscheinung handelt und nicht einfach um eine Perpetuierung mittelalterlicher Ordnungsvorstellungen. Van Dülmen hat daraus nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen, wenn er den Prozess als rigide Festschreibung und Verhärtung der Ständegesellschaft versteht. Seine Interpretation orientiert sich im Stil einer [18]älteren Strukturgeschichte vorwiegend an scheinbar objektiven sozialen Lagemerkmalen. In kulturwissenschaftlicher Perspektive würde wohl die symbolische (Neu-)Konstituierung der sozialen Ordnung um und nach 1500 in der Wahrnehmung der Zeitgenossen stärker hervortreten, emblematisch verdichtet in den vieldiskutierten und auch bei von Dülmen herangezogenen Kleider- und Luxusordnungen.33 Was im Ergebnis stärker hervortreten würde, so die hier nicht weiter zu entfaltende These, wäre die Tatsache, dass die Ständegesellschaft um 1500 sich nicht einfach nur verfestigte bzw. „erstmals herrschaftlich abgesichert“ wurde, sondern dass sie in dieser Zeit eigentlich erst entsteht.
Gegenwärtig ist für uns „Gesellschaft“ als Bezeichnung für die Gesamtheit aller sozialen Bezüge und Beziehungen so geläufig, dass diese eigentlich sehr abstrakte Vorstellung fast eine gegenständlich-materielle Gestalt angenommen hat. (Gleichsam eine Bestätigung ex negativo für diese Beobachtung ist jenes ultraliberale Diktum von Margret Thatcher aus dem Jahr 1987, dass es jenseits von Individuen und Familien „no such thing as society“ gäbe.34) Im Mittelalter dagegen wurde – wie gesagt – zwar viel über einzelne ‚ordines‘ nachgedacht und geschrieben; aber das bedeutete nicht, dass sich alle Stände zueinander in Relation setzen mussten oder gar, dass die Summe aller Stände als „Ständegesellschaft“ oder ähnlich beschrieben werden konnte. Das hätte vorausgesetzt, dass sich potentiell alle Mittglieder eines Standes mit allen anderen Gliedern dieser Gesamtheit verbunden gewusst hätten und sich mit ihnen in Beziehung hätten setzen können. Das aber war keineswegs eine Selbstverständlichkeit für Akteure, deren Lebenswirklichkeiten sowohl räumlich als auch sozial oft sehr stark voneinander abgeschottet waren und viel weniger als heute ständig medial miteinander vermittelt wurden. Kleriker, Adlige und Bauern existierten stärker für sich und waren nicht ständig gezwungen, sich miteinander zu vergleichen.
‚Gesellschaft‘ in einem umfassenderen Sinn gab es mithin im Mittelalter noch nicht, lassen wir die universitas christianorum einmal außen vor. Erst um 1500 wurden die Menschen verschiedener Stände füreinander als Gesellschaft in gesteigertem Maße erfahrbar. Ein wichtiger Grund dafür lag im Prozess der Herrschaftsverdichtung und allmählichen Staatsbildung. Je intensiver der entstehende Staat alle ihm unterworfenen Glieder und Untertanen, so unterschiedlich sie hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten auch sein mochten, adressierte und zum Gegenstand obrigkeitlicher Regulierung machte, umso [19]näher rückten die einzelnen Stände aneinander, setzten sich in ein hierarchisches Vergleichsverhältnis.35 Das konnte zugleich bedeuteten, dass sie stärker als zuvor miteinander konkurrierten und sich aneinander rieben, wie die erwähnten Kleider- und Luxusordnungen des 16. Jahrhunderts bezeugen. Die Ständegesellschaft wurde für all ihre Glieder stärker erfahrbar, damit auch verhandel- und kritisierbar. Herrschaftliche Normen wurden hier zu Medien der jeweiligen sozialen Einordnung und Selbstbeschreibung. Mehr und mehr wurden solche Normen druckmedial verbreitet. Damit eröffneten sich allen Akteuren qualitativ neue Möglichkeiten zur Selbstbeobachtung der sozialen Welt, die strukturierend und verändernd wirkten.36
Als eine Frucht dieser intensivierten Selbstthematisierung mag die Konjunktur eines Begriffes gewertet werden, der die klassischen Stände überwölbte: ‚gemeiner Mann‘. Der Humanist und Chronist Aventin lieferte in den 1520er Jahren ein vorgeblich präzises Kurzportrait des gemeinen Mannes in Bayern: Dieser sitze auf dem Land, betreibe Ackerbau und Viehzucht und übe keine obrigkeitlichen Geschäfte aus; zwar sei er einem Herrn dienst- und abgabepflichtig, doch habe der sonst keine Gewalt über ihn, er sei frei, könne Waffen tragen, Wein trinken, singen, tanzen, Karten spielen, Hochzeit und Totenmahl halten – eine Charakterisierung, in der sich leichte Herablassung und grundsätzliche Anerkennung („ist ehrlich und unsträflich“) paarten.37 Umfassendere Recherchen zeigen jedoch schnell, dass dieses Bild unvollständig ist, insofern der gemeine Mann nicht nur Landbewohner, sondern auch nicht ratsfähige Bürger in den Städten umfasst.38 Weiterhin wird bei näherer Betrachtung deutlich, dass der gemeine Mann je nach Position des Betrachters perspektivisch eine unterschiedliche Gestalt annehmen konnte. Aus der Sicht der gehobenen Stände, des Adels, der Geistlichkeit und auch der herrschenden Ratseliten in den Städten war ‚gemeiner Mann‘ ein Sammelbegriff für diejenigen, die keine herrschaftlichen Funktionen ausübten, mithin für alle Untertanen. Aus der Sicht der Dorf- und Bürgergemeinde dagegen gehörten lediglich die in den Gemeindeversammlungen vertretenen Haushaltsvorstände dazu, die in diesem Kreis durchaus Stimme und Gewicht besaßen; abhängige Knechte [20]und Gesellen waren im Prinzip ebenso ausgeschlossen wie Fremde, in den meisten Fällen auch die Frauen. (Dass sich bei Aufstandsaktionen des gemeinen Mannes die Gruppe der Aktiven in sozialer Hinsicht sehr wohl nach unten und auch gegenüber den Frauen öffnen konnte, steht auf einem anderen Blatt.) Im einen Fall verbanden sich mit dem Begriff des gemeinen Mannes Wahrnehmungen von Geringschätzung und Abwertung, im anderen ein gewisses Selbstbewusstsein als Angehörige einer gleichberechtigten Gemeinschaft.
2.2.1Adel
Weiterhin blieben um 1500 die herkömmlichen Kategorien ständischer Selbstbeschreibung leitend für die Zeitgenossen, die sich als Adlige, Bauern oder Kleriker bzw. als (Stadt-)Bürger verstanden. Dabei nahmen aber nicht nur die Konflikte zwischen den Angehörigen einzelner Stände an den Rändern zu; auch die soziale Differenzierung innerhalb der einzelnen sozialen Formationen erreichte ein zuvor unbekanntes Ausmaß. Das lässt sich nicht zuletzt für den Adel ausmachen, der mit seinen vielfältigen Privilegien die ständische Ungleichheit der damaligen Zeit geradezu verkörpert.39 Zu den Hauptmerkmalen des Adels zählen, idealtypisch gesprochen, erstens seine weitgehende Verfügung über Grund und Boden, ob als direktes Eigentum oder als Lehen eines übergeordneten Herrn. Damit eng verbunden sind Verfügungsrechte über die Menschen, die diesen Boden bearbeiten, also die Bauern. Zentral ist zweitens die Teilhabe des Adels an der Herrschaft über das Land, insbesondere über seine Beteiligung an Fehden und Kriegen, aber auch über Rechtsprechung und Verwaltung. Mit beiden Aspekten der Adelsqualitäten eng verknüpft ist ein privilegierter Zugang zu weiteren Macht- und Einkommenschancen, etwa zu Ämtern, die auch wirtschaftliches Einkommen erbringen, oder zu kirchlichen Pfründen. Gesichert werden diese Privilegien drittens über die Zugehörigkeit zu einer geburtsständisch exklusiven Gruppe, eben dem Adel. Diese Zugehörigkeit ist allerdings nicht ‚einfach da‘, sondern muss ständig gepflegt, erinnert und erneuert werden, natürlich durch die Wahrung geburtsständischer Exklusivität durch entsprechende ebenbürtige Ehegattenwahl, aber auch durch die Pflege adliger Erinnerungskultur in Form von Stammsitzen und Wappentafeln, Familiengrablegen und Gedenkritualen, Ahnenportraits und Geschlechterchroniken. Viertens gehörte zu dieser Exklusivität, aber auch ein bestimmter adliger Lebensstil mit einer Verpflichtung zu Aufwand und Luxuskonsum, der Pflege typisch adliger Beschäftigungen wie Jagd und Turnieren und umgekehrt dem Verbot der Handarbeit.
[21]‚Idealtypisch‘ sind diese Bestimmungsmerkmale vor allem deshalb, weil sich die Lebensrealitäten innerhalb des Adelsstandes beträchtlich unterscheiden konnten und weil der Adel viel stärker, als es hier zum Ausdruck kommt, der historischen Entwicklung unterworfen war. Das gilt schon allein für seine Herkunft: Viele der kleineren Adligen des späteren Mittelalters leiteten sich von ursprünglich unfreien Ministerialen ab, die im Dienst großer Herren einen rasanten sozialen Aufstieg erfahren hatten. Eine andere Wurzel des niederen Adels war das Rittertum, das im hohen Mittelalter als berittenes Berufskriegertum entstanden war und sich zu einem Geburtsstand mit eigenen Aufnahmeritualen und Tugendvorstellungen entwickelt hatte. Dass diese und andere privilegierte Gruppen im Spätmittelalter sich überhaupt alle als „adlig“ verstanden und ein übergreifendes standesspezifisches Selbstverständnis entwickelten, hat zentral mit der Konkurrenz zum Bürgertum, mit der angesprochenen Entstehung der Ständegesellschaft und mit der entstehenden Staatlichkeit zu tun. Man hat sogar von einer „Erfindung“ des Adels (erst) im Spätmittelalter gesprochen.40 Dabei wurde allerdings zugleich die Grenze zwischen den hochadligen Fürsten und ihnen standesgleichen Grafen und Herren einerseits und der Masse des ‚niederen‘ Adels andererseits schärfer gezogen. Nicht deckungsgleich mit dieser Unterscheidung von ‚hohem‘ und ‚niederen‘ Adel war die Trennlinie zwischen reichsunmittelbarem und landsässigem Adel: Wer sich „dem Sog der Landesherrschaften mit ihren landständischen Verfassungen entziehen und ein direktes Verhältnis zum König bewahren und erlangen konnte“, galt als reichsunmittelbar; wer sich in eine Landesherrschaft eingliederte, wurde ‚mediatisiert‘ und war damit nur noch mittelbar dem Reich unterworfen, unmittelbar dagegen dem jeweiligen Landesherrn.41 In Gebieten ohne starke Landesherrschaften, vor allem in Franken und Schwaben, gelang es auch vielen kleinen Adligen, ihren reichsunmittelbaren Status zu verteidigen. Als korporativ verfasste Reichsritterschaft erlangten sie schließlich eine, wenn auch prekäre, verfassungsrechtliche Stellung im Gefüge des Alten Reiches. Überhaupt aber waren im Spätmittelalter zahlreiche Adelsgesellschaften entstanden, deren Mitglieder sich bei der (Selbst-)Behauptung gegenüber Städten und Landesherren gegenseitig unterstützen wollten und gemeinsam ihren adligen Lebensstil pflegten. Die bedeutendste unter ihnen bildete im 15. Jahrhundert die ‚Gesellschaft mit St. Jörgenschild‘ im Südwesten, an deren Tradition ab 1488 der ‚Schwäbische Bund‘ anknüpfen sollte.
Das Zeitalter der ‚Erfindung‘ des Adels im 15. Jahrhundert markiert zugleich, das sollte bis hierher schon deutlich geworden sein, eine Phase des Umbruchs. [22]Zwar wird die früher gängige Charakterisierung als einer Zeit der „Adelskrise“ heute eher kritisch gesehen; klar ist aber, dass sich die niederen Adligen in dieser Zeit des Umbruchs neu orientieren mussten.42 Zu behaupten hatten sich die Adligen gegen die Marginalisierungs- und Mediatisierungsbestrebungen der Landesherren ebenso wie gegen den Reichtum und die Aufstiegsaspirationen der führenden städtischen Geschlechter, die selbst nach adeliger Standesqualität strebten, zuletzt auch gegen die Emanzipationsbestrebungen ihrer bäuerlichen Hintersassen. Auch wenn allgemeine Aussagen über das Einkommen adliger Herren in jener Zeit schwierig sind, so gibt es doch den generellen Befund, dass ihr Einkommen aus Grund und Boden rückläufig war und dass sich „für viele Adlige die Schere zwischen den Einkünften und dem als notwendig erachteten Aufwand auf die falsche Seite geöffnet“ hatte.43 Aber die betroffenen Adligen waren diesen Entwicklungen nicht wehrlos ausgeliefert. Sie versuchten, die Chancen einer stärker monetarisierten und am Markt orientierten Agrarwirtschaft aktiv gestaltend wahrzunehmen, wie Franz Irsigler eindringlich am Beispiel Philipp von Menzingens gezeigt hat.44 Die Landwirtschaft war überdies keineswegs der einzige Bereich, in dem es Kompensationsmöglichkeiten für zurückgehende Einkommen von Adligen gab. Zwar war der Glanz des Rittertums mit den großen Niederlagen der Reiterheere gegen englische Bogenschützen oder Schweizer Fußsoldaten lange verblasst, aber in Gestalt von Kriegsunternehmern und Söldnerführern konnten die Adligen ihre Funktion als professionelle Krieger weitgehend behaupten. Und als herrschaftsgewohnter Stand war der Adel auch das entscheidende Reservoir für gehobene Herrschafts- und Verwaltungspositionen im entstehenden Fürstenstaat.45 Umgekehrt erforderte die neue Zeit von den Adligen ebenfalls Anpassungsleistungen, insbesondere im Bereich der Bildung. Lese- und Schreibfähigkeit wurden für Adlige wichtiger, nicht wenige von ihnen wurden vom Renaissance-Humanismus erfasst, und auch die Universitätsausbildung gewann für diesen Stand allmählich an Bedeutung. Dass dort auch Nichtadlige ihre Abschlüsse machten, macht nicht nur die angesprochene Konkurrenz der Stände sinnfällig, sondern hatte gewiss auch eine erhöhte Kritikanfälligkeit des Adels zu Folge. Gehörte es zur gängigen Legitimation dieses Standes, dass sein Herkommen gleichsam automatisch ein Mehr an Tugend verbürgte, so ließ sich dieses Argument auch herumdrehen: Wer nicht tugendhaft lebte, erwies damit, dass er in Wirklichkeit eben nicht adelig war – oder in den Worten eines [23]zeitgenössischen Spruchs: „Wer liegt in Lastern wie ein Schwein, der kann fürwahr nicht edel sein.“46
2.2.2Bauern
Wurde der Adlige in den aus der Zeit um 1500 überkommenen Schriften also durchaus gelegentlich kritisiert, so war die Herablassung, ja Verachtung, die die gehobenen Stände gegenüber den Bauern artikulierten, weit verbreitet. In unzähligen satirischen, teils offen bösartigen Texten und Abbildungen wurde das Bild vom tölpelhaft-rohen und moralisch verderbten Bauern verbreitet. So wurden ‚die‘ Bauern zu den ganz ‚Anderen‘ stilisiert, von denen es sich abzugrenzen und über die es sich zu erheben galt; zuweilen wurden sie noch nicht einmal als wirklich zur menschlichen Gattung gehörig angesehen, sondern als ‚Wilder Mann‘ (und ‚Wilde Frau‘) zum Symbol für die Natur.47 Dabei waren sich nicht nur die Bauern selbst bewusst, dass ohne ihre Arbeit die Ständegesellschaft nicht überlebensfähig war, wie schon die funktionale Anordnung der Dreiständelehre belegt. Im populären Sprichwort „Da Adam grub und Eva spann, wer war da ein Edelmann“, das ursprünglich im Zusammenhang mit dem englischen Bauernaufstand von 1381 entstanden war, wurde dieser Tatbestand mit einer deutlich adelskritischen Spitze formuliert.48 Und in den Dialogen zur Reformation wurde aus dem groben Karsthans, dem Bauern mit der Feldhacke, ein gewitzter Gesprächspartner, der die einfachen Glaubenswahrheiten des Evangeliums gegen die Vertreter des alten Glaubens wirkungsvoll zur Geltung bringen kann.
Dabei verbindet sich mit dem Begriff ‚Bauer‘ kaum eine weniger komplexe Wirklichkeit als mit dem des Adligen. Es handelt sich nicht um eine bloße Berufsbezeichnung, wie im Fall des heutigen Landwirts, sondern um eine soziale Kategorie, mit der die betreffende Person im gesamten sozialen Gefüge verortet wurde.49 Wiederum idealtypisch kann man unter dem Terminus jemanden verstehen, der im Rahmen einer selbständigen Wirtschaftseinheit, konkret: auf einer Hofstelle, mit eigener Hand und mindestens unter Mithilfe seiner Hausgenossen pflanzliche und tierische Nahrung produziert. Im Mittelpunkt steht dabei – neben verschiedenen Sonderkulturen wie z.B. Hopfen und [24]Wein – der Anbau verschiedener Getreidearten bzw. die Milchviehwirtschaft. Das war generell ein äußerst mühsames Geschäft, vor allem, weil die Produktivität der alteuropäischen Landwirtschaft sehr viel geringer war, als wir es heute kennen. Der Ernteertrag, also das Verhältnis von Aussaat und Ernte, betrug über den Daumen gepeilt in der damaligen Zeit zwischen 4:1 und 7:1, auf ein ausgesätes kamen also vier bis sieben geerntete Getreidekörner. Ein Teil davon ging – wie gleich näher zu zeigen ist – an den Feudalherrn und an den Staat, ein weiterer Teil musste für die neue Aussaat zurückgehalten werden, und lediglich vom Rest konnte sich der bäuerliche Haushalt ernähren bzw. einen Überschuss auf dem Markt verkaufen; denn bereits im Spätmittelalter handelte es sich keineswegs um eine marktferne und autarke Subsistenzwirtschaft. Noch weiter getrübt werden konnte die ökonomische Bilanz allerdings durch schlechte klimatische Bedingungen: Nach einer klimatischen Warmphase im Hochmittelalter mit demographischem Wachstum, hohen Durchschnittserträgen und einer vergleichsweise guten Ernährungssituation breiter Bevölkerungsschichten hatte im 14. Jahrhundert eine Krisenzeit eingesetzt, in der nicht nur mit dem Schwarzen Tod von 1348/49 die Pest (erneut) über Mitteleuropa hereingebrochen war, sondern auch die einsetzende ‚Kleine Eiszeit‘50 den Nahrungsspielraum der Menschen verengt hatte; die Folgen waren ein demographischer Einbruch und die Aufgabe vieler unproduktiv gewordener Siedlungen (‚Wüstungen‘). Periodisch auftretende Hungerkrisen, bei denen Missernten zu Preisanstiegen, Nachfragerückgängen und Arbeitslosigkeit führten und schließlich in einer erhöhten Mortalität mündeten, wurden für die nächsten Jahrhunderte zu ständigen Begleitern. Allerdings stieg die Bevölkerungszahl in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wieder an und eine neue Phase des Landesausbaus begann, die die Verteilungskämpfe innerhalb des Dorfes ebenso wie diejenigen zwischen Bauern und Herren verschärfte.51
Dass diese sehr holzschnittartigen Bemerkungen regional stark zu differenzieren wären, etwa in Hinblick auf die jeweilige landwirtschaftliche Kultur, die geographischen Verhältnisse oder das örtliche Erbrecht (‚Anerbenrecht‘ vs. ‚Realteilung‘), liegt auf der Hand. Diese Notwendigkeit zur Differenzierung beträfe ebenso die Frage des dörflichen Zusammenlebens und der gemeinsamen Verwaltung der Allmende, durch die das Dorf weit mehr war als die Summe gemeinsam an einem Ort siedelnder Bauern. Als eigene Körperschaft, die das Gemeineigentum verwaltete, dessen Nutzung regelte, ein Gemeinschaftsvermögen besaß, z.T. eigene Amtsträger wie Wächter oder Hirten einstellte, [25]Konflikte moderierte und kleinere Vergehen ahndete sowie die Interessenvertretung nach außen organisierte, war das Dorf ein eigenständiger Akteur der ständischen Gesellschaft, mit eigenen Vorstehern (je nach Region u.a. ‚Schultheiß‘, ‚Schulze‘, ‚Ammann‘, ‚Vogt‘ genannt), Bürgermeistern und Gemeinderäten (Rat, Schöffen, ‚Dreier‘, ‚Vierer‘ oder ‚Zwölfer‘) und periodischen Gemeindeversammlungen. Verstärkt wurde die enge soziale Verflechtung im Dorf durch die Tatsache, dass sie gewöhnlich in Gestalt der Kirchgemeinde auch eine spirituell-religiöse Dimension hatte – eine Dimension freilich, die in Form von Abgaben wiederum eine ökonomische Seite besaß. Nicht zuletzt kann das Dorf auch als Verteidigungsgemeinschaft angesprochen werden, deren Vollmitglieder in der Regel durchaus Waffen und Harnisch besaßen.52
Vollberechtigtes Mitglied der Dorfgemeinschaft war jedoch nur der Vollbauer (‚Hüfner‘, ‚Hübner‘, ‚Huber‘ o.ä.), technisch gesprochen: der Inhaber einer Hufe als derjenigen Maßeinheit, die in grauer Vorzeit einmal als Normalausstattung eines Hofes festgelegt worden war. Auch die Halb- oder Viertelbauern bzw. -hüfner mochten, je nach Region, noch unter die Besitzenden zählen. Wer dagegen nur seine Wohnstätte und vielleicht einen kleinen Garten besaß, zusätzlich noch als Tagelöhner für andere oder als Kleinhandwerker arbeiten musste, gehörte zur bäuerlichen Unterschicht und konnte als ‚Seldner‘ oder ‚Kötter‘ (die regionalen Bezeichnungen wechselten) nicht Sitz und Stimme in der Dorfversammlung beanspruchen. Die tatsächliche soziale Differenzierung im Dorf unterschied sich von Ort zu Ort wesentlich stärker, als es diese grobe Einteilung suggeriert. So wuchs auch auf dem Dorf die Zahl der Handwerker; diese konnten zu den Reicheren zählen, wie oft der Schmied, oder auch zu den Ärmeren, wie die Schuster.
Als bestimmendes Element für die Agrargeschichte jener Epoche gilt ein deutliches demographisches Wachstum ab etwa 1450.53 Im Gebiet der vergleichsweise gut dokumentierten Reichsabtei Salem wurden im Jahr 1488 gut 566 Steuerpflichtige verzeichnet, im Jahr 1505 war ihre Zahl um 105 (15,6 %) gestiegen. In Bermatingen, einem großen Dorf von 400 bis 500 Einwohnern, das im Bauernkrieg eine zentrale Rolle spielen sollte, machte der Anstieg von 86 auf 116 Steuerpflichtige sogar mehr als 25 % aus. Für ganz Oberschwaben geht die Forschung davon aus, dass die Bevölkerung ab 1450 um ca. 1 bis 1,5 % wuchs; binnen 70 Jahren könnte sie sich verdoppelt haben.54 1505 gehörte in Bermatingen jedoch zugleich ein Drittel der Einwohner zu den armen Seldnern, die [26]von der Steuer befreit waren.55 Insgesamt wuchsen die unterbäuerlichen Schichten quantitativ stark an, ließen die Vollbauern um ihre Dominanz im Dorf fürchten und die Zahl der Konflikte um die Bodenressourcen zunehmen.56 Wenn eine Hofstelle mehr Menschen ernähren musste oder im Erbgang aufgeteilt wurde, war der familiäre Wohlstand bedroht; blieb sie in der Hand des ältesten Sohnes, so mussten die jüngeren Geschwister sich u.U. anderswo nach Einkommensmöglichkeiten umsehen. Der fortschreitende Landesausbau durch die Urbarmachung wüst gefallener oder bewaldeter Flächen konnte die potentiellen Konflikte kaum vermindern, auch deren Nutzung war sowohl innerhalb des Dorfes als auch zwischen Herren und Bauern umstritten. Verstärkten Regulierungsbedarf und ein hohes Streitpotential gab es schließlich jetzt auch hinsichtlich der Nutzungsrechte für die Allmende. Im Gebiet des Reichsklosters Ochsenhausen hatte der Abt Teile der Allmende gegen Zins an Kleinbauern und Söldner verliehen und damit die Rechte der Vollbauern geschmälert. 1502 verpflichtete er sich dazu, diese Praxis aufzugeben. Im Bauernkrieg sollten dann die bäuerlichen Unterschichten gegenüber dem Schwäbischen Bund in ihren Beschwerden darauf dringen, allen Dorfbewohnern und nicht nur den Lehnbauern die Nutzung von Allmende und Wald zu gestatten.57 Das Beispiel zeigt instruktiv, dass wir für die Zeit des Bauernkriegs mindestens von einem Dreieck der Konfliktakteure in Gestalt von Herren, Vollbauern und bäuerlichen Unterschichten auszugehen haben.
2.2.3Bauern und Herren
Die soziale Spannweite im Dorf mochte sehr groß sein, aber die eigentliche Kluft auf dem Land tat sich zwischen den Bauern und den grundbesitzenden Herren auf. Denn selbst der stolze Inhaber einer vollen Hufe war im Normalfall nicht deren Eigentümer, sondern besaß nur das Recht, das Land zu bewirtschaften. Eigentlicher Besitzer des Bodens war der Grundherr, in der Regel ein Adliger, wobei aber auch kirchliche Prälaten oder städtische Institutionen wie Spitäler als Grundherren auftreten konnten. In den frühmittelalterlichen Villikationen hatte der Adlige noch vom Herrenhof aus das Land weitestgehend in Eigenregie bewirtschaftet. Später dagegen ‚verlieh‘ er dieses Land in der Regel eher an seine Bauern, damit diese es selbständig bearbeiten konnten. (Dass im Zuge der sog. ostelbischen Gutsherrschaft später die adlige Eigenwirtschaft wieder zu einer neuen Blüte kommen sollte, kann hier beiseite [27]bleiben.) Dabei gab es vielfältige und wiederum regional sehr unterschiedliche Besitz- und Nutzungsrechte für die Bauern, von einem großzügig ausgestalteten Erbzinsrecht, bei dem der Bauer sein Haus zu eigen hatte und es ebenso wie die Nutzung des dazugehörigen Grund und Bodens vererbte, bis hin zu einer rigiden Zeitpacht, bei der ein Bauer nach wenigen Jahren stets aufs Neue fürchten musste, dass der Vertrag nicht verlängert werden würde.58 Ebenso variantenreich waren die Leistungen, die der Grundherr für die Landleihe von seinen Hintersassen verlangte: Im Wesentlichen handelte es sich um Abgaben, als Naturalien oder in Geldäquivalenten, und um persönliche Hand- und Spanndienste (‚Fronen‘) für die Eigenwirtschaft oder das adlige Herrenhaus. Die Ausgestaltung dieser Leistungen fiel ebenso vielgestaltig aus wie es die Besitzverhältnisse waren.
Eine Verschärfung der bäuerlichen Abhängigkeit trat ein, wenn über diese sachlichen Abhängigkeiten hinaus eine körperliche Dimension hinzutrat, wie es bei der Leibeigenschaft der Fall war.59 Leibeigenschaft bedeutete – zusätzlich zu den Abgaben – eine Einschränkung der persönlichen Freiheit bäuerlicher Hintersassen, die nicht ohne Erlaubnis ihres Leibherrn heiraten oder einen Ortswechsel vollziehen durften. Ausdruck der persönlichen Bindung des Leibeigenen war die Tatsache, dass der Leibherr im Fall seines Todes einen Teil seines Besitzes erbte (‚Todfall‘) oder etwa das beste Stück Vieh im Stall (‚Besthaupt‘) für sich in Anspruch nehmen konnte. Die Schollenpflichtigkeit wurde von den Betroffen umso mehr als persönliche Unfreiheit empfunden, als viele Herren im 15. Jahrhundert versuchten, ihre Leibherrschaft auf immer mehr Menschen auszudehnen, um die Abwanderung ihrer Bauern in andere Herrschaftsgebiete oder in die Städte zu verhindern. In den Händen mancher Leibherren wie z.B. des Fürstabts zu Kempten wurde das Instrument der Leibherrschaft zu einem rigiden Unterdrückungsinstrument.60 In anderen Gebieten waren sowohl die materielle Belastung aufgrund der Leibeigenschaft als auch die daraus erwachsenen Einschränkungen der persönlichen Freizügigkeit weniger gravierend; und auch mit der jeweiligen sozialen Lage der Bauern hatte dieser Status nichts zu tun, d.h. Leibeigene konnten sowohl ganz arm als auch sehr reich sein.61
Damit ist die Auffächerung der bäuerlichen Abgaben noch nicht erschöpft. Hinzu kamen Leistungen an den Kirchenpatron, vor allem der Zehnt – wir werden sehen, welches Konfliktpotential er barg. Und jenseits des nahen [28]Grundherrn gab es – oft auch räumlich etwas weiter entfernt – den Landesherrn und seine Verwaltung, die nicht nur ebenfalls Abgaben von den Bauern verlangten, sondern auch im Zuge einer zunehmenden Herrschaftsverdichtung immer mehr ins Dorf hineinregierten. Insgesamt war das gesamte Dorf mit seinen Institutionen in diese grund- und landesherrlichen Bindungen verwoben. So wurde der Schultheiß, Ammann oder Dorfvorsteher in der Regel vom Herrn bestimmt oder wenigstens bestätigt. Dabei waren die herrschaftlichen Bindungen oft kompliziert: Nicht nur, dass in einem Dorf die Hintersassen mehrerer Grundherren zusammen siedeln konnten, auch die Siedlungsgemeinschaft selbst mochte zwei oder noch mehr Herren unterstehen, Grund-, Gerichts- und Kirchenherrschaft konnten auseinanderfallen u. v. a.m. Für das Dorf selbst bot diese Gemengelage durchaus auch Chancen, sich durch geschickte Kommunikation oder eine Schaukelpolitik zwischen verschiedenen Herren Vorteile zu verschaffen. So war die Interaktion zwischen Dorf und Herrschaft häufig konflikthaft, weil stark gegenläufige Interessen aufeinanderprallten. Aber auch für die Herrenseite war es im Prinzip unstrittig, dass die dörflichen Selbstverwaltungsorgane die Interessen der Gemeinschaft zu vertreten hatten – alles andere wäre auch für die Junker kaum praktikabel gewesen.
2.2.4Bürger
„Stadtluft macht frei“, so lautet der vielleicht meistzitierte Merksatz zur mittelalterlichen Stadtgeschichte: Wer aus den unfreien Verhältnissen auf dem platten Land in die schützenden Mauern der Stadt flüchtet, ist dementsprechend nach Jahr und Tag ein freier Mann. Der Satz ist keineswegs zeitgenössisch, sondern stammt aus dem 19. Jahrhundert; entsprechende Regelungen in den Quellen sind lokal begrenzt und nicht widerspruchsfrei.62 Dennoch trifft er, wiederum im idealtypischen Sinn, etwas Richtiges. Der Stadtbürger war in der Regel tatsächlich frei, insofern er die Verfügungsgewalt über seinen eigenen Körper hatte und über seinen Besitz bzw. sein Erbe (nach Maßgabe der rechtlichen Rahmenbedingungen) frei verfügen konnte. Das veranlasste viele Menschen, in der Stadt ihr Glück zu suchen und dort die feudalen Lasten des ländlichen Raums abzuschütteln. Städte und Stadtherren hatten daran durchaus Interesse, schon allein, weil die Städte auf den Zustrom von außen angewiesen waren, um demographisch zu überleben. Allerdings waren persönliche Unfreiheit und Stadtbürgerschaft keineswegs unvereinbare [29]Größen, viele Einwohner vor allem landesherrlicher Städte gerade im Südwesten des Reiches waren bzw. blieben Hörige, die unterschiedlichen Einschränkungen unterlagen, was ihre räumliche Mobilität, ihre Heiraten und sogar ihr Kapital anging.63 Außerdem fungierten viele Städte, städtische Institutionen oder einzelne Angehörige der Führungsschicht selbst als Grund- oder Leibherren der umliegenden Dörfer. Spätmittelalterliche Städte waren mithin keineswegs freiheitliche Inseln im Meer einer feudalen Umwelt, sondern Teil der Ständegesellschaft mit ihrem System abgestufter Privilegien und Rechte.
Letztlich war auch das Bürgerrecht ein solches Privileg, das einem Menschen entweder qua Geburt zukam oder das er – oft gegen einen erheblichen Betrag – später erwerben konnte; eine wichtige Voraussetzung dafür war meist der Hausbesitz. Nicht jeder konnte dieses Recht erwerben, oft waren Angehörige bestimmter Berufe oder unehelich Geborene ausgeschlossen. Der Bürgerstatus war wiederum die Voraussetzung für die volle rechtliche und politische Inklusion in das städtische Gemeinwesen. Ein Bürger partizipierte am Friedens- und Rechtsschutz der Stadt. Er musste aber auch bestimmte Pflichten erfüllen, insbesondere Steuern zahlen und Wachdienste leisten; bis in die Frühe Neuzeit hinein gehörten Waffenbesitz und Waffendienst ganz selbstverständlich zum Erscheinungsbild des Stadtbürgers.64 Nur eine Minderheit der Stadtbewohner besaß gewöhnlich diesen Bürgerstatus, daneben gab es Einwohner minderen Rechts (Beisassen), rechtlich aus dem Stadtverband ausgenommene Menschen wie Kleriker, Adlige und Universitätsangehörige, ganz zu schweigen von den nur zeitweilig in einer Stadt anwesenden Reisenden und Gästen. Frauen hatten als Ehefrauen indirekt teil am Bürgerstatus ihrer Männer, nur Witwen besaßen ihn direkt.
Nicht nur rechtliche Differenzen generierten oder zementierten soziale Ungleichheiten. In größeren Städten konzentrierte sich der überwiegende Teil des Vermögens bei wenigen Fernhändlern und Großkaufleuten, während die Masse auch der Zunfthandwerker kaum finanzielle Rücklagen besaß und spätestens bei der nächsten Krise von Armut bedroht war. So werden manchmal über 50 % der Steuerpflichtigen zur Unterschicht gerechnet und bildeten im Wortsinn ein Prekariat. Wohlhabendere Handwerker, kleinere Krämer, Amtsträger und städtische Bedienstete bildeten eine vergleichsweise dünne Mittelschicht. Zur Veranschaulichung eine willkürlich herausgegriffene Zahl: In Augsburg hielt eine kleine Oberschicht von 104 Personen, das sind 2,3 % aller [30]Steuerpflichtigen, über 60 % des gesamten Steuervermögens in den Händen.65 Entsprechend offenkundig war die soziale Polarisierung. Häufig pflegten die reichsten Familienverbände in der Stadt ein ähnlich elitäres Selbstverständnis wie das Patriziat in Nürnberg, wo einige wenige ‚edle Geschlechter‘ qua Geburt die Sitze im engeren Rat und andere Privilegien für sich beanspruchten. In ihrem Lebensstil orientierten sich diese Geschlechter eher am Landadel und suchten nicht selten über entsprechende Heiraten auch den Anschluss dorthin.66 Am anderen Ende der sozialen Skala finden sich nicht nur die prekär lebenden bürgerlichen Unterschichten, sondern auch die vielen Menschen ohne Bürgerrecht, Knechte und Mägde, Tagelöhner oder Angehörige vagierender Randgruppen.
Die städtische Politik spiegelte in gewisser Weise diese extremen sozialen Unterschiede. Regiert wurden die Bürger in mittleren und größeren Städten von einem Ratsgremium, das für fast alle Belange des Lebens in der Stadt zuständig war, gleichsam von der Außenpolitik bis hin zur Latrinenreinigung. Gewöhnlich setzte es sich aus Sprösslingen reicher Familienverbände zusammen, die für eine solche Tätigkeit ‚abkömmlich‘ waren, indem sie nicht von ihrer Hände Arbeit leben mussten. Entsprechend wenig demokratisch waren die Regularien der damaligen Ratswahl nach unseren heutigen Maßstäben ausgestaltet. Oft erkor der Rat seine neuen Mitglieder selbst, d.h. er kooptierte sie einfach in seine Reihen. Besaßen die Zünfte oder die Stadtviertel das Recht, den Rat oder zumindest einen Teil davon zu wählen, so waren die Auswahl der Kandidaten und der Wahlvorgang selbst eine hoch ritualisierte Angelegenheit, die mit echter politischer Konkurrenz zwischen verschiedenen Lagern wenig zu tun hatte. Die wichtigsten Etappen vollzogen sich ohnehin auf der Hinterbühne. Dennoch zeigen sich hier wichtige Unterschiede zum Leben auf dem Lande. Es war ein kollektives Gremium, das über die Bürger regierte – ein Gremium zumal, das auf den Konsens der Bürgergemeinde angewiesen war, wie formell oder rituell dieser Konsens auch immer zum Ausdruck gebracht wurde. Rein formal handelte es sich zudem lediglich um Herrschaft auf Zeit (in der Regel für ein Jahr), auch wenn sich die neue Amtszeit mehr oder weniger bruchlos anschloss und es sich bei den neu ins Amt kommenden Ratsherren meist um die alten handelte. Im komplexen Ratswandel verdichtete sich performativ gleichermaßen die Bedrohung und die Bekräftigung der städtischen Ordnung.67
Die Teilhabe an der städtischen Macht verblieb für die meisten Mitglieder normalerweise auf einer abstrakt-symbolischen Ebene. In vielen Städten gab es [31]immerhin ‚Große Räte‘ als zusätzliche Vertretungsorgane der Bürgergemeinde, die zwar faktisch nur selten zusammenkamen, aber die Legitimationsbasis von Entscheidungen in wichtigen Fragen, etwa bei der Erhebung von Sondersteuern oder bei Kriegserklärungen, verbreitern sollten. In der Regel unterstützten sie so den inneren Zirkel der Macht bei der Durchsetzung seiner Politik und besaßen noch nicht einmal die Berechtigung, ohne Einvernehmen der Ratsherren zusammenzutreten. In Krisenzeiten allerdings, wenn sich der Unmut der Stadtbewohner über drückende Schulden, hohe Steuern oder Korruptionsgerüchte verdichtete, gewannen Gemeindevertretungen eine eigenständige Handlungsmacht. Außerordentliche Gemeindeausschüsse, von den Zünften oder Stadtvierteln paritätisch besetzt, wurden gewählt, formulierten die vielfältigen Beschwerden und vertraten sie gegenüber dem Rat. Auf diese Weise hatten sich in den Zunftunruhen und Bürgerkämpfen des späten Mittelalters vielfach die nachrückenden Eliten und sogar die Handwerker mehr Mitspracherechte in etlichen Städten erkämpft.68