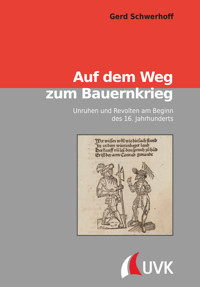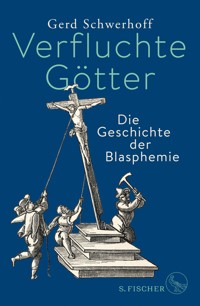
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner großen Geschichte der Gotteslästerung von der Antike bis heute zeigt der Historiker Gerd Schwerhoff, wie sehr Blasphemie die Menschen seit jeher bewegt. Die weltweite Empörung über die Mohammed-Karikaturen und der Terroranschlag auf »Charlie Hebdo« 2015 haben deutlich gemacht: Gotteslästerung ist kein Relikt der Inquisition, sie ist heute aktueller als vor hundert Jahren. Wer herabsetzt, was für andere heilig ist, muss mit heftigen Reaktionen rechnen. Und wer sich gegen blasphemische »Hassreden« wehrt, kann viele Anhänger mobilisieren. Gerd Schwerhoff erklärt, warum Menschen seit mehr als 2000 Jahren Gott, Propheten oder Heilige beleidigen. Und warum diese Worte und Taten die Gemüter so sehr erregen. Wir begegnen fluchenden, lästernden Bauern oder Reformatoren, die Marienfiguren und andere Heilige beleidigen und dafür mit dem Tod bestraft werden. Und wir lesen, wie der Aufklärer Voltaire gegen die Bestrafung der Gotteslästerung argumentiert, aber auch, warum eine junge Frau der Gruppe Femen vom Kölner Domkapitel wegen Verletzung religiöser Gefühle angezeigt wurde. Fast immer werden die »da oben« werden von denen »unten« geschmäht. Es geht um Ohnmacht und Wut, gegen die Herrschenden, gegen einen scheinbar gleichgültigen Gott oder gegen andere Religionen. Und so sieht man auch die jüngsten Blasphemie-Fälle mit anderen Augen: Die Grenze zwischen Spott und Beleidigung ist fließend, die Schmähung ist immer Teil eines größeren Konflikts - und sie kann in extreme Gewalt münden. Ein großer, souverän erzählter Bogen von der Antike (mit Judentum und frühem Christentum), über Mittelalter und frühe Neuzeit (mit Inquisition, Ketzerei und Reformation) bis zur Aufklärung und den aktuellen Konfrontationen im Spannungsfeld zwischen Christentum, Laizismus und Islam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gerd Schwerhoff
Verfluchte Götter
Die Geschichte der Blasphemie
Über dieses Buch
Die erste umfassende Geschichte der Gotteslästerung von der Antike bis heute
Gotteslästerung bewegt die Menschen. Die weltweite Empörung über die Mohammed-Karikaturen und der Terroranschlag auf die Redaktion von »Charlie Hebdo« 2015 haben gezeigt: Blasphemie ist ein hochaktuelles Thema. Wer herabsetzt, was für andere heilig ist, muss mit heftigen Reaktionen rechnen. Und wer sich gegen blasphemische »Hassreden« wehrt, kann viele Anhänger mobilisieren.
Gerd Schwerhoff zeigt, was die Gotteslästerung in unterschiedlichen Epochen und Gesellschaften ausmachte, was sie bewirkte, wer sie beging und wie gegen Gotteslästerer vorgegangen wurde. Dabei erzählt er erstaunliche Geschichten und eröffnet zugleich einen neuen Blick auf die heute so verbreiteten populistischen Schmähungen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Gerd Schwerhoff, geboren 1957, ist Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Technischen Universität Dresden. Seine Bücher handeln von den Randfiguren der frühneuzeitlichen Gesellschaft – Kriminellen, Hexen oder Ketzern. Mit der Blasphemie beschäftigt er sich u. a. im Rahmen des Sonderforschungsbereichs »Invektivität. Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung«, dessen Sprecher er ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: INTERFOTO / Mary Evans
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491097-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Antike Fundamente
1. Der eifersüchtige Gott
2. Blasphemie im Polytheismus?
3. Kampf der Götter
Judentum
Herrscherkult
Christentum
4. Das Christentum an der Macht
Die Ausgrenzung der anderen
Justinian und die Geburt eines Delikts
Streit unter den Kindern Abrahams
5. Juden – das gotteslästerliche Volk
6. Muslime – den Propheten lästern
Mittelalter: Das Zeitalter der Zungensünden
7. Die Beleidigung Gottes als Sünde und Verbrechen
8. Blasphemie als soziale Praxis
Lästerliche Worte: Was war Gotteslästerung?
Soziale Inszenierungen: Wer waren die Gotteslästerer?
9. Lästernde Ketzer – ketzerische Lästerer
Frühe Neuzeit: Blasphemie im Glaubensstreit
10. Die Disziplinierung der Eigenen
11. Die Stigmatisierung der anderen
12. Bild und Blasphemie
13. Obszönität und Blasphemie
Umkämpfte Blasphemie
14. Gestaltwandel in der Aufklärung
Religion, Vernunft und Recht
Deutschland: Die aufklärerische Debatte
Großbritannien: Allmähliche Grenzverschiebungen
Frankreich: Eine skandalträchtige Affäre
15. Repression und Skandalisierung in der Moderne
Frankreich: Radikaler Antiklerikalismus
Großbritannien: Blasphemie als politische Waffe
Deutschland I: Kunst und Politik im Kaiserreich
Deutschland II: Heilige Gefühle in Weimar
16. Vor 1989: Rückzugsgefechte gegen den Zeitgeist?
Im globalen Zeitalter der Blasphemie
17. Globale Konflikte im Zeichen der Gotteslästerung
1989: Satanische Verse
2004: Mord in den Niederlanden
2005: Bilder des Propheten
2015: Tödliche Karikaturen
18. Religiöse Intoleranz und politische Repression
Blasphemieanklagen als Unterdrückungsinstrument
2012: Ein Punk-Gebet in Moskau
19. Westliche Reaktionen und Reflexionen
Rückschau und Ausblick
Dank
Auswahlbibliographie
Abbildungsnachweis
Register
Einleitung
Rückblickend betrachtet markiert der 14. Februar 1989 eine wichtige Zäsur der jüngeren Geschichte. An diesem Tag veröffentlichte Ayatollah Khomeini, das geistliche Oberhaupt des Iran, sein Todesurteil über Salman Rushdie und alle seine Unterstützer. Niemand solle künftig mehr die heiligen Güter der Muslime so verächtlich machen, wie es der Verfasser des Romans »Die satanischen Verse« getan habe.[1] Die Nachricht fand weltweit Aufmerksamkeit, sie begeisterte die Anhänger des Ajatollah und empörte seine Gegner. Trotzdem hätte damals kaum jemand das Verdikt des Greises mit dem langen Bart als epochemachend betrachtet, eher als eine skurrile Arabeske der Weltgeschichte. Schon bald richteten sich alle Augen auf den atemberaubenden politischen Wandel in Osteuropa. In Polen und Ungarn war er am Jahresanfang bereits deutlich erkennbar, und am 9. November sollte er mit der Öffnung der Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland seinen dramatischen Höhepunkt erreichen. Bereits im Sommer dieses Epochenjahres rief der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama »Das Ende der Geschichte« aus und verkündete den dauerhaften Sieg der liberalen Demokratie und Wirtschaftsordnung.[2] Kurzfristig konnte er sich mit seiner Prophetie angesichts des dramatischen Endes der Ost-West-Konfrontation bestätigt fühlen. Schon bald allerdings sollte sie sich als kapitale Fehldiagnose entpuppen.
Fukuyamas ehemaliger Lehrer Samuel P. Huntington stellte ihr deshalb wenige Jahre später seine ebenso plakative These über den »Kampf der Kulturen« entgegen: Für ihn waren widerstreitende kulturelle und religiöse Identitäten der Motor dieses clash of civilizations, nicht der alte ideologische Gegensatz zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Vor allem der Gegensatz zwischen ›der‹ westlichen Welt und ›dem‹ Islam rückte ins Zentrum der Debatte. Zum schrecklichen Sinnbild des globalen Kulturkonflikts wurden am 11. September 2001 die einstürzenden Türme des New Yorker World Trade Centers. An seinem Beginn aber hatte die Blasphemie-Anklage gegen Rushdie gestanden, als Menetekel eines neuen, ganz und gar nicht glorreichen Zeitalters. Das Motiv der Gotteslästerung blieb auch in den nächsten Jahrzehnten ein zentraler Kristallisationspunkt des vermeintlichen Kulturkonflikts zwischen Okzident und Orient. Die Konfrontation wurde sogar zunehmend dramatischer, von den Mohammed-Karikaturen im Jahr 2005 bis zum grausamen Fanal des Attentats, das zwei Islamisten am 7. Januar 2015 auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo verübten.
Blasphemie – ein Thema von ›vorgestern‹ ist uns schnell wieder sehr gegenwärtig geworden, ja es lässt sich sogar als eine typische Signatur der Gegenwart lesen. Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde es vornehmlich in gelehrten Studierstuben verhandelt. In öffentlichen Debatten schien es allenfalls im Zuge von Rückzugsgefechten einiger unverbesserlicher Traditionalisten aufzutauchen. Gesetzliche Regelungen zum Schutz der Religion, wie in Deutschland in Gestalt des Paragraphen 166 StGB, führten ein wenig beachtetes Schattendasein. Im Zuge der Rushdie-Affäre belebte sich die Diskussion innerhalb des westlichen, christlich geprägten Kulturkreises wieder. Vielen Beobachtern erschien dabei die Gotteslästerung als eine Art Wiedergänger aus vormodernen Epochen, ein Zombie, dem mit einigen kräftigen Hieben des aufklärerischen Flammenschwertes endgültig der Garaus gemacht werden müsse. In den aufkeimenden Debatten wurde die Möglichkeit blasphemischen Sprechens und Handelns meist als eine genuin moderne Erscheinung betrachtet, als eine Frucht von Säkularisierung und Liberalismus. »Als das Christentum noch groß und stark war«, so formulierte es der Religionsphilosoph Christoph Türcke, »bedeutete Verhöhnung der Religion so viel wie Widersetzlichkeit gegen die höchste Wahrheit – und schien deshalb so ungeheuer verwerflich, weil vollkommen unvernünftig und selbstzerstörerisch.« Das habe sich mit der Aufklärung geändert: Zwar seien Aufklärung und Blasphemie nicht identisch, aber »Aufklärung sieht Blasphemie manchmal zum Verwechseln ähnlich. Spott dringt, wenn er ins Schwarze trifft, tiefer als jede andere Form von Kritik.« Oder anders: »Aufklärung, die etwas taugt, tut weh; sie kommt bisweilen nicht umhin, religiöse Gefühle zu beleidigen.«[3] Aber, so räumte der Philosoph ein, für Muslime sei der blasphemische Spott womöglich ein westlicher Zwangsimport, der in ihrem Erfahrungshorizont nur schwer von Imperialismus und Kolonialismus zu unterscheiden sei.[4]
Türckes Text zur ›Blasphemie‹ erschien wenige Jahre nach der Rushdie-Affäre. Er war Auftakt einer Serie von Essays zur ›Religionswende‹, die ihrerseits wiederum als Indikator verstanden werden kann für eine neue Bedeutung des Religiösen im öffentlichen Diskurs. Seither wurde die Diagnose, dass rund um den Globus eine Renaissance der Religionen stattgefunden habe, wissenschaftliches und publizistisches Allgemeingut. Sie verdichtete sich in der schon sprichwörtlichen »Wiederkehr der Götter« (F.W. Graf). Dass die Gotteslästerung als Thema in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zurückkehrte, ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen. Beide Diskussionsstränge, eine erhöhte Sensibilität für Religiöses und eine Debatte um kulturelle Identitäten, verstärkten sich gegenseitig. Christliche Stimmen, die Schutz vor Blasphemie anmahnten, artikulierten sich wieder vernehmlicher.
Die Blasphemie, so wird direkt deutlich, ist mehr als eine Randerscheinung. Wer über Gotteslästerung debattiert, verhandelt zugleich zentrale Probleme der Gegenwart: Fragen der religiösen und kulturellen Identität ebenso wie der Meinungsfreiheit und Toleranz. Die Geschichte ist bei all diesen Debatten – mal offen, mal hintergründig – präsent, oft als dunkles Gegenbild, vor dem sich die helle Gegenwart umso besser in Szene setzen lässt. Schon das ist Grund genug, diese Geschichte genauer zu betrachten. Der Blick zurück hält Einsichten bereit, die mit gängigen Bildern nur schwer in Einklang zu bringen sind. Mit ihrer Hilfe wird auch die Gegenwart besser verständlich.
Nun gibt es bereits etliche historische Darstellungen über Gotteslästerung, und ihre Zahl hat angesichts der Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit noch einmal deutlich zugenommen.[5] Ohne diese Vorarbeiten wäre das vorliegende Buch nicht möglich gewesen. Aber wirklich zu befriedigen vermag kaum eine von ihnen. Viele behandeln trotz eines allgemeinen Titels nur einen kleineren Ausschnitt. Hinzu kommen Probleme, das Thema terminologisch und sachlich in den Griff zu bekommen. Vielfach geht es eher um eine Geschichte der Ketzerei oder der politischen Repression, der Meinungsfreiheit und der Toleranz. In diesen Fällen verbinden Autorinnen und Autoren mit ihren Büchern ein aufklärerisches Anliegen, etwa die Verteidigung der liberalen Gesellschaft gegen Unterdrückung und Intoleranz. Daran ist solange nichts auszusetzen, wie nicht moderne Kategorien und Werte in Epochen zurücktransportiert werden, die diese noch gar nicht kannten. Wenn das geschieht, wird das Verständnis für die Vergangenheit eher behindert. Was in früheren Epochen als Gotteslästerung bezeichnet wurde, ist für uns Heutige oft ein fremdes Phänomen. Erst wenn wir uns bemühen, es in seiner Andersartigkeit zu verstehen, werden wir den historischen Wandel hin zur Gegenwart begreifen; das schließt im Übrigen weder Parallelen zwischen damals und heute aus noch Lehren, die man für den interkulturellen Dialog aus der Geschichte ziehen kann. Aus diesen Gründen folge ich hier eher dem Leitbild einer kühlen, jedenfalls distanzierenden Analyse des ›heißen‹ Themas Blasphemie. Werturteile lassen sich aus geschichtlichen Darstellungen ohnehin kaum direkt ›ableiten‹, sie bleiben der persönlichen Beurteilung überlassen. Persönlich würde ich im Zweifelsfall, so viel Bekenntnis zu Beginn darf sein, der Äußerungsfreiheit stets den Vorrang gegenüber dem Schutz individueller oder kollektiver Empfindlichkeiten einräumen. Strafgesetze sind ein untaugliches Mittel, um religiöse Gefühle zu behüten.[6] Gerade deswegen habe ich mich bemüht, den Motiven derjenigen Menschen nachzuspüren, die dazu eine andere Haltung hatten und haben.
Eine distanzierende Annäherung an das Thema Blasphemie verspricht für neugierige Leser Erkenntnisgewinn jenseits eingefahrener Wahrnehmungen, daneben durchaus auch Unterhaltung. Denn es gibt nicht nur tragische Schicksale zu studieren, wie den Fall des jung hingerichteten Chevalier de la Barre 1766 oder des durch seinen Prozess gebrochenen Schriftstellers Oskar Panizza Ende des 19. Jahrhunderts. Gestaunt werden darf über die rüden Lästerungen eines James Taylor 1675 oder über die französische Dichtung jenes Jahrhunderts, in der Religion und Sexualität bisweilen eine blasphemisch anmutende Mischung eingehen. Mindestens ebenso aufschlussreich erscheinen die Reaktionen des sozialen Umfelds und der Obrigkeit auf lästerliche Sprechakte. Schließlich geben auch die kontroversen Debatten über den Charakter und die Strafbarkeit von Blasphemie tiefe Einblicke in das Denken der jeweiligen Epoche.
Rückt man lästerliche Praktiken und ihre zeitgenössische Beurteilung ins Zentrum der Betrachtung und nicht, wie gewohnt, Glaube und Frömmigkeit, dann erscheint die Religiosität der Menschen in der ›Vormoderne‹ in ungewohntem Licht. Auf Schritt und Tritt begegnet uns in dieser Zeit gotteslästerliches Verhalten. Das deutet keineswegs auf Gottesferne hin, im Gegenteil. Denn das Christentum scheint damals eben auf andere Art als heute »groß und stark« (Christoph Türcke) gewesen zu sein.
Das erkannte vor rund einhundert Jahren bereits der niederländische Mediävist Johan Huizinga in seinem großen Zeitgemälde vom »Herbst des Mittelalters«. Er machte gerade die allgegenwärtige Religiosität der Zeitgenossen für die Lästerungen verantwortlich: »Das ganze Leben war so von Religion durchtränkt, dass der Abstand zwischen dem Irdischen und dem Heiligen jeden Augenblick verlorenzugehen drohte.«[7] Huizinga charakterisierte auf diese Weise sehr gut das Verhalten jenes alten maltesischen Fischers mit Namen Giovanni, das dieser noch im 18. Jahrhundert pflegte: Er fastete jeden Montag, Mittwoch und Samstag, und er begann seinen Tag damit, die Jungfrau Maria, die Heiligen sowie die Seelen im Fegefeuer um Hilfe anzurufen. Aber er scheute sich nicht, Gott zu verfluchen, wenn ihm nicht genügend Fische ins Netz gingen.[8] Wer vertraulich mit Gott und dem Heiligen verkehrte, überschritt leicht die Grenze zum Profanen. Dieser vertrauliche Umgang wurde keineswegs, um ein anderes gängiges Klischee anzusprechen, stets mit kapitalen Leib- und Lebensstrafen belegt. Diese waren zweifellos eine reale Gefahr, aber es existierte ebenso eine weitverbreitete Kultur der Entschuldigung und Bagatellisierung, des Wegsehens bzw. Weghörens und der Ignoranz. So ist das Spektrum der Akteure, denen wir bei unserem Gang durch Zeit und Raum begegnen werden, erheblich: Wir treffen Fanatiker und Puristen ebenso wie gelehrte Spötter und raubeinige Spieler.
Blasphemie kann definiert werden als Schmähung und Herabwürdigung des Heiligen. Im Mittelpunkt der vorliegenden Geschichte stehen deshalb herabsetzende Sprechakte und ihre zeitgenössische Bewertung.[9] Dieser Ansatz mag ebenso schlicht wie selbstverständlich anmuten, aber das ist er keineswegs. Oft wird über Definitionsprobleme geklagt und einer klaren Begriffsbestimmung ausgewichen. Oder Gotteslästerung wird in erster Linie als ›Meinungsäußerung‹ verstanden.[10] Das führt vollkommen in die Irre, auch wenn Meinungsäußerungen in der Gestalt der Schmähung daherkommen bzw. als blasphemisch stigmatisiert werden können. Blasphemie ist in erster Linie eine spezielle Variante sprachlicher und symbolischer Herabsetzung, die man in der gegenwärtigen Forschung mit dem Konzept der »Invektivität« zu fassen versucht.[11] So verstanden, wird die Aktualität des Themas noch einmal unterstrichen. Denn Schmähungen und Beleidigungen, Hassreden und sprachliche Diskriminierung erscheinen gegenwärtig geradezu als eine Signatur des angebrochenen Jahrtausends, der angebliche clash of cultures ist hier nur eine Facette unter vielen anderen.
Populistische Akteure vom Schlage eines Donald Trump benutzen äußerst erfolgreich eine Strategie systematischer Herabsetzung, um Gegner zu stigmatisieren und die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Häufig scheint die internationale Politik weniger von diskreter Diplomatie gekennzeichnet als von lautstarker Feindsetzung. Extreme Schmähkampagnen haben fast allen Krisen der jüngeren Zeit ihren Stempel aufgedrückt, von den Finanz- und Schuldenkrisen bis zum Brexit. In den Diskussionen und Aktionen rund um das Thema »Vertreibung und Migration« sind abwertende Stereotype und rassistische Zuspitzungen allgegenwärtig. Die Konjunktur von hate speech und shitstorms basiert ganz wesentlich auf den neuen digitalen Kommunikationsformen, insbesondere den sozialen Medien. Allenthalben wird geschmäht, aber allenthalben werden diese Schmähungen auch kritisiert. Mit der Allgegenwart rauer und herabsetzender Sprache scheint zugleich die Empfindlichkeit ihr gegenüber zu wachsen. Im öffentlichen Raum herrscht eine große Sensibilität gegenüber sprachlicher Abwertung und Ausgrenzung von Menschen aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder anderer (zugeschriebener) Eigenschaften. Diese Sensibilität ruft ihrerseits wiederum kritische Stimmen gegen eine vermeintlich ideologiegeleitete political correctness auf den Plan. Vor diesem hier nur angedeuteten Hintergrund erscheinen die Schmähung Gottes und die Herabsetzung des Sakralen weit weniger exotisch als auf den ersten Blick angenommen.[12]
So einfach die Ausgangsdefinition der Blasphemie ist, so unmöglich ist eine wirklich präzise Erfassung dessen, was als ›Heiliges‹ herabgesetzt wird – zu sehr variieren die Adressaten der Gotteslästerung in Zeit und Raum. Es kann sich um die Verletzung Gottes oder konkreter Heiliger in Person handeln, ebenso aber um die Herabsetzung heiliger Bilder, Gegenstände oder Symbole. Die Adressaten der Schmähungen scheinen, abstrakter gesprochen, in einer Sphäre von Transzendenz angesiedelt zu sein (bzw. zu werden), jenseits jener menschlichen Arenen, in denen gewöhnlich Schmähungen zwischen Normalsterblichen ausgetauscht werden. Insofern liegt in der Blasphemie ein Moment der Anmaßung, eine Verfügbarmachung des Unverfügbaren bzw. eben die Unterstellung einer solchen Anmaßung.[13] Umgekehrt ist mit dem Vorwurf der Gotteslästerung die Anklage verbunden, dass etwas oder jemand Besonderes herabgewürdigt wird. Damit ist eine solche Anklage gewöhnlich zugleich eine Maßnahme, um das angegriffene Heilige zu erhöhen. Offenkundig wird in den Debatten um Blasphemie also stets über die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Profanen verhandelt. Im Streit um Gotteslästerung wird diese Grenze immer wieder neu produziert, definiert, oft auch verschoben. Nicht zuletzt davon handelt das vorliegende Buch.
Auch wenn in der modernen westlichen Welt ein relativer Bedeutungsverlust der Religion verzeichnet werden kann, so heißt das keineswegs, dass zugleich die Schmähung des Heiligen in einem weiteren Sinne generell an Bedeutung verlieren muss. Ich werde im Schlusskapitel auf diesen Punkt zurückkommen.
Was bedeutet es nun genau, Blasphemie als Schmähung des Heiligen zu verstehen? Was überhaupt ist eine Schmähung? Im allgemeinsten Sinn lässt sich Schmähung als Verletzung definieren, die Personen durch Worte, Gesten oder andere symbolische Akte zugefügt wird.[14] Bei dieser Verletzung handelt es sich nicht um eine physische Wunde, sie verursacht keinen direkten körperlichen Schmerz. Natürlich gibt es zahlreiche Grenzfälle: So kann eine Ohrfeige körperlich sehr weh tun, aber in vielen Fällen wird die symbolische Erniedrigung, die sie verursacht, schwerwiegender erscheinen als der physische Schmerz. Offensichtlich besitzt der Mensch neben dem physischen Leib auch einen zweiten, einen sozial-symbolischen Körper, der durch Worte verletzt werden kann.
Damit ist aber noch nicht gesagt, wie sprachliche Verletzungen genau funktionieren. Der Sprachphilosophie sind sprachliche Akte vertraut, mit denen man nicht nur eine Aussage macht, zum Beispiel etwas beschreibt, sondern mit denen man etwas »tun« kann. John Austin bezeichnet sie in seinen klassischen Vorlesungen »How to do things with words« als performative Sprechhandlungen. Als Beispiele dienen ihm Taufen (»Ich taufe dich auf den Namen …«) oder Trauungen (»Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau«). Hier liegt der Vollzug des Sprechaktes gleichsam in sich selbst; mit der korrekten, von der ›richtigen‹ Person gesprochenen Formel ist die Taufe vollbracht bzw. die Ehe geschlossen. Bei einer Schmähung, einer Beleidigung oder einer Gotteslästerung ist das anders. Eine Ansage wie: »Hiermit beleidige ich dich!« würde wohl eher Heiterkeit hervorrufen. Ebenso würde heute eine Ansage wie »Ich lästere (oder blasphemiere) Gott!« kaum funktionieren.[15]
Auch ein gängiges Schimpfwort ist demzufolge keine verbale Waffe in dem Sinne, dass sie bei entsprechendem Gebrauch eine Verletzung hervorrufen wird, wie ein Messer oder eine Pistole. Schon zwischen Sprecher und Adressat gibt es eine breite Palette möglicher Interpretationen derartiger Worte, etwa aufgrund einer großen Bandbreite von Abstufungen (zwischen »Halbdackel« und »Riesenarschloch«). Doch auch die Intentionen des ›Absenders‹ sind sehr vielfältig (»Das soll an die Schmerzgrenze gehen!«, »War nicht so gemeint!«, »Das habe ich nicht gewollt!«), und sie treffen auf unterschiedliche Grade der Empfindlichkeit beim Empfänger. Vermeintlich eindeutige Schimpfworte können schnell ihre klare Bedeutung verlieren, eine rüde Beleidigung kann durchaus als eine vertrauliche Anrede dienen. Umgekehrt können Äußerungen, die oberflächlich neutral erscheinen, ein subtiles, aber dennoch wirksames Verletzungspotenzial in sich bergen, wenn sie Unhöflichkeiten, Anspielungen oder beschämende Geschichten enthalten. So verliert sich die Eindeutigkeit einer Schmähsituation bei näherem Hinsehen schnell.
Hier zeigt sich eine generelle Eigenheit menschlicher Kommunikation: Sie erfolgt – soziologisch gesprochen – unter der Bedingung doppelter Kontingenz. Meist wird das mit dem Bild der beiden idealtypischen Akteure (»Ego« und »Alter«) in der Interaktion von Angesicht zu Angesicht deutlich gemacht: Eigentlich kann kein Handeln und somit keine soziale Ordnung zustande kommen, »wenn Alter sein Handeln davon abhängig macht, wie Ego handelt und Ego sein Verhalten an Alter anschließen will«.[16] Vollkommene soziale Lähmung wäre die Folge. Deswegen sind die beiden Partner gezwungen, sich über den Sinn ihrer Kommunikation in einem tastenden Prozess zu verständigen, in dem sie fortwährend ihre Erwartungen, Erfahrungen und kulturellen Horizonte abgleichen. Erst durch diesen Verständigungsprozess konstituiert sich überhaupt eine soziale Welt. Das Modell macht plausibel, wie groß die Interpretationsspielräume gerade im Fall von (unterstellten) Beleidigungen sind: Sie reichen von der Rechtfertigung (»Sie haben angefangen!«) bis zur Leugnung einer Schmähung, von der demonstrativen Verletztheit (»Das ging jetzt aber wirklich zu weit!«) zur tapferen Erduldung, von der Skandalisierung zur Ironisierung.
Dabei gelangt die modellhafte Vorstellung von »Ego« und »Alter«, die in einer Art sozialem Vakuum kommunizieren, schnell an ihre Grenzen. Denn einerseits handelt es sich bei den jeweiligen Akteuren nicht um abstrakte Personen, sondern um Männer und Frauen, Reiche und Arme, Menschen unterschiedlicher Zugehörigkeit und Herkunft, deren Worte in sehr verschiedener Weise Macht gewinnen können. Zentral ist dabei nicht zuletzt der jeweilige soziale und kulturelle Kontext: Ein extremes Beispiel sind die rituellen Schimpfwettkämpfe junger Afroamerikaner in amerikanischen Metropolen. In einem typischen sound versuchen sie, einander mit vulgären und phantasievollen Beleidigungen zu überbieten, die in anderen Kontexten als extrem rassistisch gelten würden.[17] Andererseits sind, wie meist in Kommunikationssituationen, bei Schmähungen und Beleidigungen in der Regel Dritte im Spiel: Diese können Parteigänger einer der beiden kommunizierenden Personen sein, die durch die Schmähungen mobilisiert oder angegriffen werden sollen. Oder es existiert ein zunächst neutrales Publikum (womit Öffentlichkeit hergestellt ist), das vielleicht später Partei ergreift oder auch zu schlichten versucht. Dieses Publikum muss nicht körperlich anwesend sein, denn eine Schmähung kann auch medial, über einen Brief, eine Druckschrift oder einen elektronischen Kommunikationskanal verbreitet werden und eine Vielzahl von unterschiedlichen Menschen erreichen. Schmähungen können sich auf diese Weise vollkommen von ihrem Ursprungszusammenhang lösen und in einem anderen Kommunikationszusammenhang ein Eigenleben gewinnen.
Bereits hier wird deutlich, wie sehr diese Beobachtungen unserem Alltagsverständnis von verbaler Herabwürdigung widersprechen. Wir neigen dazu, die Intentionen und Motive eines Sprechers zum entscheidenden Maßstab dafür zu erheben, ob überhaupt eine Schmähung vorliegt, als wie gravierend sie einzuschätzen ist, welche Reaktion darauf angemessen erscheint etc. Die vorstehenden Überlegungen dagegen legen den Gedanken nahe, dass die Interpretation einer Schmähung gar nicht so sehr vom ursprünglichen Kommunikationsakt abhängt, sondern viel mehr von den sich daran anschließenden Verhandlungen zwischen vielen möglichen Beteiligten und Betroffenen. Erst diese »Anschlusskommunikation« entscheidet darüber, ob eine verbale oder symbolische Herabsetzung vorliegt und wie sie zu bewerten ist.[18] Nicht erst in der politischen Landschaft der Gegenwart bleibt die Einlassung eines Akteurs, er habe eine Äußerung »gar nicht so gemeint«, weitgehend wirkungslos, wenn einflussreiche Meinungsmacher sie als beleidigend bewerten oder die öffentliche Wahrnehmung in diese Richtung geht. Die Blasphemie war und ist dafür ein treffendes Beispiel.
Eine neuere Überblicksdarstellung zur Gotteslästerung spricht bereits im Untertitel von der Geschichte eines »imaginären« Verbrechens.[19] Dieses Etikett führt in die Irre. Natürlich sind Schmähungen und verbale Herabsetzungen immer »imaginär«, da sie keine sichtbaren Wunden hervorrufen, sondern stets von den Wahrnehmungen der Betroffenen und des gesellschaftlichen Umfelds abhängen. Dennoch handelt es sich um – sehr »real« wirkende – soziale Tatsachen. Auch der naheliegende Einwand, im Fall der Blasphemie sei das Opfer, also Gott, ja nicht wirklich existent, jedenfalls nicht anwesend, und er könne deshalb keinesfalls persönlich beleidigt werden, sticht nicht. Für jene langen Jahrhunderte, die ich im vorliegenden Buch als das klassische Zeitalter der Blasphemie charakterisiere, war die Gegenwart Gottes für die meisten Menschen eine sehr greifbare Realität. Die Definition von Blasphemie kommt im deutschen Begriff der »Gotteslästerung«[20] sehr plastisch zum Ausdruck – es handelte sich um die Verletzung der Ehre Gottes.
So fremd uns heute das vermenschlichte (anthropomorphe) Gottesbild hinter dieser Definition auch anmutet, es entfaltete große soziale Wirkmächtigkeit. Den Schöpfer bewegten nach der Vorstellung der damaligen Menschen sehr menschliche Motive und Gefühle, und so reagierte er auf die Verletzung seiner Ehre mit unbändigem Zorn. Und er wehrte sich, indem er nicht nur die Täter bestrafte (davon erzählen unzählige Predigtexempel), sondern die gesamte Gemeinde mit Hunger, Krieg und Seuchen zu überziehen drohte, sofern sie nicht ihrerseits streng gegen die Lästerer vorging. Hier sind wieder die »Dritten« im Spiel, die jedoch von vornherein keineswegs unbeteiligt sind, denn die kollektive Schadensdrohung des zornigen Gottes hing wie ein Damoklesschwert über ihren Köpfen. Daraus ergab sich für die Angehörigen dieser Gemeinschaft eigentlich eine klare Rollenbeschreibung: Hörer einer Lästerung hatten diese zu denunzieren und zu bezeugen, Richter harte Urteile zu sprechen usw. Unsere Darstellung wird allerdings erweisen, dass diese Dritten keineswegs immer oder auch nur gewöhnlich den offiziellen Handlungsnormen folgten: Es gab eben auch »ungeschriebene« Gesetze und informelle Verhaltensnormen, die einen anderen Umgang mit Gotteslästerern möglich machten.
Als im Zuge der Aufklärung die Vorstellung einer Ehrverletzung Gottes obsolet wurde, musste das Delikt der Blasphemie neu bestimmt werden. ›Religionsbeschimpfung‹ wurde nun als Angriff auf die Fundamente von Staat und Gesellschaft, als Anschlag auf den sozialen Frieden oder schlicht als Verletzung religiöser Gefühle verstanden. Damit wurde das Delikt keineswegs ›imaginärer‹. Eher war das Gegenteil der Fall: Traten die Ankläger der Lästerer zuvor als Stellvertreter des in seiner Ehre getroffenen Schöpfers auf, so sprachen sie nun für den Staat oder jedenfalls für die religiöse Gemeinschaft. Es ist also nicht zuletzt dieser Mechanismus der Stellvertretung, der die Debatten und Konflikte um Blasphemie in älteren und neueren Zeiten miteinander verbindet. Die stellvertretende Verteidigung heiliger Personen und Objekte, das Engagement gegen die Schmähung der wohlverstandenen Werte und Symbole einer Gemeinschaft, kann den jeweiligen Akteuren Einfluss und Ansehen verschaffen. Als vorgebliche Anwälte des Gemeinwohls haben sie gesteigerte Chancen, Anhänger zu mobilisieren oder bestimmte Personen und Gruppen auszugrenzen.
»Blasphemie«, das war und ist zunächst einmal ein Etikett, das bestimmten Sprechhandlungen angeheftet wird, um sie als normabweichend zu kennzeichnen. Kaum ein als Gotteslästerer stigmatisierter Mensch der europäischen Vormoderne dürfte sich dieses Etikett freiwillig an die Brust geheftet haben, gerade dann nicht, wenn er mit einer gewissen Lust die sakrale Macht herausforderte. Auch deswegen ist es unmöglich, durch die historischen Epochen hindurch ein klares Profil ›des‹ Gotteslästerers zu zeichnen. Er ist ganz im Gegenteil eine schillernde und wechselhafte Figur. Ein Mann konnte sich zum Beispiel in der klassischen Epoche der Blasphemie mit seinen Lästerungen ins soziale Abseits katapultieren, er konnte damit aber auch, sozial akzeptiert, männliche Stärke und Souveränität zum Ausdruck bringen. Welche dieser Varianten zutrifft, lässt sich nur mit Blick auf die jeweilige soziale Konstellation entscheiden.
Erst sehr spät in der Neuzeit wurde es denkbar, das Etikett der Blasphemie als Auszeichnung für scharfe Kritik und treffenden Spott zu verstehen, gar ein ›Lob der Blasphemie‹ zu formulieren wie die französische Journalistin Caroline Fourest im Jahr 2015. Dies war erst möglich, nachdem sich eine kritische, politisch legitimierte, ja erwünschte Öffentlichkeit etabliert hatte. Auch dass Gotteslästerer in der Kunst als avantgardistische Tabubrecher inszeniert und gefeiert werden, ist eine vergleichsweise junge Erscheinung. Zu den Pionieren gehörte in der Bundesrepublik Anfang der 1960er Jahre die situationistische Künstlergruppe SPUR. Sie provozierte die Öffentlichkeit und die katholische Kirche mit einer Zeitschrift, deren Beiträge den Mitgliedern der Gruppe Klagen und Verurteilungen wegen Pornographie und Gotteslästerung einbrachten. Ihre Strategie vor Gericht fasste Dieter Kunzelmann später so zusammen: »Jawohl, Euer Ehren Landgerichtsrat, ich bekenne mich zum Verfassen pornographischer Texte und mit Begeisterung lästere ich Gott. Was soll daran strafbar sein?«[21] Blasphemischer Avantgardismus hatte bereits damals seinen Preis, im Falle der SPUR-Künstler Gefängnisstrafen auf Bewährung und Ausschluss vom Kunstmarkt. Für viele vor und nach ihnen waren die Kosten für Freiheit, Leib und Leben wesentlich höher, wovon die Schicksale von Oskar Panizza und George Grosz ebenso zeugen wie diejenigen von Salman Rushdie oder der ermordeten Redakteure von Charlie Hebdo.
Innerhalb des christlichen Kulturkreises wurde das Etikett Blasphemie gewöhnlich Einzelpersonen aufgeklebt. Die Prediger des Mittelalters sahen einen riesigen Skandal gerade darin, dass lästerliche Worte als schlechte, aber kaum zu vermeidende Gewohnheit den Alltag vieler Christen prägten. Empört hielten sie diesen das Vorbild der sonst so vielgeschmähten Juden und Muslime entgegen, welche die Schmähung Gottes konsequent vermieden.[22] Natürlich konnte der Blasphemie-Vorwurf auch trefflich genutzt werden, um einen angeblichen Lästerer als Vertreter einer Gruppe von Abweichlern zu stigmatisieren, als Ungläubigen, als Teufelsanhänger oder als Revolutionär, jedenfalls als Gegner der herrschenden Ordnung.
Vor allem spielte der Vorwurf der Gotteslästerung gegen große Glaubensgemeinschaften aber eine Rolle bei zahlreichen Konflikten innerhalb bzw. zwischen religiösen Formationen. Der angebliche Zusammenprall von christlich-okzidentaler und muslimisch-orientalischer Welt seit 1989 steht hier, unbeschadet seiner neuen Qualität, am Ende einer langen Reihe strukturell vergleichbarer Konstellationen. Gerade im Kontext monotheistischer Religionen wurde das Blasphemie-Etikett gerne eingesetzt, um das skandalöse Verhalten und den falschen Glauben rivalisierender Bekenntnisse zu brandmarken. Das gilt, geradezu prototypisch, für das Gegeneinander von Juden und Christen. Der Vorwurf der Gotteslästerung gegen die angeblichen Christusmörder gehörte zum Standardrepertoire mittelalterlicher Prediger. Mit Vorliebe aber wurde der Vorwurf der Blasphemie auch und gerade gegen konkurrierende Bekenntnisse im Innern der jeweiligen Religionsgemeinschaft vorgebracht. Das gilt für den Streit zwischen Sunna und Schia im Islam ebenso wie für die vielfältigen Ketzereidiskurse innerhalb des Christentums bis hin zur konfessionellen Spaltung im Gefolge der Reformation. Hier liegt die Wurzel für das in der Forschung weitverbreitete Missverständnis, Irrglaube (Häresie) und Blasphemie seien über lange Zeit im christlichen Denken fast Synonyme gewesen.[23] Es wird zu zeigen sein, dass diese Behauptung falsch ist: Bei der Ketzerei ging es um den falschen Glauben, während Blasphemie umgekehrt die Schmähung des richtigen Glaubens meinte. Häresie konnte (musste aber nicht) Ausdrucksformen entwickeln, die von der Gegenseite als lästerlich empfunden wurden; Blasphemie konnte umgekehrt ganz ohne häretischen Subtext daherkommen. Jenseits dieser kategorialen Unterscheidung bleibt aber wahr, dass der Blasphemie-Vorwurf eine wichtige Waffe im Kampf gegen konkurrierende Bekenntnisse sein konnte. Dabei waren die Vertreter aller konfessionellen Lager in der Regel nicht zimperlich, wenn es um die Schmähung und Herabsetzung gegnerischer Positionen und Personen ging. In ihrer Selbstwahrnehmung handelte es sich keineswegs um Gotteslästerungen, sondern um harte, aber gerechtfertigte Stigmata für einen verdammenswerten Irrglauben. Was den einen als ein verwerfliches Schmähen des Heiligen erschien, wurde nicht selten von der Gegenseite als ›heiliges Schmähen‹ ausbuchstabiert, nämlich als legitime Herabsetzung im Dienste einer höheren Sache. Was im politischen Raum der Gegenwart am Beispiel populistischer Führungsgestalten und Bewegungen exemplarisch studiert werden kann, lässt sich durchaus auf religiöse Schmähungen der Vergangenheit übertragen: Die verbale Herabwürdigung gegnerischer Positionen eignet sich hervorragend, um die Affekte der eigenen Anhänger zu mobilisieren und sie bisweilen sogar zum Handeln zu bewegen.
Damit ist der Zusammenhang zwischen Blasphemie und Gewalt angesprochen. Ihn zu betrachten ist hier unvermeidlich, auch wenn es sich nur um eine Facette des sehr viel größeren Problems der Verknüpfung von Religion und Gewalt überhaupt handelt.[24] Seit der Todesdrohung des Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdie 1989 wurden durch Attentate oder im Zuge von Protesten Dutzende von Menschen getötet. In der Wahrnehmung vieler Muslime war physische Gewalt gerechtfertigt, weil dem Propheten Mohammed durch blasphemische Worte und Bilder seinerseits Gewalt angetan worden sei. Natürlich ist es höchst problematisch, die Grenze zwischen symbolischer und physischer Gewalt einzuebnen, wie es hier geschehen ist. Aber man wird der möglichen Wucht und Wirkung der Blasphemie nicht gerecht, wenn man sie auf ›bloße‹ Worte oder Bilder reduziert. Charakterisiert man sie als einen performativen Akt, gelangt man analytisch über die lange dominierende Entgegensetzung von Sprache (als ›vernünftiges‹ Verständigungsmittel) und Gewalt hinaus. Es war bereits von unserem zweiten, sozial-symbolischen Körper die Rede, der durch Worte verletzt werden kann. Wie wir anthropologisch von der Anerkennung des bzw. der anderen abhängig sind, so können umgekehrt Worte auch den Entzug dieser Anerkennung signalisieren, sie können verletzen und zerstören.[25] Für ein angemessenes Verständnis der Gotteslästerung gilt es im Übrigen, die Konzentration auf verbale Äußerungen aufzuweichen und ein erweitertes Feld von symbolischen Herabsetzungen einzubeziehen. So war in verschiedenen Zeiten der Angriff auf religiöse Kultbilder eine besonders markante Form von Gotteslästerung. Dabei lag es durchaus im Auge des Betrachters, ob ein solcher Angriff blasphemisch war oder als besonders fromme Handlung verstanden werden musste, die sich gegen einen als gotteslästerlich verstandenen Bilderkult richtete.[26]
Damit sind einige wichtige Aspekte angesprochen, die im Buch zur Sprache kommen werden. Die angestrebte Geschichte der Blasphemie von der Zeit des Alten Testaments bis zur Gegenwart kann natürlich nur ausschnitthaft realisiert werden, indem zentrale Konstellationen aufgezeigt und in den jeweiligen historischen Kontext eingeordnet werden. Jede dieser Konstellationen lässt wiederkehrende Motive und rote Fäden aufscheinen, aber jede ist zugleich auch einzigartig. Angesichts dieser Komplexität mögen der Gang durch lange Epochen der Weltgeschichte allzu wagemutig und die jeweilige historische Einordnung allzu grob gestrickt erscheinen. Zudem sind die Grenzen des Buches offensichtlich: Es ist aus einer westlichen Perspektive geschrieben und nimmt vornehmlich die christliche Welt in den Fokus. Judentum und Islam rücken dann in den Blick, wenn sie mit dieser Welt in Kontakt bzw. meist: in Konflikt geraten. Diese Form eines reflektierten Eurozentrismus ist sicher kritikwürdig, aber ein weitergehender Anspruch erscheint vor dem Hintergrund des derzeitigen Forschungsstandes kaum möglich, umso weniger für einen Autor, der sich ohnehin in der Antike ebenso wie in der Neuesten Geschichte häufig genug über die Grenzen seiner Kernkompetenzen hinauswagen musste. Verkürzungen und Engführungen mussten unvermeidlich in Kauf genommen werden, um das Ziel einer übergreifenden Darstellung zu erreichen. Ob die Verkürzungen tolerabel sind, müssen die Fachleute entscheiden, ob die übergreifende Darstellung gelungen ist, alle interessierten Leser.
Antike Fundamente
1. Der eifersüchtige Gott
»Es ging aber der Sohn einer israelitischen Frau und eines ägyptischen Mannes mitten unter die Israeliten und der Sohn der Israelitin zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann und lästerte den Namen und fluchte. Da brachten sie ihn zu Moses – seine Mutter aber hieß Schelomit, eine Tochter Dibris vom Stamm Dan – und legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort würde durch den Mund des HERRN. Und der HERR redete mit Moses und sprach: Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen und sage zu den Israeliten: Wer seinem Gott flucht, der soll seine Schuld tragen. Wer des HERRN Namen lästert, der soll des Todes sterben; die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben« (Lev 24,10–16).
Auf diese Erzählung vom Schicksal des Mannes, der Gott lästert und dafür bestraft wird, sollte im Laufe der christlichen Geschichte immer wieder Bezug genommen werden. Sie ist prominent platziert am Beginn jener Passage, die das bekannte Talionsprinzip des Strafens (»Aug um Aug, Zahn um Zahn«) erläutert. Von den übrigen Geboten unterscheidet sie sich durch ihre Ausführlichkeit. In lakonischer Kürze folgen auf sie weitere Gesetze über die Tötung bzw. Verwundung von Menschen und Nutztieren. Die Platzierung am Anfang und die Ausführlichkeit unterstreichen: Die Lästerung Gottes übertrifft alle anderen Vergehen gegen die Mitmenschen. Gott selbst als Person ist betroffen, und er selbst befiehlt die Todesstrafe. Ihre Vollstreckung folgt der Dramaturgie eines Gemeinschaftsrituals: Der Zug aus dem Lager versinnbildlicht bereits die Ausstoßung aus der menschlichen Gemeinschaft, und mit ihrem Handauflegen bezeugen die Hörer der Lästerung die Schuld des Delinquenten und besiegeln sein Schicksal. Schließlich wird der Ausschluss durch die gemeinschaftliche Steinigung endgültig. Zugleich handelt es sich um eine Sühnehandlung der Gläubigen dafür, dass sie in ihrer Mitte ein solches Verbrechen zugelassen haben.
Der Täter wird als ein Grenzgänger charakterisiert. Zum einen ist er klar als Mann aus der Mitte der Israeliten ausgewiesen, seine Mutter wird sogar mit Namen und Herkunftsangabe benannt. Als Sohn eines Ägypters aber entstammte er ihrer Verbindung mit einem Fremdling, einem Angehörigen jenes Herrenvolkes, das die Israeliten nach dem biblischen Bericht unterdrückt und versklavt hatte, bevor sie von Moses auf Gottes Befehl hin in die Freiheit geführt wurden. Wenn ein solcher Mensch sich despektierlich gegenüber dem Herrn äußerte, so legt der Bericht nahe, gab er damit zu erkennen, dass er in Wahrheit gar nicht zu dessen Anhängern gehörte. Paradigmatisch scheinen hier bereits die beiden Konstellationen von Blasphemie auf, die sich bis heute in immer neuen Mischungsverhältnissen finden: entweder geht es um die Lästerung des eigenen Gottes oder um diejenige des Gottes der »Anderen«.
1 Steinigung des Gotteslästerers nach Lev 24 (Druckgraphik, Michael Ostendorfer, 1554)
Was war das für ein Gott, der die Schmähung durch einen Menschen derart ernst nahm, dass er seine gesammelten Anhänger zu dessen ritueller Hinrichtung aufforderte? Sicherlich war es ein Gott, der sich vom modernen christlichen Bild eines gütigen und verzeihenden Vaters im Himmel deutlich unterschied. Es war aber auch ein Gott, der im Kontext des altorientalischen Pantheons ein ganz eigenes Profil besaß. Der Ägyptologe Jan Assmann hat in diesem Zusammenhang von der »mosaischen Unterscheidung« gesprochen, die nicht nur eine wichtige Wasserscheide des Altertums dargestellt habe, sondern eine veritable welthistorische Wende, »entscheidender als alle politischen Veränderungen«: »Nicht die Unterscheidung zwischen dem Einen Gott und den vielen Göttern erscheint mir das Entscheidende, sondern die Unterscheidung zwischen wahr und falsch in der Religion, zwischen dem wahren Gott und den falschen Göttern, der wahren Lehre und den Irrlehren, zwischen Wissen und Unwissenheit, Glaube und Unglaube.« Hier liege die wesentliche Differenz zwischen den lange gewachsenen Kultreligionen der ägyptischen, babylonischen und auch griechisch-römischen Antike einerseits und den Buchreligionen, die einem Akt der Offenbarung entspringen, andererseits. Im Untertitel seines Buches spricht Assmann vom »Preis des Monotheismus«, der für diese »revolutionäre Innovation« zu entrichten sei. Dieser Preis bestand in den neuen Formen von Herabsetzung, Ausgrenzung und letztlich Gewalt, den die mosaische Unterscheidung in die Welt gebracht habe, im »Hass auf Heiden, Ketzer, Götzendiener und ihre Tempel, Riten und Götter«.[1]
Assmanns Thesen lösten einen heftigen Streit unter Forschern verschiedener Disziplinen aus, der insofern produktiv war, als der Autor daraufhin seine Thesen schärfte. In jüngeren Veröffentlichungen setzt er den »Monotheismus der Wahrheit« im oben skizzierten Sinn ab von einem »Monotheismus der Treue«. Nicht die Leitdifferenz »wahr« gegen »falsch« sei hier entscheidend, sondern die Grundunterscheidungen in »Glaube und Unglaube, Bundestreue und Bundesbruch, Loyalität und Apostasie«. Dieser Monotheismus der Wahrheit sei erst in später entstandenen Büchern des Alten Testaments (Jeremia, Deuterojesaia, Daniel u.a.) entwickelt worden, während sich im früher herausgebildeten Monotheismus der Treue die eigentliche mosaische Unterscheidung manifestiere. »Die Idee des eifersüchtigen Gottes, der keine anderen Götter neben sich duldet«, sei dabei lediglich die Kehrseite des liebenden, seinem Volk leidenschaftlich zugewandten Gottes.[2] Diese Eifersucht konkretisiere sich in einer Sprache der Gewalt und finde ihren Ausdruck nach den Erzählungen des Alten Testaments oft genug in physischer Vernichtung der Feinde. Der spätere Monotheismus der Wahrheit hingegen verfolge die als falsch identifizierte Religion eher mit Verachtung und bediene sich des Mittels der Religionssatire, indem er etwa den heidnischen Bilderkult als leeren Wahn verspotte.[3]
Die Kontroverse um Assmanns Thesen war mit dieser Präzisierung keineswegs erledigt. Weiterhin kritisieren insbesondere Kirchenhistoriker und Theologen, dass Assmann einseitig ausgrenzende und gewaltaffine Aspekte des Monotheismus betone. Für eine Geschichte der Gotteslästerung muss das kein Nachteil sein. Sie ist notwendigerweise einseitig: Von göttlicher Liebe, Toleranz, Nachsicht oder gar Nächstenliebe wird im Folgenden kaum die Rede sein, ohne dass damit Aussagen über das tiefere Wesen des Christentums verbunden werden sollen. Für das Verständnis der Erzählung über den Sohn des Ägypters ebenso wie der gesamten Geschichte der Blasphemie bietet die mosaische Unterscheidung eine wichtige Wegweisung. Unabhängig von den notwendigen feinen Unterscheidungen zwischen verschiedenen Überlieferungsschichten des Alten Testamentes, wie sie Assmann in der zitierten Passage vornimmt, bilden die Normen und Erzählungen dieses autoritativen Textes die Bezugspunkte für die Juden und später die Christen der nachfolgenden Jahrhunderte.
»Ich bin der HERR, dein Gott (…) Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen (…) Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott (…) Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen (...).« Gleich zweimal (Ex 20,2-7; Dtn 5,6–11) enthalten die fünf Bücher Mose (der Pentateuch) den Text des Dekalogs, jener Zehn Gebote, die Jahwe auf dem Berg Sinai dem Moses offenbart hatte. Schon die doppelte Überlieferung verweist auf eine sehr komplizierte und kaum restlos aufzuklärende Textgeschichte. Die älteste Fassung des Dekalogs stammt aus der Zeit nach dem Untergang Judas im 6. Jahrhundert v. Chr., griff aber wohl auf ältere Elemente zurück.[4] Niedergeschrieben wurde er nach biblischem Zeugnis von Gott selbst auf zwei steinernen Tafeln. Die erste der Tafeln enthielt, folgt man der katholischen und lutherischen Zählung, die drei oben zitierten Gebote, bei denen es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch ging; die übrigen sieben regelten das menschliche Zusammenleben.[5]
Eingeleitet wird der wuchtige Text mit einer direkten Rede Jahwes an sein Volk, das er im Kollektivsingular anspricht (»dein Gott«). Schon das zeigt, wie intim und zugleich exklusiv die sich hier konstituierende Beziehung gestaltet ist. Fremde Götter werden nicht geduldet, was damals nicht unbedingt gleichbedeutend damit war, sie prinzipiell zu leugnen. Ganz im Gegenteil wird ihre Existenz »fraglos vorausgesetzt« und selbst ihre Macht nicht gänzlich geleugnet.[6] Aber für das Volk Israel durften sie keine Rolle spielen. Das Bilderverbot im nächsten Satz des Dekalogs bezieht sich deshalb bereits von der Logik her auf das Bild – genauer gesagt: das Kultbild – des eigenen Gottes. Mag sein, dass dieses Gebot in ganz konkret-politischen Tatbeständen des exilischen bzw. nachexilischen Israel gründet und der Jahwe-Religion keineswegs von Beginn an wesenseigen war.[7] Auf was es zielt, ist gleichwohl klar: Das Verbot von Kultbildern sichert die Entrücktheit und Vollkommenheit des eigenen Gottes, der sich gegen jede unvollkommene Materialisierung sperrt. Gott ist einmalig, Gott ist allmächtig, und Gott ist für den menschlichen Geist unfassbar. Zugleich aber besitzt er eine große Nähe zu seinem Volk Israel, und dieses Volk bewegt sein Gemüt. Seine Charakterisierung als ein eifernder, eigentlich (so die Einheitsübersetzung) »eifersüchtiger« Gott (el qannā) ist ein im Vergleich zu anderen Religionen der Zeit einmaliges Attribut. Es kennzeichnet das besondere, affektive Verhältnis zwischen ihm und seinem Volk, dem er in Zuneigung verbunden ist, das er aber auch mit seinem Zorn strafen kann.[8] Andere Götter des altorientalischen oder griechisch-römischen Kulturkreises mochten ebenfalls ihre Affekte ausleben und aufeinander neidisch sein, aber »von der Eifersucht eines Gottes gegenüber seinen Verehrern ist [dort] nie die Rede«.[9]
Wie jede intime Beziehung ist auch die zwischen Jahwe und seinen Anhängern anfällig für persönliche Kränkungen und Herabsetzungen. Bereits die beiden ersten Gebote verweisen deutlich auf eine solche Verletzungsgefahr. In einem weiteren Sinn war ohnehin jede Übertretung des vom Schöpfergott offenbarten Gesetzes eine Herabsetzung seiner Person, die seinen Zorn provozieren konnte. Die Verehrung fremder Götter, Nukleus späterer Vergehen wie Apostasie oder Häresie, bargen ein großes Verletzungspotenzial für den einen und wahren Gott. Das Verbot von Kultbildern, über weite Strecken als ein allgemeines Bilderverbot interpretiert, sollte die Herabwürdigung und Verkleinerung des unendlichen Gottes verhindern.
Zum Kern der meisten Erörterungen über die Verletzung Gottes und zu einem wichtigen Kristallisationspunkt für das Delikt der Gotteslästerung allerdings sollte das Verbot werden, den göttlichen Namen zu missbrauchen. Was genau mit diesem Missbrauch gemeint war, ist umstritten. Eine generelle Tabuisierung des Namens Gottes war, anders als bisweilen zu lesen, sicher nicht beabsichtigt.[10] War damit vielleicht ein Meineid oder ein Fluch gemeint? Beide lagen ja nahe beieinander, denn ein Eid ist nichts anderes als eine »bedingte Selbstverfluchung« im Fall eines Eidbruchs (vgl. Kap. 8). Darauf könnten präzisierende Bestimmungen an späterer Stelle hinweisen, wie etwa das Verbot, Gott zu lästern oder einem Fürsten zu fluchen (Ex 22,27). Wahrscheinlicher aber ist, dass die Verfasser des Dekalogs diesen Satz mit Absicht unspezifisch und breit anwendbar formulierten, um alle möglichen Fälle abzudecken. Das Gebot wollte der Herabsetzung des göttlichen Namens und zugleich – weil der Name in alten Gesellschaften sicherlich nicht nur als körperloses Symbol angesehen wurde, sondern die Präsenz Gottes selbst in geradezu magischer Weise anzeigte – der Herabsetzung Gottes in umfassender Weise einen Riegel vorschieben.[11] Vieldeutigkeit und Interpretierbarkeit sollten denn auch später zum Kennzeichen aller Blasphemie-Tatbestände werden.
Die eingangs zitierte Erzählung über den Sohn des Ägypters konkretisierte die gotteslästerliche Handlung ein wenig, denn es ist die Rede davon, der Sohn des Ägypters habe geflucht. Vor allem legt er eine erste Spur für die Semantik der Herabsetzung, indem in der Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung der Spätantike, das Verb »blasphemare« verwendet wird. »Qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur«, so wird am Ende die Botschaft der Erzählung noch einmal beschwörend zusammengefasst: Wer den Namen des Herrn lästert, soll getötet werden. Vielleicht war diese Übersetzung eine Weichenstellung dafür, dass die Herabsetzung Gottes langfristig als »blasphemia« etikettiert und seit dem Spätmittelalter als »Blasphemie« bzw. »blasphemieren« eingedeutscht wurde. Zugrunde liegt hier der griechische Terminus ßλασφημία bzw. ßλασφημείν (Schmähung bzw. schmähen), der sich wiederum aus ßλάβος (Schaden, Unheil) und φάναι (sagen, behaupten) zusammensetzt. Ursprünglich bedeutet »blasphemía« also »Schlechtes reden«; lange Zeit war der Begriff keineswegs allein auf eine Schmähung Gottes zugespitzt. Der Sprachgebrauch in den griechischen und lateinischen Übersetzungen des Alten Testaments blieb uneinheitlich, und das hebräische Original zog ohnehin Umschreibungen vor.
Rigorismus gegen Gotteslästerer war eine der Kernbotschaften der Gebote des Alten Testamentes. Aber dieser Rigorismus hatte auch mögliche Schattenseiten, die ebenfalls in der Bibel aufscheinen. Die Erzählung von Naboths Weinberg (1 Kön 21) zeigt, wie frommer Eifer sich in sein Gegenteil verkehren kann, wenn böse Mächte ihn für ihre Zwecke missbrauchen. Die Geschichte ist schnell erzählt: Naboth, der sich geweigert hatte, dem König Ahab seinen Weinberg zu verkaufen, fällt einer Verschwörung von Ahabs Frau Isebel zum Opfer. Sie veranlasst zwei nichtswürdige Männer (Söhne des Belial bzw. des Teufels, wie es in der Vulgata heißt), Naboth in der Öffentlichkeit der Gotteslästerung anzuklagen. Umstandslos wurde der Beklagte daraufhin gesteinigt, und Ahab konnte sich den Weinberg aneignen. Die Anklage gegen Naboth lautete im Übrigen, er habe Gott und den König geschmäht, eine Verknüpfung des Vergehens gegen den göttlichen und den weltlichen Herrscher, die uns bereits begegnet ist (Ex 22,27) und vielfach wieder begegnen wird. In der Geschichte vom Weinberg aber sind der König und seine Frau die Bösewichte. Ihre Missetat bleibt nicht ungesühnt. Bereits durch den Propheten Elija verkündet Jahwe dem Ahab, dass er seine Verbrechen missbillige und sein gesamtes Haus ausrotten werde. Der König selbst kann sich durch demonstrative Buße noch einen Aufschub erwirken, aber an Isebel und an seinen Nachkommen lässt Jahwe durch die Hand des Jehu sein Strafgericht vollstrecken (2 Kön 9f.). So bleibt das Erkenntnispotenzial der Geschichte ambivalent. Sie demonstriert die Gefahren einer Anklage, die sich fast vollkommen auf Zeugenaussagen stützen musste, weil ein Corpus Delicti im klassischen Sinn nicht existierte. Sie zeigt aber zugleich, dass Gott die Rache für die Verletzung seiner Ehre stets selbst in die Hand nehmen konnte, auch wenn er von seinen Anhängern verlangte, sich seinen Zorn zu eigen zu machen bzw. zu seiner Besänftigung die Gegner zu töten, wie im Fall des Pinchas (4 Mose 25). Eine der Gelegenheiten, bei denen Gott selbst handelte, ist die Vernichtung der Städte Sodom und Gomorra, auf die er Feuer und Schwefel regnen ließ (Gen 19).
Für sein erwähltes Volk konnte das Eingreifen Gottes aber auch die Rettung bedeuten. Nach einer anderen Erzählung des Alten Testaments musste die Großmacht der Assyrer sehr plastisch erfahren, was es bedeutete, Jahwe herabzusetzen (2 Kön 18 u. 19). Vor den Mauern von Jerusalem beleidigt ihr Feldherr Rabschake nicht nur lauthals und in der Landessprache die Judäer als Männer, die ihre eigene Scheiße fräßen und ihren Urin tränken. Überdies verhöhnte er den Glauben des judäischen Königs Hiskia an die Stärke seines Gottes – auch den anderen eroberten Städten hätten deren Götter nichts geholfen. König Hiskia und seine Gefolgsleute zerrissen daraufhin zum Zeichen ihres Entsetzens über diese Schmähungen ihre Kleider und riefen Jahwe um Hilfe an. Dieser schickte nachts zur Rache seine Engel ins assyrische Lager, die 185000 Mann erschlugen – vielleicht das Sinnbild für eine plötzliche Seuche. Der assyrische König Sancherib selbst fiel kurz nach seiner Rückkehr, zum Gebet vor seinem Abgott niedergefallen, einem Mordanschlag zum Opfer. Gott ist über die Verhöhnung durch die Gegner Judas, das wird in der direkten Anrede an den assyrischen König deutlich, sehr verletzt: »Weil du gegen mich wütest und dein Lärm meine Ohren erreicht hat, lege ich meinen Haken in deine Nase und mein Zaumzeug an deine Lippen« (2 Kön 19,28). Der eifernde Gott, so wird hier noch einmal deutlich, schützt seine Anhänger und wütet grausam gegen deren Feinde. Er tut dies allerdings nur, wenn sein Volk in unbedingtem Glauben zu ihm steht. Die strenge Trennung zwischen ›uns‹ und ›ihnen‹ ist der jüdisch-christlichen Überlieferung damit eingeschrieben und bildet die Grundlage für eine scharfe Herabwürdigung der anderen.
2. Blasphemie im Polytheismus?
Der Zorn der Unsterblichen traf den griechischen Helden Aias auf der Heimfahrt. Frevelhaft hatte er die Königstochter und Seherin Kassandra bei der Eroberung Trojas vergewaltigt, nachdem er die Widerstrebende vom Kultbild der Pallas Athene fortgeschleppt hatte. Dem Gewalttäter drohte die Steinigung, nicht wegen der Vergewaltigung, sondern wegen des Frevels an einem Kultbild. Ihr entging Aias nur, indem er sich seinerseits in das Heiligtum der Athene flüchtete. Der späteren Rache der Zeustochter aber entrann er nicht, in heftigen Sturmgewittern ließ sie sein Schiff untergehen. Mit Hilfe des Meeresgottes Poseidon konnte sich der Schiffbrüchige zunächst auf einen Felsen retten. Übermütig prahlte er, er könne den Göttern zum Trotz den stürmenden Wogen entkommen. Der daraufhin ergrimmte Poseidon spaltete den Felsen und ließ den Lästerer elend ersaufen.[1]
Beleidigte Götter sind prinzipiell keine Eigenheit des Monotheismus, sondern finden sich auch in der klassischen Antike. In der griechischen Mythologie begegnen uns erzürnte und rachedurstige Olympier auf Schritt und Tritt. Homers »Ilias« setzt ein mit dem Zorn des mächtigen Helden Achill (»Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus …«).[2] Ihm ging der Zorn des Gottes Apoll voraus, den sein Priester Chryses gegen den griechischen König Agamemnon um Hilfe angerufen hatte. Daraufhin schickte Apoll seine Pestpfeile in das griechische Lager. Um den Gott zu beschwichtigen, musste sich Agamemnon schließlich bereit erklären, seine Beute, die Tochter des Priesters, zurückzugeben. Als Kompensation erzwang er allerdings die Herausgabe der Konkubine des Achill. Diese Ungerechtigkeit eben weckte den unbändigen Zorn des Heroen: Er boykottierte vorerst nicht nur das Kampfgeschehen, sondern veranlasste auch seine Mutter, die Meernymphe Thetis, Zeus um Siege für die Trojaner zu bitten.
Schmähreden, Zorn, Rache – hier klingen einige der Motive an, die uns in der Geschichte der Blasphemie häufiger begegnen werden. Dabei stellte die herausfordernde Prahlerei eines Aias eher die Ausnahme als die Regel dar. Der Zorn der Götter wird bei Homer oft genug auch durch die Herabwürdigung eines ihrer Schutzbefohlenen erregt, wie im Fall des Priesters Chryses, oder durch Fahrlässigkeit, wie in jener Episode, als Achill durch sein Wüten den Fluss Skamandros mit Leichenbergen füllt und damit den Zorn des Flussgottes hervorruft (Illias 21, 211ff.). Derartige Geschichten markieren aber direkt auch die Differenz zwischen dem antiken, polytheistischen Götterhimmel und den uns vertrauteren monotheistischen Glaubenssystemen.[3] Fremd erscheinen heute nicht nur die Vielzahl der Götter, sondern auch die vermenschlichten (anthropomorphen) Vorstellungen, welche die Griechen und Römer von ihnen pflegten. Zwar waren die Götter unsterblich, aber sie waren unterschiedlichen Geschlechts und Alters. Sie bildeten Paare und Familien, besaßen verschiedene Fähigkeiten und wurden als hierarchisch angeordnet gedacht, mit Zeus bzw. Jupiter an der Spitze. Vor allem wetteiferten und konkurrierten, ja kämpften sie miteinander. Mit den Menschen teilten sie einen Kosmos, den sie nicht geschaffen hatten, traten mit ihnen in Kommunikation. Oft sind in den homerischen Erzählungen die Götter und die menschlichen Heroen kaum zu unterscheiden, und beide pflegten gleichermaßen den Zorn als einen Affekt, den sich nur der Mächtige und Überlegene leisten konnte und bei dem sich der Schmerz einer Ehrverletzung untrennbar mit dem Verlangen nach Rache verband.[4]
Die klassischen Epen eines Homer oder eines Hesiod geben freilich kaum ein angemessenes Bild von den gewöhnlichen Austauschbeziehungen zwischen Menschen und Göttern. Natürlich war es für alle Sterblichen ratsam, mit den Olympiern eine gute Beziehung zu pflegen, die mit übermenschlichen Fähigkeiten ihr Leben beeinflussen konnten. Aber diese Beziehung war in der Regel ritueller und nicht persönlicher Natur. Ihren Ausdruck fand sie in der Einrichtung von Heiligtümern, in feierlichen Speisegaben und Tieropfern, in der Einkleidung oder Waschung von Kultbildern sowie in Prozessionen.[5] Diese lebenspraktische Kommunikation mit den höheren Mächten und die genaue Durchführung sakraler Rituale waren das Zentrum der gelebten Religion, nicht die Einhaltung moralischer Normen.[6] Die griechische und auch die römische Religion vermittelten keine verbindlichen ethischen Gebote wie der Dekalog des Alten Testamentes. Die antiken Götter waren keine Gesetzesstifter. Ihr Interesse an irdischen Dingen war alles in allem ohnehin mäßig. »Die Götter lieben die Menschen nicht.«[7] Umgekehrt bot ihr Verhalten den Menschen kaum eine moralische Orientierungsmarke. In den griechischen Epen tritt uns vielmehr eine erstaunliche Amoralität entgegen, die bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. Xenophanes scharf kritisierte: »Alles haben Homer und Hesiod den Göttern aufgeladen, was bei den Menschen Vorwurf und Schimpf ist: Stehlen, Ehebruch treiben und einander betrügen.«[8]
Insgesamt ist die Aussagekraft der Mythen und Epen für die tatsächliche Ausprägung der antiken Religion ohnehin eher begrenzt. Eine wie auch immer geartete Theologie entfalteten weder Griechen noch Römer. Neuere Darstellungen zur Rolle der Religion in der römischen Lebenswelt richten daher den Fokus nicht auf abstrakte Vorstellungen und Dogmen oder versuchen, einen stimmigen Götterhimmel zu entwerfen. Vielmehr setzen sie bei den jeweiligen Handlungsoptionen an, die Menschen in einer konkreten Situation hatten, um mit den überlegenen Mächten zu verkehren. Es ging dabei, pointiert gesagt, nicht um eine Orthodoxie, sondern um eine ›Orthopraxie‹, um das richtige Handeln. Was die Akteure dabei dachten oder ›wirklich‹ glaubten, spielte keine Rolle.[9] Zum Kreis der rituell Verehrten konnten neben den klassischen Göttern im Übrigen auch Heroen, das heißt nach ihrem Tod verehrte Sterbliche, oder verstorbene Ahnen gehören. Und verehrt wurde gewöhnlich weniger eine Gottheit schlechthin, sondern ihre konkrete Erscheinungsform, also nicht Iuno, sondern Iuno Regina oder Iuno Sospita. In den rund 250 Jahren vor Caesars Tod wurden zum Beispiel im römischen Tempelbau 78 göttliche Mächte adressiert, darunter allein sechs verschiedene Aspekte des Jupiter und vier des Herkules. Aber auch Wertbegriffe wurden in diesen Tempeln verehrt wie die Eintracht (concordia), die Hoffnung (spes) oder die Treue (fides).[10] Dabei war die Verehrung sakraler Mächte alles andere als eine exklusive Angelegenheit: Man konnte eine Gottheit durch mehrere Bilder im gleichen Tempel ehren, mehrere Tempel in einer Polis für sie aufstellen, ganze Kultbildgruppen verehren oder auch Statuen ›fremder‹ Götter in einem Tempel platzieren.[11]
Antike Religion, das spiegelt sich in dieser Praxis, war stets konkret verortet. In klassisch griechischer und in römisch republikanischer Zeit hieß das, sie war vorwiegend auf die Polis bezogen, auf das städtische Gemeinwesen. Der dauerhafte, friedliche Einklang mit dem Göttlichen (pax deorum), Ziel aller sakralen Kommunikationsakte, sicherte die innere Ordnung des Gemeinwesens ebenso wie seinen Schutz bzw. seinen Erfolg im Konflikt mit äußeren Mächten. Dabei war der kriegerische Wettbewerb für die Verkörperungen der sakralen Mächte in der Regel weniger riskant als für die sie verehrende menschliche Gemeinschaft. So war es durchaus einen Versuch wert, die sakralen Schutzmächte der Feinde auf die eigene Seite zu ziehen. In rituellen Anrufungen versuchten die Römer, die Götter belagerter Städte herauszurufen und versprachen ihnen Tempel und Kult in der eigenen Stadt, um die von den jenseitigen Mächten entblößte Festung leichter erstürmen zu können. Die Eroberung galt dann nicht als Schwäche der jeweiligen Gottheit, sondern als Ausdruck dafür, dass sie den Sieger favorisiert hatte.[12] Nicht Zerstörung der gegnerischen Götter war das Ziel, sondern deren Integration in das eigene Pantheon. Eine Änderung deutete sich in der griechischen Welt im Zuge der Kriege gegen die Perser an, die man der Zerstörung bzw. des Raubes von griechischen Kultbildern bezichtigte. Als die Krieger des Aitolischen Bundes dann im 3. Jahrhundert v. Chr. auf ihren Plünderungszügen Heiligtümer ausraubten und verwüsteten, vergalt Philip V. von Makedonien bei seinem Rachefeldzug Gleiches mit Gleichem: »Eine Spirale der Gewalt gegen die Sitze der Götter nimmt von hier ihren Ausgang; es zeigt sich, dass man den politischen Gegner jetzt durch die Zerstörung der Sitze seiner Götter stärker treffen kann als früher.«[13]
Eine andere Sache als Kriegszüge war die Herabsetzung der göttlichen Mächte durch einzelne Menschen, wenn sie aus dem Inneren einer Gemeinschaft heraus erfolgte. Bereits in klassisch griechischer Zeit formulierten Aristoteles oder Isokrates die Überzeugung, dass die Götterfurcht den Menschen eingewurzelt sei, um ein geregeltes Miteinander zu bewahren.[14] Insofern kennen auch die antiken Religionen Pflichten und Gebote, deren Überschreitung mit schwersten Sanktionen bedroht ist. Und insofern lassen sich auch in der klassischen Antike Formen der Herabsetzung von Göttern beobachten, die in manchen Zügen mit späteren Blasphemie-Tatbeständen vergleichbar sind. Allerdings haben sich ältere Darstellungen zu sehr von der Vorstellung eines klar ausdifferenzierten Katalogs von Strafrechtsdelikten leiten lassen, wenn sie etwa »Asebeia« umstandslos zum griechischen Äquivalent der christlichen Gotteslästerung erklärten.[15] Was der griechische Begriff der »Asebeia« genau bedeutete, lässt sich in der Konfrontation mit seinem positiven Gegenstück, der »Eusebeia«, bestimmen. Diese spezielle griechische Form der Frömmigkeit meint zunächst die Orthopraxie, die rechte Verehrung der Götter gemäß dem Brauch der Vorfahren. Asebeia bezeichnet dagegen eine Verletzung der Kultregeln in Form von »Tempelraub, Eidbruch, Verletzung von Asyl oder Gottesfrieden«, die den Zorn der jenseitigen Akteure heraufbeschwören konnte und für die Polis insgesamt gefährlich zu werden drohte.[16] Wesentlich weiter sollte später im 4. Jahrhundert v. Chr. der Philosoph Aristoteles den Asebie-Tatbestand definieren, nämlich als »unrechtes Handeln gegen die Götter, gegen die Geistwesen (Daimonas) oder auch gegen die Toten, gegen die Eltern oder gegen das Vaterland«.[17]
Wenn es um die Herabsetzung des Heiligen in der Antike geht, so wird man also zunächst an rituelle Verfehlungen denken können, an das Überschreiten einer räumlichen Grenze etwa oder das Ablegen eines Zweiges auf einem bestimmten Altar.[18] Als ein schwerer Religionsfrevel, der mit dem Tod bestraft werden konnte, wurde der Tempelraub angesehen.[19] Ebenfalls als eine schwerere religiöse Übertretung galt die Missachtung der Rechte von Menschen, die an heiligen Orten oder bei Götterbildern Asyl vor Verfolgung suchten, wie es nach der homerischen Erzählung die von Aias vergewaltigte Kassandra erfolglos versucht hatte. Lange im kollektiven Gedächtnis der Athener blieb der um 630 v. Chr. verübte Alkmaionidenfrevel, die Tötung der Anhänger des Tyrannisaspiranten Kylon, die in einem Heiligtum Zuflucht gefunden hatten.[20]
Daneben sind auch Fälle von direkter Herabsetzung überliefert. In einem der Göttin Artemis geweihten heiligen Hain nahe der arkadischen Stadt Kaphyai, so berichtet der Schriftsteller Pausanias, hätte einst eine Gruppe spielender Knaben ein Seil gefunden. Daraufhin hätten sie das Seil um den Hals der Götterstatue gebunden und gesagt, »Artemis sei erdrosselt«. Als die Stadtbewohner sahen, was die Kinder getan hatten, so heißt es im Bericht lakonisch, »steinigten sie sie«.[21] Offenkundig schätzten sie die potenziellen Konsequenzen der kindlichen Tat als so dramatisch ein, dass sie umstandslos zur kapitalen Bestrafung schritten. Offenkundige Unmündigkeit schützte ebenso wenig vor den Konsequenzen des Frevels wie der Ruhm des Heroen, wie die Beinahe-Steinigung des Aias zeigt. In den Augen der Bewohner von Kaphyai forderte die Übertretung ganz unabhängig von der dahinterstehenden Intention die Rache der Göttin heraus. Nur mit einer scharfen Sanktion durch die Gemeinschaft war diese Rache abzuwenden. Die eigenen Kinder wurden zu diesem Zweck getötet, und darüber hinaus wurden sie schmählich unbeerdigt gelassen. Die Kollektivstrafe der Steinigung bildet eine auffällige Parallele zum jüdischen Gesetz. Die griechische Gesellschaft kannte sie bei den verschiedensten Vergehen, aber ihr besonderer Doppelcharakter wird doch gerade am Beispiel der Religionsfrevel sichtbar: Zum einen symbolisiert sie den Ausschluss aus der betreffenden Gemeinschaft, zum andern stellt sie eine Sühnehandlung dar, mit der sich das jeweilige Kollektiv zu entschulden sucht.[22]
Mit der Strafe der Steinigung aber endet die Geschichte des Pausanias noch nicht. Nach der Tat nämlich, so berichtet dieser, brachten die Frauen in Kaphyai nur noch tote Kinder zur Welt. Daraufhin habe die Pythia, das Orakel in Delphi, sie angewiesen, die getöteten Knaben zu bestatten und ihnen jährlich Totenopfer darzubringen. Sie seien nämlich nicht zu Recht gestorben. Seither, so schließt der Schriftsteller, heiße, ebenfalls auf Weisung der Pythia, die dortige Göttin Artemis Apanchomene (»die Erwürgte«). Anders als ihre Anhänger scheint die attackierte Göttin in diesem Fall die Frage der kindlichen Unzurechnungsfähigkeit durchaus ins Kalkül gezogen zu haben. Die Episode setzt also ein Fragezeichen hinter die Vorstellung eines rituellen Automatismus.[23] Es gab durchaus Verhandlungs- und Verhaltensspielräume hinsichtlich der Frage, ob eine gravierende Herabsetzung der Götter vorlag oder nicht – Spielräume der jeweiligen Akteure, ihrer Mitmenschen und nicht zuletzt des jeweiligen Gottes selbst.
Schärfere Konturen gewinnt das Delikt der Asebie in Athen zur konfliktreichen Zeit des Peloponnesischen Krieges. Wohl im Jahr 432 v. Chr. brachte der Seher Diopeithes einen Antrag vor die Volksversammlung, nach dem unter Anklage zu stellen sei, »wer nicht an die Götter glaube und sich in wissenschaftlichen Vorträgen mit den Dingen über der Erde befasse«.[24] Der Antrag, so berichtet Plutarch, habe sich nicht nur gegen den Philosophen Anaxagoras gerichtet, sondern indirekt auch gegen dessen Schüler Perikles, den langjährigen ersten Mann und Strategen der Polis. Zugleich sei Perikles’ Frau Aspasia wegen Asebie und Sittenlosigkeit unter Anklage geraten. Anaxagoras kann als Exponent eines geistigen Milieus betrachtet werden, das durch intellektuelle Neugier, Skepsis gegenüber herkömmlichen Erklärungen und die Suche nach umfassender Naturerkenntnis gekennzeichnet war. Es heißt, er sei der Gottlosigkeit angeklagt worden, »weil er die Sonne einen glühenden Klumpen nannte«,[25] wegen seiner kosmologischen Spekulationen also, die der herkömmlichen Götterlehre entgegenstanden und als deren Missachtung betrachtet werden konnten. Nach Plutarch handelte es sich eindeutig um eine Instrumentalisierung religiöser Vorwürfe für politische Zwecke – anders glaubten seine Gegner dem mächtigen Perikles nicht beikommen zu können. Tatsächlich geriet dieser in die politische Defensive: Zwar erreichte er für seine Frau Aspasia unter Aufbietung aller Kräfte einen Freispruch, musste aber Anaxagoras zum Gang ins Exil raten, vielleicht, um ein drohendes Todesurteil abzuwenden. Offenkundig herrschte in der Stadt am Beginn des großen Krieges ein Gefühl allgemeiner Bedrohung sowie die Angst, es sich mit den Göttern zu verderben.