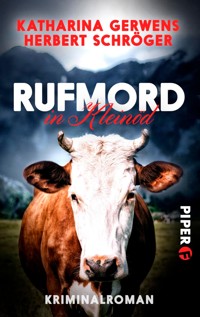8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stella braucht dringend einen Tapetenwechsel, um über ihren Ex-Freund hinwegzukommen. Doch obwohl sie ihr neues Zuhause liebevoll und gemütlich einrichtet, fühlt sie sich einsam. Auch mit ihrer Nachbarin Vicky wird sie nicht so richtig warm. Einzig Kater Boris, der ein paar Häuser weiter, auf einem Kissen thronend, das Treiben auf der Straße beobachtet, zaubert Stella gelegentlich ein Lächeln auf die Lippen. Noch ahnt sie nicht, dass genau dieser Kater ihrer aller Leben auf den Kopf stellen wird und sich am Ende als Glücksbringer erweist. Der perfekte Roman für alle Katzenfreundinnen und -freunde!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Auf Samtpfoten zum Glück« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2020
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: MELANIE DEFAZIO/Stocksy United
Redaktion: Annika Krummacher
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht und dafür keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Danksagung
1. Kapitel
Stella wusste, dass man sie in der Agentur hinter ihrem Rücken »Die Checkliste« nannte, denn sie hatte den Tick, alles und jedes in einer Tabelle festzuhalten und es mit tiefster Befriedigung schwungvoll abzuhaken, sobald es erledigt war. Es ging nun mal nichts über Checklisten, und gerade jetzt, in dieser schwierigen Situation, gaben sie ihr Halt und sorgten dafür, dass sie weiterhin bestens funktionierte.
Ohne ihre Listen hätte Stella es nie geschafft, bei Ferdinand auszuziehen und sich innerhalb von zwei Monaten ein neues Zuhause zu suchen. Für ihren Umzug hatte sie einen guten Grund gehabt: ihre Praktikantin Carina, die sich mit ihren großen Augen und ihrem Schmollmund ausgerechnet Ferdinand geschnappt hatte, mit dem Stella bis vor Kurzem zusammen gewesen war.
Mit ihrem Organisationstalent war es ihr gelungen, die Werbeagentur trotz aller Gefühlsstürme am Laufen zu halten. Es war Juni, doch sie und ihr Geschäftspartner Maximilian waren ihrer Zeit schon um Monate voraus. Stella entwickelte Drehbücher für weihnachtliche Werbespots, und der charismatische Maximilian suchte nach Influencern, die die Produkte zu gegebener Zeit so glaubwürdig wie möglich lobpreisen und auf ihren Websites positionieren sollten.
In der Innenstadt waren die Mieten in den letzten Jahren unbezahlbar geworden, deshalb hatte sich Stella eine Wohnung am Stadtrand gesucht. Ihr neues Zuhause lag im ersten Stock, und unter ihr im Erdgeschoss lebte eine blasse junge Frau, die sich ihr als Vicky vorgestellt hatte. Von der Maklerin wusste Stella, dass diese Victoria Aschenbrenner das Haus und weitere Grundstücke von den Großeltern geerbt hatte. »Sie haben die besten Chancen«, hatte die Maklerin gemeint. »Es sollen weder Familien noch Paare einziehen – nur alleinstehende Frauen. Da die Hausbesitzerin selbst wohl keine Familie haben will, hat sie auch keine Lust, mit glücklichen Familien unter einem Dach zu wohnen.«
Die Maklerin hatte Stella hinter vorgehaltener Hand erzählt, dass Vicky Aschenbrenner auch noch gar nicht so lange hier wohne. Sie habe ihren Job als Röntgenassistentin in Hamburg aufgeben müssen, denn ihre Großeltern hätten das Erbe an die Bedingung geknüpft, dass Vicky selbst in das Haus ziehe. Derzeit waren in den umliegenden Krankenhäusern keine Stellen frei, und so hatte Vicky jetzt zwar ein Haus und mehrere Grundstücke geerbt, war aber arbeitslos.
Tatsächlich wirkte sie trotz ihres Reichtums meistens mürrisch und sah mit ihrem hochgesteckten Haar aus wie eine vor der Zeit gealterte Gouvernante, dabei war sie bestimmt nicht älter als Stella. Sie schien ein Roland-Kaiser-Fan zu sein, denn Stella konnte in ihrer Wohnung hören, wie ihre Vermieterin im Erdgeschoss zu dessen Liedern lauthals mitsang. Womit sich Vicky sonst noch beschäftigte, hatte Stella bisher noch nicht herausgefunden. Sie hatten den gegenseitigen Antrittsbesuch immer wieder verschoben.
Der Blick vom Wohnzimmer in die Weite wurde von großen Schildern mit der Aufschrift »Bauerwartungsland, sichern Sie sich Ihr Grundstück« versperrt. Das Wort Erwartung war Stella entgegengesprungen, als sie die Wohnung zum ersten Mal betreten und aus dem Fenster geblickt hatte. Klar, irgendwann würde es Baulärm geben, und Bagger und Kräne würden ihr die Sicht versperren – aber da Stella tagsüber im Büro war, konnte ihr das egal sein.
Rasch und effektiv leerte sie an diesem Wochenende die sieben auf ihrer Checkliste stehenden Umzugskisten und verstaute ihr Hab und Gut ordentlich in die Schränke und Schubladen der neuen Wohnung. Mithilfe eines Küchenweckers schaffte sie es sogar, sich Auszeiten zu gönnen, indem sie mindestens einmal pro Stunde für zwei Minuten tief durchatmend am Fenster stand und den noch freien Blick auf das Bauerwartungsland genoss.
Bestimmt saß Carina in diesem Moment auf der von Stella und Ferdinand gemeinsam erworbenen Ledercouch, verzog ihre Lippen zu einem Schmollmund und brachte Ferdinand mit naiven Fragen in peinlicher Babysprache zum Lächeln: »Hat der Ferdi denn sein kleines Mäuschen auch noch lieb?« Bei Stella hatte Ferdinand so gut wie nie gelächelt. Vielleicht lag es daran, dass sie sich wie Erwachsene benommen hatten. Bei ihnen hatte es keinen Schmollmund, keine Babysprache, nichts Niedliches gegeben, aber dafür viel Alltag, damit das Leben funktionierte. Na, dem würde das Lachen schon noch vergehen!, dachte Stella.
Sie war überzeugt, dass sie nach der engen Beziehung mit Ferdinand Freiheit und Weite brauchte. Sobald sie an ihren Ex-Freund dachte und sich der wohlbekannte Kloß in ihrem Hals bemerkbar machte, wiederholte sie in ihrem Inneren die Sätze: »Ich war dort viel zu eingeschränkt. In jeder Hinsicht. Ich brauche mehr Luft!« Während sie sich das bewusst machte, hakte sie alles, was mit Ferdinand zusammenhing, auf einer unsichtbaren Liste ab. Die war erstaunlich lang und nicht auf Anhieb abzuarbeiten.
Ihre Wohnung, die nach Süden und nach Westen noch einen freien Blick bot, offenbarte im Osten das nicht immer ganz unkomplizierte Miteinander einiger Familien, die in einem ausladenden Mehrgenerationenhaus zusammenlebten. Neben den jeweiligen Eltern kümmerten sich dort etliche Großeltern um die Kleinen, die zu allem nickten und dann doch machten, was sie wollten.
In den Vorgärtchen der Kurzen Straße, die mit ihren drei Häusern ihrem Namen bisher alle Ehre machte, leuchteten Blumen, die der Jahreszeit entsprachen – momentan Pfingstrosen, Levkojen, Margeriten und Eisenhut –, und hinter den Häusern breiteten sich Rasenflächen und Blumenrabatten aus.
Aus dem Nordzimmer, vor dessen zwei Fenstern sich ein Sommerflieder entfaltete und Schmetterlinge anlockte, sollte wegen der Lichtsituation Stellas »Atelier« werden. Schon das Wort »Atelier« klang nach Künstlertum und Freiheit und einem unangepassten Leben. Dabei hatte sie gar nicht vor, den Raum jemals als solches zu nutzen. Stella fand sich zu normal für ein verrücktes, wenn nicht gar ausschweifendes Leben, in dem die Nacht zum Tag wurde. Nein, da zog sie doch ihr listenreich geregeltes Leben vor. Vorerst stapelten sich im zukünftigen Atelier die restlichen, noch unausgepackten Umzugskisten, jede akkurat mit einer Inhaltsliste versehen.
Vermutlich hatte sie bei Ferdinand einfach nur zu gut funktioniert. Wenn sie ehrlich war, hatte die Beziehung sogar ein wenig Ähnlichkeit mit ihren Checklisten gehabt. Für alles zwischen ihnen hatte es eine festgelegte Zeit und einen festen Ort gegeben, egal, ob es sich um die Bestückung der Vorratskammer, um die Absprache von Einkäufen, die Stundenlohnerhöhung für die Putzfrau oder um den wöchentlichen Sex handelte. Ein perfekt durchgetaktetes Leben, was Ferdinand offensichtlich nicht genügte. Dabei hätte sie darauf gewettet, dass ihm nichts so wichtig war wie Ordnung und Klarheit.
Bedenkenlos und ohne auch nur den Anflug eines schlechten Gewissens war der brave Berufsschullehrer nach acht soliden Beziehungsjahren mit der naivsten, dafür aber hübschesten Praktikantin aus Stellas Werbeagentur erst essen und dann ins Bett gegangen. Na ja, vielleicht war es auch umgekehrt gewesen – Ferdinand bekam nach dem Sex nämlich immer Hunger. Stellas Kränkung auf jeden Fall war so gigantisch, dass sich die Reihenfolge des Verrats als unerheblich erwies.
Die Wohnung hatte vier Zimmer und war trotz Stadtrandlange ziemlich teuer, aber die Maklerin hatte ihr versichert: »Diese Gegend ist im Kommen. Wer etwas auf sich hält, wird bald hier wohnen. Und dann sind Sie schon da!«
Ferdinand, mit dem sie sich drei Zimmer und siebzig Quadratmeter geteilt hatte, würde diese Wohnung niemals sehen. Ausgerechnet dieser Gedanke, der sie anfangs zutiefst befriedigt hatte, schmeckte nun von Tag zu Tag schaler.
»Lass uns reden«, hatte er ganz zu Anfang versucht, ihre Beziehung zu retten. Aber wenn die Carina-Geschichte nichts zu bedeuten hatte, warum war sie dann passiert?
Für Stella stand fest, dass er sich die hübsche Praktikantin als ihre Nachfolgerin in sein Leben holen würde. Sollte er doch! Denn dann würde er ziemlich schnell begreifen, was er an Stella gehabt und jetzt verloren hatte. Doch sie würde ihn nicht einmal dann in diese neue Wohnung lassen, wenn er winselnd vor ihrer Tür läge.
Ferdinand wusste auch gar nicht, wohin sie gezogen war. Eindringlich hatte sie ihrer Assistentin Christine klargemacht, dass ihre neue Privatadresse geheim gehalten werden musste, insbesondere vor Carina. Von Christine wusste sie, dass seitdem in der Agentur das Gerücht ging, Stella würde von einem Stalker verfolgt und brauche daher die Anonymität. Sie bekam einen Mitleidsbonus, der sich falsch und süßlich anfühlte. Um sich abzulenken, stürzte sie sich in die Arbeit. Genug zu tun gab es schließlich immer.
Nachdenklich saß sie nun in ihrem neuen Zuhause am Schreibtisch und blätterte in den Geschenk- und Spielwarenkatalogen für die Weihnachtssaison. Wer wusste schon, ob die brandneuen elektronischen Geräte nicht im Dezember bereits total veraltet sein würden?
Sie klickte sich durch eine Datei mit ausgemusterten Schnipseln aus Spielfilmen und Dokumentationen. Es war ihre Idee gewesen, dem Schneidetisch zum Opfer gefallene Sequenzen aus dem ganz großen Kino in Werbespots wiederaufleben zu lassen. Das war auch das Geheimnis ihres Erfolges.
Wenn sie arbeitete, war es nicht ganz so still in der Wohnung, und die Zeit verging ein bisschen schneller. Gelegentlich schallte die kräftige Stimme von Roland Kaiser ein bisschen lauter durchs Haus als sonst – immer dann nämlich, wenn Vicky die Wohnungstür öffnete und zum Rauchen in den Garten ging.
Draußen dämmerte es.
Anders als in der Stadt gab es hier im Bauerwartungsland noch keine Restaurants, Cafés oder auch nur einen Kiosk. Doch wenn man der Maklerin Glauben schenkte, würde dieser Zustand höchstens noch ein, zwei Jahre andauern.
Stella zog sich ihre Windjacke und ihre rosafarbenen Gummistiefel an und beschloss, eine Runde um die Häuser zu drehen. In ihrer Straße gab es bisher ja nur drei.
Hinter dem größten Fenster des Hauses mit der Nummer eins hockte, eingerahmt von einer Spitzengardine und auf einem wollweißen Kissen vor der kühlen Marmorplatte geschützt, eine ziemlich dicke grau-weiß gemusterte Katze und suchte Stellas Blick. Als sie sich in die Augen sahen, seufzte das Tier aus tiefster Seele und strich sich mit der rechten Pfote über den Kopf. Stella sah ihm lange zu und fragte sich, ob die Katze ihr mit dieser Geste etwas sagen wollte, dann riss sie sich zusammen. So ein Quatsch!, dachte sie.
Durch das gekippte Fenster hindurch war die dünne Stimme eines alten Mannes zu hören. »Boris, Abendbrot! Kommst du?«
Die Katze erhob sich majestätisch und ließ Stella dabei nicht aus den Augen. Boris war offenbar der Name des Katers. Stella bewunderte die Kunstfertigkeit, mit der das Tier einen Buckel machte, sich streckte und dann im Inneren des Hauses verschwand.
Karl-Anton Wederbusch hatte den Küchentisch schon fast fertig gedeckt, als Boris mit einem eleganten Satz die Tischplatte eroberte und sich auf seinem Platzdeckchen in Stellung brachte. »Dass du mir nie zur Hand gehst«, beschwerte sich der alte Mann mit einem Augenzwinkern bei seinem Kater und tischte auf. Heute würde es pürierte Schweineleber und Kartoffelbrei auf einem Bett von gedünstetem Brokkoli geben. Für Boris ungewürzt und lauwarm, für Karl-Anton heiß, mit Salz und Pfeffer sowie einem Stich Butter.
Als seine Frau Ida vor vier Jahren starb, hatte Karl-Anton keine Lust gehabt, für sich allein zu kochen. Auf Drängen seines Sohnes hatte er sich Essen auf Rädern bestellt, doch das schmeckte ihm nicht.
Das war der Zeitpunkt, als sein Enkel Fabian ihm bei einem Besuch den kleinen Boris mitbrachte. »Er wohnt jetzt bei dir, Opa«, hatte Fabian erklärt. »Ich bin zu selten zu Hause, und du bist dann nicht mehr so allein. Was willst du denn sonst machen, jetzt als Rentner?«
Karl-Anton, der sich damals nach mehreren Bandscheibenvorfällen unsicher und mit Stock und Rollator durch die Wohnung bewegte, hatte heftig protestiert. »Ich kann mich ja nicht mal um mich selbst richtig kümmern.«
»Ach, das wird schon«, hatte Fabian zuversichtlich gemeint. »Boris guckt übrigens auch gern fern.«
Allein seinem Enkel zuliebe hatte Karl-Anton das Tier genommen und schon nach einem Tag gewusst, dass das die beste Entscheidung seines Lebens war. Da war jemand, dem er alles erzählen konnte und der dazu nickte und nicht widersprach. Typisch Fabian. Da tat der Junge so, als müsse der Opa ihm einen Gefallen tun, aber eigentlich war es umgekehrt: Fabian machte immer genau das, was für den Großvater am besten war, selbst wenn der noch nichts davon ahnte.
Dem Kater hatte das Essen auf Rädern ebenso wenig geschmeckt wie seinem Herrchen. Deshalb hatte Karl-Anton angefangen, zweimal täglich zu kochen – für den Kater und für sich selbst. Ihm kam zugute, dass er in seinem früheren Leben Kantinenkoch gewesen war. Nun bereitete er eben zwei statt zweihundert Mahlzeiten vor.
Boris schien die gemeinsamen Mahlzeiten zu genießen. Karl-Anton war ganz froh, dass niemand ihnen dabei zusehen konnte. Zufällige Betrachter hätten das Gesundheitsamt, das Ordnungsamt und den Tierschutzverein gerufen und ihm ebenso langweilige wie überflüssige Vorträge über Hygiene gehalten. Alles dummes Zeug. Als wüsste er nicht, was er tat.
Nun thronte Boris auf seinem Platz am Tischende und schleckte sein Menü, das in einem Porzellanschälchen angerichtet war. Karl-Anton war es nicht gelungen, das Tier an eine Serviette oder ein Lätzchen zu gewöhnen. So ein Kater hatte nun mal seinen eigenen Kopf. Und Boris hatte einen besonders dicken Kopf.
Karl-Anton dagegen benutzte Messer und Gabel, trank brav seine zwei Liter Wasser tagsüber – und gönnte sich abends ein Bier oder ein Glas Wein, während Boris ein wenig schwer zum Wassertrinken zu motivieren war. Abgesehen davon, waren sie aber ein eingespieltes Team mit etwa dem gleichen Geschmack.
Schon bald hatte Karl-Anton herausgefunden, dass Boris Innereien und Gerichte mit Hühnerfleisch bevorzugte, Gemüse nur in der höchsten Not aß (oder wenn es nach Fleisch duftete), von Reis, Hirse oder Graupen nicht viel hielt und Bulgur nur widerwillig akzeptierte.
Während Boris am Tisch saß, konnte Karl-Anton ihn, wie in früheren Jahren seine Frau Ida, über das Abendprogramm informieren. »Wir werden uns heute einen Krimi anschauen«, erklärte er. »Dazu gibt es für beide Kartoffelchips und für mich ein Glas Rotwein. Ist das in deinem Sinne?«
Der Kater sah kurz hoch und schien zu nicken.
Wir sind ein gutes Team, dachte Karl-Anton und fragte sich, ob er noch leben würde, wenn er das Tier nicht hätte. So nämlich, unter diesen Umständen und bei diesem Mitbewohner, konnte er nicht einfach abtreten, denn was würde dann aus Boris? Man trug doch Verantwortung für so ein Haustier.
»Was machst du nur, wenn ich nicht mehr bin?«, wollte er von Boris wissen. Der Kater setzte sich sehr aufrecht hin und strich sich mit der rechten Pfote über den Kopf. Dazu seufzte er aus tiefster Seele. Karl-Anton war davon überzeugt, dass sein Gegenüber bei der Vorstellung, einer von ihnen könne sterben, eine Träne verdrückte.
Tatsächlich war Karl-Anton Wederbusch nun um einiges fitter. Boris hatte ihn gerettet – vor was auch immer. Daher liebte er seinen Kater.
»Also, kommst du nun mit auf die Couch?«
Karl-Anton schüttelte das Tischtuch durchs geöffnete Fenster aus, um es anschließend zurückzulegen und glatt zu streichen. Ordnung musste sein. Der Kater sprintete schon los, schoss vor ihm durch die angelehnte Tür ins Wohnzimmer und machte es sich auf dem Sofa vor dem Fernseher bequem.
Hatte sich der Kater hinter dem gekippten Fenster tatsächlich eine Träne aus dem Augenwinkel gewischt? Stella schüttelte über sich selbst den Kopf. Übertrug sie etwa ihr eigenes Gefühl des Verlorenseins auf das Tier? Sigmund Freud ließ grüßen. Und überhaupt: Sie hatte Ferdinand verlassen. Wenn einer weinen müsste, dann er. Hoffentlich schon recht bald und dann aus Verzweiflung über seine blöde Carina.
Stella hängte ihren Mantel an die Garderobe und zog sich die Gummistiefel aus. Vermutlich fing sie schon an zu verschraten und so komisch zu werden wie ihre Vermieterin im Erdgeschoss. Nur manchmal, wenn Vicky lächelte, blitzte etwas Lebendiges in ihr auf und ließ erahnen, dass sie fröhlich und ausgelassen sein konnte. Vielleicht war sie das ja auch, wenn niemand zusah, zum Beispiel, wenn sie zu den Liedern ihres Idols sang.
Würde Stella bei einer Frauenzeitschrift arbeiten, hätte sie Vicky für jene Seiten rekrutiert, die so vielversprechend »Vorher – Nachher« hießen. Auf denen wäre aus dem hässlichen Entlein ein strahlender Schwan geworden. Aber wer weiß, ob die Besitzerin des Hauses sich darauf eingelassen hätte. Sie wirkte eher so, als mache ihr alles aus der Außenwelt Angst und als fühle sie sich nur in ihren eigenen vier Wänden sicher. Wenn sie rauchend im Garten stand, erweckte sie den Eindruck, als müsse sie mit Rauchwolken der Ernsthaftigkeit gegen die Absurditäten der Welt angehen. Fürwahr keine leichte Aufgabe.
Ganz anders als Carina, die von morgens bis abends fröhlich über die Flure der Agentur tänzelte. Ein Albtraum! Stella hatte bereits bei deren Vorstellungsgespräch ein mieses Gefühl gehabt, sich aber dann von Maximilian überstimmen lassen. »Die kommt bei den Kunden gut an. Die ist der perfekte Türöffner für neue Märkte. Mit ihrem naiven Charme wickelt sie alle um ihre Finger.« Das war ihr in der Tat gelungen. Und zwar nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei Stellas Berufsschullehrer für Druck- und Medientechnik.
Um sich abzulenken, öffnete Stella die nächste Umzugskiste. Die war zwar eigentlich erst morgen dran, aber ihr fiel nichts Besseres ein, während sie im Backofen eine Tiefkühllasagne auftauen ließ.
In diesen Karton hatte sie Ordner mit Briefen, Fotoalben und Tagebücher geschichtet, die sie schon seit ihrer Schulzeit mit sich herumschleppte, ohne jemals wieder hineingeschaut zu haben. Sie hätte sie gleich wegwerfen sollen, am besten schon, bevor sie mit Ferdinand zusammenzog. Aber bei ihrem Auszug konnte sie die Ordner auch nicht einfach dortlassen oder in den Papiermüll stecken, denn sie hätten auf keinen Fall in Ferdinands Reichweite landen dürfen. Sie traute ihm zu, dass er ihre weggeworfenen Papiere durchwühlte, und wenn er es nicht tat, dann sicher das Carina-Mäuschen. Der war überhaupt nur Schlechtes zuzutrauen.
Während Stella den Karton durchsah, bedauerte sie zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie nicht schon als Kind Checklisten geführt hatte. Alte Freunde durfte man nicht vergessen. Und doch war es ihr passiert. Ohne Vorwarnung flutschten ihr aus einer Plastikhülle Automatenfotos entgegen. Vierfach grinste ihr eigenes junges Ich neben den unterschiedlichen Gesichtern früherer Freundinnen und Freunde, so nah, dass sie selbst jetzt noch deren Duft wahrzunehmen meinte, dabei wusste sie nicht einmal mehr, wie sie geheißen hatten.
An die Enge des Automaten erinnerte sie sich und daran, dass sie sich vor den vierfachen Klicks mit den Fingern durch die Haare gefahren waren, den grellen Lippenstift nachgezogen und die Augen aufgerissen hatten, sie hatten herumgealbert, und alle Küsse hatten damals nach Pfefferminz geschmeckt. Die der Jungen ebenso wie die der Mädchen. Die Kaugummis wurden vor dem Fotografieren in einer Backentasche gelagert. Damals, als alles für die Ewigkeit angelegt schien und sie sich Freundschaften bis ans Ende aller Tage schworen.
Stella wischte sich mit der Hand übers Gesicht und dachte dabei an den Kater, der fast dieselbe Bewegung vorweggenommen hatte, vorhin, als sich ihre Blicke durchs Fenster kreuzten. Sie hatte draußen im Regen gestanden, er drinnen auf dem Fensterbrett gelegen.
Was für ein Glück, dass sie morgen wieder in die Agentur gehen konnte. Eines war klar: Sie brauchte Menschen um sich, und diese Carina würde sie sich schon vom Hals halten können. Sollte die doch mit Maximilian die Akquise machen und den Kunden ihren Schmollmund präsentieren. Denn darin war sie ja wohl perfekt.
Als Ferdinand in ihr Leben trat, hatte Stella ihre Freunde und auch ihre Vergangenheit so beiseitegelegt, wie man ausgelesene Zeitungen auf den Altpapierstapel packt. Alles sollte neu sein, alles auf Anfang. Alles mit ihm! Ihre gemeinsame Zukunft bestand in Stellas Vorstellung aus lauter weißen Blättern, die sie gemeinsam beleben, beschriften, bezeichnen und entfalten würden. Wie naiv sie gewesen war! Ferdinand hatte sich um keine Zukunft gekümmert, keine dieser imaginären und so verheißungsvollen Seiten mit Plänen gefüllt, sondern stattdessen über Medien und Drucktechnik doziert und ihr ab und zu einen Kuss auf die Stirn gedrückt. Beziehungsarbeit sollte doch eigentlich ein Teamplay sein – aber letztlich war das alles an Stella hängen geblieben. Sie verspürte so was wie Selbstmitleid und schüttelte sich.
Erst viel zu spät hatte sie gemerkt, dass Ferdinand in Wahrheit unflexibel, fantasielos und lächerlich war. Er war das absolute Gegenteil des charismatischen Maximilian, der es wie kein anderer verstand, Menschen zu begeistern.
Kopfschüttelnd las sie zwanzig Jahre alte Briefe und Tagebuchnotizen und staunte über ein fremdes Leben: So vertraut war sie einmal mit all diesen Menschen gewesen! Über die intimsten Dinge hatten sie und ihre Freundinnen sich ausgetauscht, und immer hatte jede von den anderen gewusst, wer gerade in wen verknallt war.
Der größte Schwarm von allen hatte Alex geheißen. Damals hatte er zusammen mit seiner Mutter in einer Wohnung oberhalb der Post gewohnt. Zur Miete, was ungewöhnlich gewesen war in jener Kleinstadt, wo alle ihre eigenen Häuschen nebst Gärtchen bewirtschafteten. Stellas Freundinnen waren sich darin einig gewesen, dass Alex wie ein Filmheld aussah. Später war er zur Polizei gegangen. Die grüne Uniform hatte wie angegossen gesessen und perfekt zu seinen smaragdenen Augen gepasst. Wenn sie sich doch nur erinnern würde, wie er mit Nachnamen hieß, dann könnte sie nach ihm suchen. Aber nirgends fand sie seinen vollen Namen. Na ja, wirklich beeindruckt hatte er sie ja auch nicht. Seine hochnäsige Arroganz und die Selbstverständlichkeit, mit der er auf seinen weiblichen »Hofstaat« herabsah, waren ihr von Anfang an suspekt gewesen. Aber fast alle Mädels aus ihrer Klasse wollten mit ihm gehen – und natürlich ließ er sie alle im Ungewissen, dieser eingebildete Schönling. Auf wen oder was wartete er bloß, auf eine Prinzessin? Einmal, dachte Stella und musste ein wenig über sich selbst lächeln, einmal hatte sie sich nichts so sehr gewünscht wie mindestens drei Pickel in Alex’ Gesicht. Ob dieser Traum jemals in Erfüllung gegangen war?
Sie betrachtete die Fotos und die säuberlich und sogar alphabetisch abgehefteten Briefe. Nach der Lektüre konnte sie einigen Gesichtern auf den Automatenfotos Namen zuordnen und schrieb sie mit Bleistift auf die Rückseiten der Abzüge.
Offenbar hatte es einen Jungen gegeben, für den sie durchs Feuer und bis ans Ende der Welt gegangen wäre. Weiter noch als später für Ferdinand. Den einen – nie abgeschickten – Liebesbrief an ihn hatte sie in den Ordner geheftet – schon damals eher pragmatisch als romantisch. Schüchtern und mit sehr gerade gezogenem Scheitel lächelte er ihr nun von einem Foto entgegen, das sie auf die Rückseite des edlen und nur für ihn gekauften und dann niemals verschickten Büttenpapiers geheftet hatte, dabei wusste sie nicht einmal mehr, wie er hieß. In dem Brief hatte sie ihn als »mein Liebster« angeredet, als verböte ihr eine geheime Macht, seinen Namen zu nennen. Abgeheftet hatte sie den Brief allerdings unter »M«. Marco, Martin, Michael? Alle Namen klangen fremd.
Stellas beste Freundin hatte Moni geheißen. Doch die hatte schon mit zwanzig auf dem Oktoberfest in München einen australischen Agraringenieur kennengelernt und war ihm nachgereist. Stella suchte im Internet nach ihr und wurde tatsächlich fündig. Mittlerweile war Moni eine kräftige und rotwangige Farmerin mitten in Queensland und hatte, vermutlich mit ihrem oktoberfestaffinen Jungfarmer, fünf Kinder bekommen, die Stella aus einem Meer lockiger Merinoschafe entgegenstrahlten. Die Website warb für »Farmstays«, und wer keine Schafe hüten wollte, konnte unter Monis Aufsicht auch Schafe scheren, Wolle waschen, spinnen oder färben. Die Hüterin der Farm sah auf dem Bild so glücklich aus, dass es Stella fast wehtat.
Wenn sie eine von ihren damaligen Freundinnen jetzt durch Zauberei zu sich einladen könnte, dann am ehesten Moni – oder kam ihr der Gedanke nur, weil gerade die so weit weg war? Und würden sie sich überhaupt entspannt unterhalten können? Besaß Stella noch die Fähigkeit zur leichten Plauderei? Hatte sie sie jemals besessen?
Stella schnappte sich ihr Smartphone und notierte sich: Small Talk, mindestens zehn Minuten täglich. Sie wusste, dass das für sie eine schwere Übung sein würde, denn mit Ferdinand hatte sie nur über das Wesentliche gesprochen, und da es letztlich nichts Wesentliches mehr zwischen ihnen gab, hatten sie sich friedlich angeschwiegen.
Carina war da um einiges begabter. Sie war ein Naturtalent in Sachen inhaltsleerer Plauderei. Doch mit der wollte Stella auf keinen Fall üben.
»Wie war dein Wochenende?«, begrüßte sie Montagfrüh ihre Assistentin Christine und wunderte sich, als diese zusammenzuckte und besorgt aufsah.
»Gut, bestens. Ist was passiert?«
»Nein, was soll schon sein? Na ja, am Samstag fand ich es etwas zu windig, um spazieren zu gehen.« Breitbeinig stand Stella am Schreibtisch ihrer Mitarbeiterin und überlegte krampfhaft, wie sie das Gespräch in einem lockeren Ton weiterführen könnte.
»Das stimmt.« Christine nickte knapp. »Was steht heute an? Ist übers Wochenende noch was Wichtiges reingekommen?«
Normalerweise hätte Stella nun geantwortet: »Ja, und ich will ein Meeting noch vor der Mittagspause.« Aber von den zehn Minuten Small Talk, die sie sich für heute fest vorgenommen hatte, waren noch nicht einmal sechzig Sekunden vorüber. Hilflos sah sie sich um und bemerkte: »Was für schöne Blumen dort auf der Fensterbank.«
Stellas Assistentin blickte erschrocken hoch. »Geht es dir nicht gut?«
»Doch, wieso?« Stella räusperte sich. »Meine Wohnung ist übrigens jetzt fast komplett eingeräumt. Was soll man auch sonst tun bei dem Wetter?«
»Da hätte ich dir doch helfen können. Mit dem Bus wäre ich in vierzig Minuten da draußen gewesen.«
Da draußen – wie sich das anhörte. Als sei sie nicht nur an die Peripherie der Stadt, sondern direkt ins australische Outback gezogen.
»Wieso mit dem Bus? Ich brauch mit dem Wagen nur fünfzehn Minuten. Hast du denn kein Auto?«
Christine schüttelte den Kopf. »Nicht einmal einen Führerschein.«
Da arbeiteten sie seit vier Jahren zusammen, und Stella wusste nichts von Christine. Und das in einer Agentur, die sich Kommunikation auf die Fahnen geschrieben hatte.
Aber Stella wusste auch, dass ihr ein Besuch von Christine gar nicht so recht gewesen wäre, insbesondere nicht als Hilfe beim Einräumen ihrer privaten Wohnung. Unauffällig sah sie auf die Uhr. Noch nicht einmal zwei Minuten des verordneten netten Gesprächs hatte sie geschafft. Wie machten andere Menschen das bloß?
Mit Schwung öffnete sich ausgerechnet jetzt die Tür, und eine strahlend junge Carina rief, noch bevor sie die Tür wieder hinter sich geschlossen hatte: »Meine Süßen, da bin ich! Alles klar bei euch? Auf zu neuen Taten!«
Die versammelte Mannschaft nickte und lächelte sie so an, als freute sie sich tatsächlich über ihren Anblick. Nur Stella blieb stocksteif stehen.
»Leute, ich hatte so ein tolles Wochenende. Kein Wunder bei dem Kuschelwetter. Oh, war das gemütlich!« Carina seufzte aus tiefster Seele und warf ihren nassen Regenmantel in so hohem Bogen über die Flurgarderobe, dass das Parkett mit Wassertropfen übersät war. »Das Leben ist so schön!« Erst dann bemerkte sie Stella und wandte sich verlegen ab.
»Wischst du bitte gleich den Fußboden trocken?« Christine rief die Praktikantin zur Ordnung, und Stella ahnte, dass sie ihr damit einen Gefallen tun wollte. Doch es war schon zu spät.
Ferdinand und sein Mäuschen hatten bei dem Regen gekuschelt! Vermutlich auf dem Ledersofa, das sie zur Hälfte bezahlt hatte. Sechshundert Euro von ihrem Konto steckten darin, ohne dass Ferdinand und sie je darauf gekuschelt hätten.
»Punkt zehn Meeting im Konfi«, ordnete sie mit strenger Stimme an. »Zum Status quo des Möbelkatalogs, zum Umgang mit dem neuen Kunden und zur Besprechung sämtlicher Werbespots aus der Pipeline.« Dann schloss sie resolut ihre Bürotür hinter sich.
Diese Agentur war kein Ort für Small Talk – auch wenn Außenstehende das so sehen mochten. Und überhaupt, dafür war Maximilian zuständig. Es reichte ja wohl, dass sie den Rest machte, Ideen umsetzte und Drehbücher schrieb. Wo blieb ihr Geschäftspartner überhaupt? Vielleicht sollte sie ihn darum bitten, ihr leichte und unverbindliche Plaudertöne beizubringen. Sie schüttelte über sich selbst den Kopf. So weit käme es noch!
Das Meeting dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Die Praktikantin tischte den Konferenzteilnehmern Kaffee, Saft und Kekse auf, und immer, wenn Carina den Konferenzraum betrat, schienen alle aufzuatmen. Sogar Maximilian. Als ginge mit ihr die Sonne auf! Dabei lieferte diese strahlende Saftschubse doch nur was für den Magen.
Genauso hatte auch Ferdinand gestrahlt und es genossen, als er Carina hier zum ersten Mal begegnet war. Das war direkt nach der jährlichen Agentur-Weihnachtsfeier gewesen, und hätte Stella nicht ein bisschen zu viel Glühwein getrunken, wäre das alles nicht geschehen. So aber hatte sie daheim angerufen, anstatt sich ein Taxi zu bestellen: »Kannst du mich abholen? Nicht, dass ich noch meinen Führerschein verliere.«
»Mach ich, kein Problem. Ich fahre sofort los.«
Schon eine halbe Stunde später hatte er neben der Praktikantin auf dem Besuchersofa im Foyer gesessen, plaudernd und lachend und wilde Geschichten aus seinem Lehreralltag mit schon fast erwachsenen Schülern erzählend, sodass man meinen könnte, er habe schwuppdiwupp einen durchweg gut gelaunten, weltoffenen, selbstbewussten und charmanten Zwillingsbruder aus dem Ärmel gezaubert. Dabei zeigte er der Kleinen, die ihn voller Naivität anzubeten schien, nur jene Seiten, die er vor Stella sehr sorgsam verborgen hatte.
So hatte das Ende begonnen, von Ferdinand hochtrabend als »Ich brauch einfach mal mehr Lebendigkeit in meinem Leben« betitelt. Als hätte sie ihm sein Lebendigsein untersagt. Ob er sich nun ständig albern und glücklich und redegewandt gab? Immer und überall? Wie anstrengend!
2. Kapitel
Wie fast immer kam Stella auch heute spät nach Hause und merkte, dass sie zugleich müde und überdreht war. Da würde ein abendlicher Spaziergang nicht schaden. Wozu war sie schließlich an den Stadtrand gezogen? Und stand nicht auch »viel frische Luft« auf einer ihrer vielen To-do-Listen?
In den vergangenen vier Wochen hatte sie jeden Abend eine kleine Runde gedreht. Zwar hatte sie sich immer dazu aufraffen müssen, aber dafür ein neues Ritual für sich entdeckt. Einfach nur langsam gehen. Dabei sprang kein Auftrag raus, keine neue Idee wurde geboren, kein wesentlicher Punkt abgehakt. Sie ging und schwang in unbeobachteten Momenten beide Arme um sich und fühlte sich wohl. Sie spürte sich. Wenigstens einmal am Tag.
Am Fenster des Hauses mit der Nummer eins hockte wie immer der Kater, von dem sie nun wusste, dass er Boris hieß. Unverwandt blickte er sie allabendlich an, fast so, als erwarte er mit wachsender Unerbittlichkeit ihren Rapport, und tatsächlich ließ sie in seiner Gegenwart den Arbeitstag Revue passieren. Verständnisvoll und mit milderem Blick als zuvor wischte er sich dann mit der Pfote über das rechte Auge.
Das Fell um seine Augenpartie war wie mit einem weißen Lidstrich gezeichnet, und unterhalb seines rosafarbenen Näschens vibrierten weiße Bartstoppeln. Sie lächelte und wunderte sich, dass ihr in seiner Gegenwart immer wieder auch schöne Momente einfielen – die hätte sie ohne diese abendlichen Gänge und ohne den Blick des vierbeinigen Pelzbündels ganz vergessen.
Sie unterhielten sich per Gedankenübertragung. Da konnte niemand mithören oder sich gar einmischen.
Boris nickte, als würde er alles verstehen.
Der Hund war groß, hatte einen langen und spitzen Kopf und sah aus, als würde er jeden Tag gekämmt. Und die Frau, die mit ihm an der Bushaltestelle wartete, blickte fast zärtlich auf ihr Haustier hinab. Der Junge kannte diesen Blick. Er hatte ihn nur schon lange nicht mehr gesehen. Seine Mutter hatte ihn auch so angeschaut, doch sein Vater hatte keine Zeit dafür.
Schüchtern trat der kleine Junge ganz dicht an beide heran. Der Hund roch gut. Nach frischem Shampoo und nach leckeren Äpfeln. Die Frau bemerkte das Kind und lächelte. »Willst du ihn mal streicheln?«
Er nickte.
»Er heißt Bruno«, fuhr die Frau fort, und der Junge fuhr fast andächtig über das kurze Rückenfell und die langen Haare an Ohren und Beinen des Tiers. Brunos Schnauze war so braun, als habe er sie in Schokolade getunkt.
Der Bus kam, die Türen öffneten sich automatisch, und Frau und Hund stiegen ein. Bruno drehte sich dabei fragend nach dem Jungen um, und so stieg er auch in den Bus.
Die Frau sah den Knirps an und fragte besorgt: »Bist du etwa ganz allein unterwegs?«
Der kleine Junge nickte. Die Frau fand, dass er ein wenig verloren wirkte, die Fingernägel waren zu lang, die Haare zerzaust, und seine zusammengewürfelte Kleidung machte den Eindruck, als hätte er sie willkürlich aus einer mit Pullovern und Hosen vollgestopften Schublade geholt. Aber sie war sich nicht ganz sicher, ob nicht genau das die neue Mode für Kinder war. Da gab es ja fast jeden Tag einen neuen Trend. Sollte jedoch tatsächlich das der letzte Modeschrei sein, so zeugte er eindeutig von Geschmacklosigkeit. Gut, dass Hunde nicht wie Kinder auf eigene Modetrends bestanden.
Sie beschloss, sich nicht einzumischen, und ließ es zu, dass der vom Hundefriseur kommende Afghane von den schmutzigen Händen des unfrisierten Kindes gestreichelt wurde.
Die Mitfahrenden hatten nur kurz aufgesehen und sich dann wieder auf ihre Smartphones, Zeitungen oder Fingernägel konzentriert. Manche blickten auch einfach aus dem Fenster. Je weiter die Stadt hinter ihnen zurückblieb, umso mehr Sitze wurden frei. Immer mehr Leute stiegen aus und immer weniger ein.
Frau und Hund setzten sich in eine Reihe, der Junge drückte sich auf der Bank hinter den beiden ans Fenster. Er hatte nicht gewusst, dass die Erde sich so weit ausdehnte. Auf einmal knurrte sein Magen, dann noch einmal, und zwar so laut, dass die Leute den Afghanen vorwurfsvoll ansahen und sich einig waren: so ein unerzogener Hund. Im Bus knurrte man nicht! Der kleine Junge verschränkte die Arme um sich und verkroch sich in sich selbst. Zu gern hätte er das Geräusch in seinem Bauch abgestellt.
Dann hielt der Bus erneut. Entsetzt stellte der Junge auf dem Fensterplatz fest, dass Frau und Hund verschwunden waren. Er musste kurz eingeschlafen sein, dabei hatte er schon fest eingeplant, bei den beiden zu bleiben. Fürs Erste jedenfalls. Dann hätten Tante Tina, Onkel Michael und vor allem der Papa wieder ein bisschen Zeit für sich. Denn das sagten sie ja dauernd: »Ich brauche auch mal Zeit für mich.«
Wenn das Kind eines in seinem Leben gelernt hatte, dann das: Die Erwachsenen brauchten immer Zeit für sich, hatten immer sehr, sehr viel zu tun und aßen unregelmäßig. Im Gegensatz zu Menschen bekamen Tiere regelmäßig etwas zu essen. Der Magen des kleinen Jungen knurrte nun wie ein hungriger Wolf, und jetzt war kein Tier mehr im Bus, das man für das Geräusch hätte verantwortlich machen können.
Denn der Bus war nun so gut wie leer.
»Endstation!«, rief der Fahrer. »Alles aussteigen, bitte.«
Der kleine Junge stieg brav aus. Er hatte beizeiten gelernt, keine Fragen zu stellen und den Erwachsenen nicht zu widersprechen. Damit nahm man denen nur Zeit weg. Und überhaupt: Wer tat, was die Leute wollten, blieb unsichtbar. Und nur die Unsichtbaren waren auf der sicheren Seite.
Der kleine Junge staunte über diesen Teil der Welt: keine Hochhäuser mit Balkonen und gläsernen Aufzügen an den Seiten, stattdessen Hecken und Vorgärten und Zäune aus Holzlatten, an deren Spitzen Blumentöpfe mit bunten Blüten hingen.
Er zog die schmuddelige Jacke, die ihm etwas zu groß war, enger um sich und stapfte los. Vielleicht hatte er ja Glück. Vielleicht traf er ein Tier und mit dem Tier einen Menschen, der gut zu ihm war.
Und tatsächlich: Hinter einem der Fenster hockte eine dicke grauweiße Katze und sah ihm freundlich entgegen. Zumindest kam es ihm so vor. Jetzt wischte sie sich übers Auge. Weinte sie etwa? Der Junge hatte einen Kloß im Hals. Da saß eine Katze, und die durfte weinen. Beneidenswert. Wenn er mal weinte, wurde er sofort von Onkel Michael ermahnt: »Reiß dich zusammen. Männer heulen nicht.« Sein Vater weinte auch nicht – oder nur, wenn er dachte, niemand würde ihn sehen. Dafür sagte er aber sehr oft: »Es ist zum Heulen!«
Fast hätte der Junge mit der Katze geweint, denn sein Magen tat inzwischen richtig weh. Nun wurde es auch noch kalt.
Er hätte bei dem Hund bleiben sollen. Bruno hatte nach Apfelshampoo gerochen und zugelassen, dass man seine Hände in seinem Fell wärmte. Sicher wäre es auch gut gewesen, neben Bruno einzuschlafen. So warm, so weich und so flauschig! Und gut bewacht wäre er dann obendrein.
Die Katze dort drinnen fror bestimmt nicht.
Sie saß auf einem Kissen, das vermutlich von unten von der Heizung erwärmt wurde. Zu gern hätte er sich neben sie gesetzt. Kaum dachte er das, schon hatte er nicht nur kalte Hände, sondern auch kalte Füße und trat von einem Bein auf das andere.
Ende der Leseprobe