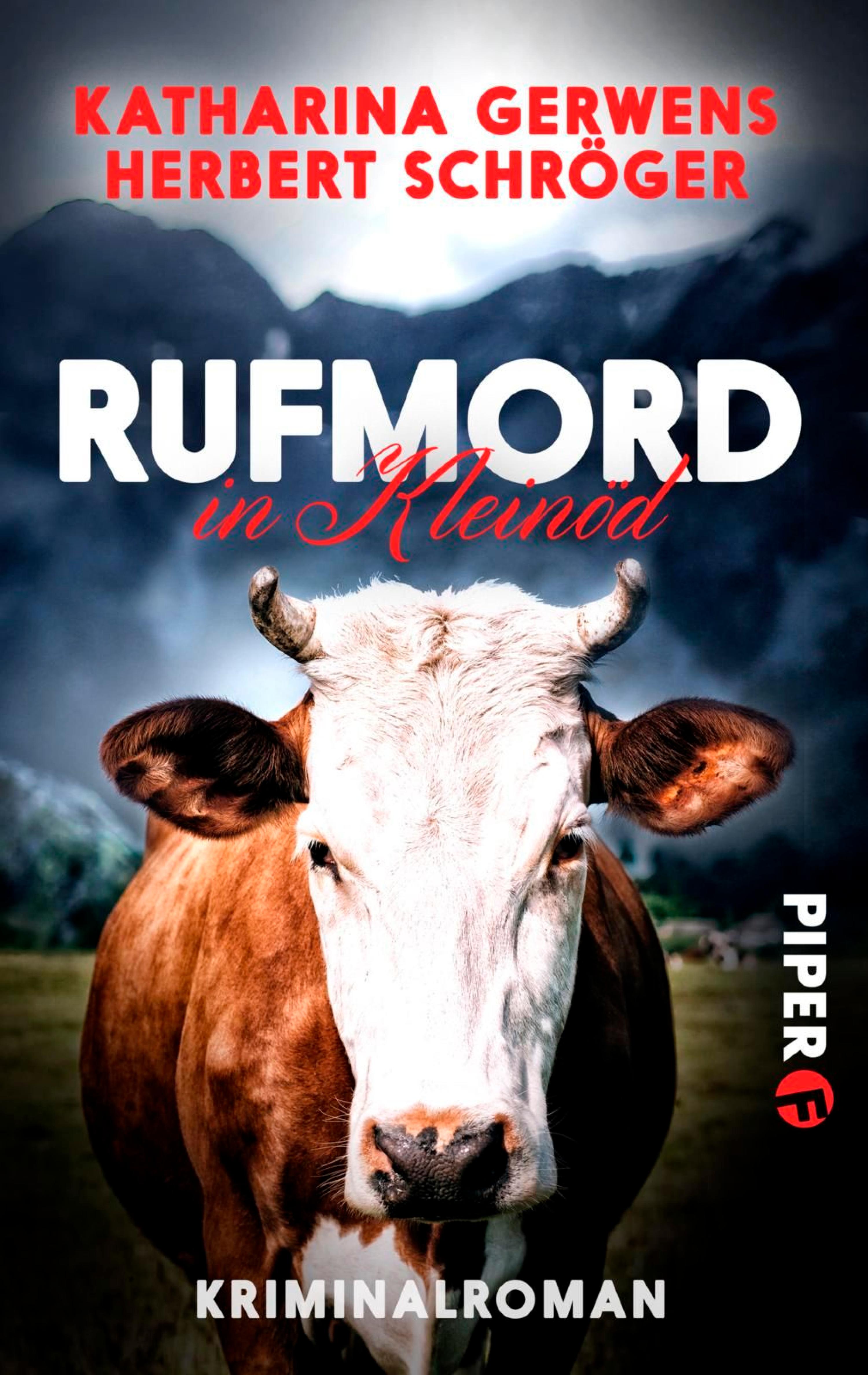8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mord in Westfalen – da waren's nur noch 8: Als ein Mitglied des Frauen-Kegelclubs »Sterntaler« tot und in grotesker Pose drapiert aufgefunden wird, steht Hauptkommissarin Annalena Brandt vor einer schwierigen Aufgabe: Die Tote war die Stieftochter von Kriminaloberrat Schmeing, und Annalena soll die Ermittlungen leiten. Die restlichen Sterntalerinnen verhalten sich verdächtig einsilbig, und wenn sie etwas sagen, dann alle im exakt gleichen Wortlaut. Doch dann verschwindet eine weitere Keglerin, und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit … »Kegeltour« ist neben »Schürzenjäger« (Piper, 2013) und »Westfälische Affären« (Piper, 2014) der dritte Westfalen-Krimi von Katharina Gerwens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Katharina Gerwens
Kegeltour
Ein Krimi aus Westfalen
Prolog
Einmal im Jahr dürfen auch wir mal so richtig die Sau rauslassen. Und zwar alle Neune. Das ist Tradition hier in Kalverode. Das machen alle so. Jeder Kegelclub hat ein Ziel, das den Mitgliedern anderer Vereine nicht verraten wird. Das wäre ja noch schöner, wenn die da auch ankämen. Nee, so ‘ne Kegeltour ist das genaue Gegenteil vom grauen Alltag. Da wird endlich mal gefeiert! Und zwar richtig.
Wissen Sie, wir sind gestandene Frauen, und wir schließen das ganze Jahr hindurch immer nur Kompromisse. Da wird man sich ja wohl einmal eine kleine Reise gönnen dürfen, ein verlängertes Wochenende, einfach mal ein bisschen Spaß.
Keine Ahnung, wer uns den nicht gönnt, aber einer hat’s auf uns abgesehen. Meinen Sie, dass ich nun auch sterben muss, so wie die anderen?
Verhörprotokoll Nr. 7 der Akte „Kegelclub“.
*
Der Zug war an diesem Sonntagabend rechtzeitig eingetroffen, nicht nur, was die Ankunftszeit betraf, sondern zum Glück auch vor dem Schneesturm, der Kalverode in den nächsten Tagen in ein mittleres Chaos stürzen würde. So schafften es alle Reisenden, noch vor dem Unwetter heimzukommen.
Seit die neun Damen des Kegelclubs „Sterntaler“ in Hannover ihre vorreservierten Plätze in einem Großraumwagen eingenommen, sich schweigend mitsamt ihren Taschen und Tüten dort niedergelassen und dabei eine so bedrückende Stille um sich verbreitet hatten, dass die anderen Fahrgäste automatisch verstummten, schien sich am Horizont ein Unwetter zusammenzubrauen. Der Schaffner sollte sich später erinnern, dass er sich bei der Fahrkartenkontrolle um einen Scherz bemüht hatte, und dabei voll aufgelaufen war. Nicht eine der Damen hatte ihn eines Blickes gewürdigt oder gar die Lippen zu einem Lächeln verzogen. Und vor den Fenstern war es immer dunkler geworden.
Vielleicht war das der Grund, warum er ihnen in Kalverode nachsah wie sie, aufgeschreckten Hühnern gleich, davonstoben. Jede in eine andere Richtung. ‚Nee, glücklich sind die nicht‘, dachte er bei sich. Die neun Keglerinnen sahen sich nicht um, winkten sich nicht zu und hatten auch keine freundlichen Abschiedsworte füreinander übrig. Offensichtlich herrschte zwischen ihnen, die noch vor vier Tagen gut gelaunt, kichernd und abenteuerlustig zu ihm in den Zug gestiegen waren, ein eiskalter Krieg.
Hätte man ihm gesagt, dass eine dieser Neun noch in der gleichen Nacht zu Tode kommen würde, so wäre er vermutlich zur Polizeidienststelle gegangen und hätte für jede einzelne der Sterntaler Polizeischutz verlangt. Aber wer konnte schon in die Zukunft sehen und außerdem hatte der an diesem Sonntag diensthabende Schaffner sich beizeiten dazu erzogen, sich nicht in die Angelegenheiten anderer einzumischen. Er hatte einfach schon zu viel gesehen, um sich wirklich noch zu wundern. Zumindest behauptete er das.
1. Kapitel
„Du, sag mal“, wollte Mechthild Benkhoff an diesem Vormittag von ihrer einzigen Kundin wissen und blickte dabei so verschwörerisch um sich, als vermute sie in allen Ecken und Winkeln ihres Geschäftes Spione. „Sag mal, die Iris, die Iris Zentner, die kennste doch, oder?“
Hedwig Hagenkötter war gewarnt. Sie kannte ihre Pappenheimer, und wenn jemand schon so fragte, rechnete sie grundsätzlich mit dem Schlimmsten. Sie suchte im Spiegel den Blick der Friseurmeisterin und nickte verhalten. „Ja, warum?“
„Ach, nur so“, sagte die Frau mit dem kurzen blonden Haar und dem gigantischen Ohrgehänge, klapperte ein paar Mal mit der Schere und fügte dann geheimnistuerisch hinzu: „Weißte, ich will nämlich einen Kegelclub gründen und dachte mir, die würde ganz gut zu uns passen. Ich brauche noch zwei oder drei Frauen. Die Kinder von der Zentner sind schon aus dem Gröbsten raus und vielleicht kann die ja auch samstags.“
„Was hat denn das mit samstags zu tun?“ Hedwig beobachtete, wie Mechthild ihr das Haar in der Mitte zu scheiteln begann und die Haaransätze Scheitelzug um Scheitelzug in Mahagoni-dunkel nachkolorierte. „Du wirst auch immer weißer“, stellte Mechthild dabei fest und ihre Ohrringe mit den vielen bunten Perlen klapperten im Takt der Pinselstriche. „Wann gehst du denn in Rente? Und wie lange willste noch als Schwarzkopf rumlaufen? Grau sieht doch auch ganz gut aus.“
„Klar, aber bei den jungen Frauen“, widersprach Hedwig und hakte nach. „Also, warum samstags?“
„Weil ich nur für samstags eine Bundeskegelbahn kriegen könnte und mir ist das – ehrlich gesagt – auch ganz recht. Samstage sind schwierige Tage.“
Hedwig seufzte verhalten. Für Mechthild Benkhoff nämlich war jeder Tag ein schwieriger Tag.
„Außerdem ist es mein letzter Arbeitstag in der Woche; samstags schließ ich mittags um zwei den Laden ab, und hab dann noch den Sonntag und den Montag, um mich auszuruhen.“
Hedwig versuchte, zustimmend zu nicken. Ihr Kopf aber war fest in Mechthilds Hand: „Na ja, so anstrengend ist Kegeln ja nun auch nicht, dass man sich gleich zwei Tage davon erholen müsste“, sagte sie dann.
„Vielleicht nicht direkt vom Kegeln“, grinste Mechthild mit Kennermiene. „Wohl aber von dem, was dazugehört, verstehste, Pilsken, Likörchen und das ganze Knabberzeug. Ich hab gehört, die Zentner mag ganz gerne mal einen. Stimmt das?“
Hedwig hob die Schultern und beschloss, dazu besser keine Meinung zu haben. „Wird ja immer viel geredet, weißte doch.“
„Datt machste wohl sagen! Sodala …“ Mechthild hatte inzwischen die ganze Farbe aus ihrem Plastikschälchen mithilfe eines breiten Pinsels auf Hedwigs Kopf verteilt und massierte sie nun mit den Fingerspitzen ein. Ihre Hände steckten in gelben Gummihandschuhen, die sich zusehends schwarz verfärbten. „Jetzt lass das mal ein halbes Stündchen einziehen und dann siehste wieder aus wie Schneewittchen – Haare schwarz wie Ebenholz, im Nachglanz leicht rötlich. Hat sonst keine. Aber nochmal zu meiner Frage. Passt die Iris nun in meinen Kegelclub? Sag einfach ja oder nein.“
Hedwig zögerte: „Ich kenn ja deine anderen Kandidatinnen nicht, aber wenn du einen guten Draht zu der Zentner hast, warum nicht. Das ist doch das Wichtigste, dass man sich versteht, darauf kommt’s doch an.“
„Ja, dat stimmt. Käffchen?“
Hedwig nickte.
Während Mechthild in der Teeküche mit Filtertüten und Wasserkessel hantierte und Geschirr klappern ließ, dachte Hedwig erneut, dass es wirklich nicht ihre Aufgabe war, die gute Frau Benkhoff darauf hinzuweisen, dass Iris Zentner nicht nur ganz gerne mal einen mochte, wie man in Kalverode die Neigung zu Bier, Wein und Schnaps elegant zu umschreiben verstand, sondern definitiv eine Alkoholikerin war. In ihrer Eigenschaft als Teilzeitsekretärin der Polizeidienststelle Kalverode hatte Hedwig ein paarmal miterleben können, wie die achtunddreißigjährige ledige Mutter bereits am frühen Vormittag volltrunken und verwahrlost bei ihnen abgegeben worden war. Offensichtlich hatten deren Kinder die Polizei um Hilfe gebeten – „Mama sagt nichts mehr. Ich glaub, die ist krank“ – und dann die von Oberwachtmeister Wilfried Lütke-Tillmann vorgeschlagene Sofortmaßnahme ergriffen: „Gießt ihr erst mal einen Topf mit kaltem Wasser über’n Kopf, dann wird sie schon wieder sprechen.“
Sie erinnerte sich an den Schrecken in den Augen des Kriminaloberrats, der die noch tropfnasse und zeternde Frau in sein Büro hineinschob und dann den Notarzt benachrichtigte. Eine Szene, die immer nach dem gleichen Drehbuch abzulaufen schien.
Iris Zentner war eine Quartalssäuferin, wobei die Zeiträume zwischen den „Quartalen“ beängstigend schrumpften. Zugleich war Iris Zentner aber auch die Tochter der Lebensgefährtin des Kriminaloberrats Ewald Schmeing, also dessen Stieftochter, und erkennbar die einzig bittere Zutat in seinem ansonsten so ausgeglichenen und vor Harmonie fast überquellenden Lebensabend.
In diesen Phasen, in denen deren Mutter angeblich im Kreiskrankenhaus von einem Kreislaufkollaps genas, brachte Ewald seine Stiefenkelkinder vormittags mit ins Büro, schob sie zu Hedwig in den Mehrzweckraum und befahl der elfjährigen Nadine und dem neunjährigen Lutz, brav zu sein. Brav, was für ein wunderbares altmodisches Wort.
Fügsam und artig saßen die beiden dann auch am großen Konferenztisch und spielten miteinander Verhör. Hedwig, die vorgab, wichtige Dinge in ihren Computer zu tippen, hörte ihnen neugierig zu und kam so in den zweifelhaften Genuss, das ganze Elend dieser kleinen und vaterlosen Familie vorgespielt zu bekommen.
Als Mutter und auch als Mensch war Iris Zentner eigentlich okay, sie durfte nur nicht in die Nähe von Schnaps kommen. Das war die Krux. Und wenn die Benkhoff jetzt bereits ihre Kegelabende weniger unter sportlichen, sondern eher unter gesellschaftlichen, also alkoholdurchtränkten, Aspekten plante … Hedwig seufzte.
Mechthild stellte nun den Kaffee vor sie hin und verkündete fröhlich: „Dann frag ich sie einfach mal.“
„Mach das“, nickte die Frau mit der dunklen Chemiefarbe in den Haaren und wollte wissen: „Wer ist denn sonst noch so dabei?“
„Ich bin noch auf der Suche“, sagte Mechthild und rieb ihre Finger so theatralisch mit Handcreme ein, dass es den Anschein hatte, sie würde verzweifelt die Hände ringen. „Kannst du mir einen Tipp geben?“
„Mal sehen – aber warum für den ‚schwierigen‘ Samstag?“, wiederholte Hedwig Mechthilds Formulierung.
„Weil mein Kalle jeden Samstag unterwegs ist. Dem seine Band muss doch immer am Wochenende auftreten.“
„Ach so.“
„Und da hab ich mir gedacht, es gibt sicher noch genug andere Frauen, die am Samstag alleine zu Hause hocken. Und für die gründe ich meinen Verein. Nur für Frauen. Weißt du übrigens, wie ich den nennen will?“ Sie lachte vergnügt.
Hedwig schüttelte den Kopf und zeigte sich interessiert.
„Sterntaler“, verkündete Mechthild Benkhoff stolz. „Weil das Märchen von dem ‚Sterntaler‘ doch damit endet: ‚und ward reich für sein Lebtag.‘ Das ist doch ein gutes Omen. Reich an Spaß und Gesang …“ Sie trällerte vor sich hin.
*
Spätestens da, so sollte Hedwig knapp zwei Jahre später denken, hätte sie Mechthild warnen müssen. Aber sie hatte geschwiegen, sie fühlte sich einfach nicht für das Seelenheil aller Kalveroder zuständig, auch wenn sie als junge Frau ein paar Semester Psychologie studiert hatte und nun ehrenamtlich Selbsthilfegruppen leitete. Ob irgendetwas anders gekommen wäre, wenn die neun Frauen sich nicht zu einem Kegelclub, sondern zu einer Therapiegemeinschaft zusammengeschlossen hätten? Diese Frage war müßig.
*
Mit der Gründung ausgerechnet dieses Kegelklubs hatte es in der Kalveroder Gerüchteküche zu brodeln begonnen. Hedwig konnte sich noch genau daran erinnern.
Ihr Mann hatte am zweiten Februar Geburtstag, und sie waren auch an diesem Abend, der damals auf einen Samstag fiel, gegen neun Uhr abends auf ein Absacker-Pils beim „Torfstecher“ eingekehrt und hatten vom Wirt hinter dem Tresen erfahren, dass die Friseurmeisterin dort „mit irgendwelchen Weibern rummachte“, von denen alle, mit Ausnahme Mechthild Benkhoffs, nur Apfelsaft bestellten.
„Sind vermutlich mit dem Auto da“, hatte Albert Hagenkötter als Erklärung angeboten und verständnisloses Kopfschütteln geerntet. „Ha, was heißt das denn schon? Ein Pilsken wird ja wohl immer drin sein!“
„Solln die doch“, hatte der Pächter des „Torfstecher“ geseufzt. „Entweder, die machen mindestens hundertfünfzig Euro Umsatz oder die Bahnmiete wird teurer. So oder so steht der Saal samstags leer und heizen muss ich ihn auch dann, wenn keiner drin ist.“
Hedwig hatte sich gefragt, ob die Benkhoff am Freitagnachmittag noch herumtelefoniert hatte. Vielleicht war sie ja auch am Samstagvormittag auf den Augustin-Wibbelt-Platz zum Wochenmarkt gegangen, um sich umzusehen. Fast alle Kalveroder Frauen waren Kundinnen ihres Salons, und was war schon gegen ein bisschen Bewegung am Samstagabend einzuwenden? Nichts.
Später sollte sich herausstellen, dass die Benkhoff tatsächlich auch noch eine Zeitungsanzeige aufgegeben und Interessierte zu einem sportlichen Kennenlernabend in den „Torfstecher“ eingeladen hatte.
Die sechs Kalveroder Frauen waren zu Fuß gekommen, hatten auf der Kegelbahn bequeme Sportkleidung und Turnschuhe angelegt und warteten dort mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf die Gründerin ihres Vereins, während Mechthild in der Gaststube zwei potenzielle Kegelschwestern begrüßte, die auf ihre Anzeige hin gekommen waren. Die eine hieß Maren Lisowski, die andere Isabella Höhler. Der Wirt schätzte sie zwischen Mitte bis Ende dreißig und hatte das Gefühl, eine von denen irgendwoher zu kennen. Steif hatten die beiden in der noch leeren Kneipe an zwei Einzeltischen gesessen, Kaffee bestellt und sich so lange argwöhnisch beäugt, bis eine strahlende Sterntalerin, in sportlichen schwarzen Lederhosen und weißem T-Shirt unter der Pelzjacke, mit frisch gegeltem Strubbelhaar, leuchtend rot geschminkten Lippen und riesigen Ohrringen, an denen quietschgrüne Plastikkegel vor und zurück baumelten, die Damen erst eingesammelt und dann miteinander bekannt gemacht hatte.
Über diese Zeitungsanzeige sollte noch lange in Kalverode geredet werden. Als hätte etwas Verwerfliches darin gestanden, als hätten damals schon alle geahnt, dass die Sterntaler nichts Gutes brachten.
An jenem Geburtstagsabend ihres Mannes und an der langen und gemütlichen hölzernen Theke des „Torfstechers“ hatte Hedwig, daran erinnerte sie sich nun auch noch, darüber nachgedacht, ob sie die Zweite Kriminalhauptkommissarin von Kalverode auf den Kegelverein der Friseurmeisterin aufmerksam machen sollte. Offenkundig saß Melanie Dierks an ihren dienstfreien Wochenenden alleine zu Hause herum und hatte es angeblich nach Monaten immer noch nicht geschafft, alle ihrer achtzig Umzugskisten leer zu räumen. Darüber klagte sie nach verregneten Wochenenden beim montäglichen Frühstückskaffee in der Dienststelle und ließ dabei die Lästerreden von Oberwachtmeister Krabbe an sich abprallen, der steif und fest behauptete, das alles seien nur Ausflüchte, sie wolle einfach nicht die Kollegen zur Wohnungseinweihung einladen.
*
Hedwig war sich sicher, dass Melanie gut in diesen Kegelclub hineingepasst hätte. Und noch viel später sollte sie denken, dass all das Schreckliche möglicherweise gar nicht geschehen wäre, wenn die Zweite Kriminalkommissarin zu den Kegelschwestern gestoßen wäre. Auch altersmäßig hätte sie gut zu den Damen gepasst.
Aber dann fiel ihr wieder ein, wie sie an jenem Tag mit frisch gefärbten Haaren, einer ziemlichen Verspätung und genau dieser Idee in die Dienststelle gekommen war, Melanie gesehen hatte und den Gedanken sofort wieder verwerfen musste.
In ihr keimte nämlich der durchaus begründete Verdacht, dass Melanie Dierks, Zweite Hauptkommissarin in Kalverode und ausgewiesene Expertin bei der Aufdeckung krummer Geldgeschäfte, noch niemals in ihrem Leben bei einem Friseur gewesen war. Und Hedwig kannte Mechthild Benkhoff gut genug, um zu wissen, dass die der bezopften Kollegin als Erstes eine Kurzhaarfrisur einreden würde. Die Kommissarin würde protestieren und die Friseurmeisterin würde sie als hinterwäldlerisch bezeichnen und, und, und … nein, das war keine gute Idee.
*
Am Wochenende zuvor waren in der Kalveroder Dienststelle die Büros neu bezogen und mit einer gemütlichen Kaffee- und Kuchenrunde in Besitz genommen worden. Kriminaloberrat Schmeing hatte den Gemeinderat nach vielem Hin und Her davon überzeugen können, dass drei der noch leer stehenden Zimmer des Alten Amtshauses der Polizeidienststelle zugeschlagen wurden. Zudem war es inzwischen immer fraglicher geworden, ob das Stadtarchiv überhaupt jemals in das Alte Amtshaus ziehen würde. Wäre es nicht grob fahrlässig, die wenigen handschriftlichen Aufzeichnungen zur Stadtgründung Kalverodes in einem Gebäude unterzubringen, in dem Diebe, Trickbetrüger, Lügner sowie noch schlimmeren Zeitgenossen erst verhört und dann festgesetzt wurden?
Außerdem fühlte sich das Stadtarchiv unter dem Dach des Kalveroder Rathauses pudelwohl. Das war ein Neubau mit großen gläsernen Fronten, Etagenaufzügen und Regalsystemen, die im Lesesaal still und elegant auf Rollen vor- und zurückglitten. Hier herrschte vornehme Stille. In allen vier Teeküchen auf den vier Etagen gab es nicht nur einen Kühlschrank, sondern auch eine Geschirrspülmaschine.
Das Alte Amtshaus dagegen war ein Gebäude aus den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts mit hohen Räumen, knarzenden Treppen, quietschenden Türen und ausladenden Fluren, durch die immer ein eisiger Wind zu pfeifen schien – außer im Sommer. Dann stand hier die Luft.
Die neuen Büros für Annalena Brandt und Melanie Dierks lagen direkt hinter dem Empfangsraum mit dem hölzernen Tresen, einem mit Schnitzereien versehenen Unikat aus einem Kneipenabbruch im vergangenen Jahr – hier hatte Kriminaloberrat Ewald Schmeing spontan zugeschlagen und die Theke für seine Dienststelle ersteigert. Es wirkte zwar etwas ungewöhnlich, dass ausgerechnet die Anmeldung der Kalveroder Polizei mit kunstvollen Schnitzereien von trinkfreudigen Gestalten ausgeschmückt war – aber Theke ist Theke und Ewald brachte es einfach nicht übers Herz, die schöne Handarbeit glatt hobeln zu lassen.
Alle Büroräume hatten nun nach dem Umbau eine Schiebetür zum Flur; die Zimmer der meisten Kollegen waren zusätzlich durch ausladende Flügeltüren miteinander verbunden und konnten im Bedarfsfall zu langen Zimmerfluchten geöffnet werden.
Die baulichen Veränderungen hatten sich monatelang hingezogen, da während des ganzen Winters immer nur stundenweise gearbeitet wurde. Die stadteigenen Handwerker waren in diesen Herbst- und Wintermonaten an zu vielen Baustellen eingesetzt. „Wie in meiner Familie“, jammerte Hedwig, „da blieb das Wichtige auch immer liegen.“ Ihr Vater war Klempner gewesen und hatte bei allen Leuten tropfende Wasserhähne repariert – nur nicht zu Hause.
Aber rechtzeitig zu Mariä Lichtmess und zufälligerweise auch zum Geburtstag von Albert Hagenkötter war endlich alles fertig geworden. Direkt hinter dem Mehrzweckzimmer der Halbtagssachbearbeiterin Hedwig Hagenkötter war nun sogar eine kleine Teeküche mit Herd und Kühlschrank eingerichtet worden – aber ohne Geschirrspülmaschine.
„Mariä Lichtmess“, so hatte Ewald seine Eröffnungsrede feierlich begonnen, „das war zu früheren Zeiten der Termin des Personalwechsels. Für uns ist es in diesem Jahr der Tag, an dem das Personal nicht die Herrschaft, dafür aber die Räume wechselt.“ Er hatte sich dabei an die Brille gefasst und wohlwollend von einem zum anderen geblickt. Manchmal kam er ihnen vor wie ein verhinderter Pfarrer, vor allem dann, wenn er in diesen salbungsvollen Ton verfiel. Hedwig hatte sich schon oft gefragt, wie Ewalds Lebensgefährtin mit dieser Attitüde des Kriminaloberrates umgehen mochte. Vermutlich sah Birgit Zentner nur kurz hoch, machte eine lapidare Wischbewegung und kommentierte: „Ich hab dir mal schnell deinen Heiligenschein weggepustet. Jetzt kannste wieder normal mit uns reden!“ So zumindest hatten es die Enkelkinder in einem vormittäglichen Spiel nachgestellt.
Aber noch hielt Ewald Schmeing rotgesichtig und strahlend vor Glück seine Predigt und Hedwig stellte Kannen mit dampfendem Kaffee auf den Konferenztisch. ‚Alles bei uns sind Unikate‘, dachte sie dabei, ‚sogar die Tassen und die Teller.‘ Kein einziges Geschirrteil passte zum anderen. ,Und die Leute sind erst recht nicht aus ein und demselben Holz geschnitzt.‘ Aber vielleicht war ja gerade das das Geheimnis der so erfolgreichen Ermittlungsarbeit des Kalveroder Teams.
Auf Zehenspitzen ging sie zum Wandschrank und holte eine große Blechdose mit Plätzchen hervor, die von der Weihnachtsbäckerei übrig geblieben waren. Sie buk einfach zu viel und sie buk zu gerne. Es gehörte nun einmal dazu, dass es von Mitte November an in ihrer großen Wohnung über dem stillgelegten Bahnhofsgebäude wie in einer Konditorei duftete, auch wenn seit Jahrzehnten feststand, dass weder ihr Mann noch sie selbst mit dem Verzehr all der Köstlichkeiten nachkamen. Daher wurde der Überschuss ins Alte Amtshaus gebracht und versüßte bis weit ins nächste Jahr hinein jede Sitzung, auch wenn die Plätzchen von Monat zu Monat trockener zu werden schienen.
„Die mittelalterlichen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter“, hörte sie den Chef nun dozieren und dankte ihrem Schicksal dafür, dass sie sich nicht in jedem Jahr zu Mariä Lichtmess eine neue Arbeitsstelle suchen musste, sondern hier bei den Kolleginnen und Kollegen der Polizeidienststelle in Kalverode, bei ihrem Mann, ihrer Telefonseelsorge und ihren Selbsthilfegruppen bleiben durfte, was ja auch eigentlich schon genug war.
Ewald Schmeing hatte seine Rede beendet und seine sieben Zuhörerinnen und Zuhörer klopften mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. Dann stand Annalena auf. Mit ihren vierundzwanzig Jahren war sie die Jüngste von allen und zugleich Erste Hauptkommissarin von Kalverode. In spätestens zwei Jahren würde sie Ewalds Nachfolge antreten. Annalena wirkte nervös und schien zu schwitzen. Sie öffnete den Reißverschluss ihrer schwarzen Strickjacke, strich sich das mittelblonde lange Haar zurück und faltete die Hände vor dem Bauch.
„Leute, ich mach’s kurz“, sagte sie schnell und verschluckte sich fast an den Silben. „Da jeder sein eigenes Zimmer hat, wird sich in diesen acht Räumen vermutlich unsere volle Individualität entfalten. Ehrlich gesagt, darauf bin ich schon richtig gespannt.“ Sie grinste.
Kriminalhauptmeister Markus Wissing stupste dem neben ihm sitzenden Kollegen von der Spurensicherung in die Seite und flüsterte: „War ja wohl klar, dass die auf diese Anmerkung nicht verzichten konnte. Jetzt hat sie’s der Dierks aber gegeben!“
„Aber irgendwie hat sie doch auch recht, oder?“, murmelte Horst Toplischek und strich sich über seinen grauen Bart. So kompetent diese Melanie Dierks auch sein mochte, mit Ordnung hatte sie leider nun gar nichts am Hut. Es grenzte an schwarze Magie, wie sie es schaffte, innerhalb von zehn Minuten die Papiere und die Unterlagen auf der Empfangstheke so durcheinanderzubringen, dass ihr Nachfolger den ganzen Nachmittag brauchte, um das Tohuwabohu wieder zu richten. Wenn sie den Raum verließ, war die Telefonschnur verknotet, hatten sich Papiere im Fax verhakt, blinkte der Drucker nach Farbpatronen, waren Bleistifte und Kugelschreiber verschwunden, dafür aber lagen überall auf der Theke Zettelchen mit unleserlichen Notizen herum, denn Melanie hielt ihre Erkenntnisse in Stenografie fest – und Kurzschrift beherrschte nicht einmal Hedwig. Immerhin hatte sie sich als Einzige für eine Fortbildung im klassischen Steno nach dem Begründer der Kurzschrift, Franz-Xaver Gabelsberger, angemeldet.
Anfangs vermuteten alle eine böse Absicht hinter Melanies Chaos, inzwischen aber war der ganzen Crew klar: Die Zweite Hauptkommissarin konnte nicht anders.
Annalena sah all ihre Kolleginnen und Kollegen lange an und setzte ihre Rede fort: „Ich hoffe doch sehr, dass nicht jeder aus seinem Zimmer eine Mördergrube macht und nur noch für sich alleine darin herumwurschtelt, ohne wichtige Informationen an seine Kollegen weiterzugeben.“
Bei dem Wort ‚Mördergrube‘ begann Wilfried Lütke-Tillmann zu kichern. Annalena suchte seinen Blick. „Bei mir kannste nur tote Fliegen finden“, sagte der blonde Oberwachtmeister und griff nach einem Zimtstern mit Zitronenguss. „Ich denke, Mördergruben, das sind doch die, die wir finden müssen, oder habe ich da was falsch verstanden?“
Ewald stützte sich auf der Tischplatte ab und beugte sich halb vor: „Das haste schon alles richtig verstanden, aber nun halt mal die Klappe und bete zu allen verfügbaren Heiligen, dass demnächst kein Mord oder so was passiert. Wir müssen erst mal unsere Sachen abarbeiten. Ist ja auch schon genug passiert in den letzten Monaten.“
Er sah, dass Annalena immer noch in Vortragshaltung hinter ihrem Stuhl stand und nickte ihr aufmunternd zu: „Also, was ich sagen wollte“, vollendete Annalena ihre Rede, „ist, dass wir uns weiterhin ständig über alles informieren sollten, auch über die kleinsten Kleinigkeiten, und sobald eine größere Teamarbeit ansteht, öffnen wir einfach unsere Türen und dann ist wieder jeder für jeden da. Ewald, an dieser Stelle noch mal Danke, dass du das Innere der Dienststelle so klug hast umbauen lassen. Jeder für sich, aber wenn’s drauf ankommt, reißen wir nur unsere Türen auf und sind wieder ein großes und perfektes Team.“
Da hatte sich noch niemand vorstellen können, dass sich dieses perfekte Team bereits achtundvierzig Stunden später an die Arbeit machen sollte und alle Türen bis auf Weiteres geöffnet blieben.
2. Kapitel
Der Kriminaloberrat hatte an jenem Montag, dem vierten Februar, genauso ausgesehen, wie Hedwig sich während des ganzen Sonntags gefühlt hatte. Nämlich zum Kotzen.
„Was ist denn mit dir passiert?“, fragte sie fürsorglich und bot an, einen Tee zu kochen.
„Erzähl ich gleich“, antwortete Ewald Schmeing und verschwand mit blasser Nase in seinem Büro. Hatte der etwa auch Geburtstag gehabt? Hedwig Hagenkötter suchte in den Schränken der neuen Teeküche nach alten Aufgussbeuteln mit Kamillentee. Nein, der Ewald feierte doch immer erst im Oktober.
Dass es ihr am Sonntag schlecht gegangen war, hatte unmittelbar damit zu tun, dass sie Samstagnacht beim „Torfstecher“ versackt waren. Noch auf dem Heimweg von ihrem Stammlokal hatte Hedwig ihrem Mann das Versprechen abgerungen, in Zukunft seine Geburtstage nicht mehr in einer Kneipe zu beschließen. Aber das hatte er ihr im vergangenen Jahr auch schon hoch und heilig zugesichert. Ebenso wie in all den Jahren davor.
Irgendwann zu weit fortgeschrittener Stunde war auch diesmal wieder jemand auf die Idee gekommen, eine Runde Apfelkorn auszugeben. Der trank sich ja wie Saft. Und Hedwig hatte fröhlich mitgekippt. Und dann kam die nächste Runde, und dann noch eine. Aus dem Kegelsaal war an diesem Abend überhaupt nichts zu hören gewesen. Sonst vernahm man immer den dumpfen Schlag, wenn die Kugel auf der Bahn aufsetzte.
„Wo sind die Mädels denn?“, hatte Hedwig zu einer Zeit wissen wollen, als sie noch klar sprechen konnte und die auch noch in ihrer Erinnerung gespeichert war.
„Nach zwei Jahren ihre erste Kegeltour“, erklärte der Wirt und fügte mit einer geringschätzigen Grimasse hinzu: „Das wird was werden bei den gackernden Sterntalern!“
Leider hatte Hedwig vergessen nachzufragen, was genau er damit gemeint haben könnte.
„Kegeltour, wohin denn?“, hatte Albert Hagenkötter wissen wollen. Seine Worte flossen eigenartig feucht ineinander über und fügten sich zu einer Art Sprechgesang. ,Der hat schon reichlich intus‘, hatte Hedwig gedacht und verwundert beobachtet, wie das Geburtstagskind in seiner Jackentasche nach dem Handy suchte. Wen würde er denn wohl um diese Zeit anrufen wollen? Ihr fiel niemand ein. Dann hielt er das Telefon hoch und verkündete: „Ich finde, wir sollten Kitty einladen!“
Hedwig hatte sofort den Kopf geschüttelt: „Wie soll die denn herkommen? Von dahinten, aus den Zollhäusern. Jetzt um diese Zeit? Friert doch draußen!“
Die Stimme ihres Mannes kippte ins Weinerliche. „Das ganze Jahr baut sie für mich so schöne Häuskes, und nun isse nich mal an meinem Geburtstag dabei. Weißte wat, ich spendier ihr ein Taxi.“
„Du spinnst, die liegt doch schon längst inne Kiste!“, widersprach einer der Thekensteher.
„An meinem Geburtstag? Nee, dat glaub’ ich nich!“
Und während der Diskussion darüber, ob die gehbehinderte und knapp fünfzigjährige Kitty Siebert, die einst alte Puppen gesammelt hatte, seit Neuestem aber nur noch für Alberts Modelleisenbahn tätig war, ob diese Kitty, die perfekt darin war, Häuser, Kathedralen, Lagerhallen, Containerbahnhöfe und Erholungsoasen aus winzigen Bauteilen zusammenzukleben, überhaupt jemals schon beim „Torfstecher“ gewesen sein mochte, hatten weitere Tabletts mit Apfelkorn die Runde gemacht und letztendlich war beschlossen worden, dass Kitty vermutlich keine Lust haben würde. Da war es auch schon weit nach Mitternacht gewesen.
Die neun Frauen des Vereins „Sterntaler“ waren einfach nicht mehr auf Hedwigs Schirm gewesen, wie sie es zu nennen pflegte, und deswegen hatte sie auch ganz vergessen, sich nach dem Reiseziel der Damen zu erkundigen.
Es ging sie ja auch nichts an.
*
Sanft klopfte sie nun an die Tür des Kriminaloberrats und trat vorsichtig ein. Sie kannte sich aus. Wenn man nach zu viel Alkohol einen dicken Kopf hatte, tat selbst das Rascheln eines Papiertaschentuchs weh, und das Klingeln des Telefons war schrecklicher als eine plötzlich losgehende Sirene.
„Geht’s schon ein bisschen besser?“, wollte sie fürsorglich wissen.
Ewald schüttelte den Kopf. „Ich brauch gleich meine ganze Mannschaft. Punkt neun! Organisier das mal!“
Hedwig riss die Augen auf und nickte. „Hamse dir gestern was innen Tee gekippt? Will dich wer vergiften? So siehste nämlich aus!“
„Nein, nein! Und jetzt geh!“ Er zog die Augenbrauen zusammen, gab ihr mit einer unwirschen Handbewegung zu verstehen, dass sie sein Büro verlassen sollte, und griff zum Telefon.
‚Das fängt ja gut an‘, dachte Hedwig und bereitete die Besprechung vor, das heißt, sie installierte den kleinen Computer und die externe Tastatur auf dem runden Konferenztisch, um gleich alles mitschreiben zu können. Kein individuelles Zimmereinräumen, nun, da jeder sein eigenes Büro hatte, sondern gleich eine große Besprechung. Was konnte da nur passiert sein?
Bei ihr war nichts eingegangen. Sie checkte das Verlaufsprotokoll des Wochenendes. Auch da nichts Besonderes. Ein Fahrrad war gestohlen worden, jemand hatte sich beschwert, weil er nicht in die Disco durfte. Ein Autofahrer war mit einem Reh zusammengestoßen, hatte sich das tote Tier in den Kofferraum geladen und sich bei der Polizei nach dem Pächter der Jagd erkundigt. Der sollte dann wohl noch die Autoreparatur zahlen.
Als sie aufblickte, sah sie, wie die Zweite Kriminalkommissarin ihr Fahrrad in den Hof schob. Dessen Gepäckträger war mit einem Ungetüm von hölzernem Regal beladen; an beiden Lenkstangen hingen Plastiktüten mit Topfblumen. Hedwig hielt ihr die Eingangstür auf.
„Danke, mein Zimmer hat so große Fenster“, erklärte Melanie Dierks. „Da mach ich mir jetzt meinen ganz privaten Wintergarten.“ Sie hatte sich ein grünes Band in den dichten Zopf geflochten, als wolle sie damit ihre Fertigkeiten als Floristin unterstreichen.
„Gute Idee“, fiel Hedwig ihr ins Wort. „Aber heute kannste das erst mal vergessen.“
„Wieso das denn?“ Melanie wuchtete das Holzregal vom Gepäckträger und drückte Hedwig die zwei Tüten in die Hand.
„Der Chef will euch alle um neun am Konferenztisch sehen.“
„Nee echt?“ Melanie sah auf die Uhr. „Also schon in zehn Minuten. Ist was passiert?“
„Das wüsste ich auch gern.“ Hedwig hob die Schultern und sah in diesem Augenblick Heinz Krabbe um die Ecke biegen – er trug ein sorgfältig aufgerolltes DIN-A2-Plakat der Jugendspielgemeinschaft Dörentrup in der linken Hand und wickelte es vor den Kolleginnen halb auf; blauhemdige Sportler vor grünem Rasen. „Das sind Farben!“, verkündete er. „Die bringen gute Laune und den Sieg! Hedwig, du hast doch sicher Reißzwecken?“
Annalena Brandt kam mit einem Blumenaquarell, das eine Magnolienblüte zeigte. „Das hat meine Mutter gemalt, als sie mit mir schwanger war. Und jetzt kommt es hinter meinen Schreibtisch.“
Wie so vieles andere würde auch dieses Aquarell in einer Zimmerecke auf seine eigentliche Bestimmung warten müssen; aber zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand in der kleinen Polizeiinspektion Kalverode, dass die kommenden Wochen zu den schwersten ihres Lebens werden sollten.
*
„Iris ist verschwunden“, eröffnete Kriminaloberrat Ewald Schmeing die Sitzung.
„Seit wann?“, fragte Kriminalhauptmeister Markus Wissing und fügte automatisch seinen Lieblingsspruch hinzu: „Kopf hoch, da wird schon nichts passiert sein. Das ist doch eine erwachsene Frau.“
Eigenartigerweise fragte keinen von ihnen, wer Iris war. Jeder schien sie zu kennen.
„Die sind alle am Sonntagabend zurückgekommen und dann auch nach Hause gegangen“, murmelte Ewald. „Nur Iris nicht.“ Er schwieg und sah hilfesuchend in die Runde. Annalena, die ihm direkt gegenübersaß, hatte den Eindruck, er warte darauf, dass einer von ihnen die Hand hob, wie in der Schule, und verschmitzt verkündete: „Sie ist bei mir.“
„Meine Lebensgefährtin hatte die Kinder, und ich hab ihr dann einzureden versucht, dass die neun Frauen ihren kleinen Urlaub vielleicht aus Jux und Dollerei verlängert haben. Aber meine Birgit war so unruhig, die hat echt jede Stunde bei der Iris in der Wohnung angerufen. Ans Handy ist sie auch nicht gegangen, und das macht sie sonst immer.“ Er seufzte. „Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, und als wir dann vorhin bei Mechthild Benkhoff anriefen, weil die doch alles organisiert hatte, sagte die, der ganze Kegelclub sei gestern Abend pünktlich um 18:27 Uhr am Bahnhof in Kalverode angekommen. Und dass dann jede zu sich nach Hause gegangen sei. Nur unsre Iris nicht. Und nachgucken konnten wir nicht, weil die uns nicht mehr ihren Schlüssel gibt.“
„Hat sie gesehen, wo Iris hingegangen ist?“
Sie sagt: „Die Straße runter, in Richtung ihrer Wohnung.“
„Bist du dir da sicher?“
„Ja. Außerdem hat die Benkhoff heute früh schon bei allen Kegelschwestern angerufen. Keine von denen weiß, wo die Iris steckt. Die Hilde Möllensiep ist noch bis zur Kreuzung mit ihr gegangen, aber dann musste die ja nach rechts in die Bismarckstraße und Iris geradeaus.“
Alle schwiegen. Die Erste Hauptkommissarin sah ihre Kolleginnen und Kollegen an und hatte das Gefühl, dass alle das Gleiche dachten. Es war dann Horst Toplischek, der losblaffte und mit der Sensibilität eines Fleischerhundes vom Kriminaloberrat wissen wollte: „Die Iris Zentner, die mag doch ganz gern mal einen, oder? Hab ich so gehört.“
Ewald Schmeing wurde rot. „Was willst du damit sagen?“
„Nix.“ Horst zog den Kopf ein.
„Wenn du nix sagen willst“, fauchte Ewald ungewöhnlich wütend, „dann hältst du demnächst am besten einfach mal die Klappe. Verstanden?“
„Das heißt, die waren alle verreist?“, fragte Annalena.
„Ja“, Ewald nickte. „Alle neun Damen von der ihrem Kegelclub ,Sterntaler‘.“
„Und acht sind zu Hause angekommen?“, vergewisserte Hedwig sich, während sie weiter blind auf ihre Tastatur einhackte.
„Nur Birgits Tochter nicht“, bestätigte Ewald Schmeing mit einem müden Nicken. „Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir uns große Sorgen machen.“
„Aber Chef, ist es nicht bisschen zu früh, nach grad mal fünfzehn Stunden schon von einem Vermisstenfall auszugehen?“, gab Heinz Krabbe zu bedenken und Annalena sah dem Oberwachtmeister an, dass er tausendmal lieber sein Zimmer umgestaltet hätte, als hier im Konferenzbereich zu sitzen. Sie hatte schon mit Melanie eine Wette laufen, dass der sich garantiert noch ein Trampolin unter das Plakat seiner Lieblingsmannschaft stellen und Hanteln auf den Schreibtisch legen würde, um während der Dienstzeit Fitnessübungen machen zu können. Das, so hatte er in den vergangenen Wochen verkündet, war der eigentliche Vorteil eines eigenen Büros.
Ewald wurde blass und presste ein „Nein!“ hervor. Dann schluckte er. „Klar, ihr könnt mir nun Befangenheit und emotionale Verbundenheit unterstellen, aber ich sage euch, da ist was passiert. Meine Birgit spürt so was. Sie sagt, sie hat mit einem Mal kalte Füße gekriegt, und sie kriegt immer kalte Füße, wenn eine Katastrophe beginnt, so wie damals, als ihr Aribert nicht nach Hause kam.“
Konzentriert schrieb Hedwig alles mit und dachte dabei an die braven und wohlerzogenen Kinder von Iris Zentner. Denen ging es bei der Großmutter sicher besser als bei ihrer alkoholkranken Mutter. Trotzdem: Ein Mensch konnte sich doch nicht einfach so in Luft auflösen!
„Was schlägst du vor?“, wollte Markus Wissing nun vom Kriminaloberrat und Stiefvater der Vermissten wissen. „Ich meine, irgendwo muss die ja hingegangen sein. Hast du vielleicht eine Idee?“
Annalena sah, dass Horst Toplischek zu einer Aufzählung jener Lokalitäten ansetzte, die bis spät in der Nacht oder bereits ab sechs Uhr morgens geöffnet hatten und warf ihm einen strengen Blick zu. Er verstand und schwieg.
„Wir sollten herausfinden, wer sonst noch im Zug war“, murmelte Melanie Dierks ungewöhnlich leise und legte das Ende ihres grün umflochtenen Zopfes auf die Tischplatte. „Da sind neben den neun Frauen ja sicher auch noch andere mitgefahren und hier ausgestiegen.“
„Ja, gute Idee“, mischte Hedwig sich ungefragt ein. „Mein Mann war ja bis zu seiner Pensionierung Lokomotivführer. Der hat immer gesagt, dass so ein Schaffner eine verdammt gute Menschenkenntnis hat. Fragt doch einfach mal nach, wer da gestern Dienst hatte.“
Ewald seufzte und wandte sich an Annalena: „Würdest du das bitte alles koordinieren? Ich bin ja befangen, weil Iris meine Quasi-Stieftochter ist, auch wenn Birgit und ich noch nicht verheiratet sind. – Tut bitte alles, dass die so schnell wie möglich wieder hier ist. Die Kinder sind jetzt in der Schule und wir haben ihnen versprochen, dass die Mutter zum Mittagessen wieder da ist. Also, strengt euch mal an!“
Auf dem Weg in den Konferenzraum hatte er gesehen, welche Dekorationsgegenstände vor den Türen der einzelnen Zimmer lagerten. Mit einem müden Kopfnicken fügte er daher nun hinzu: „Und wenn Iris wieder da ist, könnt ihr in aller Ruhe eure Zimmer einrichten. Aber erst dann!“
*
Ächzend stand er auf und ging gebeugt in sein Büro zurück. ‚Wie alt er plötzlich geworden ist‘, dachte Annalena und sah ihm besorgt nach. Man hörte es manchmal, dass jemand über Nacht gealtert war; sie hatte immer gemeint, das sei nur eine Redensart; jetzt wusste sie es besser.
„Du“, wandte sie sich dann an Hedwig Hagenkötter. Die nickte kurz, blickte jedoch nicht von ihrem Computer auf. „Ruf doch noch mal bei dieser Frau Benkhoff an und lass dir Namen und Daten aller Kegeldamen nennen. Also Vor- und Nachname, Spitznamen brauchen wir nicht, dafür aber Straße und Hausnummer sowie Telefon- und Mobilnummer.“
Hedwig tippte weiter und murmelte: „Kein Problem.“
„Und dann sollten wir die einzeln besuchen“, stellte Annalena klar. „Machst du das, Heinz?“
Oberwachtmeister Krabbe nickte erfreut und Annalena ahnte, dass er diesen Dienstgang in ein morgendliches Walking umwandeln würde; hoffentlich zog er sich dazu nicht das blaue Sporttrikot seiner Lieblingsmannschaft über. Das wäre ihm zuzutrauen.
„Du musst bedenken“, unterbrach Hedwig den Gedankengang ihrer Ersten Hauptkommissarin, „dass die Benkhoff ja heute früh schon alle angerufen hat. Die sind vorgewarnt.“
„Die sind nicht vorgewarnt“, widersprach Annalena, „die spekulieren aber garantiert seit heute früh selbst darüber, was passiert sein könnte. So ist es. Und die Ergebnisse dieser Brainstormings soll Heinz abgreifen.“ Sie bedachte ihn mit einem aufmunternden Blick. „Vergiss also nicht, ein Aufnahmegerät mitzunehmen, okay?“
„Geb ich dir“, versprach Hedwig und mischte sich erneut ungefragt ein: „Ich sag dir, mit der Befragung von dem Schaffner kommst du am ehesten weiter. Mein Albert behauptet immer, dass das so gute Menschen …“
„Ja, ja, ist ja gut!“ Annalena unterbrach sie. „Dann krieg doch mal als Erstes raus, wer gestern geschaffnert hat und wo man den oder die heute erreichen kann.“ Sie sah in die Runde, bemerkte Melanies zerfurchte Stirn und stellte fest: „Du findest die Idee also nicht so gut.“
Melanie nickte. „Schau mal, der Schaffner ist weitergefahren. Kalverode ist ja nicht die Endstation des Zuges. Kalverode ist nur Durchgangsstation. Deshalb sollten wir die Leute befragen, die hier in Kalverode mit den Sterntalern ausgestiegen sind. Vielleicht haben die ja was Ungewöhnliches bemerkt.“
„Wär auch ein Ansatz.“ Annalena gab ihr recht. „Kümmerst du dich darum?“
„Klar, kann ich machen“, Melanie klang missmutig. „Im Gegensatz zu euch kenne ich hier ja auch alle und bin mit jedem in der Stadt per Du. Das ist doch ein Superansatz.“
„Da hat sie recht. Die kennt ja keinen. Lass mich das machen“, schlug Markus vor. „Ich kenn wirklich fast alle.“
„Danke“, murmelte Melanie, griff nach ihrem Zopf und fuhr gereizt fort: „Da ist noch was, was überhaupt nicht in die Geschichte passt.“
Annalena drückte sich den rechten Zeigefinger gegen die Nasenspitze und fragte betont ruhig: „Und das wäre?“
„Dein Ermittlungsansatz!“ Der Zopf klang aggressiv und beleidigt.
„Ach was? Und wieso?“ Annalena bemühte sich um Gelassenheit.
„Also, ich hab so flüstern hören, dass die Zentner ganz gern mal einen gehoben hat. Vielleicht ist sie ja doch nach Hause gekommen, nicht um zehn Uhr abends, sondern erst um drei Uhr in der Früh. Und vielleicht hat sie ja so viel getrunken, dass sie einfach nicht mehr ans Telefon gehen konnte. Und so könnte es doch durchaus sein, dass die gerade jetzt noch einfach nur besoffen in ihrer Wohnung rumliegt, während wir hier alle Pferde scheu machen. Soweit ich Ewald verstanden habe, hat da noch keiner nachgeguckt.“
Annalena biss sich auf die Lippen. Da hatte sie tatsächlich was übersehen. „Das stimmt“, gab sie zu. „Da hast du völlig recht.“
„Sag ich doch.“ Die Zweite Hautkommissarin lehnte sich zurück. Sie wirkte etwas entspannter.
„Wer will?“ Annalena sah in die Runde.
„Ich kann das machen, der Ewald wird ja wohl einen Schlüssel haben“, bot Melanie sich an.
„Okay. Dann machst du das.“
Annalena sah aus dem Fenster. Draußen hatte es zu schneien begonnen.
„Heute Nacht hätte es schneiden sollen“, jammerte der Leiter der Kalveroder Spurensicherung plötzlich los. „Spuren im frischen Schnee – das ist das Tollste. Der Traum eines jeden Ermittlers. Wenn die eindeutig sind, muss man sich um nichts mehr Gedanken machen. Aber nun …“
„Nach was für Spuren willste denn suchen?“ Wilfried Lütke-Tillmann schüttelte verständnislos den Kopf. „Dazu brauchst du doch erst mal ‘nen Tatort.“
„Aber jetzt deckt der Schnee alles zu. Wie eine weiße Decke“, jammerte Horst Toplischek weiter.
„Werd bloß nicht sentimental“, ermahnte Heinz Krabbe ihn. „Wir finden die schon. Die ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Und vielleicht hat Melanie ja auch recht und die gute Frau liegt in irgendeinem anderen Bett und muss nur aufgeweckt werden und schon ist Ewalds Welt wieder in Ordnung.“
„Oder sie zwitschert sich woanders einen?“, warf Horst Toplischek ein. „Immerhin gibt’s in Kalverode achtundfünfzig Kneipen. Und die meisten davon könnten jetzt sogar geöffnet haben.“
„Die Option greifen wir auf, sobald Melanie in der Wohnung der Vermissten war“, stimmte Annalena zu. „Sollte dort nichts sein, dann macht ihr euch auf den Weg.“
„Ihr? Wen meinst du denn damit?“, fragte Horst.
„Na dich und Wilfried, aber nicht zusammen, sondern einzeln. Der eine fängt im Westen an und der andere im Osten – und dass ihr mir bloß nicht überall ein Pilsken zwitschert.“ Annalena hob spielerisch den Zeigefinger.
„Und ich halt mal wieder hier die Stellung?“, wollte Hedwig wissen und packte übrig gebliebene Plätzchen in eine Blechdose zurück.
„Du koordinierst“, nickte Annalena und legte ihr eine Hand auf den Arm. „Danke.“
„Und spülst Geschirr und kochst dem Chef einen Kamillentee und sorgst für Frieden … und überhaupt“, seufzte Hedwig.
„Du kannst doch gar nicht weg. Du hast doch immer Dienst. Warum leitest du auch deine Notrufnummer in die Dienststelle weiter? So haste ja nie Feierabend.“
Es war Horst, der auf das Telefon an Hedwigs Arbeitsplatz deutete. Das war mit einem lilafarbenen Band umwickelt und allein für die seelsorgerischen Aktivitäten der Sachbearbeiterin reserviert.
*
Die Wohnung lag in einem großen Mietshaus in der Gasstraße acht. Das vierstöckige Gebäude erinnerte Melanie an das Haus, in dem sie wohnte. Wie bei ihr standen auch hier ein verrostetes Klettergerüst und eine Schaukel im Vorgarten, aber anders als bei ihr waren die Parkplätze vor dem Haus mit Autos ohne Nummernschilder belegt.
Melanie näherte sich dem Gebäude und nahm ein kleines Schild wahr: „Freddy Feldkamp. An- und Verkauf von Gebrauchtwagen“.
Vermutlich war es dem Inhaber dieser Werkstatt noch zu kalt, um an seinen Gebrauchtwagen herumzubasteln. Nirgends war ein Mensch zu sehen. Es herrschte eine eigenartige Stille, als würde der frisch fallende Schnee jedes Geräusch verschlucken. Unwillkürlich sah sie zu Boden. Kein einziger menschlicher Fußabdruck – dafür hatten streunende Hunde, Katzen, Hasen und vermutlich Vögel ihre Spuren hinterlassen.
Die Kommissarin sah an den Klingelschildern, dass Familie Zentner im zweiten Stock wohnte. Sie schloss die schwere Eingangstür mit dem Sicherheitsschlüssel auf und stieg die gelb geflieste Treppe hoch. Im Treppenhaus duftete es nach frisch gebrühtem Kaffee.
Nach vierzig Stufen erreichte sie den Treppenabsatz des zweiten Stocks. Wie im Parterre und im ersten Stock lagen sich auch hier zwei Wohnungen direkt gegenüber. Vor der einen Tür hing ein geflochtener Strohkranz mit Trockenblumen und einem Schildchen, mit dem das Ehepaar Feldkamp all seine Besucher herzlich willkommen hieß. An die andere Tür war die Zeichnung eines Kindes geklebt. Drei graue Säcke waren darauf gemalt und darunter stand: „Hier wohnen die Zentners“. Es sollte lustig aussehen, aber es war überhaupt nicht komisch, und während Melanie die Holztür öffnete, dachte sie, dass in dieser Familie offensichtlich jeder eine zentnerschwere Last mit sich herumschleppte. Deshalb wirkten die Stiefenkelkinder des Kriminaloberrats, die an manchen Tagen in der Dienststelle von Hedwig beaufsichtigt wurden, so bedrückt.
Sie öffnete das schlichte Türschloss mit einem Dietrich, dankbar, dass die Zentners sich kein Sicherheitsschloss hatten einbauen lassen, und rief dann leise: „Iris, sind Sie da?“
In der Wohnung war es totenstill.
3. Kapitel
„Der wird schon nichts passiert sein“, sagte Hedwig leise und schob ihrem Chef den dritten Kamillentee dieses Vormittags vor die gefalteten Hände. „Trink mal. Das beruhigt auch die Nerven.“ Je schweigsamer Ewald wurde, umso mehr meinte sie, auf ihn einreden zu müssen. „Meine Güte“, begann sie nun erneut und versuchte, besonders munter zu klingen. „Die Iris, das ist doch eine gestandene Frau. Die kann sich doch zur Wehr setzen! Der geht es garantiert bestens. Pass mal auf, in ‘ner Stunde lachen wir über all die Sorgen, die wir uns gemacht haben.“
Der Kriminaloberrat hob hilflos die Schultern. Sein Kopf blieb gesenkt. Unwillkürlich musste Hedwig Hagenkötter an Papst Benedikt XVI. denken. Genauso erschöpft, fast gebrochen, hatte der ausgesehen, als er seinen Rücktritt vom höchsten Kirchenamt bekannt gab. Aber da war der auch schon weit über achtzig gewesen. Und Ewald war gerade mal dreiundsechzig.
„Und wenn du nach Hause gehst?“, schlug Hedwig fürsorglich vor und ließ erneut durchblicken, dass sie sich nicht nur als Mädchen für alles, sondern auch als Mutter für alle verstand.
„Was soll ich da?“, murmelte Ewald und schlürfte den heißen Tee. „Ich hab Birgit versprochen, dass ich entweder mit Iris zurückkomme oder gar nicht.“
„Ach du lieber Himmel!“ Hedwig verdrehte die Augen. „So wörtlich darfste datt aber auch nicht nehmen. Guck mal, hier sind nur kompetente Leute um dich rum. Das wird schon alles wieder.“
Er sah sie lange an. Ihr fiel auf, dass seine Augenbrauen zerrupft wirkten, jedes einzelne der braunen und weißen Härchen wies in eine andere Richtung. Wie oft er sich wohl an diesem Tag schon mit der Hand über die Stirn gefahren war? Ganz plötzlich klappten seine Mundwinkel nach unten. „Hoffentlich haste recht. Ich hab kein gutes Gefühl. Mir ist überhaupt nicht wohl bei der Geschichte.“
*
Annalena saß in ihrem Büro und ließ sich im etwa halbstündlichen Takt von Heinz Krabbe berichten, was die acht Sterntalerinnen aus Iris’ Kegelverein erzählten. Gleich nach seinem ersten Anruf hatte sie das Hotel recherchiert, in dem die Damen abgestiegen waren. Ein Wellnesshotel in Montegrotto Terme, ganz in der Nähe von Padua, und von Venedig etwa fünfzig Kilometer entfernt. Neun Einzelzimmer für jeweils drei Nächte. Das hatte der Deutsch sprechende Hotelportier bestätigt. Sie sah sich die Fotos des Thermenbereichs, des türkischen Bades und der großen Sauna an und verspürte so etwas wie Sehnsucht: achtunddreißig Grad heißes Wasser. Vor ihrem Fenster schneite es. Und dort, gerade mal eintausendzweihundert Kilometer entfernt, lag dieses Hotel mit den großen Pools, die aus heißen Quellen gespeist wurden und von Ruheliegen umsäumt waren. Die Innenbecken waren durch Schleusen mit dem Außenbereich verbunden. Wie es wohl sein mochte, im heißen Wasser zu liegen, in den Himmel zu sehen und Schneeflocken auf dem Gesicht zu spüren?
Die hatten es sich wirklich gut gehen lassen, die neun Sterntalerinnen. Waren am Donnerstagabend von Hannover nach Venedig geflogen und sonntags wieder zurück. Alle Neune. Und das alles aus der Kegelkasse. Donnerwetter!
Da wäre sie auch gern dabei gewesen. Oder vielleicht doch nicht?
Sie notierte die Aussagen der einzelnen Damen wortwörtlich so, wie Heinz Krabbe sie ihr durchgab. Keine der Kegelschwestern hatte Mechthild Benkhoffs Aussage etwas hinzuzufügen.
„Wir hatten wunderbare drei Tage. Wir waren einmal in Venedig. Und wir haben uns bestens erholt. Aufgefallen ist uns nichts.“ Das hatte die Erste gesagt. Dann war Heinz weitergejoggt oder per Nordic Walking zur nächsten Adresse gelaufen, eins von beidem auf jeden Fall – und dort hatte er genau das Gleiche gehört. Wortwörtlich. Als auch die dritte und die vierte Befragung in genau diese Sätze mündeten, wurde Annalena stutzig. Die hatten sich abgesprochen. Das war die einzige Erklärung. Die hatten diese vier kurzen Sätze einfach auswendig gelernt. Das wiederum aber konnte nur bedeuten, dass sie mit einer Befragung rechneten, dass irgendetwas passiert war, über das Stillschweigen gewahrt werden musste.
Annalena starrte erneut auf ihre Notiz. Oder hatte sie sich von Ewalds Sorge anstecken lassen und unbewusst viermal das Gleiche geschrieben? Konnte das sein? Mit zitternden Fingern schickte sie Heinz Krabbe eine SMS. „Unbedingt Aufnahmegerät einschalten!“
Sekunden später kam eine SMS zurück. „Klaro, mach dir keine Sorgen. Alles im grünen Bereich.“
Sie beschloss, sich erst einmal das Band anzuhören, bevor sie ihre Vermutung mit den anderen teilte. „Eile mit Weile“ – das war auch so ein Kalenderspruch, mit denen Ewald sie zur genauen Recherche ermahnte. Sie hängte trotz des Dekorationsverbots des Kriminaloberrats das Magnolienaquarell ihrer Mutter auf.
*
Die Vierzimmerwohnung hatte muffig und ungelüftet gerochen. In der Küche stand ungewaschenes Geschirr, auf dem Couchtisch im Wohnzimmer hatte Melanie einen bis zum Rand gefüllten Aschenbecher entdeckt und sich gerade noch zurückhalten können, die Kippen in den Müll zu werfen. Wenn wirklich was passiert war, konnten das alles Spuren sein.
Sie fand weder einen herumstehenden Koffer, der auf eine Rückkehr schließen ließ, noch eine Iris Zentner. Nicht im vollgestopften Badezimmer und auch nicht in dem kleinen Schlafzimmer mit dem Doppelbett, weder in der Küche beim Kühlschrank, noch auf dem Balkon und auch nicht in den Kinderzimmern, in die Melanie kurz hineinschaute. Was für nette Kinder. Die Zwei waren ja noch unordentlicher als sie selbst. Und das wollte was heißen. Die Zweite Kommissarin lächelte und registrierte, dass das Mädchen die Malerin zu sein schien. Die rosa gestrichenen Wände waren mit bunten Zeichnungen vollgehängt.
Nadine hieß die, wenn sie sich recht erinnerte.
Der Anrufbeantworter in der winzigen Diele blinkte und zeigte acht aufgezeichnete Gespräche an. Sie notierte sich die Zahl. Falls Iris nicht auftauchte, müsste man das Ding abhören. Aber wahrscheinlich waren nur die besorgte Mutter und der Kriminaloberrat darauf gespeichert.
Vorsichtig schloss sie die Wohnungstür hinter sich und ging durch das gelb geflieste Treppenhaus wieder nach unten.
*
Er stand breitbeinig in der Haustür, hatte ihr den Rücken zugekehrt, und sie lief direkt in seinen grünen Anorak hinein. Mit einer unwilligen Schulterbewegung schien er sie abschütteln zu wollen, blieb wie ein uneinnehmbares Hindernis vor den geparkten Wagen ohne Nummernschilder stehen und tippte eine SMS.
‚Kein Benehmen, aber sich so eine Schrottkarre kaufen!‘, dachte die Zweite Kommissarin und fauchte den Anorak an: „Können Sie nicht zur Seite gehen? Sie stehen ja mitten im Hauseingang.“
Der Typ drehte sich um. „Du? Was machst du denn hier?“
„Das könnte ich dich genauso gut fragen“, antwortete Melanie und sah Heinz an.
„Ich mache meine Befragungen“, sagte der schnell, holte eine Liste aus der Tasche und zeigte sie ihr. Schau, hier wohnt die Sechste von den Sterntalern. Aber wissen tut die auch nichts. – Und du?“
„Ich war in der Wohnung“, sagte Melanie. „Da ist sie nicht.“
„Super, dann können Wilfried und Horst ja nun mit der Kneipentour beginnen. Sagst du denen Bescheid?“
Melanie nickte. „Wie viele hast du denn noch vor dir?“
Er sah erneut auf seine Liste. „Jetzt nur noch Hilde Möllensiep und Mechthild Benkhoff. Heute ist ja Montag. Da ist der ihr Friseursalon geschlossen. Da werd ich sie wohl zu Hause besuchen.“
Seine Kollegin klopfte ihm auf die Schulter. „Du hast in den letzten zwei Stunden schon vier Frauen befragt. Super. Und das alles zu Fuß.“
„Klar, ich sprinte“, antwortete er.
„Dann könnten wir ja um zwei eine Sitzung einberufen“, schlug Melanie vor.
Er grinste und schüttelte den Kopf. „Bis dahin sind Horst und Wilfried nie zurück. Die sprinten ja nicht, und in einer Stunde schaffen die keine zweiundfünfzig Kneipen. Die nicht!“
Sie gab ihm recht. „Vielleicht müssen die ja gar nicht auf Tour gehen. Kann doch sein, dass die Iris schon wieder da ist, bei Birgit auf dem Sofa sitzt und die ganze Aufregung umsonst war.“
„Das wäre schön.“ Heinz genoss die Schneeflocken, die in sein Gesicht fielen.
„Ich glaub’s aber nicht“, gestand Melanie und legte sich den Zopf mit dem eingeflochtenen Band wie eine Schlange um den Hals. „Wir sehen uns dann?“
Er nickte.
*
„Ich bin krank.“ Hilde Möllensiep zog sich den gelben Schal noch fester um den Hals und blieb abweisend im Eingangsbereich ihres Hauses stehen. Sie sah in der Tat blass und erschöpft aus.
„Ich fass es nicht“, brachte sie verständnislos zwischen zwei Hustenattacken hervor. „Ich hab doch im Amt angerufen und mich krankgemeldet. Schicken die jetzt schon die Polizei, um das zu überprüfen? Für mich ist das Mobbing.“
„Kann ich reinkommen?“ Oberwachtmeister Heinz Krabbe merkte, dass seine Füße kalt wurden und hüpfte im Leerlauf vor der Möllensiep auf und ab.
„Nein“, sagte die, trat in ihrem blauen Bademantel auf die mit Schneeflocken überpuderte Türschwelle und zog resolut die Haustür hinter sich zu. Er sah sie von oben bis unten an. Vermutlich trug sie unter ihrem Bademantel nicht viel mehr als ein Nachthemd. Ihre Füße steckten in Fellpantoffeln. Sie hatte keine Strümpfe an.
„Ich lass dich nicht in mein Haus. Was willst du?“
„Ich komm nicht von deinem Meldeamt, ehrlich nicht. Ich will nur wissen, ob du eine Idee hast, wo Iris Zentner stecken könnte.“
„Keine Ahnung.“ Sie schüttelte den Kopf. „Wir sind alle gestern Abend hier angekommen, und dann ist eine jede ihres Weges gegangen. Angerufen hat sie dann auch nicht mehr bei mir. Warum sollte sie auch. Und überhaupt: Mechthild hat mich das Ganze doch auch schon gefragt.“
„Die Iris ist immer noch verschwunden“, erklärte Heinz, der nun richtig fror. Entweder die ließ ihn in ihr Haus oder er joggte weiter. Wenn er noch länger hier stehen blieb, würde er sich den Tod holen.
„Ach was, und da schickt der Kriminaloberrat gleich seine ganze Mannschaft aus?“ Sie zitterte. Er hätte nicht sagen können, ob aus Wut oder vor Kälte.
„Hast du ‘nen Kaffee für mich?“, versuchte er es noch einmal.
„Nein“, antwortete sie schnell.
„Dann erzähl vom Wochenende. Machen wir es kurz.“ Er holte sein Diktiergerät hervor und sie schluckte und sah über seine rechte Schulter in den fallenden Schnee.
„Vom Wochenende?“
„Ja, was hast du da gemacht?“
„Wir hatten wunderbare drei Tage. Wir waren einmal in Venedig. Und wir haben uns bestens erholt. Aufgefallen ist uns nichts.“
So wie sie es sagte, klang es teilnahmslos und apathisch. Heinz fixierte sie aus zusammengekniffenen Augen. Da stimmte was nicht.
Mit frostroten Händen suchte sie in der großen Tasche ihres strahlend blauen Bademantels nach dem Schlüssel, öffnete die Tür hinter sich und stellte klar: „Ich muss nun wieder rein.“
Und schon war die Tür vor der Nase des Oberwachtmeisters ins Schloss gefallen.
„Die spinnen doch alle“, murmelte der, verbarg das ausgeschaltete Aufnahmegerät in der Brusttasche seines grünen Anoraks und joggte weiter. Zur nächsten und letzten Station –Mechthild Benkhoff – waren es nur knapp vierhundert Meter, und dort würde er sicher einen Kaffee bekommen.
*
Hilde Möllensiep lehnte sich von innen gegen die schwere Haustür und atmete tief durch. Geschafft! Sie sah sich um und wusste: In dieses Haus konnte sie so schnell niemanden hineinlassen. Vielleicht niemals mehr. Seit Monaten war sie nicht mehr in der Lage, aufzuräumen oder gar zu putzen.
Sie ließ einfach alles vor und hinter sich fallen und dann blieb es genau dort liegen, wo es lag.
Anfangs hatte sie es noch geschafft, bevor angekündigte Besucher kamen, alles in ein Zimmer zu schaufeln. Inzwischen jedoch war das sogenannte Kinderzimmer dermaßen vollgestopft, dass sie es nicht mehr betreten konnte. Und das Gleiche war mit dem Gästezimmer passiert. Egal. Sie wollte weder Gäste noch Kinder.
Die Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Sie ernährte sich seit einem halben Jahr von Tiefkühlgerichten, die sie in der Mikrowelle erhitzte, war aber nicht mehr in der Lage, die leer gegessenen Plastikgefäße und die sie umhüllenden Pappen in den Müll zu werfen.
Ja, es grenzte an ein Wunder, dass sie es überhaupt geschafft hatte, mit all den anderen nach Montegrotto zu fahren. Ebenso wie es all ihre Kraft brauchte, fünfmal pro Woche in der Meldebehörde von Kalverode ihren Dienst zu tun und allsamstäglich auf die Kegelbahn zum „Torfstecher“ zu gehen und dort die ganz Normale und Ausgeglichene zu spielen. Warum war nur alles so entsetzlich anstrengend?
Eine ihrer Kegelschwestern hatte vor Kurzem angeboten, ihr beim Aufräumen und beim Putzen zu helfen. Aber wozu?
Hildes Mann war seit Monaten nicht mehr heimgekommen und hatte damit gedroht, er würde dieses Haus erst dann wieder betreten, wenn es ordentlich darin aussähe. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte, und vor allem wusste sie nicht, ob sie Ingo zurückhaben wollte. Sollte der doch dort auf seiner Ölplattform versauern und für die Ingenieure kochen und dabei so viel Geld verdienen, dass er sich ein eigenes Haus kaufen konnte. Dann könnte sie sowieso hier machen, was sie wollte.
Sie waren gerade vier Jahre verheiratet, aber wenn er nach Hause gekommen war, hatten sie sich nichts zu sagen gewusst.
Stattdessen war er wie ein Kontrolleur von Raum zu Raum gegangen und hatte damit geprahlt, dass er in seinem winzigen Reich auf der Plattform mehr Ordnung und Sauberkeit halten konnte als sie in diesem großen und großzügig eingerichteten Haus. Wo sie doch so wenig zu tun hatte. Beamtin auf der Meldebehörde. Da fiel doch keine Arbeit an. Sie könne sich wirklich mal anstrengen.
Hilde Möllensiep biss sich auf die Lippen und dachte trotzig, wie so oft in letzter Zeit: ‚Dann sollte er doch dort bleiben. In seinem Reich. In seiner Ordnung.‘
Ihre Unordnung war das Gegengewicht zu seinem Perfektionismus. Das musste so sein, sonst geriete die Welt aus den Fugen.
Dennoch hatte sie vorhin, als dieser Oberwachtmeister plötzlich vor ihr stand, zum ersten Mal begriffen, dass sie ein wirkliches Problem hatte. Sie würde niemals jemanden in dieses Haus mit seinen fünf Zimmern, den zwei Bädern und der großen Küche lassen können. Angenommen, sie hätte einen Unfall und jemand Fremdes müsste hier nach ihrer Krankenkassenkarte suchen. Was dann?
Ihr wurde siedend heiß. Sie griff sich an die Stirn und war sich sicher, dass sie Fieber hatte. Kein Wunder nach all den Katastrophen. Wenigstens hatte sie dem Krabbe den abgesprochenen und auswendig gelernten Satz in sein Diktiergerät hineingesagt. Da war sie aus dem Schneider.
Dachte sie.
*
Die Mechthild war okay. Er ließ sich schon seit Jahren von ihr die Haare machen, auch wenn seine Frau nach seinen Salonbesuchen behauptete, Mechthild Benkhoff sei auf Damenfrisuren spezialisiert und er würde viel zu viel Geld dort lassen. Aber es war Mechthild gewesen, die ihm, als er noch sehr jung war, einmal geraten hatte, mit farbigen Strähnen von seinen etwas zu großen Ohren abzulenken. Das hatte sogar funktioniert. Seitdem war er ihr treuester Kunde und nahm all ihre Ratschläge an.
Nun goss sie ihm einen Kaffee ein und bot ihm ein Likörchen an.
„Nee, danke“, lehnte er pflichtgemäß ab. „Bin doch im Dienst.“
„Und, habt ihr sie gefunden?“, wollte sie dann wissen.
Oberwachtmeister Krabbe wusste sofort, von wem sie sprach und schüttelte den Kopf. „Noch nicht.“
„Wo kann die nur hingegangen sein?“
Mechthild bewegte nur ganz leicht den Kopf und ihre gewaltigen Ohrgehänge klingelten wie ein Windglockenspiel. Riesenohrringe waren nun mal Mechthilds Markenzeichen.
„Hat sie denn auf der Rückfahrt nicht gesagt, dass sie sich auf ihre Kinder freut?“
Heinz wärmte sich die Hände an der Kaffeetasse.
Mechthild schien nachzudenken. „Wir waren alle ein wenig erschöpft. Also wenn ich so überlege, nee, auf der Rückfahrt haben wir gar nicht viel geredet. Da war jede ein bisschen in ihren eigenen Gedanken versunken.“ Sie lächelte schief. „Wie das so ist, wenn man sich plötzlich von allen Seiten kennenlernt.“
„Wie von allen Seiten?“, hakte Heinz Krabbe nach. „Was meinst du damit?“
„Na ja, nicht durchgängig bekleidet beispielsweise“, versuchte Mechthild es zu umschreiben.
„Ihr habt euch also nackt gesehen“, bestätigte der Oberwachtmeister und wusste weltgewandt hinzuzufügen: „Das ist doch normal, wenn man in der Sauna sitzt oder im Türkischen Bad und was da sonst noch alles so ist.“
Gleichzeitig dachte er an die Damen, die er seit heute früh schon befragt hatte und wusste, dass er nicht gerade scharf darauf wäre, auch nur eine von denen nackt zu sehen. Und schon gar nicht die Möllensiep in ihrem königsblauen Bademantel. Bei dem Gedanken, dass sie den auch auf offener Straße vor ihm hätte öffnen können, wurde er ganz rot.
„Nein, nein“, widersprach Mechthild sofort. „Doch nicht nackt. In Italien geht man mit Badeanzug in die Sauna. Da haben wir uns natürlich dran gehalten. Andre Länder, andere Sitten.“