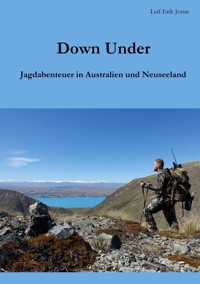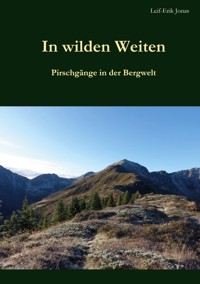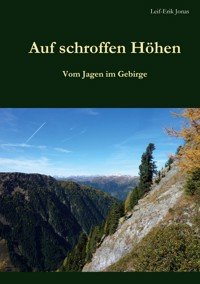
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Passion des Autors gilt der Jagd im Gebirge. Nicht Schuss und Strecke stehen für ihn im Vordergrund seines Handelns, sondern die Erlebnisse und Erfahrungen, welche die Bergjagd dem Jäger beschert. Seine Pirschgänge hat Leif-Erik Jonas bereits seit jungen Jahren in Wort und Bild festgehalten. Nach zahlreichen Veröffentlichungen in Jagdzeitschriften macht er diese Erzählungen mit dem vorliegenden Werk nun einem breiteren Publikum zugänglich. Der Reiz anspruchsvollen Waidwerks in atemberaubender Bergwelt zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Buch und entführt den Leser gedanklich in die wilden Weiten der Tiroler Alpen. 276 Seiten, 33 Farbfotos
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Frühlingserwachen im Gebirge
Der Urhahn von Lotron
Der Spielhahn vom Gipfelgrat
Räudegams
Der Mittsommerbock vom Hinterkofelegg
Der Achter vom Lärchenwald
Der Gabler vom Waldgrat
Der Gewitter-Jahrling vom Almrücken
Ein Zwölfer unter schroffem Felsgewänd
Der Einkruckige von der Rippn
Murmeljagd im verschneiten Gebirge
Der Murmelbär vom Stollen
Das Berghirschl aus den Moschen
Almsau – wunderseltenes Glück
Die alte Geltgeiß vom Rauchbichl
Der Widder vom Almkessel
Eine Junggeiß in Sturm und Schnee
Gamsjagd im Wintergebirge
Die Gamsgeiß vom Eggenkofel
Schneehuhnjagd im rauwinterlichen Hochgebirge
Ein winterweißer Hahn vom Joch
Ein weißer Hase im kältestarrenden Gebirge
Die Hüttenmarder
Schwarze Schatten am glitzernden Weiß
Kontakt
Vorwort
Ein heißer Sommer war es, der den ersten großen Einschnitt in meinem noch jungen Leben markierte. Der Kindheit war ich noch nicht entwachsen, als meine Familie beschloss, von der sturmumheulten Ostseeküste in die sonnenverwöhnte Bergwelt Osttirols zu übersiedeln. Doch die Eingewöhnung in die neue und so völlig andere Welt fiel mir unerwartet leicht. Nur anfangs vermisste ich hin und wieder die alte Heimat und all das, was ein Kind damit verbindet. Rasch hingegen verspürte ich in der neuen Welt ein Heimatgefühl, das ich so noch nicht gekannt hatte. Die tiefgrünen Bergwälder und üppigen Almwiesen, die schroffen Gipfel und zackigen Grate fanden einen festen Platz in meinem Bubenherz – einen Platz, den sie bis zum heutigen Tage behalten haben.
Würde mir jemand die Frage stellen, wann ich entschied, Jäger zu werden – ich könnte sie nicht beantworten, denn solange ich denken kann, erlebte ich die Jagd als etwas Faszinierendes, das wie selbstverständlich zum Leben dazugehört. Schon in früher Kindheit durfte ich meinen Vater auf seinen Pirschgängen begleiten. Und ich tat dies bei jeder Gelegenheit und mit wachsender Begeisterung. So wie ich nach unserem Weg in die neue Heimat die Bergwelt rasch lieben lernte, eröffnete auch die Gebirgsjagd völlig neue Horizonte. An einen Gamsjagdtag, den ich mit meinem Vater erleben durfte, erinnere ich mich so, als sei er gerade gestern gewesen. Vierzehn war ich damals. Es war ein kalter und windiger Morgen im späten September und der schon winterschwarze, eng gestellte Bock, der nach einer sauberen Kugel hingestreckt vor uns lag, faszinierte mich bis in mein Innerstes. Ich weiß noch, wie ich an jenem Tag für mich erkannte, wie viel an emotionalen Werten mir die Bergjagd zu geben vermag.
Dreieinhalb Jahre später legte ich selbst die Jagdprüfung ab. Wann immer es meine Zeit zuließ, fand man mich fortan draußen in den wilden Gebirgsweiten. Ich muss gestehen, dass anfangs der Wille zum Beutemachen mein jagdliches Handeln bestimmte. Doch mit jedem erlegten Stück pulsierte das heiße Jägerblut etwas weniger gierig durch meine Adern und sehr bald besann ich mich auf das, was das eigentliche Jagen ausmacht – das Erleben und Leben, das Schauen und Sinnen, das Fühlen und Denken. Schuss und Strecke rückten in den Hintergrund, sodass sich mein Jägerherz für die tieferen Werte des Jagens öffnen konnte.
Hier nahm dieses Buch seinen Anfang, denn ich verspürte den Wunsch, das Erlebte und Erfühlte niederzuschreiben, um es zu konservieren. Seitdem sind nicht wenige Jahre ins Land gestrichen und ich befand, dass es nach einigen Veröffentlichungen in Jagdzeitschriften jetzt auch an der Zeit sei, die Erzählungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Eines sei an dieser Stelle noch erklärend hinzugefügt: Die meisten Erlebnisse schreibe ich nieder, wenn sie noch taufrisch sind. Manches Geschriebene liegt also schon eine längere Weile zurück, sodass der eine oder andere Aspekt überholt ist. Revier, Jagd und Leben unterliegen nun einmal einem steten Wandel – die Landschaft wird von Mensch und Natur geformt, Ansichten und Einstellungen ändern sich, neue Erfahrungen geben zurückliegenden Ereignissen eine andere Bedeutung und dergleichen mehr. Dennoch habe ich diese Textstellen meist so belassen, denn ich möchte unverfälscht von dem erzählen, was ich seinerzeit erlebt habe und nicht von den Erinnerungen, die von den Wandlungen beeinflusst und von den Jahren verwässert wurden.
Nun wünsche ich Dir, lieber Leser, viel Freude mit diesem Buch.
Leif-Erik Jonas
Frühlingserwachen im Gebirge
Schon zeitig im November hatte der Winter Einzug gehalten und monatelang mit eisiger Hand regiert. Fünf volle Monate wuchs die Schneehöhe und einmal durchnässte ergiebiger Regen den Schnee, bevor sibirische Kälte ihn betonhart gefrieren ließ. Das Wild litt schwere Not, der Futterverbrauch an unseren Fütterungen stieg in ungeahnte Höhen und dennoch raffte die kalte Atempause der Natur das Wild in all ihrer Unbarmherzigkeit dutzendweise dahin. Im April endlich kündeten die steigenden Temperaturen vom nahenden Ende der entbehrungsreichen Jahreszeit und nach einem neuerlichen Wintereinbruch zur Monatsmitte gewann der Frühling endgültig die Oberhand. Während drunten im Tal gar sommerliche Hitze lastete, hauchte droben im Gebirge der Winter seine letzten Züge aus und die milde Witterung erweckte die Bergwelt zu neuem Leben.
Wir schreiben die vorletzte April-Woche und in der Wärme der Mittagssonne steige ich durch raumen Fichtenwald meiner Jagdhütte entgegen. In diesem südexponierten Wald liegt nicht mehr viel Schnee und vielfach ist der Nadelstreuboden gar schon aper. Allein auf dem sich in engen Kehren den Berg hinaufwindenden Forstweg liegt das Weiß noch mehr als knietief, sodass ich mein Fahrzeug wenig oberhalb der letzten Häuser stehen lassen musste und meinen Weg nun zu Fuß fortsetze, um zwei Tage in der Gebirgseinsamkeit zu verbringen und das Erwachen des Bergfrühlings zu erleben.
Am Rande eines winterbraungrasigen Kahlschlages springen drei Stücke Rehwild – eine Geiß mit ihrem vorjährigen Kitz sowie ein geringer Bock – ab und entschwinden zwischen den rauen Fichtenstämmen meinen Blicken. Dann habe ich nach drei Viertelstunden des Stapfens und Steigens endlich die Jagdhütte erreicht, öffne zum ersten Mal seit der Gamsbrunft die Hüttentür und trete hinein in den kleinen, aber gemütlichen Raum. Bald lodert im Kamin ein knackendes und prasselndes Feuer, und da die Wasserleitung noch eingefroren ist, sodass in den Brunnentrog kein Wasser plätschert, fülle ich drei Töpfe mit sulzigem Frühjahrsschnee und lasse das Weiß schmelzen.
Die Nachmittagsstunden vergehen mit verschiedenen Arbeiten wie im Fluge. Am Abend dann steige ich noch hundert Schritte höher und hin zu einer Stelle, von wo man aus steilem, lichtem Wald in einen tief eingefurchten, felsigen und büchsenschussbreiten Schottergraben sieht, der gerade im Frühjahr und Frühsommer einen beliebten Gamseinstand darstellt. Nach einer kurzen Weile habe ich auch tatsächlich sechs Stücke des Krickelwildes zusammengeschaut. Genau vis-à-vis meinem Aussichtsplatz äst ein kleines Rudel – ein vorjähriges Kitz sowie drei bald zweijährige Geißen – vor sich hin. Weiter oben im Graben zieht eine einzelne Geiß immer höher hinauf, bevor Steinschlag sie in eine Jungwuchsgruppe flüchten lässt. Und weit jenseits des Grabens habe ich schon beim Anmarsch eine Gamsgeiß erschaut, die über einen Kahlschlag wechselte. Doch ansonsten tut sich lange Zeit nichts, und als ich schon zur Jagdhütte zurückkehren will, entdecke ich drunten im Grabengrund hinter Lärchengezweig den Rumpf einer weiteren Gams, die langsam den jenseitigen Hang hinaufzieht und die wenigen Hälmchen äst, die zwischen dem lockeren Geröll Halt finden. Nachdem sie endlich aus der Zweigübergitterung herausgewechselt ist, kann ich sie als eine starkkruckige und weit ausgelegte, aber nicht sonderlich alte Geiß ansprechen.
Als ich schließlich bei noch gutem Licht zur Hütte hinabgehe, äst am aperen Boden unter einer starkstämmigen Lärche ein junger Rehbock – ein geringer Gabler. Der jubilierende Gesang der Bergvögel ist an diesem Abend recht verhalten und zeugt davon, dass der Winter hier heroben gerade erst dabei ist, dem Frühling Platz zu machen. In der Nacht dann dringt jedoch immer wieder der tremolierende Ruf des Raufußkauzes, der für mich ähnlich wie Hahnenbalz und Kuckucksruf Inbegriff des Bergfrühlings ist, in die Hütte.
Um drei Uhr läutet der Wecker. Nach einem schnellen Frühstück steige ich durch den urwüchsigen Fichten-Lärchen-Wald der Waldgrenze entgegen. Die Schneehöhe nimmt rasch zu und der nadelübersäte Frühjahrsschnee ist sulzig nass und trägt nicht. So lege ich den Rucksack ab, auf den ich wohlweislich meine Schneeschuhe gebunden habe, und lege sie an. Nun ist das Gehen wieder ein kommodes, sodass ich gut vorankomme. Und wenn ich verschnaufend meinen Schritt verhalte, verwebt sich die große Stille der nächtlichen Bergwelt mit dem fernen Tosen der den Talgrund durchschäumenden Schmelzwasser.
Als ich endlich den geschlossenen Bergwald hinter mir lasse und auf sanften Almhängen weiter an Höhe gewinne, erleichtert sogar ein tragfähiger Harschdeckel das Vorwärtskommen. Aus den letzten schütteren Lärchen streichen drei oder vier Stücke Birkwild ab und lassen mich durch ihr nahes und überraschendes Geflatter richtiggehend zusammenfahren. Dann geht es über den freien Schneehang weiter hinauf auf einen rundlichen Grat, hinter dem sich eine weitläufige, nahezu ebene und von unzähligen Mulden und Büheln durchzogene Almfläche ausbreitet, die mit einzelnen Junglärchen und Latschen bestockt ist – ein Balzplatz der Spielhahnen.
Nach fünf Viertelstunden des Steigens nehme ich am Almgrat schließlich auf einer abgewehten Felskante neben einer winzigen Hütte Platz, während sich der Himmel hinter den zackigen Ostgipfeln schon eine Nuance heller zeigt als zuvor. Vom urwüchsigen Lärchenwald herauf tönt der geheimnisvolle Ruf des Raufußkauzes und irgendwo in meiner Nähe ist ein leises Tapsen zu vernehmen und so hoppelt dort vermutlich einer der weißen Berghasen. Langsam steigt das Licht hinter den scharf gezeichneten Graten empor, verdrängt die finsteren Schatten der Nacht und gibt der noch winterlich anmutenden Gebirgswelt immer klarere Konturen. Neben mir hüpft am harschigen Weiß ein unscheinbarer Frühlingsbote umher – ein Bergpieper.
Dann lässt mich der scharfe Faucher eines Spielhahns aufhorchen. Vorerst getraue ich mich nicht zu bewegen, sondern versuche, mit freiem Auge das dämmergraue Zwielicht zu durchdringen und zwischen den Junglärchen einen dunklen Klumpen zu erschauen, während das Blasen des Hahns wieder und wieder an mein Ohr dringt. Und wirklich bleibt mein Blick rund hundertfünfzig Schritt entfernt bald an einem schwarzen Schatten haften, der mir zuvor nicht aufgefallen ist.
Nur wenige Atemzüge später bewegt sich dieses schwarze Etwas und gibt mir die Gewissheit, dass es wirklich der Hahn ist. Mit der Geschwindigkeit eines Stundenzeigers hebe ich nun das Glas an die Augen und was ich da sehe, treibt meinen Puls in die Höhe. Es ist ein Kapitalhahn – das ist auch im schwachen Frühlicht, und obwohl der Hahn sein Spiel nicht gefächert hat, leicht zu erkennen, denn die Sicheln, die er nachschleift, sind stark gekrümmt und lang. Ich spüre jedoch, dass der Hahn nicht in rechter Balzstimmung zu sein scheint und deshalb versuche ich, ihn mit einigen feurigen Zuschern zu reizen. Doch er zeigt keine Reaktion, sitzt einfach zusammengekauert am verharschten Kristallweiß und wirkt irgendwie missmutig. Als ich dann gerade einmal in eine andere Richtung schaue, höre ich den Hahn abstreichen, doch sehe nicht, wohin. Bald darauf ertönt sein Grugeln sanft und leise aus weiter Ferne.
Kein weiterer Hahn fällt an diesem Morgen auf der weiten Almfläche ein. Im Ausklang dieses harten Winters hat die Balz offenbar noch nicht richtig eingesetzt. Hinzu kommt, dass die Balz auf diesem Almrücken ohnehin stets eine unberechenbare ist – mal balzen die Hahnen hier, mal dort, mal ist es ein Dutzend, mal ist es keiner.
Das ist auch der Grund, weshalb ich mich schon bald wieder auf den Weg mache und entlang des Almgrats dem Talschluss entgegengehe, denn vielleicht spielt sich andernorts eine bessere Balz ab und ich höre die Hahnen möglicherweise nur deshalb nicht, weil sie sich hinter irgendeiner Geländekante aufhalten. Hier am Grat trägt der Schnee sogar ohne die Schneeschuhe und ich komme leicht und schnell voran.
Droben bei den Spielhahnen
In größerer Entfernung erschaue ich auf einem abgewehten Geländerücken ein kleines Gamsrudel und später entdecke ich unter himmelhoch aufragendem Kalkgewänd ein weiteres. Dort, wo der Almgrat eine schwache Rechtsbiegung beschreibt, werde ich dann wachsamer und gehe langsamer, denn auf dem hinter der Biegung liegenden, mäßig steilen Hang, der zu jungem Lärchenwald hinunterzieht, balzen die blauschwarzen Ritter besonders gern. Vorsichtig setze ich Pirschschritt vor Pirschschritt und kann immer mehr dieses Hangabschnitts einsehen. Und richtig – bald dringt das vibrierende Grugeln eines Hahns an mein Ohr! Wenige Schritte weiter entdecke ich den Sänger in einem büchsenschussentfernten Lärchenwipfel. Auch dieser Sichelritter ist ein starker und kaum geringer als jener, der im Frühdämmer am Almboden eingefallen ist. Mit gefächertem Spiel balzt er selbstvergessen vor sich hin und sein blauschimmerndes Gefieder glänzt im klaren Morgenlicht. Doch weil vor mir keine Deckung mehr liegt und ich das wunderbare Schauspiel nicht stören möchte, kehre ich um und mache mich auf den Rückweg, während der Sonne Glutball langsam über die Ostgipfel steigt, zuerst nur die höchsten Grate in goldenen Schein taucht und bald die gesamte Bergwelt in gleißendem Licht erstrahlen lässt.
Über die flachen Hänge spaziere ich hinüber zum östlichen Rand der Hochalm, wo der sanfte Almrücken in steilen und felsdurchsetzten Bergwald übergeht. Diese scharfe Geländekante zieht in südlicher Richtung zur Jagdhütte hinunter und so folge ich ihr. Durch unterwuchsreichen Lärchen-Fichten-Wald steige ich tiefer, erreiche das obere Ende jenes Schottergrabens, in dem ich am Vorabend noch das Gamswild beobachtet habe und der nun wildleer ist. Doch irgendwo aus dem dichten Nadelwuchs dringt wieder und wieder das feine Spissen des Haselhahns an mein Ohr.
Eine kurze Weile später lange ich dann bei der Jagdhütte an. Der Tag vergeht wie im Fluge, und als der Nachmittag sich der Abendzeit entgegenneigt, gehe ich büchsenschussweit den Berg hinauf und setze mich am Rande eines idyllischen Bergmahds unter einer starkstämmigen Lärche nieder. In manchem Jahr balzt im angrenzenden urwüchsigen Wald ein Großer Hahn und heute in den Frühstunden ist mir während des Aufstiegs die reichlich vorhandene Auerwildlosung aufgefallen. So habe ich nun die Hoffnung, dass einer der majestätischen Urhahnen hier in seinen Schlafbaum einfallen könnte.
Auch wenn mir vorerst kein Anblick vergönnt ist, ist es ein wunderbares Sitzen und Sinnieren in der Ruhe und Abgeschiedenheit der vorfrühlingshaften Bergwelt. Mein Blick schweift hinüber auf die noch tiefwinterlichen Gipfel und Grate der Schattseite und die Gedanken gehen manch wohltuenden Weg, der ihnen im regen Treiben des Alltags verwehrt bleibt.
Ringdrosseln hüpfen futtersuchend am braunwelken Grasboden umher und irgendwo im vielschichtigen Gebirgswald spisst der unscheinbare und doch so prachtvolle Haselhahn vor sich hin. Schließlich senkt sich in mattem Grau die Dämmerung über Berg und Tal, verwischt Farben und Konturen. Droben am Wipfel einer einzelnen Fichte, unter der ein Bodensitz steht, jubiliert die Ringdrossel ihre letzte Strophe, flattert dann davon und entschwindet in der aufsteigenden Finsternis. Doch kein schwerer Schwingenschlag verrät die Anwesenheit eines der Urhahnen und so kehre ich zur Jagdhütte zurück.
Am nächsten Morgen bin ich schon zeitig wieder auf den Beinen und gehe der Hochalm entgegen. An der Waldgrenze angekommen biege ich jedoch in östlicher Richtung ab, quere den sanften Almgrat wenig oberhalb der scharfen Geländekante und erreiche so einen noch tief verschneiten Forstweg, der in das hinter der Alm liegende Seitental hinabführt. Diesem Weg folge ich noch reichlich büchsenschussweit, bis ich einem Balzplatz des Auerwildes nahe bin, an dem an guten Tagen die Strophen von vier oder fünf Hahnen durch den frühmorgendlichen Lärchenwald perlen. Ich wechsele mein verschwitztes Hemd, lege wärmere Kleidung an, steige nun möglichst leise noch ein kurzes Stück den mäßig steilen Hang hinab und nehme auf einem Geländebuckel Platz.
Unter mir wird der lichte Bergwald nun steiler, bevor er rund hundert Meter entfernt hinter einer Hangkante extrem steil abfällt. Hohe Lärchen dominieren das Landschaftsbild, doch auch einige dicht beastete Fichten trotzen hier heroben dem rauen Gebirgswetter. Der Schnee liegt oft noch mehr als knietief und nur an den wenigsten Stellen ist der almrauschüberwucherte Waldboden schon aper.
Die Balz ist an diesem Ort stets eine besonders reizvolle, denn zum einen ist dieser Hang ostexponiert, sodass es spürbar früher tagt und man den Sonnenaufgang in all seiner Farbenpracht erleben kann. Zum anderen bietet sich zwischen den lichten Kronen der alten Bergbäume hindurch Blick über das Seitental hinweg und hinein in eine schroffe Hochgebirgswildnis, deren Anblick mich jedes Mal aufs Neue in seinen Bann zieht.
Bald eine halbe Stunde mag bereits verstrichen sein, da meine ich, von weiter unten ein zaghaftes Knappen vernommen zu haben – oder war es nur das Knacken eines Astes? Angestrengt horche ich in die Finsternis hinein und versuche den leisen Gesang des Urhahns aus dem Rauschen des fernen Baches herauszuhören. Nach einer kurzen Weile ein zweiter Knapper – und nun zweifelsfrei! Jetzt folgt ein hölzerner Knapper dem nächsten, doch recht einspielen will sich der Hahn nicht. Er muss ein alter, vorsichtiger und gerissener sein.
Dann herrscht plötzlich wieder Stille im einsamen Bergwald. Hat der Urvogel irgendetwas wahrgenommen, das ihn verstummen ließ? Oder hat er sich vielleicht einfach nur von mir fortgedreht, sodass sein Knappen vom Bachrauschen übertönt wird? Es wird wohl Letzteres gewesen sein, denn wenige Minuten später dringen Hauptschlag und Schleifen klar und deutlich an mein Ohr – mitten in der Strophe muss sich der Hahn wieder zu mir hergewandt haben. Richtig eingespielt hat er sich allerdings immer noch nicht, denn dem neuerlichen Knappen folgt zwar der Triller, doch dann bricht die Strophe ab.
Bald darauf wieder Knappen, Triller – und Stille. Nach einer kurzen Pause tönt endlich ein volles Gsetzl durch den nun schon im ersten Graudämmer liegenden Bergwald. Ein, zwei weitere folgen, bevor der Urhahn erneut verschweigt. So geht es eine ganze Weile und ich habe mich schon damit abgefunden, dass es mir heute wohl kaum gelingen wird, diesen misstrauischen Hahn anzuspringen. Schließlich allerdings spielt er sich doch noch ein und Strophe um Strophe perlt durch den lichten Hochwald.
Während des nächsten Schleifens schultere ich den Rucksack und bei jedem weiteren Schleifen springe ich nun zwei, drei lange Schritte den sulzschneebedeckten Waldhang hinab, sodass ich nicht selten bis übers Knie im nassen Weiß versinke. Anfangs komme ich gut voran und auch die kleinen Schneeklumpen, die durch meine Stapfschritte den Hang hinabkugeln und erst zur Ruhe kommen, nachdem der Hahn seine Strophe beendet hat, scheinen ihn nicht zu beunruhigen. Das mag aber auch einfach daran liegen, dass ich den Hahn nicht stichgerade anspringe, sondern mich bewusst etwas seitlich halte, damit der Schnee nicht direkt unter seinem Balzbaum hindurchrieselt. Doch dann trete ich einmal eine reichlich handballgroße Schneekugel los, die geräuschvoll tiefer rollt, um schließlich unter dem tief hängenden Gezweig einer Fichte zu zerbrechen. Der Hahn verschweigt und minutenlang verharre ich wie angewurzelt. Mein gesamtes Körpergewicht lastet auf dem rechten Bein, da ich das linke in Erwartung des nächsten Schrittes schon halb aus seinem Schneeloch herausgezogen habe. Doch ich darf jetzt keinen Rührer tun, soll der noch unerschaute Hahn nicht abreiten.
Die Zeit will kaum vergehen. Endlich tönt erlösend ein misstrauischer Knapper durch den frühmorgendlichen Bergwald. Bald hat sich der Hahn wieder eingespielt, sodass ich ihn weiter anspringe. Doch nur ein, zwei Dutzend Sprungschritte weiter verschweigt der Hahn ohne offensichtlichen Grund erneut. Wieder stehe ich äußerst unkommod da und sehne das nächste Knappen herbei. Vorerst bleibt es jedoch still im einsamen Gebirgswald. Ich spüre, dass sich ein Krampf anbahnt und beinahe will ich schon aufgeben, mich ein wenig bewegen und so in Kauf nehmen, wahrgenommen zu werden, als ein erster zaghafter Knapper meinen Durchhaltewillen wiederbelebt. Das Knappen wird schneller, doch dann bricht der Hahn die Strophe ab und beginnt erneut. Endlich geht das Knappen in den Triller über und es folgen Hauptschlag und Schleifen, sodass ich unbemerkt meine unbequeme Körperhaltung aufgeben und dem Hahn näherspringen kann.
Gar weit bin ich nun nicht mehr von ihm entfernt und so spähe ich, während ich stillstehe, immer in das finstere Fichtengezweig und kahle Lärchengeäst hinauf. Und schließlich entdecke ich in einer mittelstarken Lärche, die genau auf der Hangkante thront, fünf, sechs Bergstocklängen über dem Waldboden einen schwarzen Klumpen, der sich hin und wieder bewegt – der Hahn! Rasch habe ich im lichten Wald einen Punkt ausgemacht, von dem ich freien Blick zum Hahn haben dürfte, sodass mir später vielleicht das eine oder andere gute Foto gelingen wird. Bei jedem Schleifen springe ich nun – den Hang querend – diesem Punkt entgegen. Doch noch bevor ich dort bin, verschweigt der Hahn erneut und knappt dann nur mehr vor sich hin. Lange geht das so und mir wird klar, dass er sich an diesem Balzmorgen wohl kein weiteres Mal einspielen wird, sodass ich hier erst uneräugt fortkomme, sobald er abgeritten ist.
Die Zeit verstreicht zäh und zäher, das reglose Stehen wird von Minute zu Minute unbequemer. Immer wenn sich der Hahn einmal von mir fort dreht, sodass der Fächer seinen Kopf verdeckt, bewege ich mich daher ein wenig, nehme eine kommodere Haltung ein und hebe das Glas an die Augen. Es ist ein starker Hahn, dessen Stoß eine ungewöhnlich intensive weiße Sprenkelung aufweist. Das Licht wird besser und besser, bald ist es richtig Tag geworden und so kann ich trotz der Zweigübergitterung doch noch einige passable Fotos von dem prachtvollen Wildtier schießen. Der Hahn spaziert auf seinem Lärchenast hin und her, dreht und wendet sich und knappt immer fort, während von der Alm herunter das ferne Grugeln der Spielhahnen tönt und irgendwo im lichten Wald einige Birkhennen gocken. Eine knappe Stunde mag so wohl vergangen sein, als sich der Urhahn vom schwankenden Ast abstößt und über die Hangkante hinweg in steilem Winkel in den raumen Gebirgswald hinabgleiten lässt.
Während die Sonne nun in goldenem Schein über die spitzzackigen Grate steigt und die weite Bergwelt in ein warmes Licht taucht, mühe ich mich durch den Sulzschnee wieder zum Forstweg hinauf und trete den Rückweg an. Als ich dem Wegende schon nahe bin, burrt wenige Schritte neben mir ein taubengroßer, grauer Vogel davon und entschwindet hinter dichtem Fichtengeäst. Während ich im ersten Augenblick an das Naheliegendste – ein Haselhuhn – denke, erkenne ich schon einen Herzschlag später meinen Irrtum. Nicht das unscheinbare Raufußhuhn war es, sondern das einzige Glattfußhuhn unserer Berge – ein Steinhuhn! Droben auf der weiten Hochalm habe ich seinen Ruf schon einmal vernommen und den Vogel auf große Distanz vielleicht auch sekundenkurz in Anblick bekommen, doch eine sichere Sichtbeobachtung dieser raren Art ist mir hier auf der Sonnseite des Reviers zuvor nicht vergönnt gewesen.
Der Abstieg entlang meiner alten Stapfspur geht leicht und schnell. Fast habe ich die Jagdhütte wieder erreicht, als plötzlich hundert Schritt vor mir ein Stück Gamswild steht, das mir schon entgegen äugt. Gerade noch bekomme ich das Glas an die Augen und kann das Stück als jüngere Geiß ansprechen, bevor sie in langen Fluchten über eine scharfe Geländekante meinen Blicken entschwindet.
An der Hütte angekommen packe ich nach einem kurzen Frühstück meine Siebensachen zusammen und steige hernach talwärts. Dabei nehme ich jedoch nicht den direkten Weg, da ich an einer Salzlecke noch eine Wildkamera installieren möchte, um einen bekannten Rehbock, den sich ein Jagdkollege in den Kopf gesetzt hat, zu bestätigen. Und bei der Gelegenheit will ich auch gleich einige steile Wiesen, auf denen schon erste frische Äsung spießt, nach Abwurfstangen absuchen.
Wenig unterhalb des Salzes zeugt eine große Menge an Rehhaaren davon, dass auch hier der kalte Tod zugeschlagen hat. Auf meinem weiteren Weg liegen immer wieder Haare vor mir und nach vielleicht hundert Metern stehe ich plötzlich vor den Überresten des Stückes, einer jungen Geiß.
Etwas tiefer komme ich in den Wiesen an einem Stadl vorüber, in dessen Umgebung mir die Unmengen an Rotwildlosung und die stark ausgetretenen Wechsel ins Auge stechen. So werfe ich einen Blick durch die offene Stadltür, und als ich die blauen Ballenschnüre sehe, geht mir ein Licht auf. Hier wurden über den Winter also Heuballen gelagert und das Rotwild hat in seiner Not diese unfreiwillige Fütterung selbstverständlich gerne angenommen.
Weiter drunten am Hang verdrückt sich am Waldrand zögerlich und nahezu widerwillig eine Rehgeiß. Als ich meinem Fahrzeug dann schon nahe bin, spisst im dichten Fichtenwald ein Haselhahn und kündet vom Frühling, der nun unaufhaltsam Einzug hält. Und ich bin glücklich, in einem Revier jagen zu dürfen, in dem man binnen weniger Stunden vier der fünf Berghühner begegnen kann.
Der Urhahn von Lotron
Wer einmal in stockfinsterer Frühlingsnacht dem leisen Lied des Großen Hahns gelauscht hat, wird dem Zauber dieser Wildart erliegen. An das erste hölzerne Knappen, das vor Jahren an mein Ohr gedrungen ist, erinnere ich mich, als sei es gerade gestern gewesen – und der faszinierende Anblick des balzenden Urhahns, den wir kurz darauf ansprangen und im Geäst einer dünnstämmigen Lärche als schwarze Silhouette erschauten, hat sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt.
Seit jenem Morgen zog es mich Jahr für Jahr hinauf in den urwüchsigen Bergwald, wo schon seit Ewigkeiten das geheimnisvolle Balzlied des majestätischen Urvogels vom Heraufdämmern eines neuen Frühlingstages kündet. Diese einsamen Stunden in der Abgeschiedenheit der lichten Gebirgswälder und der Anblick der balzenden Hahnen zählten für mich auch ohne Schuss zu den großen Höhepunkten eines jeden Jagdjahres. Und der Wunsch, zumindest einmal im Leben einen dieser den Jäger verzaubernden Vögel als kostbare Beute heimzutragen, wuchs stetig. Heuer endlich bot sich mir die Möglichkeit, diesen Wunsch greifbare Wirklichkeit werden zu lassen, denn einer der Großen Urhahnen war mir freigegeben.
Über das Wie und Wo hatte ich mir zuvor schon unzählige Male Gedanken gemacht. Es waren im Wesentlichen zwei Balzplätze, an denen mich die Jagd auf meinen Auerhahn besonders reizen würde. Der eine befand sich auf der Sonnseite unseres Reviers in einem lichten Lärchenbestand wenig unterhalb der Waldgrenze – dieses Gebiet wird gemeinhin als Lotron bezeichnet. Hier bot es sich an, in der Jagdhütte zu nächtigen und zeitig am neuen Morgen weiter ins Gebirge hinaufzusteigen. Das war nicht nur kommod, sondern würde das Erlebnis der Hahnenjagd auch ungemein bereichern. Der andere Balzplatz war jener oberhalb unserer schattseitig gelegenen Rotwildfütterung – in der sogenannten Sanger. Die Hahnen dort sind unstet, in manchem Jahr ist keiner da – und selbst, wenn ein Hahn balzt, ist es nicht unbedingt leicht, ihn schussgerecht in Anblick zu bekommen. Außerdem ist der Fußmarsch nach schneereichen Wintern meist ein besonders weiter. Das alles war ebenfalls genau nach meinem Geschmack.
Den besten Balzplatz des Revieres, wo oft die Strophen von fünf oder mehr Hahnen durcheinanderperlen, wollte ich hingegen in Ruhe lassen. Oft schon war ich dort gewesen und konnte daher annehmen, dass sich die Jagd an diesem Ort vergleichsweise einfach gestalten würde. Und gar zu leicht wollte ich es mir keinesfalls machen, sondern wollte mir meinen Auerhahn vielmehr hart erwaidwerken. Zeitig im Jahr wollte ich damit beginnen und schon lange vor der Jagdzeit mehrfach den weiten Steigweg zu beiden Balzplätzen unter die Bergschuhsohlen nehmen, um die Hahnen zu verlosen und zu bestätigen. Solange die Fütterungsperiode anhielt und das Rotwild in großer Zahl in der Nähe der Fütterung stand, verbot es sich jedoch freilich von selbst, zu nachtfinsterer Stunde unnötige Unruhe in die Einstände zu bringen. Obwohl mir die Jagd in der Sanger vielleicht ein wenig reizvoller erschien, sollte mich mein erster Hahnengang daher hinauf in den urigen Lärchenwald von Lotron führen.
Der April ist kaum eine Woche alt, als ich mein Fahrzeug am späten Nachmittag oberhalb der letzten Häuser parke und durch raumen Fichtenwald der Jagdhütte entgegensteige. Die wärmende Frühjahrssonne hat in den letzten Wochen ganze Arbeit geleistet und den Schnee auf den Südhängen ordentlich weggeputzt. Zwar brachte ein neuerlicher Wintereinbruch zu Beginn des Monats noch einmal einen dreiviertel Meter Neuschnee, aber das lockere Weiß schmolz rasch dahin, sodass im Hochwald nun zunächst nur wenig Schnee liegt und der Bergwaldboden nicht selten gar aper ist. Doch je höher ich komme, desto seltener wird apere Nadelstreu und immer häufiger sinke ich mehr als wadentief in den sulzigen Frühjahrsschnee ein.
Jenseits eines tief eingefurchten Taleinschnitts entdecke ich einige Stücke Gamswild in einem Windwurf und über mir im Altholz wechselt eine Rehgeiß mit ihren vorjährigen Kitzen davon. Schließlich erreiche ich nach reichlich einer halben Wegstunde die Hütte, sperre erstmals seit der Gamsbrunft ihre Tür auf und betrete den holzgetäfelten Raum. Die Temperaturen liegen nur wenig oberhalb des Gefrierpunktes, doch bald lodert im Kamin ein knackendes Feuer und verbreitet wohlige Wärme und jene dem Hüttenleben so eigene Gemütlichkeit. Später tönt von fern der geheimnisvolle Ruf des Raufußkauzes, der zu Winterausklang und Frühlingserwachen im Gebirge untrennbar dazugehört.
Als ich am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe in die nächtliche Finsternis hinaustrete, prasselt dichter Graupelfall auf den nassen Sulzschnee. Doch der Spuk dauert nicht lange, und als ich wenig später mit Schneeschuhen durch vielschichtigen Lärchen-Fichten-Wald weiter in die Bergwelt hinaufstapfe, umfängt mich die große Stille einer Vorfrühlingsnacht, in der nur das ferne Rauschen der Schmelzwasser zu vernehmen ist.
Anfangs komme ich gut voran, doch bald wird der Schnee immer weicher und das Gehen mühsamer. Nicht weit über mir ertönt das Bellen Reinekes, und als ich dort anlange, von wo ich die Rufe vernommen habe, stehen die Spuren des roten Nachtschnürers kreuz und quer im kristallenen Weiß. Ein wenig höher verhalte ich meinen Schritt, verschnaufe eine kurze Weile, setze dann zum nächsten Steigschritt an – und da schwirrt plötzlich wenige Armlängen neben mir ein Stück Birkwild unter lautem Geflatter aus dem dichten Gezweig davon und lässt mich richtiggehend zusammenfahren.
Bald darauf habe ich die Waldgrenze erreicht, schreite über einen flachen Boden und quere einen sanften Almgrat. Gleich jenseits des Grats erreiche ich zwischen den letzten knorrigen Lärchen das Ende eines Forstwegs, der durch den Hahnenwald von Lotron in ein felsüberragtes Seitental hinabführt. Wenige hundert Schritte noch folge ich diesem Weg – dann bin ich nach fünf Viertelstunden des Steigens und Stapfens endlich oberhalb des Balzplatzes angekommen. Hier schnalle ich die Schneeschuhe ab, wechsele mein verschwitztes Hemd, lege wärmere Kleidung an und stapfe noch schrotschussweit den Hang hinab und hinauf auf einen Bühel. Dort setze ich mich nieder, komme zur Ruhe und lausche voll Spannung und Erwartung in die Nacht hinaus.
Der Bergwald hier ist alt, licht und eher steil als sanft. Er besteht hauptsächlich aus mächtigen Lärchen und zu einem geringeren Teil aus hohen Fichten – doch dazwischen finden sich immer wieder unterständige Bäume, schütterer Jungwuchs, moderndes Totholz, kleinräumige Blößen und verschwiegene Böden, sodass das Waldbild abwechslungsreich ist und einer so anspruchsvollen Art wie dem Auerwild optimale Lebensbedingungen bietet. Nicht weit über mir lichtet sich der Wald immer weiter auf, bildet keinen geschlossenen Bestand mehr und geht bald in eine freie Hochalm über. Der mitunter kniehohe Almrausch, der im Hahnenwald großflächig den Boden bedeckt, liegt hier auf diesem Osthang noch unter einer hohen Schneedecke, die das Anspringen eines Hahns alles andere als leicht gestalten wird.
Obwohl dieser Balzplatz der zweitbeste des Revieres ist, wäre er beinahe in Vergessenheit geraten. Wohl viele Jahrzehnte lang hatte in der Balzzeit kein Jäger den weiten Weg hinauf nach Lotron unter die Bergschuhsohlen genommen – zumindest berichteten die alten Jäger, dass hier heroben seit Ewigkeiten kein Hahn erlegt worden sei. So wusste ich kaum, was mich erwarten mochte, als ich mich an einem drei Jahre zurückliegenden Aprilmorgen erstmals in Lotron in die Almrauschstauden setzte und in die Finsternis hinaushorchte. Rund eine Stunde war vergangen, als tiefer am Hang wahrhaftig das zarte Lied eines Hahns erklang. Ich sprang ihn auf Schrotschussentfernung an und schoss stimmungsvolle Fotos des Urvogels, der sich gegen den im Morgenrot erglühenden Osthimmel als schwarze Silhouette abzeichnete. Später bekam ich noch einen zweiten Hahn in Anblick, der stumm am Bergwaldboden saß, und am Rückweg zur Jagdhütte einen dritten, der auf einer exponierten Felsnase aus einem hohen Wipfel abritt.
Im Jahr darauf war ich mehrfach an diesem Balzplatz. So fand ich heraus, dass er sich über eine relativ große Fläche ausdehnte und man von keinem Ort alle Hahnen hören konnte. Vier, fünf oder gar sechs waren es an guten Tagen aber gewiss – an schlechten hingegen war es nur einer. Im Wonnemonat jenes Jahres führten der Jagdpächter und ich in Lotron schließlich einen Jagdgast erfolgreich auf seinen Auerhahn – und jener war der erste nach langer Zeit, der in diesem urwüchsigen Gebirgswald zur Strecke kam.
Wiederum ein Jahr später – mithin im vergangenen – stieg ich in der vorletzten Aprilwoche erneut hinauf nach Lotron. An jenem Morgen war nur ein einziger Hahn zu hören – weniger als hundert Meter unterhalb meines heutigen Horchbühels, auf dem ich auch an jenem Tag saß. Dieser Hahn balzte ausnehmend vorsichtig, spielte sich nur zögerlich ein und legte immer wieder lange Pausen ein, sodass es alles andere als leicht war, ihn anzuspringen. Doch es gelang – und fast eine Stunde lang konnte ich den majestätischen Urvogel beobachten und fotografieren.
Selbst als es heller Tag geworden war und die Bergvögel längst ihr vielstimmiges Konzert in den Morgen hinausjubilierten, saß er immer noch auf seinem starken Lärchenast, knappte unregelmäßig vor sich hin und drehte sich mit gefächertem Rad in alle Richtungen. Und dabei fiel mir auf, wie ungewöhnlich intensiv die weiße Sprenkelung in seinem Stoß war. Auch unabhängig davon war dies ein Prachthahn – vielleicht kein ganz alter, aber doch zumindest ein starker, dessen grünes Schild im Morgenlicht schillerte und dessen scharlachrote Rosen aus dem Lärchengezweig hervorflammten. Schon an jenem Tag merkte ich mir diesen Hahn für die Jagd im heurigen Jahr vor. Zwar wollte ich mich nicht darauf festlegen, meinen Urhahn in Lotron zu erlegen – doch falls ich in Lotron auf meinen Hahn waidwerken sollte, so würde mich der Weiße besonders reizen.
Als der Wonnemonat schon mehr als halb vorüber war, wollte ich mit einem guten Jagdfreund ein weiteres Mal in Lotron nach den Hahnen schauen. Die Frühjahrssonne hatte den Schnee dahinschmelzen lassen, sodass die Forstwege nun aper waren und wir bis in die Nähe des Balzplatzes fahren konnten. Wenig später saßen wir auf dem wohlbekannten Bühel und horchten in den nachtfinsteren Frühlingswald hinaus. Doch selbst als die Schatten der Nacht sich langsam hoben und zarte Grautöne dem Waldboden schwache Konturen verliehen, war kein noch so fernes Knappen zu vernehmen. Einmal meinte ich, tief drunten am Hang zwar das Schleifen eines Hahns vernommen zu haben. Da es hernach jedoch still blieb, glaubte ich an eine Täuschung. Ein paar Minuten später hingegen klang aus derselben Richtung unzweifelhaft das Schleifen eines der Urhahnen – immer wieder. Der Hahn balzte heute also so tief drunten, dass wir das leise Knappen und den Triller ebenso wenig vernahmen wie den kurzen Hauptschlag. Nur der vierte und letzte Abschnitt der Gsetzl, während dem sich die Erregung eines Hahns bis aufs Äußerste steigert und er nichts um sich herum wahrnimmt, tönte kaum vernehmbar bis herauf zu uns.
Und weil der leise Gesang des Urvogels mehr zu erahnen als wirklich zu hören war, ließ sich der Hahn auch nicht anspringen. Dennoch erhoben wir uns vorsichtig und pirschten möglichst leise so weit den Hang hinab, bis die Strophen klar und deutlich an unsere Ohren drangen. Nun taten wir bei jedem Schleifen ein paar flinke Schritte und kamen dem Balzenden rasch näher. Während wir nach einem Schleifen wieder einmal wie angewurzelt verharrten, reckte ich meinen Kopf, um durch das Genadel einiger naher Fichten zu spähen, hinter denen der Hang nach einer scharfen Geländekante steiler abfiel. Und da entdeckte ich durch eine Zweiglücke den Hahn, der als schwarzer Klumpen jenseits von Kante und Fichten in einer Lärche stand.
Wir sprangen näher an ihn heran und schließlich trennten uns nur mehr zehn Bergstocklängen von dem majestätischen Urvogel, dessen Balzgesang selbst jetzt ungewöhnlich leise klang, sodass es weiter kein Wunder war, dass wir ihn zuvor, als wir mehr als hundert Meter höher am Hang gesessen waren, beinahe überhört hätten. Beim nächsten Schleifen legte ich den Rucksack ab, um die Kamera herauszuholen und einige Fotos des prachtvollen Wildtieres zu schießen. Doch dazu gab mir der Hahn keine Gelegenheit mehr, stieß sich vom schwankenden Lärchenast ab und glitt mit schwerem Schwingenschlag in den Bergmorgen hinaus, ohne dass ich erkannt hätte, ob er der Weiße war. Meinem Begleiter hingegen war zumindest ein kurzes Video gelungen.
Dies war mein letzter Hahnengang im vergangenen Jahr. Fortan galt meine Aufmerksamkeit meist dem Schalenwild. Sommer und Herbst verstrichen, der Winter hielt Einzug – und je mehr sich das neue Jahr einer Ahnung von Frühling entgegenneigte, desto öfter wanderten meine Gedanken hinauf in die Abgeschiedenheit der urigen Bergwälder und zum verzaubernden Lied der Hahnen. Ob der Weiße von Lotron noch da war? Und ob vielleicht gar in der Sanger ein guter Hahn balzte? So bin ich heute hier herauf nach Lotron gestiegen und horche in erwartungsfroher Spannung in die Finsternis.
Viel Zeit ist nicht verstrichen, als ich weit links und tief unten wirklich ganz schwach einen Ton vernehme, der dem Knappen des Großen Urhahns nicht unähnlich ist. Angestrengt lausche ich und schließe die Augen, um meine Wahrnehmung ganz aufs Hören zu konzentrieren. Erklang dort nicht jetzt auch – kaum wahrnehmbar – das Schleifen? Oder war das nur Einbildung und Hoffnung? Ich halte die Hände an die Ohren, höre so bedeutend lauter – aber dort, wo ich geglaubt habe, den Hahn zu hören, herrscht große Stille.
Die Zeit vergeht und eigentlich müssten die Hahnen längst in voller Balz sein – doch es bleibt still im vorfrühlingshaften Lärchenwald. Lange will ich nicht mehr zuwarten, bevor ich weitergehe, um womöglich einen Hahn zu erlauschen, der außer Hörweite balzt.
Eine leichte Bewegung meinerseits lässt meine Kleidung leise rascheln – und hinein in diesen Ton, der eigentlich laut genug wäre, um das zarte Balzlied des Urvogels zu überdecken, fällt unterhalb meines Horchbühels in geradezu unwirklicher Deutlichkeit ein tief hölzernes Knappen, gefolgt von einem zweiten. So klar und laut, wie diese mich elektrisierenden Laute sind, muss der Hahn ganz in meiner Nähe balzen, und ich halte es für möglich, dass er bereits in Sichtweite ist. Vorsichtig hebe ich das Glas an die Augen, suche im tiefdämmerigen Licht das noch völlig nadellose Lärchengeäst ab – und kaum weiter als einen Schrotschuss entfernt entdecke ich wahrhaftig einen schwarzen Klumpen. Das muss der Hahn sein, auch wenn er sich im ahnenden Graulicht noch nicht zweifelsfrei als solcher auflösen lässt.
Langsam steigert sich die Geschwindigkeit des Knappens, doch dann verschweigt der Hahn plötzlich. Nach einer kurzen Weile ertönt wieder ein misstrauischer Knapper, abermals wird das Knappen schneller, erste Doppelknapper mischen sich in das Lied – und erneut verschweigt der vorsichtige Vogel. Wieder und wieder steigert sich seine Balz dem ersehnten Hauptschlag entgegen, doch jedes Mal bricht er die Strophe ab. Er muss ein alter, erfahrener Hahn sein, dem meine Annäherung vor mittlerweile anderthalb Stunden nicht verborgen geblieben ist – was mich in Anbetracht der geringen Entfernung und des lauten Schnees auch nicht verwundert – und nun immer noch argwöhnisch ist. Deshalb hat er erst so spät sein geheimnisvolles Balzlied angestimmt und mag sich auch jetzt nicht recht einspielen, damit keine Gefahr seinen scharfen Sinnen verborgen bleibt.
Mittlerweile ist es so hell, dass sich der dunkle Klumpen im Lärchengeäst klar als die noch farblose Silhouette des Hahns abzeichnet. Auf der linken Kopfseite gewahre ich zudem einen kaum fingernagelgroßen weißen Fleck. Ist dort ein Schneeklumpen am Gefieder festgefroren? Oder sind einige Kopffedern wirklich weiß? Und ist es dann womöglich der Weiße vom Vorjahr? Auf den Stoß und seine Sprenkelung habe ich keinen guten Blick, sodass ich mir diese Frage, deren Antwort mich brennend interessieren würde, nicht beantworten kann.
Dann endlich – nach sicher einer Viertelstunde des Knappens – tönt auch das erste volle Gsetzl durch den raumen Gebirgswald. Einer kurzen Pause folgt das zweite und nun spielt sich der Hahn richtig ein.
Ein paar Schritte unterhalb meines Sitzplatzes krallt sich eine doppelstämmige Lärche in den steilen Hang. Dort will ich hin, um gänzlich freie Sicht zum Hahn zu haben und – sobald es richtig Tag geworden ist – vielleicht auch ein paar gute Fotos schießen zu können. Das nächste Schleifen nutze ich daher dazu, aufzustehen, und das darauffolgende dazu, die Kamera aus dem Rucksack zu kramen. Dann springe ich den Hahn an. Als ich wenige Gsetzl später die Doppellärche erreiche, wird mir klar, dass ich mir von hier keine brauchbaren Fotos erwarten kann, da nicht weit entfernt ein Lärchenast ins Blickfeld hängt. Um freie Sicht zu erhalten, will ich noch etwas zur Seite springen. Doch vorerst muss ich wie angewurzelt hinter dem rauschuppigen Doppelstamm verharren, denn der Hahn verschweigt und knappt nur von Zeit zu Zeit.
Dann endlich folgt wieder eine volle Strophe und gleich darauf eine weitere, was ich dazu nutze, ein paar wenige Schritte nach links zu springen. Hernach verschweigt der Hahn erneut, wendet sich auf seinem Ast hin und her und äugt misstrauisch um sich. So geht es sicher eine Viertelstunde, während der ich dazu verdammt bin, mucksmäuschenstill zu verharren. Dennoch stößt sich der mächtige Vogel schließlich unter kräftigem Schwingenschlag vom schwankenden Lärchenast ab, gleitet in den raumen Bergwald hinab und wenige Atemzüge später höre ich ihn tiefer am Hang und weiter rechts polternd im Geäst einfallen.
Selbst falls er sein Balzlied dort ein weiteres Mal anstimmen sollte, wäre es wenig aussichtsreich, ihn nun am helllichten Tag erneut anzuspringen. Ich weiß jedoch, dass in Lotron ein Hahn balzt – und das genügt mir fürs Erste.
So trete ich frohen Herzens den mühsamen Rückweg an. Erste feine Schneeflocken rieseln vom überwölkten Himmel. Und kaum, dass ich den Balzplatz hinter mir gelassen habe, wird der Schneefall so dicht, dass man kaum hundert Schritt weit sieht. Entlang einer scharfen Geländekante steige ich tiefer und bekomme im extrem steilen Gelände unter der Kante zweimal Gamswild in Anblick, das sich durch den trüben Vorhang des Flockenfalls nur verschwommen erkennen lässt. Und als ich die Jagdhütte schon beinahe wieder erreicht habe, vernehme ich höher am Hang den klatschenden Schwingenschlag eines einfallenden Urhahns und irgendwo pfeift eine Gams.
Daheim suchte ich jene Hahnenfotos aus dem Archiv, die ich im Vorjahr in Lotron gemacht hatte. Und auf diesen Fotos war an der linken Kopfseite des Hahns ebenso ein weißer Fleck zu erkennen, auch wenn er kleiner war als im heurigen Jahr. Und mein Jagdfreund bestätigte mir, dass der Hahn in seinem Video diesen Fleck ebenfalls aufwies. Der Hahn droben in Lotron musste also wahrhaftig der Weiße sein!
Dennoch blieb ich bei meinem Vorhaben, zunächst auch in der Sanger nach den Hahnen zu schauen. Und dazu musste ich noch einige Zeit verstreichen lassen und abwarten, bis das Ende der Fütterungsperiode gekommen war.
Als das Frühjahr dann schließlich so weit fortgeschritten war, dass wir das Füttern einstellen konnten, neigte sich die zweite Aprildekade bereits ihrem Ende entgegen und es verblieb nur mehr eine Woche bis zur Jagdzeit, die am letzten Samstag des Monats begann. Zweimal stieg ich in diesen Tagen hinauf in die Sanger, doch rasch machte sich Ernüchterung breit. Dass kein Hahn balzte, war schon enttäuschend genug – dass ich jedoch nicht einmal die geringste Menge Losung finden würde, hatte ich gewiss nicht erwartet. Nur einmal strich am Heimweg eine Auerhenne davon, aber einen Hahn gab es hier im heurigen Jahr ganz offensichtlich keinen. Und wenn man sich am Balzplatz umschaute, war das eigentlich auch wenig verwunderlich: Im vergangenen Herbst hatte ein schwerer Sturm unzählige Bergbäume niedergerissen. Die beliebtesten Balzbäume standen daher unmittelbar am Rande einer Fläche, die derart aufgelichtet war, dass man sie kaum noch als Wald bezeichnen konnte. Und daran schloss sich ein hektargroßes Gebiet an, wo in vergangenen Jahren oft besonders viel Losung gelegen war und in dem nun kein einziger Baum mehr stand. Vermutlich hatten die Hahnen der Sanger die Talseite gewechselt und balzten nun am besten unserer Balzplätze – was auch erklären mochte, weshalb dort noch mehr Hahnen zu zählen waren als üblich.
So fasste ich den Entschluss, auf den Weißen von Lotron zu waidwerken. Und dazu wollte ich schon am Mittwochabend die Jagdhütte beziehen, um die Hahnen am Donnerstag und Freitag noch zweimal zu verlosen und so für die Jagdzeit bestmöglich gerüstet zu sein.
Spät am Mittwoch fahre ich dann einen Forstweg hinauf, der im Winter von den Grundbesitzern wieder und wieder vom Schnee befreit wurde, um Sturmschäden aufarbeiten zu können, und der daher nun bereits aper ist. Auf diesem Weg erreiche ich annähernd die Höhe der Jagdhütte, sodass mir nur mehr ein hangparalleler Fußmarsch über nasse Wiesen bleibt, für den ich mit schwerem Rucksack rund zwanzig Minuten benötige. Als ich die behagliche Hütte erreiche, nehmen die Farben des Tages schon jene weichen Töne an, die der einsetzenden Dämmerung so eigen sind. Die Temperaturen sind nicht unangenehm, liegen im einstelligen Bereich und sanft tröpfelt leichter Regen hernieder. Nach einer Weile hat ein knackendes und prasselndes Kaminfeuer die ausgekühlte Hütte so aufgewärmt, dass ich das Fenster einen schmalen Spalt öffnen kann.
Die unmittelbare Umgebung der Hütte ist bereits aper, doch einen Schrotschuss höher – dort, wo eine schmale Wiese den Bergwald teilt – ist ein Schneefeld verblieben. Das ist wichtig, denn die Wasserleitung ist noch eingefroren und die nächste Quelle eine Viertelstunde entfernt, sodass diese Schneefläche die Wasserbeschaffung wesentlich erleichtert.
In der Nacht tue ich kein Auge zu. Eigentlich bilde ich mir ein, dass die erwartungsvolle Anspannung nicht größer ist als an anderen Jagdtagen. Dennoch liege ich wach und bin froh, als es endlich spät genug ist, um den Weg hinauf in den Lärchenwald von Lotron unter die Bergschuhsohlen zu nehmen.
An diesem Morgen glimmen die Sterne von einem nahezu wolkenlosen Nachthimmel, der vom halben Mond erhellt wird und so in tiefem Blauschwarz erscheint. Ich komme gut voran, denn bis hinauf zur Waldgrenze liegt nur wenig Schnee und meist sind Nadelstreuboden und Bergwiesen gar gänzlich aper. Droben am Almrücken hat sich hingegen noch eine geschlossene Schneedecke gehalten, doch obwohl sie durchnässt und sulzig ist, sinke ich meist nur bergschuhtief ein, sodass ich auf die Schneeschuhe, die ich auf den Rucksack gebunden habe, verzichten kann. So ist kaum mehr als eine Stunde vergangen, bis ich oberhalb des Balzplatzes angekommen bin, meine verschwitzte Kleidung gegen trockene tausche und im seidigen Silberlicht des Mondes zu meinem Horchbühel hinabpirsche.
Mein Sitzplatz ist bereits aper, doch im lichten Hochwald liegt an den meisten Stellen noch mehr oder weniger viel Schnee. Einsame Stille umfängt die wilden Gebirgsweiten und nur vom tiefen Talgrund herauf tönt fern das Rauschen der schäumenden Schmelzwasser, die sich ihren Weg durch ein felswandiges Bachbett bahnen. Von Zeit zu Zeit bilde ich mir ein, das leise Knappen eines Hahns zu vernehmen – doch wenn ich genauer lausche, ist da nichts, und so muss ich mich getäuscht haben.
Bald schon drei Viertelstunden sind verstrichen, da ist mir, als wäre tief unten – und etwas links – das Schleifen eines der Urhahnen erklungen. Angestrengt horche ich in die Finsternis. Wahrhaftig, nun gibt es keinen Zweifel mehr! Weit unten – fast schon außer Hörweite – balzt ein Hahn. Doch über die genaue Richtung werde ich mir nicht im Klaren, denn mal tönt der geheimnisvolle Gesang von leicht rechts und dann wieder von etwas weiter links – und schließlich scheint es so, als balze der Hahn genau in der Falllinie unter mir. Trügt meine Wahrnehmung oder verträgt der Wind die leisen Töne?
Vorerst bleibe ich sitzen. Es ist noch früh und ich will gewiss nicht ausschließen, dass – so wie neulich – in meiner Nähe ein Hahn stumm auf einem starken Ast steht und erst später sein Lied anstimmt, wenn schon ahnendes Graulicht auf den Bergwaldboden fällt. Doch als nach einigen weiteren Minuten immer noch kein nahes Knappen zu vernehmen ist, stehe ich vorsichtig auf, schultere den Rucksack und pirsche dem Balzenden entgegen. Besonders leise geht das nicht vonstatten, denn selbst dort, wo ich meinen Weg im Aperen wählen kann, knacken oft Almrauschzweige unter den harten Bergschuhsohlen.
Endlich bin ich dem Hahn so nahegekommen, dass ich seine Strophen laut genug vernehme, um den Urvogel anspringen zu können. Und nun wird mir auch klar, warum es mir zuvor derart schwergefallen ist, die genaue Richtung des fernen Gesangs zu erlauschen. Es ist nämlich nicht nur ein Hahn, sondern es sind zwei. Der eine – jener, den ich bislang deutlicher vernommen habe – balzt ziemlich genau in der Falllinie unterhalb meines Horchbühels. Der andere hingegen singt ein hübsches Stück weiter rechts.
Aufgrund meiner Erfahrungen vom letzten Jahr vermute ich, dass es sich bei dem linken Hahn um den Weißen handelt – und deshalb will ich weiterhin diesen anspringen. Damit die Schneeklumpen, die ich bei manchem Schritt lostrete, nicht unter seinem Balzbaum hindurchrollen, springe ich ihm jedoch nicht direkt entgegen, sondern halte mich etwas rechts. Dadurch komme ich dem zweiten Hahn näher, als ich eigentlich beabsichtigt habe. Und weil es sich freilich nur selten ergibt, dass beide zugleich schleifen, konzentriere ich mich auf die Strophen des vermuteten Weißen, sodass der zweite Hahn oft knappt oder gar stumm ist, wenn unter meinen Sohlen ein Ästchen knackt oder der Schnee knirscht. Obwohl jener Hahn kaum mehr als zwei Schrotschussweiten von mir entfernt sein dürfte, ist er so in seine hitzige Balz versunken, dass er den verräterischen Geräuschen kaum irgendwelche Beachtung schenkt. Und manchmal komme ich auf staudenlosem, aperem Boden ohnehin nahezu geräuschlos voran.
Bald gelange ich an den Rand einer verschwiegenen Blöße, auf der mehrere Quellbächlein aus dem noch tief verschneiten Hang sprudeln. Irgendwo vom oberen oder jenseitigen Rand dieser urigen Freifläche tönt das Balzlied des zweiten Hahns. Mit dem Glas suche ich das nadellose Geäst der Lärchen ab, vermag den Balzenden jedoch nicht zu erschauen und wende meine Aufmerksamkeit wieder jenem Hahn zu, in dem ich den Weißen vermute.
Im Hahnenwald
Schließlich bin ich so weit gekommen, dass ich eine recht genaue Vorstellung davon habe, wo er balzt – nämlich fast genau dort, wo ich im vergangenen Mai gemeinsam mit meinem Jagdfreund dem Lied des Weißen gelauscht habe. Den Hahn von rechts her anzuspringen, wäre ungünstig, da ich durch einige dicht und tief beastete Fichten erst sehr spät freien Blick hinauf in die hohen Lärchen, in denen der Balzende vermutlich steht, erhalten würde. Von oben wäre das Anspringen zwar nicht unmöglich – doch dort hat der Sturm des Vorjahres eine starkstämmige Fichte entwurzelt und hangparallel zu Boden geworden. Will ich den Hahn also aus einer aussichtsreichen Richtung anspringen, muss ich den verschneiten Hang über der Fichte queren und mich dem Balzenden schließlich von links nähern.
So gehe ich die Sache auch an. Den Weg bis zum Wipfel der sturmgefällten Fichte habe ich fast geschafft, als über mir in den Baumkronen eine Auerhenne laut gockend davonstreicht. Der Hahn jedoch balzt gottlob weiter. Am Wipfel angekommen, liegt eine bergstockhohe Steilpartie unter mir, auf der die Sulzschneedecke nur mehr dünn ist. Ich bin mir im Klaren darüber, dass dieser durchnässte Schnee auf dem niedergedrückten Altgras nur wenig Halt bietet. Weil ich aber diese Steilpartie nicht auch noch umgehen möchte, will ich das Risiko eingehen. Beim nächsten Schleifen springe ich in den kaum bergschuhhohen Nassschnee, der Schnee gleitet am steilen Grashang ab, zieht mir die Füße weg und ich rutsche – mithilfe des Bergstockes leidlich das Gleichgewicht haltend – ein, zwei Männerschrittweiten den Hang hinab. Wenige Herzschläge später verrät polternder Schwingenschlag das Abreiten des Hahns.
Eine Weile bleibe ich stehen und horche in den lichten Gebirgswald, in den sich schon zart ein Hauch von Farbe webt. Doch alles Hoffen, dass der Hahn vielleicht nur überstellt hat und in größerer Entfernung wieder zu knappen beginnt, bleibt vergebens. Mein harmloser Ausrutscher muss länger zu hören gewesen sein, als das Schleifen des Hahns andauerte, und ich habe ihn vergrämt.
Enttäuschung über diesen verpatzten Hahnenmorgen macht sich breit und ich entscheide, weiterzugehen, um zumindest den anderen Hahn noch anzuspringen. Erst ein paar wenige Schritte weit bin ich gekommen, da dringen in perlendem Fluss urplötzlich wieder die Balzstrophen des vermeintlich Vergrämten an mein Ohr. Weit ist er von seinem Balzbaum nicht entfernt und fast hat es den Anschein, dass sein leises Lied nicht mehr aus den hohen Wipfeln tönt, sondern vom Bergwaldboden – mag schon sein, dass er gar nicht meinetwegen abgeritten, sondern der gockenden Henne wegen zu Boden getreten ist. Und da bestätigt der charakteristische Schwingenschlag eines Flattersprungs meine Vermutung auch schon.
Bei jedem Schleifen springe ich dem hitzig Balzenden nun einige Schritte näher, hangparallel unter der niedergebrochenen Fichte entlang. Bald zwänge ich mich zwischen einigen nah beisammenstehenden Stämmen hindurch, trete hinter einer tief beasteten Fichte hervor und erhalte von Norden her freien Blick auf einen zimmergroßen, nahezu ebenen Boden, der gen Osten und Süden von dichtem Fichtenwuchs begrenzt wird und deshalb noch arg im Finstern liegt. Am jenseitigen Rand dieses Bodens – dort, wo er wieder in steileren Wald übergeht, sodass schwarz scheinendes Genadel den Hintergrund bildet – erahne ich dennoch einen dunklen Klumpen. Beim nächsten Schleifen hebe ich das Fernglas an die Augen und habe den Balzenden, von dem mich vielleicht zehn Bergstocklängen trennen, groß und klar in den Linsen. Er ist ein im Wildbret starker Hahn, dessen Stoß mir allerdings kürzer erscheint als jener des Weißen. Die weiße Sprenkelung der Schaufelfedern ist hingegen deutlich ausgeprägt – und doch habe ich sie vom Weißen noch intensiver in Erinnerung. Oder täuscht nur das karge Licht? Auch den weißen Wangenfleck vermag ich nicht zu erkennen – aber auch dafür mag es einfach noch zu finster sein.
Der Hahn spaziert auf seinem Balzboden mit gefächertem Rad und in die Höhe gerecktem Brocker hin und her. Knappen, Triller, Hauptschlag und Schleifen perlen immer fort und wieder und wieder vollführt er Flattersprünge. Gebannt verfolge ich dieses Naturschauspiel, dem man bei den wenigsten Hahnengängen derart nahe kommt.
Und dann dringt von wenig oberhalb des Bodens das Lied eines zweiten Hahns an mein Ohr. Jener, der zuvor am Rande der Quellblöße gebalzt hat, muss also zugestrichen sein. Allerdings versperrt mir das Geäst der sturmgefällten Fichte den freien Blick dort hinauf, sodass ich den Hinzugekommenen nur schemenhaft am Schnee umherschreiten sehe.
Schließlich trippelt der vor mir Balzende hinab in den dichten Fichtenwuchs und entfernt sich knappend. Als der Hahn über mir nun wieder schleift, springe ich rasch ein paar Schritte vor. Dann habe ich den Wurzelteller der Fichte erreicht und spähe den Hang hinauf. Der Anblick, der sich mir bietet, lässt mein Jägerherz schneller schlagen, denn dieser Hahn muss der Weiße sein. Die dichte Sprenkelung seines Stoßes sticht mir auf den ersten Blick ins Auge – und nun in voller Bodenbalz wirkt der Hahn gar noch stärker und begehrenswerter, als ich ihn in Erinnerung gehabt habe. Einen Atemzug später wendet er sich ab, läuft balzend von mir fort und schon verschwindet sein Rad schwankend über jenen undeutlichen Geländerücken, der die Quellblöße seitlich begrenzt.
Rasch setze ich mich nieder, krame die Kamera aus dem Rucksack und erwarte die Rückkehr des Hahns. Doch nichts dergleichen geschieht und auch kein leises Knappen dringt mehr an mein Ohr. Schließlich stehe ich auf und pirsche vorsichtig dem Geländerücken entgegen, denn vielleicht vernehme ich den Balzgesang des Hahns nur der Überriegelung wegen nicht – außerdem lässt mir die Frage, ob dies wirklich der Weiße gewesen ist, keine Ruhe. Nach ein paar Schritten höre ich tiefer im Bergwald jenen Hahn davonpoltern, der zuvor vor mir am Schneeboden gebalzt hat. Als ich endlich den Geländerücken erreiche, dringt leise auch wieder das Balzlied des vermutlichen Weißen an mein Ohr. Irgendwo in der Nähe seines Balzbaumes – wenig oberhalb der Quellblöße – muss er sich aufhalten, doch obwohl es mittlerweile heller Tag ist, vermag ich vorerst keine Feder zu erschauen. Bald jedoch gewahre ich hundert Schritt entfernt eine schwache Bewegung hinter raurindigen Lärchenstämmen – es ist der Hahn, der mit gefächertem Stoß knappend hin und her trippelt. Durch die Zweigübergitterung lässt er sich aber auch jetzt nicht als der Weiße ansprechen.
Da huscht einen Steinwurf vor dem Hahn plötzlich – vom Astwerk meist verdeckt – ein schlanker Schatten hangabwärts. Der Baummarder hat es jedoch nicht auf den Balzenden abgesehen, der von der Anwesenheit der nahen Gefahr kaum irgendwelche Notiz nimmt. Stattdessen quert der flinke Räuber eilig die Quellblöße und entschwindet hinab in den raumen Gebirgswald.
Jetzt läuft der Hahn in seiner Balz in eine Gezweiglücke hinein – und da endlich erschaue ich den weißen Fleck an der Kopfseite und finde Bestätigung für meine Vermutung, dass dieser Hahn wahrhaftig der Weiße ist. Dann trippelt er heraus auf den nadelübersäten Frühjahrsschnee der Quellblöße, seine Balz steigert sich wieder in volle Ekstase und ganze Gsetzl perlen durch den morgendlichen Bergwald. Das erste Schleifen nutze ich, um ein paar lange Schritte weiterzuspringen, das zweite, um mich nach einem weiteren Sprungschritt auf einem aperen Fleck zu Boden fallen zu lassen. Und weil ich mich dabei vielleicht einen Wimpernschlag länger bewegt habe, als das Schleifen angedauert hat, unterbricht der Hahn seine Balz. Starr steht er am Schneeboden und äugt misstrauisch um sich. Schließlich aber beruhigt er sich, spielt sich wieder ein und beim nächsten und übernächsten Schleifen lege ich den Rucksack ab.
Ganz verflogen ist das Misstrauen des Hahns aber doch nicht, denn nun folgen keine Gsetzl mehr. Zögerlich knappt er vor sich hin, während ich mit der Geschwindigkeit eines Stundenzeigers die Kamera und das Spektiv einrichte, um einige Fotos dieses herrlichen Wildtieres zu schießen und es durch die hochvergrößernden Linsen wie zum Greifen nah zu sehen. Und dabei überkommen mich Zweifel, ob es überhaupt richtig wäre, den Hahn zu erlegen. Könnte seine Erbeutung in meinem Herzen so viel schwerer wiegen als ein traumhafter Balzmorgen wie der heutige, dass es gerechtfertigt wäre, das Leben dieses majestätischen Urvogels auszulöschen? Doch die sentimentalen Gedanken wische ich rasch beiseite, denn mein inniger Wunsch, zumindest einmal im Leben auf dieses verzaubernde Wild zu waidwerken, ist ungebrochen – und wenn sich dabei die Möglichkeit bietet, nicht einfach irgendeinen Hahn zu erjagen, sondern einen ganz bestimmten, dem ich nicht zum ersten Mal begegne und mithin ein reiches Maß an Erleben mit ihm verbinde, so ist mir das mehr als recht.
Dann lenkt das Geräusch knirschenden Schnees meine Aufmerksamkeit bergwärts. Als ich meinen Blick dorthin wende, steht im lichten Wald weniger als schrotschussentfernt ein junger Rehbock mit außergewöhnlich weit gestellten Stangen und beäugt mich neugierig. Nun setzt er sich wieder in Bewegung, zieht im Halbkreis um mich herum und zwischen dem Hahn und mir talwärts. Für eine kurze Weile verstummt der Hahn, doch schon bald fällt ein erstes misstrauisches Knappen und schließlich knappt der Weiße wieder flüssig vor sich hin. Etwas später ist jenseits der Quellblöße der schwere Schwingenschlag eines einfallenden Hahns zu vernehmen. Der Weiße reagiert augenblicklich, läuft in voller Balz in jene Richtung und verschwindet zwischen den rauschuppigen Lärchenstämmen. Das nutze ich, um mich unbemerkt zurückzuziehen und in der Deckung eines undeutlichen Geländerückens wieder zum Forstweg hinaufzusteigen.
Kaum bin ich dort angekommen, dringt das heisere Kröchen eines Hahns an mein Ohr, und ich weiß, dass die beiden Rivalen drunten im Hochwald aneinandergeraten sein müssen. Als ich dann entlang des Forstweges der Hochalm entgegenstapfe, vernehme ich die röchelnden Laute erneut – und kurz darauf entdecke ich zwischen Ästen und Stämmen mehr als hundert Meter unterm Weg auch die beiden Kontrahenten, die sich gegenüberstehen und einander drohen. Vorerst vermag ich nicht zu erkennen, welcher von beiden der Weiße ist. Bald zieht sich der linke Hahn zurück, trippelt mit langem Stingl einige Bergstocklängen davon und verharrt schließlich hinter einer Bodenwelle so, dass lediglich Kopf und Stingl noch zu sehen sind. Der Sieger der Auseinandersetzung hingegen verharrt noch eine ganze Weile in Drohhaltung, bevor auch er sich abwendet. Und dann endlich erkenne ich an der Kopfseite des unterlegenen Hahns auch den weißen Fleck.
Dass der Weiße trotz seiner Stärke und seines gewiss nicht jungen Alters hier nicht der Platzhahn ist, hätte ich kaum erwartet. Unrecht ist mir diese Erkenntnis jedoch ganz und gar nicht, denn die Erlegung des Platzhahns wäre mit dem faden Beigeschmack verbunden, den Hennen jenen Hahn zu nehmen, von dem sie sich bevorzugt treten lassen.
Mein Rückweg zur Jagdhütte führt mich – wie schon vor ein paar Wochen – entlang der scharfen Geländekante, unter der das Gefels mitunter schier senkrecht abfällt und sich extrem steile Schottergräben in den urigen Bergwald furchen. Zwischen den Wipfeln der licht stehenden Bergbäume streicht ein Spielhahn davon und von fern tönt das kampfeslustige Fauchen eines der Sichelritter.
Untertags hole ich den Schlaf nach, den ich in der Nacht nicht zu finden imstande gewesen bin. In den Abendstunden jedoch breche ich wieder auf und unternehme einen Pirschgang durch den raumen Gebirgswald oberhalb der Hütte. In manchem Jahr balzt auch hier ein Hahn und ich hoffe nun, anhand von Losung wertvolle Anhaltspunkte zu erhalten und beim Abendeinfall vielleicht gar den schweren Schwingenschlag eines der mächtigen Urvögel zu vernehmen. Die Temperaturen sind mild und sanft tröpfelt leichter Regen hernieder. Der bissige Wind hingegen ist unangenehm und rauscht in den Wipfeln der hohen Bergbäume. Hinweise auf Auerwild finde ich zunächst allerdings kaum und auch sonst tut sich wenig.