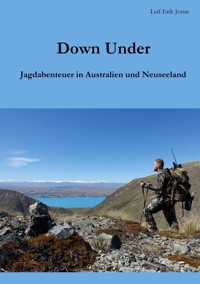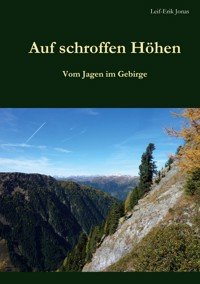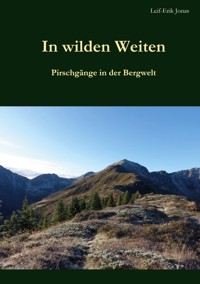
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seinem dritten Buch knüpft Leif-Erik Jonas an sein Erstlingswerk "Auf schroffen Höhen" an und nimmt seine Leser wieder mit auf eine Pirsch durchs Jagdjahr in einem Tiroler Gebirgsrevier. Der detailreiche Erzählstil des Autors lässt den Reiz ursprünglichen Waidwerks in den wilden Weiten der Alpen mit jeder Zeile spürbar werden. Von der Hahnenbalz im Erwachen des Bergfrühlings spannt sich der Erzählbogen über rote Rehböcke in der Sommeridylle, die Faszination der Hirschbrunft und mühsame Gamspirschgänge bis hin zum winterlichen Fuchspassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Knappen im Bergwald – ein neues Jagdjahr beginnt
Ein hart erkämpfter Spielhahn
Das Schaf von der Mosescharte
Der Abnorme von der Bergwiese
Der Bock vom Felswald
Der Einstangler vom Bergmahd
Ein hart erwaidwerkter Knöpfler
Schwarzwild im weiten Gebirge
Die Pechkruckige aus der Rippn
Das Murmel aus dem Steilgraben
Der Murmelbär vom Kargrat
Hirschbrunft am Falglahner
Die Einkruckige vom Gamskofel
Schlitzohr
Ein zäh erjagtes Gamsl
Ein Schneehahn aus frühwinterlicher Bergwildnis
Ein Gebirgshirsch in Eis und Schnee
Füchse unterm Febermond
Kontakt
Vorwort
Der Erfolg meiner beiden Bücher „Auf schroffen Höhen“ sowie „Im Reich der Tahre“ hat meine eigenen Erwartungen bei weitem übertroffen und erfüllt mich mit Freude. Ohne Euer Interesse an meinen Jagderzählungen wäre dieser Erfolg jedoch niemals möglich gewesen. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und einem jeden meiner geschätzten Leser meinen ehrlichen Dank aussprechen.
Mit diesem dritten Werk werde ich an „Auf schroffen Höhen“ anknüpfen und den Leser wieder in die wilden Weiten der Tiroler Alpen entführen – vom Zauber der Hahnenbalz im Frühjahr, über die Idylle das jagdlichen Bergsommers und die Faszination der Hirschbrunft bis hin zum Reiz des Fuchspassens im tiefsten Bergwinter.
So wünsche ich ein paar frohe Stunden beim Lesen und hoffe, dass Ihr Gefallen daran finden werdet, Euch ein wenig in meine Erlebnisse und Erfahrungen hineinzudenken.
Leif-Erik Jonas
Knappen im Bergwald – ein neues Jagdjahr beginnt
Der März ist vorüber, ein erlebnisreiches Jagdjahr nur mehr Vergangenheit und Erinnerung. Ein milder und schneearmer Winter wurde drunten im Tal schon vom Frühling abgelöst – und auch droben am Berg liegt die raue, kalte, entbehrungsreiche Jahreszeit in ihren letzten Zügen. Es ist Mitte April und eine Zeit hat begonnen, die ich jedes Jahr mit Spannung und Vorfreude erwarte – die Zeit der Hahnenbalz! Heute ist mein zweiter Hahnengang im heurigen Jahr. Droben im einsamen, Jahrhunderte alten Fichten-Lärchen-Wald der Schattseite will ich dem urtümlichen Lied des Großen Hahns lauschen. Ganz ohne Waffe und jagdliche Absichten will ich einen wunderbaren Vorfrühlingsmorgen in der stillen Abgeschiedenheit der weiten Bergwelt verbringen.
Doch bevor ich davon erzähle, muss ich von einem wenige Tage zurückliegenden Hahnenmorgen – dem ersten des noch jungen Jagdjahres also – schreiben. An jenem Tag wollte ich der Spielhahnen wegen auf einen sonnseitigen Almrücken hinaufsteigen. Der dortige Balzplatz ist zwar kein schlechter, aber halt auch keiner der ganz guten. Und dennoch hatte es seinen Grund, dass ich mir gerade diesen Balzplatz ausgesucht hatte: Er ist so früh im Jahr jener, der am leichtesten zu erreichen ist. Seit dem vorhergegangenen Abend fühlte ich mich nämlich nicht besonders gut, ein unterschwelliges Unwohlsein halt. Den vergleichsweise einfachen Weg – im Sommer so anderthalb Stunden in flachem bis mäßig steilem Gelände, im Winter je nach Schneelage freilich etwas mehr – zu diesem Platz traute ich mir aber auch trotz meiner Angeschlagenheit ohne Zögern zu. Zudem war der Hochwald der Sonnseite schon weitgehend aper und der verbliebene Schnee war in den letzten Tagen sogar am Nachmittag noch tragfähig gewesen. Es würde also ein recht kommodes Steigen sein, fast wie im Sommer – glaubte ich! Um alles in Ruhe angehen zu können, plante ich für den Aufstieg dennoch zweieinhalb Stunden ein.
Nach einer schlaflosen Nacht – Unwohlsein und Vorfreude hatten mich wach gehalten – fuhr ich dann eine schmale, asphaltierte Bergstraße zu einem hoch gelegenen Weiler hinauf und von dort weiter auf einem Forstweg. Weit kam ich auf Letzterem jedoch erwartungsgemäß nicht, denn nach der ersten Kehre konnten auch Untersetzung und gesperrtes Mitteldifferenzial nichts mehr gegen den harten, eisigen Schnee ausrichten.
Die Birkhenne, die mir förmlich in die Hände fiel
Also ließ ich mein Fahrzeug stehen und setzte meinen Weg zu Fuß fort. Die sich in engen Kehren den Berg hinaufwindende Forststraße war zwar noch fast vollständig schneebedeckt, der Schnee aber trug – und wo immer möglich kürzte ich ohnehin durch den Hochwald ab. Das Steigen fiel leichter als erhofft und nur drei Viertelstunden waren vergangen, bis mich noch kaum mehr als ein weiter Büchsenschuss von der Waldgrenze trennte. Hier wurde der Wald lichter, es lag mehr Schnee – und dieser Schnee war sulzig weich und trug nicht. Meist sank man bis zu den Waden oder Knien ein. Langsam begann ich mich zu ärgern, meine Schneeschuhe im Auto gelassen zu haben. Aber auch wenn das Steigen jetzt anstrengender wurde, kam ich trotz meiner Angeschlagenheit noch recht gut voran – zumal ich nicht einfach geradewegs bergwärts stapfte, sondern meine Route nach Möglichkeit so wählte, dass ich von einem aperen Fleckchen zum nächsten ging.
Der Wald lichtete sich immer weiter, wies immer mehr und größere Bestandslücken auf. Da vernahm ich aus einer nahen Lärche heftiges Geflatter und sah im Stirnlampenlicht ein Stück Birkwild in die vom Halbmond schwach erhellte Nacht hinausgleiten, gefolgt von einem zweiten. Ich mühte mich wieder einige Schritte den wadentief schneebedeckten Hang hinauf – und wieder Geflatter! Von einem zwei, höchstens drei Armlängen entfernten, tiefhängenden Ast stießen sich mit kräftigem Schwingenschlag zwei Birkhennen ab und aus der danebenstehenden Lärche eine weitere. Während die zwei ohne Probleme in die Nacht entschwanden, hatte die einzelne zweifellos Schwierigkeiten – ob ihr die Finsternis zu schaffen machte oder ob mein Lampenlicht sie blendete oder ob es beides gewesen ist, kann ich nicht sagen.
Was sich dann zutrug, war so unglaublich, dass ich es niemandem übel nehmen kann, wenn er es meiner blühenden Fantasie zuschreibt und schlicht als pures Jägerlatein abtut – aber es hat sich doch genau so zugetragen. Vielleicht drei Bergstocklängen über mir flog die Henne gegen einen starken Lärchenast, kam dadurch ins Trudeln, fiel etwas tiefer in feineres Gezweig, konnte dort ihre Schwingen nicht mehr richtig einsetzen und stürzte richtiggehend ab – genau auf mich herunter. Dass ich sie auffing, war kein großes Kunststück, sondern eher ein Reflex. Die Henne wirkte geradezu paralysiert, lag in meiner Hand und rührte sich kaum. Schnell kramte ich meine Kamera aus der Hosentasche, schoss ein Foto – und der Blitz brachte den herrlich braun gesprenkelten Vogel offenbar wieder zu sich. Er schlug mit seinen Schwingen, flatterte zu Boden, saß ein, zwei Mannsschritte unter meinem Standort, drehte sich dann herum, flog bodennah wenige Meter bergwärts, blieb etwas oberhalb von mir sitzen – und griff mich von dort an, schlug mit seinen harten Schwingenbugen nach mir, lies aber bald ab, flatterte unter eine nahe Jungfichte, saß dort eine Weile, beruhigte sich wohl und burrte schließlich ganz normal davon.
Ich stieg weiter und hatte wenig später die Waldgrenze erreicht. Was mich jetzt erwartete, war nichts als eine elendige Tortur. Hier auf dem flachen Almrücken lag nämlich weit mehr Schnee als im Hochwald, im Durchschnitt vielleicht etwas weniger als ein Meter. Und dieser Schnee war von solch ungünstiger Beschaffenheit, wie man es selbst im Frühjahr nur höchst selten erlebt. Das war kein normaler Bruchharsch, auch kein frühjahrstypischer Sulz. Das war so etwas wie eine Mischung aus beidem – eine heimtückische Mischung, die Fuß und Bein bei jedem Stapfschritt regelrecht einbetonierte. Unter einem knapp handbreit dicken Harschdeckel lag grobkörniger, nasser, halb gefrorener Altschnee. Der Harschdeckel war eisig und bröckelig zugleich. Bei fast jedem Schritt brach man durch ihn hindurch und steckte oft bis zu den Knien – manchmal gar bis zu den Hüften – im Schnee. Der Harsch war gerade noch so instabil, dass er nicht trug. Aber er war doch so fest und dick, dass man oft nur mit größter Mühe den Fuß wieder aus dem Schneeloch heben konnte – vor allem dann, wenn man bis übers Knie eingebrochen war.
Der darunterliegende Altschnee hatte durch seinen halb gefrorenen Zustand ähnlich unvorteilhafte Eigenschaften: Man sank tief ein und der Schnee saugte den Fuß richtiggehend fest. Mit den unmöglichsten Verrenkungen kämpfte man sich aus einem solchen Schneeloch heraus – oft gelang das erst beim zweiten oder dritten Versuch, weil man bei seinen Bemühungen nur noch weiter einbrach –, stemmte sich dann wieder auf den Harschdeckel hinauf, tat den nächsten Schritt, verlagerte sein Gewicht also zwangsläufig kurz auf nur einen Fuß und versank dadurch erneut. Es war also nicht so, dass der Harsch schon bei der ersten Belastung brach, sondern wirklich erst, wenn das gesamte Körpergewicht auf einer kleinen Fläche lastete. Und das alles zusammen war ungemein kräfteraubend!
Wieder burrte ein Birkhuhn neben mir unter dem dichten Gezweig einer einzelnen Lärche hervor und entschwand in die Nacht. Von meinem Ziel – einem alten, halb verfallenen Heustadl – trennte mich jetzt noch die Entfernung eines weiten Büchsenschusses. Und allein für dieses kurze Stück sollte ich beinahe eine volle Stunde benötigen. Denn war das erste Stück über die Alm noch sehr flach – oft fast eben – gewesen, musste ich nun einen reichlich hundert Meter langen, steileren Abschnitt hinter mich bringen, dann noch zwei kleine, flache Böden und zwei kürzere Steilpartien. Steil ist hier nicht unbedingt wörtlich zu nehmen – unter weniger extremen Schneeverhältnissen wäre es nicht der Rede wert, aber heute brachte einen selbst eine Hangneigung von zwanzig, dreißig Grad an die Grenzen des Machbaren. Wie soll man, wenn man bis fast zu den Hüften im hartgefrorenen Schnee feststeckt, auch noch einen Schritt bergwärts machen? An den schlimmsten Stellen gab es nur eine Lösung: Auf allen Vieren kroch und krabbelte ich den Hang hinauf! Dabei nahm ich den Bergstock in beide Hände, legte ihn flach auf den Schnee, sodass sich mein Gewicht ähnlich wie bei einem Ski besser verteilen konnte und ich kaum einbrach.
Immer wenn es wieder einmal ganz zäh herging, überlegte ich, ob ich nicht einfach umkehren und mir diesen Wahnsinn nicht länger antun sollte. Aber ich entschied mich dagegen. Ich hatte mich jetzt schon so weit den Berg hinaufgemüht – das sollte nicht alles umsonst gewesen sein! Zudem war ich meinem Ziel ja auch bereits sehr nah.
Also kämpfte ich mich weiter. Jeder Stapfschritt wurde zur Schinderei, zur Quälerei. Ich spürte, dass das Ende meiner Kräfte nicht mehr gar fern war. Außerdem sollte ich meinen Ansitzplatz mittlerweile längst erreicht haben – falls die Hahnen früh einfallen würden, wäre mein ganzes Mühen vergebens gewesen.
Doch dann – nach fast drei Gehstunden – zwängte ich mich endlich durch die niedrige Türöffnung des morschholzigen Stadls, wechselte mein verschwitztes Hemd und setzte mich erschöpft auf einen kaum kniehohen Steinhaufen, den ich hier schon im Vorjahr aufgeschichtet hatte.
Ohne das schwache Licht des Halbmondes hätte die Alm jetzt noch in tiefer Finsternis gelegen, denn noch war vom Ostlicht kein Hauch zu erahnen. So aber konnte ich doch schon deutliche Konturen erkennen. Halb links und vor mir zogen flache bis mäßig steile, noch vollständig schneebedeckte, mit einzelnen schmächtigen Lärchen, wenigen christbaumgroßen Fichten und einigen niedrigen Latschenstauden bestockten Hänge hinauf zum büchsenschussentfernten Gratrücken. Diese Hänge waren von unzähligen flachen Mulden und undeutlichen Kanten durchzogen, sodass viele Flächen überriegelt waren. Jenseits des Grats standen die abweisenden Felswände des höchsten Berges unseres Reviers gegen den sternfunkelnden Nachthimmel. Zu meiner Rechten breitete sich die weite Alm aus und hinter mir reichte steiler, lichter Lärchenwald bis fast zu meinem Ansitzplatz herauf.
Im vergangenen Jahr hatte sich die beste Balz dieses Almrückens ein, zwei Schrotschüsse links oberhalb des Stadls abgespielt. Das war eine neue Entwicklung gewesen, denn in den Vorjahren hatten die Hahnen überwiegend oben entlang des Grats gebalzt. Und nun war ich gespannt, ob sie heuer wieder zu ihrer Gewohnheit zurückgekehrt waren oder ob sich dieser neue Balzplatz etablieren würde.
Stille – große, weite, unendlich scheinende Stille umgab mich vorerst. Hier auf den flachen, rundlichen Bergrücken gelangt vom Talgrund kein Laut herauf – weder das Rauschen des im tief eingekerbten Tal dahinsprudelnden Gebirgsbachs noch gar irgendwelcher Lärm der fernen Zivilisation. Nach einer Weile – es dämmerte schon etwas – das erste, schläfrige Aufzwitschern einer Ringdrossel, dann wieder Stille. Plötzlich vernahm ich sausenden Schwingenschlag – und hernach wieder Stille, kein Faucher, kein Grugeln, nichts. War es eine Henne gewesen? Doch dann, ein scharfes Zischen, gefolgt von einer längeren Pause, dann wieder ein Zischen, wieder und wieder. Ich hob das Glas an die Augen, konnte den Balzenden aber zunächst nicht erschauen. Er musste sich in einer nicht einsehbaren Mulde – kaum hundert Meter links vor mir – aufhalten.
Doch schon bald darauf entdeckte ich im ahnenden Morgendämmer mit freiem Auge einen schwarzen Fleck am Rand der Mulde – der Hahn! Immer wieder blasend und flatternd lief er zielstrebig zum Balzplatz des vergangenen Jahres, fauchte dort noch einige Male, senkte dann seinen blauschimmernden Stingl, plusterte ihn auf, begann zu grugeln und drehte sich dabei in alle Richtungen.
Sicher ein Viertelstündlein balzte er dort selbstvergessen vor sich hin. Als dann aber weder Henne noch Rivale ihm Gesellschaft leisten wollten, trippelte er ohne Eile weiter nach rechts, blies und rodelte zwischendurch immer wieder – so würde er bald meinen Blicken über eine undeutliche Geländekante hinweg entschwinden. Ich wollte dieses faszinierende Schauspiel aber noch etwas länger genießen, also zischte ich zum Hahn hinauf. Der hatte das nicht überhört, drehte sich herum, reckte seinen Stingl, stieß sich dann vom Schneeboden ab, tat einen weiten Flattersprung und fauchte zornig. Ich antwortete – und mit einigen wilden Flattersprüngen kehrte der Hahn zum Balzplatz zurück und balzte dort wie verrückt! Da sich sein vermeintlicher Rivale aber nirgends blicken ließ und er sich mit diesem Feigling wohl nicht länger abgeben wollte, lief er dann wieder nach rechts und drohte, erneut zu verschwinden. Wieder reizte ich ihn – und jetzt war es mit seiner Geduld wohl endgültig vorbei. Geradezu erbost kam er mit weiten Flattersprüngen, begleitet von scharfen Fauchern, direkt auf mich zu und begann dann nur einen halben Schrotschuss entfernt, feurig zu grugeln.
Ich hoffte, dass er bis zum vollen Tageslicht bleiben würde, damit ich auf diese geringe Entfernung ein paar gute Fotos von ihm schießen könnte. Aber diesen Gefallen tat er mir dann doch nicht. Wie aus heiterem Himmel unterbrach er nach einer ganzen Weile sein Spiel, stieß sich vom Boden ab und flatterte über meinen Ansitzstadl davon. Bald aber hörte ich wieder sein Grugeln – und als ich mich etwas aus dem Fenster hinauslehnte und in die Wipfel der vom Gebirgswetter gezeichneten Bäume hinaufschielen konnte, entdeckte ich ihn. Weit war er gar nicht davongestrichen, sondern hatte zwanzig Meter zu meiner Linken in einer dünnstämmigen Lärche aufgebaumt. Lange blieb er aber auch dort nicht, denn schon nach wenigen Minuten strich er endgültig in den Bergwald hinunter. Nur hin und wieder drang sein fernes Grugeln jetzt noch an mein Ohr.
Und weil der Balzmorgen offenbar gelaufen war und mir die Kälte langsam in die Glieder kroch, packte ich meine Sachen zusammen und machte mich auf den Rückweg. Die aufgehende Sonne tauchte die zarte Bewölkung des Osthimmels in kitschiges Rosa, dann stieg sie in goldenen Farben über die Gipfel. Ein naher Gamspfiff ließ mich innehalten und einige Herzschläge später sah ich einen schwarzbraunen Wildkörper über eine Bestandslücke wischen. Der Abstieg entlang meiner nächtlichen Stapfspur fiel zwar freilich wesentlich leichter als die Schinderei des Hinaufsteigens – aber kommod war es wirklich nicht, von einem hart gefrorenen Schneeloch ins nächste zu staksen. Ich ließ mir an diesem traumhaften Morgen aber auch Zeit und so dauerte es letztendlich zwei volle Stunden, bis ich wieder zu meinem Vehikel zurückkehrte.
Nun aber zurück zum heutigen Morgen, zum Beginn dieser Erzählung – zum Auerwild! Von den Talwiesen windet sich hier ein Forstweg den Berg hinauf. Etwa dort, wo der Weg endet – im Sommer rund zwei Gehstunden über Talniveau – geht der steile Hang in einen sanft ansteigenden, langgezogenen Waldgrat über. Kaum eine Waldgegend des Reviers ist so unberührt wie dieser lichte Bergwald. Wohl deshalb findet sich dort droben auch unser bester Balzplatz der Urhahnen. Und ebendort will ich heute hinauf!
Hier auf der Schattseite hat es noch weit mehr Schnee als auf der Sonnseite und so ist nur das allerunterste, kurze Stück des Forstwegs schon befahrbar – und selbst das überrascht mich, hatte ich doch eigentlich erwartet, vom Talboden zu Fuß gehen zu müssen. Bald nach der ersten Spitzkehre ist dann aber auch wirklich endgültig Schluss, ich lasse mein Fahrzeug stehen, schultere den Rucksack, auf den ich heute meine Schneeschuhe gebunden habe, und mache mich unter übersterntem Firmament auf den Weg.
Man hat hier in den tieferen Lagen kaum die Möglichkeit, durch den Wald abzukürzen, denn fast flächendeckend sind es Dickungen und Stangenhölzer – und so folge ich dem sich schier endlos dahinziehenden Forstweg. Apere Passagen wechseln mit wadentiefem Sulzschnee und es ist daher ein recht bequemes Steigen. Neben mir höre ich im dichten Fichtenwuchs ein Haselhuhn davonburren.
Bald schon wird der Schnee höher, trägt in der beinahe sommerlich warmen Nacht nicht einmal ansatzweise. Und als ich die ersten Male bis zu den Knien einbreche, lege ich meine Schneeschuhe an. Aber selbst damit sinkt man doch oft zwei, drei Handbreit tief in den nassen Frühjahrssulz ein. Erst als ich die kühleren höheren Bergwaldlagen erreiche, erlauben die Schneeschuhe kommodes Gehen auf einem gerade tragfähigen Harschdeckel.
Nach reichlich zwei Gehstunden bin ich dem Balzplatz schon recht nahe. Ich ziehe die Schneeschuhe aus – mit ihnen wäre man beim Anspringen eines Hahns nicht beweglich genug –, taste mich dann noch vielleicht hundert Meter weiter und setze mich am aperen Boden unter einer mächtigen Fichte auf meinen Rucksack.
Angespannt lausche ich in den finsteren Bergwald hinaus. Hin und wieder rauscht ein sanfter Windstoß durch die Wipfel, lässt manch alten Baum ächzen und knacken. Ansonsten umgibt mich die große Stille der nächtlichen Gebirgswelt. Bald drei Viertelstunden des Wartens und Horchens sind vergangen und meine Umgebung erscheint mir schon einen Hauch heller als zuvor, da lässt mich ein kaum wahrnehmbares Geräusch aufhorchen – ist das ein fernes, zaghaftes Knappen gewesen oder habe ich mich getäuscht? Ich halte den Atem an, um mein Hörvermögen nicht zu beeinträchtigen. Doch so angestrengt ich auch lausche – es bleibt still im einsamen Gebirgswald. Dann aber, nach vielleicht einer Minute, wieder – jetzt deutlicher – dasselbe Geräusch, bald darauf erneut. Nun gibt es keinen Zweifel mehr – irgendwo weit zu meiner Linken singt einer der majestätischen Urhahnen sein Liebeslied.
Er muss ein alter, misstrauischer Hahn sein, denn er will und will sich nicht recht einspielen. Nur sehr zögerlich folgt Knapper auf Knapper, immer wieder unterbrochen von längeren Pausen. Das geht so sicher an die zehn Minuten. Dann der erste Doppelknapper, noch einer – und wieder Stille. Nach einer kurzen Weile aber knappt der Hahn weiter, das Knappen reiht sich, geht in den Triller über, dann der sektkorkenknallartige Hauptschlag – und das erste Schleifen! Jetzt perlt Strophe um Strophe durch den noch tiefdämmerigen Frühjahrswald. Beim dritten oder vierten Gsetzl stehe ich vorsichtig auf und beginne beim nächsten Schleifen, den sicher hundert oder mehr Meter entfernten Hahn anzuspringen. Auf aperen Partien komme ich gut voran, schaffe bei jedem Schleifen zwei, drei Sprungschritte. Dort aber, wo Schnee liegt und unter meinen Bergschuhsohlen knirscht und kracht, nutze ich das Schleifen oft nur für einen einzigen Schritt.
Nach einer kurzen Weile ist der urtümliche Gesang schon weit deutlicher zu hören. Mich verblüfft es immer wieder, wie leise das Balzlied eines solch mächtigen Vogels wirklich ist – denn wenn man es deutlich hört, ist man schon ganz in seiner Nähe. Deshalb gehe ich beim nächsten Schleifen nicht weiter, sondern hebe das Glas an die Augen und suche das kahle Lärchengeäst und das dichte Fichtengezweig ab. Und bald schon erschaue ich auf kaum halber Höhe einer Lärche gegen den sternfunkelnden Himmel einen sich bewegenden, dunklen Klumpen! Noch trennt mich etwa die Entfernung eines Schrotschusses von dem mächtigen Urvogel.
Bei jedem Schleifen springe ich jetzt nur ein, zwei Schritte näher. Und doch verstummt der Hahn plötzlich. Hat er mich wahrgenommen? Minutenlang schweigt er – minutenlang stehe ich wie angewurzelt da. Dann aber die Erlösung – der erste misstrauische Knapper. Weitere folgen und bald schon tönen wieder volle Gsetzl durch den lichten Wald. Ich springe den Hahn weiter an, hin zu einem aperen Fleck unter einer breitastigen Fichte wenig oberhalb der Balzlärche. Durch die Steilheit des Hangs steht der Hahn jetzt schon beinahe auf Augenhöhe und er ist nur mehr reichlich ein Dutzend Armlängen von mir entfernt. Selten nur gibt es das Zusammenspiel von steilem Gelände und geringer Sitzhöhe eines Hahns her, so nah an dieses geheimnisvolle Wild heranzukommen.
Nun stehe ich hier unter dem deckenden Fichtengeäst und habe die Silhouette des starken, in der Dämmerung noch schwarz scheinenden Wildkörpers übergroß in den Linsen meines Fernglases. Mit halb gefächertem Stoß und gesträubtem Kehlbart lässt der Hahn Strophe um Strophe aus seinem hellen Brocker perlen. Es ist etwas Wunderbares, diesem Schauspiel aus solch geringer Entfernung unbemerkt beiwohnen zu können.
Recht bald aber stößt sich der Hahn mitten im Schleifen vom Lärchenast ab und überstellt in eine vielleicht hundert Meter weiter taleinwärts liegende Fichtengruppe. Zu sehen ist er im dichten Nadelgezweig nun nicht mehr. Ein paar verhaltene Knapper noch, dann verschweigt er. Eine Weile warte ich noch zu, doch es tut sich nichts mehr.
Immer wieder ein faszinierender Anblick
Gerade will ich mich schon zurückziehen, da dringen wie aus heiterem Himmel wieder Knappen, Triller, Hauptschlag und Schleifen an mein Ohr. Ein Gsetzl folgt dem nächsten und das gibt mir die Möglichkeit, den Hahn erneut anzuspringen. Mittlerweile ist es schon volles Tageslicht geworden und ich hoffe nun, von dem prachtvollen Vogel ein paar gute Fotos schießen zu können. Bald bin ich wieder auf Schrotschussentfernung am Hahn. Er sitzt jetzt sehr hoch, nur wenig unterm Wipfel. Zwischen ihm und mir stehen noch einige Fichten – deren Geäst verdeckt und übergittert den Hahn so sehr, dass an ein Fotografieren nicht zu denken ist. Also springe ich etwas den Hang hinauf, um zwischen den Wipfeln hindurch freien Blick zu haben. Und gerade als mich noch zwei, drei Sprungschritte von einer brauchbaren Fotoposition trennen, unterbricht der Hahn sein Spiel. In einer reichlich unbequemen Position – zudem vom Hahn abgewandt – erstarre ich zur Salzsäule. Minuten vergehen. Nur gelegentlich tönt ein hölzerner Knapper von des Hahns hoher Warte her.
Irgendwann, als das verkrampfte Stillstehen gar zu unbequem wird, drehe ich mich mit der Geschwindigkeit eines Stundenzeigers herum und schiele vorsichtig zum Hahn hinauf. Der brockt in aller Ruhe Fichtennadeln – und wenn er die Äsungsaufnahme einmal kurz unterbricht, knappt er. Durch meine Gewichtsverlagerung knirscht der hier reichlich knietiefe Schnee unter meinen Sohlen – das vernimmt der Hahn sofort, reckt seinen Stingl, kann dann aber wohl nichts Verdächtiges eräugen, beruhigt sich bald, knappt wieder und widmet sich seiner Morgenäsung.
Bald darauf scheint es, als wolle er sich doch noch einmal einspielen, die Knapper und Doppelknapper werden schneller – dann jedoch stößt sich der majestätische Vogel mit kräftigem Schwingenschlag vom schwankenden Fichtenast ab und gleitet in den Bergmorgen hinaus. Ich gehe zurück zu meinem am morgendlichen Horchplatz zurückgelassenen Rucksack. Unweit davon streicht ein Auerhahn vom Boden ab.
Der Frühlingsmorgen ist zu wunderbar, um jetzt schon ins Tal zurückzukehren. So lege ich die Schneeschuhe wieder an und stapfe entlang des licht bewaldeten Grats weiter in die Bergwelt hinein. Im Wald liegt der Schnee selten mehr als knietief, stellenweise ist es sogar aper und so ist es kein übermäßig anstrengendes Steigen. Für ein kurzes Stück muss ich die Schneeschuhe dann aber ausziehen, um eine apere, felsdurchsetzte und teilweise eisige Steilpartie zu queren. Danach geht es weiter auf dem sanft ansteigenden Waldgrat, bis ich nach etwa zwei Gehstunden das nächste Steilstück erreiche. Hier jedoch liegt der Schnee reichlich hüfttief und die Morgensonne hat den ohnehin schlecht tragenden Schnee jetzt schon merklich aufgeweicht, sodass auch die Schneeschuhe nicht verhindern können, dass man oft bis übers Knie versinkt. Manchmal – dort, wo Staudenvegetation und Jungwuchs für Hohlräume unter der Schneedecke sorgen – bricht man gar bis zum Boden durch. Und so kämpfe ich mich mühsam die Steile hinauf und erreiche schließlich an der Waldgrenze einen kaum schrotschussbreiten, nahezu ebenen Boden – ein Balzplatz der Spielhahnen! Irgendwo in der Ferne höre ich auch wirklich das Rodeln eines der schwarzblauen Ritter, aber sonst ist am Balzplatz um diese Tageszeit freilich nicht mehr viel los. Nur ein Tannenhäher fällt gleich unterhalb des Bodens in einer mächtigen Fichte ein.
Vor mir baut sich hier eine reichlich büchsenschusshohe, extrem steile, stufige Felskuppel auf. Dort hinaufzusteigen ist schon im Sommer eine etwas heikle Angelegenheit – jetzt bei Schnee, Eis und Lawinengefahr wäre es lebensgefährlich. Und so trete ich nach kurzer Rast und Jause den Rückweg an. Das tiefschneebedeckte Steilstück rutsche ich der Faulheit halber am Hosenboden hinunter – und selbst das will im weichen Schnee nicht recht gelingen. Dann geht es weiter durch den alten, urwüchsigen Gratwald.
Als ich später bereits ein gutes Stück des Abstiegs geschafft und auch den Balzplatz der Großen Hahnen längst wieder hinter mir gelassen habe, ziehen kaum hundert Meter entfernt zwei Hirsche – der eine schon abgeworfen – in meiner nächtlichen Stapfspur vor mir her, biegen dann bergwärts ab und entschwinden meinen Blicken.
Mittag ist dann schon vorüber, als ich schließlich bei meinem Fahrzeug anlange. Es war wunderschön, oben bei den Hahnen gewesen zu sein. Und sehr bald werde ich wieder dort sein, denn viel zu schnell ist diese erlebnisreiche Zeit des erwachenden Bergfrühlings vorbei. Und dann wird es wieder zehn, elf lange Monate dauern, bis man von der Alm das Grugeln der Spielhahnen vernehmen kann und im frühmorgendlichen Bergwald das Knappen des Großen Hahns des Jägers Herz höherschlagen lässt.
Ein hart erkämpfter Spielhahn
Mitunter schreibt das Leben Geschichten, deren Wendungen und Wirrungen, Höhen und Tiefen sich ausgerechnet am Punkt der größten Hoffnungslosigkeit zum erträumten Ende zusammenfügen, sodass das Erlebte in der Rückschau geradezu unwirklich erscheint. Unauslöschlich brennen sich solche Stunden und Tage ins Gedächtnis ein, denn der Erfolg, den man sich im Grenzbereich des Machbaren hart erarbeitet hat, wiegt im Herzen weit schwerer als jener, der einzig einem glücklichen Zufall zu verdanken ist und mit dem nichts Außergewöhnliches oder Mühevolles verbunden war.
Obwohl der Wonnemonat seine Mitte bereits erreicht hat, zeigt sich das Gebirge noch wenig frühlingshaft. Seit Wochen schon ist die Witterung für die Jahreszeit viel zu kalt und immer wieder schneit es ergiebig bis in die Tallagen herab. Droben auf der weiten Hochalm, wo im ahnenden Graulicht das zischende Fauchen der Kleinen Hahnen den neuen Frühlingstag begrüßt und ihr vibrierendes Grugeln später die Luft erfüllt, liegt der Schnee sogar auf der Südseite immer noch meterhoch. So ist der Weg dort hinauf ein ebenso weiter wie beschwerlicher, muss man das Auto doch schon im mittleren Bergwald stehenlassen.
Die widrigen Bedingungen haben auch ganz entscheidend dazu beigetragen, dass von den drei Spielhahnen, die in unserem Revier frei sind, noch kein einziger zur Strecke gekommen ist. An den Hahnen selbst mangelt es keineswegs. Aber wenn das Hinkommen zum Balzplatz schon mühsam ist, die Balz sich aufgrund der geschlossenen Schneedecke über große Flächen verteilt, die Hennen noch kaum ans Brüten denken und zu allem Übel auch noch Pech hinzukommt, wird es schwierig, sich einen der Sichelritter zur Beute zu machen. So verbleiben von der reichlich zweiwöchigen Jagdzeit nun nur mehr vier Tage.
Mir wurde die ehrenvolle Aufgabe zuteil, in diesen letzten Tagen der Schusszeit eine junge, passionierte Jägerin auf ihren ersten Spielhahn zu begleiten. Wir kennen uns nicht persönlich und nur über gemeinsame Jagdfreunde habe ich bereits viel Gutes über sie gehört. So stehe ich in wolkenverhangener Maiennacht im schwach erleuchteten Dorf und warte auf Scheinwerferlicht, das sich die nächtens kaum befahrene Talstraße entlangtastet und das Nahen der Jägerin, die mit ihrem Vater und zwei Jagdfreunden erst spät am Vorabend in ihrer steirischen Heimat abgereist ist, ankündigt.
Gestern bin ich in nächtlicher Finsternis an den Westrand des weitläufigen Almrückens hinaufgestiegen. Dort balzen Jahr für Jahr zwei oder drei Hahnen, doch sie sind recht unstet und nicht leicht zu bekommen. Die intensivste Balz dieser Hochalm spielt sich hingegen für gewöhnlich in ihrem Nordosten ab. Im heurigen Jahr konnte ich dort bei zwei Pirschgängen auch schon eine stattliche Zahl an Hahnen bestätigen. Beide Male jedoch wäre es kaum möglich gewesen, auf einen guten Hahn zu Schuss zu kommen. Auf dieser weiten Hochfläche überriegeln unzählige flache Mulden und sanfte Bühel die Balzenden, deren Verhalten auch hier wenig vorhersehbar ist, sodass man oft am falschen Ort sitzt. Ich hatte bei diesen beiden Balzmorgen jedoch einen Ansitzplatz ausgemacht, von dem aus man sich jeweils einen Hahn hätte zur Beute machen können und war guter Dinge, die Jägerin dort zu Schuss bringen zu können.
Dass ich mich gestern dennoch für den Westrand der Hochalm entschied, hatte gleich mehrere Gründe: Zum einen glaubte ich, das Verhalten der Hahnen am Hauptbalzbalz nun halbwegs zu kennen, sodass jedes weitere Verlosen sie eher vergrämen mochte, als dass es neue Erkenntnisse gebracht hätte. Zum anderen war der Westen der Hochalm etwas leichter zu erreichen. An den Vortagen war nämlich erneut nicht gerade wenig Neuschnee gefallen, der das Steigen nun äußerst mühevoll gestalten mochte. Das allein hätte mich zwar nicht geschreckt, doch seit meinem ersten heurigen Gang hinauf zu den Spielhahnen plagten mich leichte Knieprobleme. Und ich wollte vermeiden, dem Knie ausgerechnet am Vortag der Jagd beim Waten im Tiefschnee mehr zuzumuten, als ihm guttun würde. Sollten die Schneeverhältnisse wider Erwarten allzu mühsam jedoch nicht sein, wollte ich zumindest später noch auf den Almgrat hinaufsteigen, um aus größerer Entfernung Blick zum Hauptbalzplatz zu erhalten.
Das Steigen und Stapfen fiel dann jedoch äußerst schwer, da man selbst mit Schneeschuhen meist wadentief – mitunter gar nahezu knietief – im kristallenen Weiß versank. Erst nach beinahe sieben Viertelstunden erreichte ich – gerade noch rechtzeitig – einen alten, halb verfallenen Heustadl, der guten Blick auf den westlichen Balzplatz bot. Ich war heilfroh, an diesem Morgen nicht droben am freien Almgrat zu sitzen, denn die Temperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt und eisiger Nordföhn blies mir mit solcher Kraft entgegen, dass ich mich bald in den geschütztesten Winkel des morschholzigen Stadls verzog, obwohl ich von dort nicht nach draußen sah. Doch infolge des Sturmes war die Balz ohnehin flau. Irgendwo drunten im Bergwald fauchte einige Male einer der Sichelritter und kurz darauf drang auch sein Grugeln zu mir herauf. Als es schon heller Tag geworden und am Balzplatz kein Hahn eingefallen war und mir die eisige Kälte immer ärger zuzusetzen begann, packte ich meine Siebensachen zusammen und stieg schnellen Schrittes talwärts, fort aus dem Sturm.
So bin ich heute kaum schlauer als zuvor. Den Messstationen zufolge weht der Nordföhn in der Höhe aber mit unverminderter Sturmgewalt und die Temperaturen sind weiter gesunken. Es ist also absehbar, dass uns auf der freien Hochfläche ohne jeden Wetterschutz eisige Stunden bevorstehen. An meinen gestrigen Ansitzplatz verschwende ich dennoch kaum einen Gedanken, denn auch wenn wir dort leidlich geschützt wären, so erscheinen mir die Erfolgsaussichten viel zu gering. Berufliche Verpflichtungen gewähren der Jägerin nämlich nur zwei Jagdtage, sodass wir keinen an einem wenig aussichtsreichen Ort vertun dürfen.
Jetzt gewahre ich in einiger Entfernung den Lichtschein eines nahenden Autos, das wenig später neben mir hält und dem zwei bekannte und zwei unbekannte Gesichter entsteigen. Die bekannten sind die beiden Jagdfreunde – die unbekannten die Jägerin Franziska und ihr Vater Werner. In Anbetracht der mühsamen Verhältnisse werden jedoch nur wir beiden jungen Waidleute – Franziska und ich – zu den Spielhahnen hinaufsteigen, während die drei Begleiter mit einem Wirt in der Nachbargemeinde vereinbart haben, ihn zu nachtschlafender Zeit aus den Federn läuten zu dürfen.
Bald sind Franziska und ich schon unterwegs und kurven auf der Sonnseite des Reviers eine schmale Bergstraße hinauf, die oberhalb der letzten Häuser in einen schotterigen Forstweg übergeht. Durchs Scheinwerferlicht zieht immer wieder Rotwild, das sich infolge der noch winterlich anmutenden Höhen derzeit im ergrünenden Talbereich konzentriert.
Heute will ich einen anderen Weg als gestern gehen und dazu einen weiter nach Osten führenden Abzweiger des Forstweges hinauffahren, denn so können wir das nahezu kilometerweite Queren der tief verschneiten Hochalm vermeiden. Das erspart uns nicht nur beträchtliche Mühen, sondern auch viel Zeit – und gerade Letzteres ist heute wichtig, denn alles hat ein wenig länger gedauert als geplant, sodass wir schon etwas spät dran sind. Als wir um eine der ersten Kurven des Forstweges biegen und uns der Abzweigung nähern, starre ich fassungslos in den Lichtkegel des Scheinwerfers, denn ein Seilkran versperrt die Abzweigung so, dass nur der Hauptweg befahrbar ist.
Da bleibt uns nichts anderes übrig, als doch meinen gestrigen Weg zu gehen und hernach mühsam quer über die Hochfläche zu stapfen. Um rechtzeitig am Balzplatz anzulangen, müssen wir diesen Weg, für den ich gestern zwei oder zweieinhalb Stunden benötigt hätte, nun aber in eineinhalb Stunden bewältigen. Meine alte Stapfspur mag uns zwar eine Hilfe sein und Franziska ist eine herausragende Sportlerin – dennoch habe ich Zweifel, ob dieses Unterfangen gelingen kann. Aber versucht muss es sein!
Rasch fahren wir den Hauptweg so weit hinauf, wie es die Schneelage halt zulässt. Vor einem Wegabschnitt, der durch schattenwerfenden Jungwuchs führt und daher noch hoch schneebedeckt ist, müssen wir den Pajero dann stehenlassen, raffen unsere Ausrüstung zusammen und machen uns schnellen Schrittes auf den Weg.
Zuerst geht es ein kurzes Stück recht steil durch hochstämmigen Fichtenwald hinauf, bis wir erneut auf den Forstweg treffen. Von nun an hätte es wenig Sinn, durch den Wald abzukürzen, da ein Sturm zahllose Bäume niedergerissen hat und das Vorwärtskommen abseits des Weges äußerst mühsam wäre. So folgen wir dem Fahrweg und meiner gestrigen Spur. Anfangs liegt der Schnee ohnehin meist nur etwa bergschuhhoch, sodass wir rasch an Höhe gewinnen.
Erste Schneeflocken rieseln im Licht der Stirnlampe federleicht zu Boden und allmählich wird der Schneefall dichter. Dann erreichen wir jene Stelle, an der ich gestern Schneeschuhe anlegen musste. Meine Hoffnung, dass die breite Stapfspur uns fortan auch auf Bergschuhsohlen trägt, erfüllt sich, und so machen wir im Vergleich zu gestern nicht wenig Zeit gut.
Bald schon lassen wir die Waldgrenze hinter uns und steigen in der eisig harten Schneeschuhspur über die freien Almhänge höher. Schließlich sind wir nicht mehr weit von meinem gestrigen Ansitzplatz entfernt und müssen meine alte Spur nun gen Osten verlassen. Als ich auf die Uhr schaue, macht sich Erleichterung breit, denn wir haben den Weg hier herauf tatsächlich in einer Dreiviertelstunde bewältigt, sodass uns für das Queren der Alm noch einmal so viel Zeit bleibt – und das sollte zu schaffen sein.
Rasch schnalle ich nun Schneeschuhe unter meine Bergschuhsohlen und stapfe – meist wadentief einsinkend – durch den Tiefschnee voraus. Mir bleibt nur, zu hoffen, dass Franziska, die keine Schneeschuhe dabeihat, in meiner Spur ein halbwegs kommodes Gehen finden wird. Nach einigen Dutzend Schritten halte ich daher an, drehe mich um und erkundige mich, wie die Jägerin zurechtkommt – und ihre Antwort könnte die Situation treffender kaum beschreiben: „Derweil schau i noch außa.“ Viel besser ist es um Franziska tatsächlich nicht bestellt, denn selbst in meiner Spur versinkt sie nicht selten bis zu den Knien im kristallenen Weiß.
Aber es nützt alles nichts. Wir müssen den Hauptbalzplatz erreichen, bevor der erste Hahn einfällt. Weiter geht es! Der Schneefall nimmt stetig zu und über den sanften Almgrat bläst nun auch der eisige Nordföhn zu uns herab und verschärft die ohnehin schon tiefen Minusgrade derart, dass ich trotz der körperlichen Anstrengung zu frösteln beginne und überlege, eine zweite Jacke anzulegen – aber nein, damit will ich keine Zeit vertun. Die Schneeflocken wirbeln waagerecht durch die Lichtkegel unserer Stirnlampen und schränken die Sicht so stark ein, dass es mir nicht immer leichtfällt, den rechten Weg zu finden, da die nur von einzelnen Bäumchen bestockte Hochfläche wenig Orientierung bietet.
Endlich erreichen wir jene sanfte Einsattelung des Almgrats, jenseits derer der Balzplatz liegt – und hier heroben bläst uns der Föhnsturm den Schnee mit voller Kraft ins Gesicht. Wir haben für das Queren der Alm nur eine halbe Stunde benötigt, sodass uns sogar noch ein wenig Zeit bleibt, zumal die Hahnen bei dieser unwirtlichen Witterung – wenn überhaupt – eher spät als früh einfallen werden. Der Gedanke, im Schneegestöber unnötig lange dem Sturm ausgesetzt zu sein, gefällt mir gar nicht – und da erblicke ich wenige Dutzend Schritt entfernt im Stirnlampenlicht eine reichlich mannshohe Schneewechte, deren windabgewandte Seite nahezu senkrecht ist und mithin leidlichen Windschutz gewährt. Bald sind wir dort und legen all unsere warme Kleidung an, während der Schnee von jeder Bö aufgewirbelt und schwallweise über die Wechte geblasen wird. Dann harren wir noch eine kurze Weile hier im Windschatten aus, bevor wir den sanften Grat queren und hinüber auf die sturmumheulte Nordseite des Almrückens gehen, wo nichts mehr die eisigen Böen zu zähmen vermag.
Wenig jenseits des Almgrats nehmen wir auf einer undeutlichen – kaum mehr als wadenhohen – Geländekante, die vom Sturm nahezu aper geblasen worden ist, zwischen einigen nadellosen Junglärchen Platz. Die Deckung an diesem Ort ist mager, doch solange die Hahnen nicht sehr nah sind und wir unbedachte Bewegungen vermeiden, sollte es gehen. Vor uns – mithin in nördlicher Richtung – liegt eine plateauartige Schneefläche, die von unzähligen Büheln und Kanten durchzogen ist und auf der hie und da schüttere Junglärchen den Unbilden des Gebirgswetters trotzen. In der Entfernung eines weiten Hahnenschusses endet das Almplateau an einer markanten Geländekante, hinter der sich ein enges, felsüberragtes Seitental anschließt. Nach links hin zieht das Plateau kaum merklich ansteigend mehr als kilometerweit in die Bergwelt hinein, während nach rechts der Rand des Lärchenwaldes nur etwa dreihundert Schritt entfernt ist – unsere Sicht dorthin ist durch schütteren Jungwuchs und Geländekanten allerdings nicht besonders üppig. Das jedoch spielt ohnehin eine untergeordnete Rolle, denn am ehesten erwarte ich die Hahnen in einer weiträumigen Schneemulde vor und links von uns – oder noch weiter links im Bereich einer zimmergroßen Latsche, von der uns reichlich hundert Meter trennen.
Eisiger Balzmorgen
Um dem Wind eine möglichst geringe Angriffsfläche zu bieten und sich nach dem Einfallen der Hahnen kaum bewegen zu müssen, liegt Franziska von Beginn an auf ihrem Wetterfleck hinter unseren Rucksäcken, die wir als Auflage für die Bockbüchsflinte hergerichtet haben. Ich jedoch sitze des besseren Über- und Rundblicks wegen zu ihrer Linken. Einem Schneesturm gleich fegt uns der Nordföhn die feinen Kristalle ins Gesicht und lässt schon nach wenigen Minuten die Kälte in die Kleidung kriechen. Das Heulen und Brausen des Sturmes würde zudem jeden feurigen Faucher eines Spielhahns übertönen, sodass wir besonders achtgeben müssen, eines einfallenden Hahns rechtzeitig gewahr zu werden. Nur von Zeit zu Zeit lässt der Wind einmal nach, schläft für Sekunden sogar nahezu ein, sodass die plötzliche Stille beinahe unwirklich erscheint und es erlauben würde, einen Hahn viele hundert Meter weit zu hören.
Zwanzig Minuten sind verstrichen und schwacher Frühdämmer webt sich bereits in die nächtliche Finsternis, als der Sturm wieder einmal etwas schwächer wird und von fern ein erster undeutlicher Zuscher an mein Ohr dringt. Franziska, deren erster Balzmorgen es heute ist, hat den kaum vernehmbaren und ihr freilich auch wenig vertrauten Ton nicht aus dem Brausen des Windes herausgehört. Und auch ich bin mir über die Richtung, aus der der Laut gekommen ist, nicht recht im Klaren. Doch bald folgen weitere Faucher. Irgendwo links von uns muss der Hahn sich aufhalten, doch im noch schwachen Dämmerlicht ist kein schwarzer Schatten am kristallenen Weiß auszumachen.
Allmählich verdrängt trübes Tageslicht die Schatten der eisigen Nacht. Und bald überschlagen sich die Ereignisse derart, dass ich mir in der Rückschau an mancher Stelle über ihren genauen Ablauf nicht mehr im Klaren bin. Und auch die beißende Kälte, die uns beide schon nach so kurzer Zeit an die Grenzen des Ertragbaren drängt, scheint die Wahrnehmung irgendwie zu trüben, weil das Denken und Handeln zwar dem Wild gilt, der Körper sich aber im Überlebenskampf zu befinden glaubt.
Zuerst dringt auch rechts hinter uns ein scharfer Blaser aus dem Heulen des Sturmes. Dieser Hahn kann weit nicht entfernt sein, doch ist vorerst verdeckt. Dann ertönt vor uns ganz leise das Zischen eines dritten Hahns. Nach kurzem Umhersuchen mit dem Glas entdecke ich ihn wenig vor dem Rand des Almbodens – doch gerade an einer solchen Stelle, dass eine schrotschussweit vor uns aus dem Schnee ragende Junglärche ihn aus Franziskas Sicht verdeckt.
Der Hahn zu unserer Rechten faucht immer lauter und näher. Und als ich meinen Kopf wieder einmal in Richtung dieser Töne wende, erstarre ich, denn kaum mehr als schrotschussentfernt steht der Hahn hinter dem kahlen Geäst einer hüfthohen Lärche und äugt aufmerksam um sich. Doch lange kann ihm meine Aufmerksamkeit nicht gelten, denn der Hahn vor uns setzt sich in Bewegung und läuft eilig und stichgerade auf uns zu. Bald ist er durch eine undeutliche Bodenwelle zwar für uns beide verdeckt, doch jederzeit kann er in passender Schussentfernung frei werden und deshalb rate ich der Jägerin, sich bereits zum Schuss zu richten.
Kaum hat Franziska den Schaft in die Schulter gezogen, hebt sich der Hahn rechts von uns auf seine Schwingen und zeitgleich kommt aus derselben Richtung ein weiterer Sichelritter herangestrichen. Im Sturm haben die beiden Hahnen größte Mühe voranzukommen, sodass sie unter kräftigem Schwingenschlag beinahe in der Luft stehen. Wie in Zeitlupe flattern sie vor uns vorüber und fallen halblinks in doppelter Schrotschussentfernung ein. Ihre Sicheln werden vom Föhnwind hin- und hergewirbelt, sodass es mir zunächst schwerfällt, anzusprechen, welcher der bessere ist, zumal sich auf den Linsen des Fernglases immer fort Schneeflocken anlagern, die mir die klare Sicht nehmen, sodass ich das Glas wieder und wieder absetzen und die Kristalle fortblasen muss.
Dann wird der Hahn vor uns frei und trippelt uns mit gefächertem Spiel weiter entgegen. Jetzt gibt es kein Überlegen mehr, denn auch wenn die anderen beiden gewiss keine geringen Hahnen sind – der Hahn vor uns ist ein kapitaler! Und mit gedämpfter Stimme lasse ich Franziska wissen, dass sie diesen nehmen solle. Näher und näher kommt der Kapitale und auch die beiden anderen Hahnen laufen nun auf uns zu. Kaum mehr als einen Schrotschuss vor uns dreht sich der Kapitalhahn breit und beginnt, inbrünstig zu rodeln, während die anderen beiden wenige Bergstocklängen neben ihm nicht weniger feurig vor sich hin balzen und etwas weiter hinten im Schneegestöber gar noch ein vierter guter Hahn in Anblick kommt.
Gebannt erwarte ich den Knall der Bockbüchsflinte – doch da bemerke ich, dass Franziska zwar angestrengt durchs Zielglas blickt, aber ihr Finger gar nicht am Abzug liegt. Hat der Sturm meine leisen Worte, dass sie den Hahn erlegen könne, nicht an ihr Ohr dringen lassen? Möglich wäre das schon und so wiederhole ich die Freigabe. Franziska vergewissert sich daraufhin zwar, dass ich den rechten der drei meine – doch dann macht sie erneut keine Anstalten, zu schießen. Will Franziska das eindrückliche Schauspiel der Balz noch in sich aufnehmen, bevor sie den Schießfinger krümmt? Oder beutelt sie das Jagdfieber, sodass ihr kein Schuss möglich ist? Ersteres würde ich ihr keineswegs nehmen wollen und auf Letzteres habe ich keinen Einfluss – also sage ich vorerst nichts und mein Blick wandert zwischen den Balzenden und der Jägerin hin und her.
Schließlich aber erkundige ich mich doch, ob es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und die gibt es in der Tat: Die eisige Kälte hat Franziskas Finger binnen kürzester Zeit klamm werden lassen, nachdem sie die Handschuhe ausgezogen hat. Nun fehlt ihr die Kraft, den Rückstecher vorzudrücken – und jedes Gefühl, das sie fürs Abdrücken benötigen würde, ist ohnehin schon lange aus ihren Fingern gewichen. Darauf hätte ich freilich genauso gut selbst kommen können, denn auch ich habe nur äußerst selten eine extremere Kälte erlebt und habe es heute einzig meinen dicken Handschuhen zu verdanken, dass meine Hände zwar kalt, aber nicht gefühllos sind, obwohl ich bereits durchgefroren bin, wie ich mich nur an wenige Male erinnern kann. Daher überrascht mich Franziskas Situation kaum.
Auf meinen Rat, sie solle ihre Schießhand unter der Kleidung so lange wärmen, bis ein Mindestmaß an Gefühl in sie zurückgekehrt sei, erwidert Franziska, dass sie dies bereits erfolglos probiert habe. So biete ich ihr an, das Stechen für sie zu übernehmen, und fühle mich schlecht bei diesen Worten – einerseits möchte ich der Jägerin ungern einen Teil der Schussabgabe nehmen und andererseits würde diese Hilfe ohnehin nichts daran ändern, dass Franziska in dieser Situation den Schuss nicht präzise auslösen könnte. So bin ich recht froh, dass sie auf meinen Vorschlag nicht eingeht und sich weiterhin bemüht, ihre Finger zu wärmen.
Der Kapitalhahn balzt derweil immer noch am gleichen Fleck, während die drei übrigen Hahnen mittlerweile ein Stück nach links gelaufen sind und in doppelter Schrotschussentfernung blasen, rodeln und drohend umeinander trippeln. Da lässt mich Franziska wissen, sie glaube, dass ihr das Einstechen endlich gelungen sei und sie nun schießen würde. Gebannt starre ich auf den Hahn, der seine hitzige Balz unterbrochen hat und mit langem Stingl dasitzt. Hat er etwas von uns wahrgenommen? Oder gilt seine Aufmerksamkeit vielmehr den Rivalen? Und wann endlich bricht der Schuss? Da stößt sich der Kapitale plötzlich vom Schneeboden ab und entschwindet im Flockenfall dieses sturmumtosten Maienmorgens. Entgegen Franziskas Annahme ist die Bockbüchsflinte nicht eingestochen gewesen – der Jägerin ist es mit klammen Fingern schlicht unmöglich gewesen, dies richtig zu erfühlen, geschweige denn, den nicht gestochenen Abzug auszulösen. Franziska ist die Angelegenheit sichtlich peinlich, doch ich kann mich gut in sie hineinversetzen und weiß nicht, ob es mir an ihrer Stelle besser ergangen wäre.
Die übrigen Sichelritter balzen mittlerweile im Bereich der Latsche zu unserer Linken. Noch also haben wir die Wahl zwischen drei guten Hahnen. Und sobald es Franziska gelingt, ihre Finger ausreichend zu wärmen, wird sie sich einen der drei zur Beute machen können. Einige Minuten vergehen, bevor so viel Kraft und Gefühl in Franziskas Schießfinger zurückgekehrt ist, dass sie sich erneut zum Schuss richtet.
Der beste Hahn balzt nun unmittelbar links der Latsche, die anderen beiden sitzen stumm einige Dutzend Schritt neben ihm. Diesmal gelingt Franziska das Einstechen ohne Schwierigkeiten. Doch binnen kürzester Zeit kehrt die Kälte in ihre Finger zurück und nimmt ihr zunehmend das Gefühl, das sie für den eher weiten als nahen Schuss auf das kleine Wild benötigt. Mein Blick wandert zwischen Franziska und den Hahnen hin und her – und plötzlich sind alle drei Hahnen wie vom Erdboden verschluckt, ohne dass ich auch nur einen von ihnen hätte abstreichen sehen. Sie müssen in irgendeiner Mulde oder hinter Jungwuchs verschwunden sein und jeden Augenblick erwarte ich, dass einer von ihnen aus der Deckung heraustrippelt. Doch nichts dergleichen geschieht. Nur weit außerhalb der Reichweite von Franziskas Kugel entdecke ich einen Sichelritter im Wipfel einer haushohen Lärche. Auch dringen kein Grugeln und kein Blasen mehr an unsere Ohren. Die Hahnen müssen zeitgleich abgestrichen sein, während ich meinen Blick Franziska zugewandt hatte und sie ihrerseits mit der bitteren Kälte zu kämpfen gehabt und kurzzeitig nicht auf die Hahnen geschaut hat.
Die Balz scheint für diesen Morgen gelaufen – und selbst, falls doch noch irgendwo ein Hahn schussgerecht in Anblick kommen sollte, würde uns die unwirtliche Witterung kaum eine Möglichkeit lassen, zu Schuss gekommen. Deshalb, und um Sturm und Kälte zu entfliehen, geben wir bald auf. Obwohl wir nur eine Stunde hier ausgeharrt haben, fällt es mir nicht leicht, aufzustehen und die Beine gerade zu bekommen – derart ausgekühlt ist die Muskulatur. Und Franziska verrät, dass sie noch nie in ihrem Leben derart gefroren habe, und ist sichtlich erleichtert, als ihr klar wird, dass es mir kaum anders ergeht.
Rasch packen wir unser Zeug zusammen, ich schnalle wieder Schneeschuhe unter die Bergschuhsohlen – dann machen wir uns auf den Weg. Auch wenn es mir nahezu aussichtslos erscheint, den Hahn im Lärchenwipfel anzupirschen, wollen wir es zumindest nicht unversucht lassen, zumal das Schneestapfen auch wieder Wärme in unsere Körper zurückkehren lassen wird. Doch es kommt so, wie es bei diesem Wild, das sprichwörtlich auf jeder Feder ein Auge hat, kommen muss: Nur ein paar wenige Schritte weit sind wir gekommen, bevor der Hahn sich vom schwankenden Lärchenwipfel abstößt und in den flockenumwirbelten Bergmorgen hinausgleitet. So gehen wir noch hinüber zum nördlichen Rand der Hochalm, denn in den Lärchen des dahinterliegenden Hangs fallen die Hahnen nach der Balz nicht ungern ein – doch heute vermögen wir in den sturmumpeitschten Wipfeln keinen zu erschauen.
Nun ist es aber endgültig Zeit geworden, der lebensfeindlichen Hochalm den Rücken zu kehren und den weiten Weg, den wir hier heraufgestiegen sind, zurückzugehen. Die oft mehr als wadentiefe Stapfspur, die wir erst vor reichlich einer Stunde quer über die Alm getreten haben, ist kaum mehr zu erahnen. Der Sturmwind hat sie vollständig mit Schnee gefüllt und nur einige Schneeklumpen, die durch unsere Schritte auf der Schneeoberfläche zu liegen gekommen sind, markieren noch den Verlauf der Spur.
Weit sind wir auf der Südseite der Alm noch nicht gekommen, als ich durch den verwirbelten Flockenfall in einem fernen Lärchenwipfel den schwarz scheinenden Umriss eines Spielhahns gewahre. Doch er hat uns schon wahrgenommen und noch während ich überlege, ob und wie er sich anpirschen ließe, streicht er ab.
Je mehr wir uns meiner gestrigen Schneeschuhspur nähern, desto mehr gelangen wir in den Windschatten des Almgrats. Und da höre ich plötzlich einen Hahn und gleich darauf das Gocken einer Henne. Gar weit können die beiden nicht sein, doch so angestrengt wir mit freiem Auge und durch unsere Gläser auch suchen, vermögen wir doch keine Feder zu entdecken. Vorsichtig pirschen wir weiter – und schließlich erschaue ich die Silhouette des Hahns im dichten Wipfel einer hohen Lärche drunten am Rande des Bergwaldes. Wenn wir einen beträchtlichen Umweg gehen, könnte das Anpirschen dieses Hahns gelingen, da wir auf weiten Strecken durch Geländekanten oder Bäumchen leidlich gedeckt wären. Anfangs nimmt er auch wirklich keine Notiz von uns, doch als wir – noch weit jenseits jeder vertretbaren Schussentfernung – eine deckungslose Partie hinter uns bringen müssen, streicht der Hahn auch schon in pfeilschnellem Flug davon.
Kurz darauf erreichen wir meine gestrige Stapfspur, in der nun immer noch wenig Neuschnee liegt, sodass ich die Schneeschuhe ausziehen und auf den Rucksack binden kann. In der eisig harten Spur kommen wir rasch voran und ganz langsam weicht auch die lähmende Kälte aus unseren Körpern.
Drunten im Dorf erwarten uns in der Wirtsstube bereits die übrigen Jäger. Bald steht ein reichhaltiges Frühstück am Tisch, weckt unsere Lebensgeister und in der guten Gesellschaft vergeht die Zeit wie im Fluge. Draußen wirbeln Schneeflocken zwischen den Häusern umher und immer wieder spinnen sich unsere Gespräche um dieses Wetter, das auch im Gebirge ganz und gar nicht zur Mitte des Wonnemonats passen mag. Obwohl wir nun bereits einige Stunden behaglich im Warmen sitzen, verspürt Franziska in ihren Fingerkuppen immer noch ein taubes Gefühl, das davon zeugt, dass sie droben im Schneegestöber beinahe Erfrierungen erlitten hätte. Um die missliche Situation dieses Morgens kein zweites Mal erleben zu müssen, ergänzt sie den Inhalt ihres Rucksacks im Laufe des Tages um einige warme Kleidungsschichten und Wärmekissen für die Handschuhe.
Am Nachmittag finden wir noch ein, zwei Stunden Schlaf, bevor wir schon wieder an die Hahnen denken müssen. Wir haben es uns so überlegt, dass wir schon zeitig am Abend den Weg bis über die Waldgrenze hinter uns bringen wollen – diesmal zu viert, denn Werner und der Kleine Münsterländer der Familie wollen uns begleiten. Wenn uns großes Glück vergönnt sein sollte, wird vor dem Zunachten vielleicht ein Hahn in einem Lärchenwipfel einfallen und Franziska zur Beute werden. Für den anzunehmenden Fall, dass dies nicht gelingen wird, haben wir mit einem Bauern vereinbart, droben auf der Hochalm in seiner gemütlichen Hütte nächtigen zu können, sodass der Weg zum Balzplatz am neuen Morgen kein weiter mehr wäre.
Anders als in den Frühstunden lassen wir den Weg durch den hochstämmigen Gebirgswald hinauf auf die freien Weiten der Hochalm nun gemütlich angehen. Auch das Wetter zeigt sich von einer wesentlich angenehmeren Seite als noch vor ein paar Stunden. Kurz nachdem die Waldgrenze unter uns liegt, verlassen wir die gut ausgetretene Spur, halten uns rechts und stapfen hinüber zu der kaum hundert Schritt entfernten Hütte. Rasch richten wir uns ein und entfachen ein knackendes Feuer im Herd, bevor Franziska und ich schon wieder aufbrechen. Werner bleibt an der Hütte, um das Feuer nicht verlöschen zu lassen, Teewasser zu kochen, alles für einen gemütlichen Hüttenabend herzurichten und seinerseits nach Hahnen Ausschau zu halten.
Franziska und mich führt unser Weg nicht besonders weit. Einen Hahnenschuss schräg oberhalb der Hütte setzen wir uns bei einer buschigen, doppelt christbaumgroßen Fichte nieder. Vor uns liegt in passender Schussentfernung eine lichte Lärchengruppe, in der die Hahnen nicht ungern einfallen. Und zu unserer Rechten – immer noch in Reichweite von Franziskas Kugel – befindet sich der Rand des Bergwaldes mit jener dicht gewachsenen Lärche, in der wir während unseres morgendlichen Abstiegs den letzten Hahn erschaut und bei der misslungenen Pirsch zum Abstreichen veranlasst haben.
Einmal dringt von fern – kaum wahrnehmbar – das Grugeln eines Hahns an mein Ohr. Später gewahre ich im Unterbewusstsein eine flatternde Bewegung in einem Lärchenwipfel drunten am Waldrand und bin augenblicklich hellwach. Doch es ist nur ein Kleinvogel – ein Baumpieper wohl – und mein Jägerblut beruhigt sich rasch.
Eine Stunde mögen wir bei der Fichte verhockt haben, als Franziskas Handy vibriert. Werner lässt sie wissen, dass unweit der Hütte – wenig oberhalb jener Stelle, wo wir beim Aufstieg aus dem geschlossenen Wald getreten sind – ein guter Hahn in einer Lärche eingefallen sei. Der Sichelritter muss also in unserem Rücken sitzen. Vorsichtig spähe ich um unsere Jungfichte herum nach hinten – und vermag keinen Hahn zu erschauen. So stehe ich bedachtsam auf, um besser über eine reichlich schrotschussentfernte Geländekante hinwegschauen zu können. Da entdecke ich den Hahn wahrhaftig im kahlen Gezweig eines schütteren Lärchenwipfels. Die Entfernung ist auch für die rasante 5,6x50 auf ein solch kleines Wild grenzwertig – etwa 160 Meter. Das größere Problem allerdings ist, dass der Hahn aus liegender Position überriegelt ist, sodass Franziska ohnehin keine Auflage für die Bockbüchsflinte hätte.
Geschwind packen wir unsere Sachen zusammen und wollen in voller Deckung auf die nahe Geländekante hinüberpirschen, von der es ein recht kommodes Schießen sein sollte. Kaum sind wir hinter unserer Fichte hervorgetreten, da gewahre ich höher am Hang einen weiteren Hahn. Der Entfernungsmesser zeigt 220 Meter. Wir sind dort hinauf kaum gedeckt – und nur ein paar Schritte weiter hat uns der Hahn bereits eräugt und streicht unter raschem Schwingenschlag davon. Kurz darauf erreichen wir die Geländekante, doch als wir darüber spähen, sticht keine schwarze Hahnensilhouette mehr aus dem Lärchengezweig heraus.
So kehren wir zur Hütte zurück und Werner berichtet, dass er etwas unterhalb des zuerst erschauten Hahns – für uns stets überriegelt – gar noch ein weiteren erschaut habe, doch dieser sei lediglich ein Schneider gewesen. Die Hahnen hätten ihn aber offenbar eräugt, hätten mit langen Stingln gesichert und seien nicht lange geblieben.
Noch ist der Tag nicht im Vergehen und leicht mag irgendwo ein weiterer Hahn einfallen. Reichlich schrotschussweit unter der Hütte geht der sanfte Höhenrücken abrupt in einen steileren Hang über, wo der Baumbewuchs rasch dichter und höher wird. Dort unten weiß ich beliebte Schlafbäume des Birkwildes und deshalb setzen Franziska und ich uns nun auf dieser Kante nieder. Das bringt auch den Vorteil mit sich, dass wir von hier in jene Lärchen hinaufsehen, in denen die drei Hahnen zuvor eingefallen sind – vielleicht wird es ihnen ein vierter gleichtun.
So sitzen wir da, spähen nach einem heransausenden schwarzen Schatten und lassen unsere Blicke über die noch tiefwinterlich anmutende Bergwelt schweifen. Ruhe und Zauber dieses Maienabends erscheinen geradezu unwirklich im Vergleich zu der lebensfeindlichen Witterung, die uns hier heroben erst Stunden zuvor an unsere Grenzen gebracht hat. Zaghaft brechen erste Sonnenstrahlen durch das ziehende Gewölk und malen Lichtflecken auf die weißen Hänge der Schattseite. Bald erstrahlen Gipfel und Grate im goldroten Schein der versinkenden Abendsonne und verleihen dem Gebirge eine rare Pracht, die sich wohltuend auf das Gemüt legt.
In der klaren Luft und im kahlen Lärchengeäst rührt sich jedoch keine Feder. Und als die Farben des Tages schließlich verblassen und sich bleigraues Dämmerlicht über die weiten Höhen legt, kehren wir zur Hütte zurück.