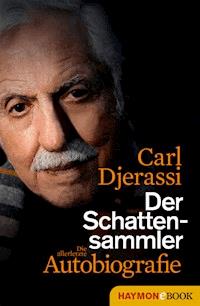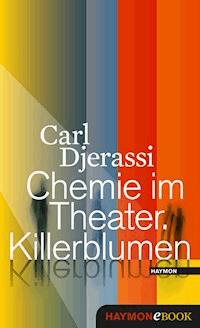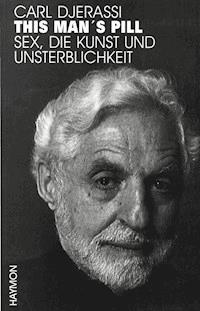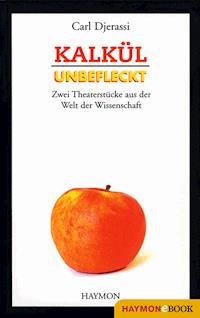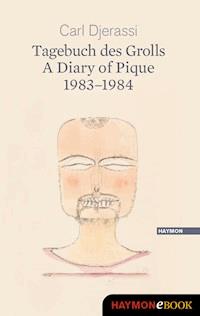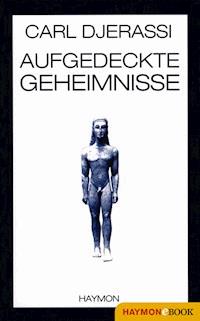
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie schon im Buch "Stammesgeheimnisse" (mit den Romanen Das Bourbaki-Gambit und Cantors Dilemma) macht der Haymon-Verlag zwei längst vergriffene Romane von Carl Djerassi wieder zugänglich. Der berühmte Wissenschaftler ist seit Jahren als Literat erfolgreich und ermöglicht in Romanen und Theaterstücken interessante, oft beklemmende Blicke in die Welt der Forschung und der Wissenschaft, enthüllt brisante Geheimnisse einer - wie er sagt - ganz eigenen, in sich geschlossenen "Stammeskultur". In den beiden Romanen NO (nach der chemischen Formel für Stickoxyd) und Menachems Same, die hier mit einer neuen Einführung des Autors zusammengefasst sind, geht es um die Forschung rund um künstliche Befruchtung und männliche Potenz, aber auch darum, wie die unter sich zerstrittenen Wissenschaftler die Welt tiefgreifender verändern als die internationale Politik, die in Menachems Same ebenfalls ein Thema ist. "Es ging mir darum zu beschreiben, wie sich Wissenschaftler verhalten, und nicht nur zu schildern, was sie tun", schreibt Djerassi im Vorwort. Während in den ersten Romanen die Universitäten im Mittelpunkt stehen, "wollte ich in den abschließenden Bänden der Tetralogie mein Netz weiter auswerfen und bestimmte Verhaltensmuster sowohl von Forschern in der Industrie als auch von Naturwissenschaftlern einfangen, die in der geopolitischen Arena agieren." Wer könnte uns dies besser vermitteln als ein Mann, der als Biochemiker schon Nobelpreiskandidat war, der aber zusätzlich erzählerische Phantasie besitzt und exzellent schreiben kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl Djerassi: Aufgedeckte Geheimnisse
Carl Djerassi
AUFGEDECKTE GEHEIMNISSE
Menachems SameNO
Zwei Romane aus der Welt der Wissenschaft
Aus dem Amerikanischenvon Ursula-Maria Mössner
© 2005HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7500-8
Umschlag: Benno Peter
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
INHALT
Vorwort
Menachems Same
No
Biografischer Abriss
Vorwort
Wer einen neuen Roman zu lesen beginnt und auf ein Vorwort stößt, verspürt automatisch ein gewisses Unbehagen. Ein Vorwort deutet im Allgemeinen darauf hin, dass ein Wissenschaftler am Werk war, der sich bemüßigt fühlt, zu erläutern, warum das vorliegende Buch überhaupt geschrieben wurde, und sich anschickt, dies mit Anmerkungen, gelehrten Verweisen oder schamloser Eigenwerbung darzulegen. Warum begebe dann auch ich mich auf dieses unsichere Terrain? Weil ich ein halbes Jahrhundert lang ein Wissenschaftler war, dessen Schriftstellerkarriere erst im Alter von etwa 60 Jahren begann – zu spät, als dass der Leopard seine Flecken hätte ändern können. Darüber hinaus liegt meiner „Science-in-Fiction“ (nicht zu verwechseln mit Science-Fiction) eine pädagogische Motivation zugrunde, die zu leugnen töricht von mir wäre, auch wenn dieses Eingeständnis offensichtliche Risiken in sich birgt.
Nachdem dieses caveat lector des „Herrn Professor Doktor“ abgehakt wäre, möchte ich, als schlichter „Herr Autor“, erläutern, was mich bewogen hat, meine beiden letzten Romane – Menachems Same und NO – unter dem Titel Aufgedeckte Geheimnisse in einem Band zusammenzufassen, quasi als das Yin zum Yang des ersten Bandes, Stammesgeheimnisse, der die beiden ersten Romane meiner Tetralogie enthält, Cantors Dilemma und Das Bourbaki Gambit.
Die erste Erklärung ist sehr einfach. Genau zu dem Zeitpunkt, als die ursprünglichen deutschen Ausgaben aller vier Romane vergriffen waren, erwies sich ihr pädagogischer Wert als aktueller denn je, was die Tatsache beweist, dass die englischen Ausgaben ständig neu aufgelegt werden und fast jedes Jahr Übersetzungen in weitere Sprachen hinzukommen. Aber worin genau besteht dieser Wert?
Zunächst war meine Tetralogie von „Science-in-Fiction“-Romanen als ein Mittel konzipiert, um unter dem Deckmantel der Fiktion wichtige Aspekte der Kultur und des spezifischen Verhaltens von Naturwissenschaftlern einem Publikum nahe zu bringen, das den Naturwissenschaften distanziert oder sogar ablehnend gegenübersteht – das heißt, ich wollte beschreiben, wie sich Naturwissenschaftler verhalten, und nicht nur schildern, was wir tun. Die Aufnahme, die Cantors Dilemma und Das Bourbaki Gambit insbesondere in den USA fanden, zeigte jedoch, dass auch Naturwissenschaftler selbst – ob Studenten oder altgediente Praktiker – geeignete Leser sind, da sich die meisten von ihnen der kulturellen Eigentümlichkeiten ihres eigenen Stammesverhaltens gar nicht bewusst sind. Die beiden Romane werden inzwischen in einer Vielzahl von Seminaren als Lektüre empfohlen oder sogar als Lehrbuch verwendet. Während Cantor und Bourbaki sich ausschließlich auf die universitäre Welt konzentrierten, wollte ich in den abschließenden zwei Bänden mein Netz weiter auswerfen und auch bestimmte Verhaltensmuster sowohl von Forschern in der Industrie als auch von Naturwissenschaftlern einfangen, die in einer geopolitischen Arena agieren. Vor allem aber stellte ich fest, dass ich in Menachems Same und in NO immer wieder ein naturwissenschaftliches Thema aufgriff, das mich seit Jahrzehnten beschäftigt, nämlich die menschliche Fortpflanzung.
Mein Interesse daran begann vor etwa fünfzig Jahren, als ich, ein in der Forschung tätiger „harter“ Chemiker, an der ersten Synthese eines hormonellen oralen Verhütungsmittels beteiligt war. In den zurückliegenden dreißig Jahren, in denen ich diesem Interesse als „weicherer“ Naturwissenschaftler weiter nachging, befasste sich ein Großteil meiner Lehrtätigkeit, meiner Vorträge und Veröffentlichungen mit den sozialen Implikationen und der Erkenntnis der bevorstehenden Trennung von Sex und Befruchtung – ein Thema, das eine Fülle praktischer und ethischer Fragen aufwirft. In Menachems Same schilderte ich die 1991 in Belgien erfolgte Entdeckung von ICSI (Intracytoplasmatische Spermieninjektion, d.h. die Injektion eines einzelnen Spermiums direkt in die Eizelle) – die wohl bedeutsamste Erfindung auf dem aufstrebenden Gebiet der In-vitro-Fertilisation. Ich kam zu der Überzeugung, dass diese Methode, die ursprünglich zur Behandlung der Unfruchtbarkeit bei Männern entwickelt wurde, in naher Zukunft von fruchtbaren Paaren benutzt werden würde und dass sie ihre stärksten Auswirkungen auf die Frauen haben könnte. Gestützt wird diese Annahme von der Beobachtung, dass das erste ICSI-Baby zwar erst elf Jahre alt ist, inzwischen aber bereits 50 000 bis 100 000 ICSI-Babys geboren wurden. Während der Roman die praktischen Aspekte von ICSI schildert, entschied ich mich für ein anderes Genre – nämlich „Science-in-Theatre“ –, um die enormen ethischen Folgen von ICSI zu beleuchten. Diese werden in meinem Bühnenstück Unbefleckt anhand der gleichen Personen veranschaulicht, die schon in dem Roman Menachems Same auftreten.
Ein weiterer wichtiger Punkt der menschlichen Fortpflanzung, der meine Überlegungen und meine Veröffentlichungen bestimmt, ist das Fehlen einer „Pille für Männer“ und mein zunehmender Pessimismus, dass jemals ein Verhütungsmittel für den Mann entwickelt werden wird, wenn man bedenkt, dass die künftig bestehende Möglichkeit, Eizellen und Sperma zu lagern, gekoppelt mit einer Sterilisation, Verhütungsmittel in nicht allzu ferner Zukunft überflüssig machen könnte. Dabei gibt es die „Pille für Männer“ bereits in Form von Viagra, nur dass es dabei um sexuelle Leistung und nicht um die Kontrolle der Fruchtbarkeit geht. In meinem letzten Roman, NO, beschäftige ich mich mit dieser Frage und anderen Ansätzen bei der Behandlung der männlichen Impotenz, und zwar in einem realistischen Kontext im Rahmen eines typischen Biotech-Unternehmens – wie sie in meinem persönlichen geographischen Umfeld des Großraums San Francisco so zahlreich vertreten sind.
Ähnlich wie C. P. Snow, der englische Naturwissenschaftler und Schriftsteller, der den Begriff von den „Zwei Kulturen“ prägte, entschloss ich mich, in NO alle Personen aus den früheren Romanen meiner Tetralogie zu einer Art Finale zu versammeln, in dem das Wie, Was und Warum der naturwissenschaftlichen Forschung zusammengefasst wird. Man könnte auch sagen, dass meine früheren Stammesgeheimnisse und jetzt meine Aufgedeckten Geheimnisse Bemühungen meinerseits darstellen, die Kluft zwischen den zwei Kulturen zu überbrücken. Doch jedes Geheimnis muss letzten Endes gelüftet werden. Nachdem ich fast mein Leben lang Geheimnisse gehütet habe, bin ich nun dazu übergegangen, sie zu lüften.
San Francisco, 2004
Menachems Same
1
„Was er über die Königin von Saba nicht weiß, lohnt sich auch nicht zu wissen.“
„Das ist Menachem Dvir?“, fragte sie leise. „Mit dem weißen Bart und der Brille? Er sieht eher wie ein Bibelforscher aus.“
„Nein“, erwiderte Le Gourou im Flüsterton. Im Gegensatz zu dem Mann, um den es in ihrem Gespräch ging, war der Franzose einer der wenigen Teilnehmer ohne Namensschild. Er brauchte keines. Jeder auf der Kirchberg-Konferenz wusste, wer Le Gourou war. „Das ist einer von den Russen. Der andere ist Dvir.“ Er gluckste. „Der Israeli sieht aus wie ein Russe und der Russe wie ein Rabbi. Sogar der äußere Schein betrügt bei ihm.“
„Es heißt ‚trügt‘.“ Melanie Laidlaw konnte nicht widerstehen, sie musste Le Gourou einfach verbessern – die Gelegenheit dazu bot sich einem schließlich nicht alle Tage. „Was Wittgenstein wohl von alledem gehalten hätte?“, setzte sie hinzu, vielleicht etwas zu sehr bemüht, das Gespräch in Gang zu halten.
„Wittgenstein?“
„Ludwig, der Philosoph.“
„Ich sehe da keine Verbindung.“
„Er war hier in den Zwanzigerjahren als Lehrer tätig.“
„Hier?“ Der Franzose blickte so erstaunt drein, wie das nur ein Franzose kann. „In Kirchberg? In diesem …“ Er wedelte mit der Hand. „Wie sagt man für trou perdu?“
Melanie Laidlaw zuckte hilflos mit den Schultern. Ihr Schulfranzösisch hatte sich in den zurückliegenden 25 Jahren so gut wie verflüchtigt, sodass sie kaum noch nach der Damentoilette fragen konnte.
„Le kaffe?“ fragte er zögernd.
„Ach so“, sagte sie erleichtert. „Sie meinen in einem Kaff. Tja, große Dinge ereignen sich manchmal sogar in einem kleinen Nest, wie wir auch dazu sagen. So wie diese Konferenz.“
„Sie sind also der geheimnisumwitterte Dr. Dvir.“ Sie hatte sich nach der Kaffeepause an ihn herangepirscht, als die Gruppe wieder in den Sitzungssaal aufbrach. „Wie ich höre, sind Sie eine der größten Autoritäten, was die Königin von Saba betrifft.“
Dvir drehte sich langsam zu der Fragestellerin um. „Mister Dvir“, sagte er bedächtig mit einer Stimme, die aus einer Furcht einflößenden Tiefe zu kommen schien. „Ohne Doktor.“
Sie deutete auf das Klebeschild an seinem Pullover. „Ben-Gurion-Universität“, las sie vor. „Ich dachte, Sie seien Mitglied einer Fakultät. Ein Sabaist“, ergänzte sie rasch. „Falls es dieses Spezialgebiet gibt.“
Dvir brach in Gelächter aus und klang einen Moment lang bedeutend weniger Furcht einflößend. „Ich bin in meinem Leben ja schon allerhand genannt worden, aber das noch nie. Darf ich den Ausdruck borgen?“ Er blickte rasch auf ihr Namensschild. „Von der REPCON-Stiftung?“
Melanie Laidlaw lachte verlegen. „Leider ja.“
Er zuckte die Schultern. „Und muss es Doktor Laidlaw heißen?“
„Leider ja. Ich war früher an einer Universität tätig.“
„Sie sagen zu oft ‚leider‘: erst im Hinblick auf die Stiftung und nun auf Ihren Titel.“
Melanie Laidlaw wurde rot. „Das ist nur so eine Redensart.“
„Immer mit der Ruhe“, sagte er, während er sie beim Ellbogen nahm und zu einem der leeren Plätze hinten im Saal führte. „Ich bin kein Fakultätsmitglied, sondern nur ein Verwaltungsmensch.“
„Von was?“, fragte sie, während sie Platz nahm.
Dvir machte eine lässige Handbewegung. „Ich bin Leiter des administrativen Bereichs und für alles Mögliche zuständig. Ben Gurion ist eine junge Universität, und eine kleine Verwaltung ist eine Methode, Geld zu sparen.“
„Sie sind in Beer Sheva, nicht?“
Dvir nickte.
„Das ist im Negev, nicht?“
Dvir nickte geistesabwesend; seine Aufmerksamkeit hatte sich anderen Dingen zugewandt.
„Liegt Dimona nicht auch im Negev?“, bohrte Melanie weiter.
Dvirs Aufmerksamkeit richtete sich schlagartig wieder auf seine wissbegierige Nachbarin. „Ja, und?“
„Ist das nicht der Ort, wo Sie Ihr Atomarsenal haben?“
Der Mann vor Melanie hatte sich umgedreht. „Pst.“ Er legte den Finger an die Lippen. „Merken Sie denn nicht, dass die Sitzung begonnen hat?“, zischelte er.
Dvir nahm keine Notiz von ihm. Seine Aufmerksamkeit konzentrierte sich einzig und allein auf Melanie. „Ja, und?“, fragte er wieder.
„Wïe ich höre, waren Sie einer der ersten Direktoren dort“, flüsterte sie ihm ins Ohr.
Dvirs Kopf fuhr so schnell herum, dass ihre Lippen sein Ohr streiften. „Erst die Königin von Saba, dann Dimona. Wer hat Ihnen das erzählt?“ Sie konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, ob er verärgert oder neugierig war.
„Später“, flüsterte sie.
2
„Haben Sie Familie?“, fragte Melanie Laidlaw, als die Suppe serviert worden war.
„Na sicher. Oder ist bei Ihnen in Amerika die unbefleckte Empfängnis üblich?“
Sehr witzig, dachte sie, aber das geschieht mir recht, was muss ich auch so anfangen. „Ich meine, haben Sie Kinder?“
„Meinen Sie wirklich genau das?“, sagte er verschmitzt.
„Na schön. Dann eben eine Frau. Viele Leute haben ihre Ehepartner nach Kirchberg mitgebracht. Aber Sie scheinen allein hier zu sein.“
„Und wo ist Ihr Partner?“ Nun war er inquisitorisch.
„Mein Partner? Sie meinen, mein Mann …“
„Seien Sie nicht sophistisch“, fiel er ihr ins Wort. „Ich meinte ‚Partner‘.“
„Mein Mann ist tot.“
„Das tut mir Leid.“ Das Glitzern war aus seinen Augen verschwunden.
„Und Sie?“
„Ich bin nicht verwitwet. Aber warum so umständlich?“
„Umständlich?“ Obwohl Melanie nicht leicht rot wurde, zeichnete sich der erste rosige Hauch auf ihren Wangen ab. „Wie meinen Sie das?“
„Warum haben Sie mich nicht geradeheraus gefragt, ob ich verheiratet bin?“
„Sind Sie es denn?“
„Fragen Sie das, weil Sie mit mir schlafen wollen?“
Melanies Wangen waren knallrot geworden. Sie warf einen schnellen Blick auf die Nebentische, teils um ihre Verlegenheit zu kaschieren, hauptsächlich aber um festzustellen, ob jemand ihr Gespräch mit anhörte. Diesbezüglich hatte sie keine Veranlassung, sich Sorgen zu machen. Wie in den meisten Speisesälen, die mit Wissenschaftlern oder Politikern besetzt sind – und die Kirchberg-Konferenzen waren dafür bekannt, beide Gruppen zusammenzubringen –, sorgte der Lärmpegel für absolute Ungestörtheit.
„Ich schlage vor, das Thema zu wechseln“, sagte sie in bewusst förmlichem Ton. Doch etwas an seiner Direktheit, seine offensichtliche Verachtung für konventionelles Geplauder machten Melanie unbefangen. „Sie nehmen vermutlich regelmäßig an diesen Tagungen teil. Was bringt es Ihnen?“
Menachem zuckte die Schultern. „Ich bin hier, weil es mir tatsächlich etwas bringt: Ich treffe Leute, denen ich normalerweise nicht begegne. Ich kann über Themen diskutieren, die mich interessieren.“
Melanie wusste, warum sie gekommen war. Für sie war es ihr erstes Kirchberg. Als neu aufgenommenes Mitglied dieses bekanntermaßen exklusiven Gesprächskreises westlicher und osteuropäischer Wissenschaftler war sie gespannt, was die anderen hergeführt hatte, insbesondere die, die sich alle zu kennen schienen, die, die dazugehörten.
Die Fakten waren ihr bekannt. Zum ersten Mal hatte man sich Ende der Fünfzigerjahre getroffen, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Der einzige gemeinsame Nenner war ursprünglich die Furcht vor einem unkontrollierten atomaren Wettrüsten gewesen – eine Befürchtung, die von einer erstaunlichen Anzahl von Wissenschaftlern diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs geteilt wurde. Am 9. Juli 1955 hatte Bertrand Russell auf einer öffentlichen Versammlung in London das Manifest verlesen, das er und Einstein verfasst hatten: „Angesichts der verhängnisvollen Situation, vor der die Menschheit steht“, hatte es begonnen, „sind wir der Auffassung, dass sich Wissenschaftler zu einer Konferenz versammeln sollten, um die Gefahren zu erörtern, die infolge der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen entstanden sind, und um über eine Resolution zu beraten …“ Unter den Zuhörern befand sich auch ein zu Besuch weilender Physiker aus Österreich, den ein jäher Geistesblitz kombinieren ließ, dass politisch unbesudeltes Geld erforderlich war, um Russells Vision in einer für Ost und West akzeptablen Form zu verwirklichen. Der österreichische Physiker, der selbst in keinster Weise nazistisch kontaminiert war, beschloss, sich dafür einzusetzen, dass das Russell-Einstein-Manifest Früchte trug.
Österreich war erst kurz zuvor durch einen Friedensvertrag, der den Abzug sowohl der sowjetischen als auch der westlichen Besatzungstruppen beinhaltete, zu einem neutralen Staat erklärt worden, einer potenziellen zweiten Schweiz. In dieses frischgebackene neutrale Land war der Physiker mit der Überzeugung zurückgekehrt, dass es in Österreich nur einen einzigen Mann gab, der Russells Vision Wirklichkeit werden lassen konnte. Nicht er selbst, sondern Ludwig Wittgenstein, Österreichs bedeutendster Philosoph. Die Familie Wittgenstein war um die Jahrhundertwende so reich geworden, dass viele sie als die österreichischen Rockefellers oder Krupps bezeichneten. Ludwig, der Philosoph, machte sich nie etwas aus Geld. Seine Verachtung für ererbte Vermögen war sogar so groß, dass er mit dreißig – Jahre nach der Veröffentlichung seines Tractatus logico-philosophicus – alles aufgab, um in der Abgeschiedenheit des Umlandes von Kirchberg am Wechsel, nämlich in den Weilern Trattenbach, Hassbach und Otterthal, Volksschullehrer zu werden. Er lehnte jegliche Unterstützung seitens seiner Familie ab, sogar Lebensmittelpakete, als er krank war. Der Mann war praktisch ein Einsiedler.
Der Wiener Physiker erinnerte sich an den Namen einer Bekannten, einer Cousine Wittgensteins, und rief sie an. Warum sollte man nicht einen Teil der Wittgenstein-Millionen für einen edlen Zweck verwenden, den selbst Ludwig gutgeheißen hätte, wenn er nicht vor vier Jahren gestorben wäre?, fragte er. Und warum sollte man Russell, der inzwischen in den Achtzigern war, nicht diskret eine Reverenz erweisen, da er Ludwig doch den Weg zur Philosophie gewiesen hatte, auch wenn dieser später stark von Russells eigenem Weg abwich? Und warum sollte man nicht Österreich wählen, dessen neu gewonnene Neutralität eines der wenigen Beispiele für politische Zusammenarbeit im Kalten Krieg zwischen dem Westen und dem Osten war? Und mit bemerkenswertem Weitblick schlug der Wiener Physiker schließlich vor, als Tagungsort der ersten Konferenz zu Wissenschaft und Weltgeschehen anstelle von Wien, mit seinem ungeheuren historischen Ballast, das unbekannte Dorf Kirchberg am Wechsel zu wählen, in dessen Umgebung der berühmte Philosoph einst versucht hatte, den Bauernkindern Bildung zu vermitteln. Mit vollendetem diplomatischen Instinkt ließ es der Physiker damit bewenden; die Geschichte endete nämlich mit Wittgensteins überstürzter Abreise aus der Gegend von Kirchberg, nachdem er einen Schüler selbst für dortige Verhältnisse zu heftig geprügelt hatte.
Die erste Konferenz fand 1957 in Kirchberg am Wechsel statt, auf die in den Jahren danach weitere Tagungsorte in Österreich folgten: Kitzbühel, Bad Gastein, Wien und Zell am See. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Konferenzen bereits den Namen Kirchberg-Konferenzen erhalten, und die Teilnehmer bezeichneten sich stolz als Kirchberger. Menachem Dvir gehörte nicht zur ersten Gruppe israelischer Kirchberger, auch nicht zu späteren Kirchberg-Delegationen aus Israel in den Sechzigerjahren. Die Israelis, gewöhnlich nie mehr als drei pro Tagung, wurden erstmals 1962 eingeladen. Zu der Zeit stand die nukleare Proliferation bereits ganz oben auf der Tagesordnung der Kirchberg-Bewegung: Die französisch-israelische Zusammenarbeit auf atomarem Gebiet war kein Gerücht mehr, sondern eine Tatsache; es war daher nur vernünftig, israelische Wissenschaftler in die Kirchberg-Bewegung einzubinden. Menachem Dvirs Position in einem der sensibelsten Bereiche Israels ließ Auslandsreisen nur unter größter Geheimhaltung zu. Erst 1969 – als er bereits offiziell in der Verwaltung der Negev-Universität tätig war, die später den Namen des früheren Ministerpräsidenten Ben Gurion erhielt – nahm er eine Einladung zur nächsten Kirchberg-Konferenz an.
„Was für Leute können Sie hier und nicht auch anderswo treffen?“, fragte Melanie.
Menachem hatte gerade seinen Suppenteller weggeschoben. Er gehörte zu den Menschen, die durch Wegschieben des leeren Tellers unterstreichen, dass sie einen Gang beendet haben. Bei Menachem geschah dies nicht einmal besonders diskret. Man musste es einfach bemerken. Es hieß soviel wie finito, fini, fertig.
„Alle Möglichen“, sagte er, „aber vor allem Araber. Sie können sich denken, dass die Leute, die mich interessieren, mir nicht gerade in Beer Sheva über den Weg laufen. Oder sonst wo in Israel“, setzte er schulterzuckend hinzu.
Menachem hatte begonnen, sein Schnitzel zu schneiden. Auf Kongressen, bei denen Kost und Logis mit eingeschlossen sind, wird im Allgemeinen in der Küche über die Speisenfolge entschieden. Abgesehen von den Gerichten für die Vegetarier – die in dem Jahr eingeführt wurden, als die Kirchberg-Konferenz in Udaipur stattfand und alle Teilnehmer bis auf die Inder am Ende Durchfall hatten –, wurde nur Table d’hôte serviert, und man aß, was einem vorgesetzt wurde. So verhielt es sich auch in diesem Jahr; und natürlich bestand die Verpflegung aus den üblichen Kalorienbomben der österreichischen Küche.
„Wie ich sehe, sind Sie in der Arbeitsgruppe ‚Lokale und regionale Konflikte‘“, fuhr Melanie fort. „Sind Sie deshalb hier?“
„Wir sollten essen, bevor alles kalt wird“, sagte Menachem. „Ich habe gelernt, mit vollem Mund zu sprechen“, setzte er hinzu, „auch wenn sich das angeblich nicht gehört. Jedenfalls hat man mir das in Afrika beigebracht.“
„In Afrika?“
„Später“, sagte er. „Sie fragten nach lokalen und regionalen Konflikten. Die Israelis wurden in beide hineingeboren, und wir stecken noch immer mittendrin. Anfang der Sechzigerjahre waren wir die Underdogs, aber jetzt?“ Er kaute auf seinem Schnitzel herum, als wäre es ein lokaler Konflikt, den es auszumerzen galt. „Wir sind immer in der Defensive. Steht alles im Titel meines Beitrags.“ Er fuchtelte mit der Gabel, als läge der Tagungsband vor ihnen. „ ‚Anmerkungen zu einem Artikel von M. M. El-Gammal mit dem Titel Israels militärische und nukleare Alternativen zum Frieden‘. Ich habe ihn geschrieben, weil ich schon vor mir sehe, wie beifällig die Briten und Holländer nicken werden, wenn El-Gammal morgen Vormittag seine Ansichten von sich gibt. Haben Sie seinen Artikel gelesen?“
Melanie schüttelte den Kopf. „Ich bin in der Arbeitsgruppe ‚Bevölkerungsfragen‘.“
„Lohnt sich auch nicht“, sagte er abschätzig, um dann eine Gabel voll Kartoffelpüree zu nehmen. Als er weitersprach, kam es Melanie so vor, als wende er sich an ein größeres Publikum als nur an sie. „Es sollte mich nicht wundern, wenn die Briten El-Gammal zustimmen“, sagte er. „Bei den meisten von denen, die hier sind, braucht man nur ein wenig an der Oberfläche zu kratzen und schon kommt unter ihren zerknautschten Tweedjacketts Lawrence von Arabien zum Vorschein. Was mir dagegen Sorgen macht, sind die Holländer. Darum habe ich El-Gammals Artikel ernst genommen und meine Widerlegung zu Papier gebracht. Aber das ist nicht der einzige lokale Konflikt auf unserer Tagesordnung. Früher waren es Vietnam und Biafra und die Tschechoslowakei; heute sind es Kambodscha, Nordirland und natürlich wie eh und je der Nahe Osten. Aber sagen Sie, warum hat man Sie eingeladen?“
„Ich bin bei der REPCON-Stiftung. Die amerikanische Delegation hat beschlossen, mich mitzunehmen.“
„Nie davon gehört. Was macht sie?“
„Geld verteilen.“
„Tatsächlich?“ Menachem grinste und tat so, als würde er näher rücken. „Wieviel Geld?“
Er ist genau wie alle anderen, dachte Melanie.
„Das war ein Scherz“, sagte er, als hätte er ihre Gedanken gelesen. „Aber wie der Verwaltungschef jeder Universität mache ich es mir zur Aufgabe, über Stiftungen Bescheid zu wissen. Wieso habe ich dann noch nie von Ihrer gehört?“
„Vielleicht, weil wir für Sie zu klein sind. Oder zu spezialisiert.“
„Wie klein und wie spezialisiert?“
„Klein verglichen mit Ford oder MacArthur. Wir vergeben weniger als 20 Millionen Dollar im Jahr.“
„Das nennen Sie klein? Dann muss Ihr Stiftungskapital mindestens 400 Millionen Dollar betragen. Für Negev-Verhältnisse ist das eine Riesensumme.“
Melanie zuckte die Schultern. „Wir sind sehr spezialisiert. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die menschliche Fortpflanzung. REPCON steht für Reproduktion und Kontrazeption. Und wir sind viel kleiner, als Sie denken, da wir von unserem Kapital nicht leben müssen. Unsere Gründerin hat nämlich bestimmt, dass das ganze Geld innerhalb von 20 Jahren ausgegeben werden muss. Wenn das geschehen ist, wird REPCON aufgelöst. Falls innerhalb von 20 Jahren keine Lösungen gefunden werden, sagte sie, geht die Welt ohnehin den Bach runter.“
„Sie?“
„Athena Campobello. Eine bemerkenswerte Frau. Ich werde Ihnen bei Gelegenheit einmal ihre Geschichte erzählen.“ Sie sah ihn abschätzend an. „Dann können wir also gleich nach Ihrer Rückkehr an die Ben-Gurion-Universität mit einem Antrag rechnen?“
„Reproduktionsbiologie?“, sagte er nachdenklich. „Da muss ich mich erst erkundigen, was auf diesem Gebiet bei uns läuft.“
Melanie hob den Zeigefinger. „Reproduktionsbiologie beim Menschen. Oder zumindest Arbeiten, die sich auf den Menschen anwenden lassen. Ehrlich gesagt dachte unsere Gründerin in erster Linie an Geburtenkontrolle, aber seit ich dort angefangen habe, stelle ich fest, dass die meisten Anträge aus der entgegengesetzten Richtung kommen: Unfruchtbarkeit, In-vitro-Fertilisation, Manipulationen ex utero …“
„Und um die Männer kümmern Sie sich gar nicht?“, fragte er plötzlich so laut, dass sich an den Nebentischen mehrere Köpfe nach ihm umdrehten.
Melanie Laidlaw war verblüfft. „Im Gegenteil“, sagte sie ruhig. „Wir fördern Projekte auf dem Gebiet der männlichen Reproduktion. Unsere Mrs. Campobello interessierte sich nämlich in Sonderheit für die Probleme des Mannes: Empfängnisverhütung durch den Mann für alle Welt, Unfruchtbarkeit beim Mann bei sich zu Hause.“
„Wirklich?“, sagte er und rückte näher. „Erzählen Sie mir mehr darüber.“ Der Gefühlsausbruch oder was immer es gewesen sein mochte, war ebenso schnell vergangen, wie er gekommen war.
„Über Athena Campobello?“
„Nein. Darüber, was Sie gegen Unfruchtbarkeit beim Mann unternehmen.“
„Wir unternehmen nichts dagegen. Wir unterstützen lediglich die Arbeit anderer.“
3
„Reproduktionsbiologie? Sie meinen doch sicher weibliche Reproduktionsbiologie. Wieso kümmert ihr Männer euch eigentlich nie um eure Rolle bei der Fortpflanzung?“
Obwohl die Frage der Frau an ihren Nachbarn gerichtet war, hatte sie so laut gesprochen, dass alle am Tisch sie hören mussten. Der Anlass war das alljährliche Bankett, um Spender für die Brandeis-Universität zu gewinnen, und so fühlten sich die Gäste berechtigt, Unmutsbekundungen zu äußern. Diese wurden ausnahmslos höflich behandelt, insbesondere wenn sie von potenziellen Geldgebern kamen, die eine Privatuniversität wie die Brandeis eventuell unterstützen wollten.
Der Tischnachbar der Frau und Gegenstand ihres Unmuts war Professor Felix Frankenthaler, einer der Stars der Brandeis-Universität und an diesem Abend eingeladen, um den Gästen darzulegen, welchen Gegenwert sie für ihre Spenden erwarten konnten. „Ihre Frage ist durchaus angebracht“, erwiderte Frankenthaler diplomatisch. „Ich muss gestehen, dass ich selbst mir meine Reputation im Eileiter erworben habe. Obgleich“, er hob die Hand, um nicht unterbrochen zu werden, „sich meine Arbeit im Grunde mit der Beweglichkeit der Spermien befasste.“
„Und?“, fragte die Frau in einem Ton, der inzwischen eher amüsiert als aggressiv klang. „Was haben Sie denn nun in letzter Zeit so für mich getan?“
„Nun“, verkündete Frankenthaler laut genug, dass die anderen Gäste am Tisch sich ihm zuwandten, „wir sind jetzt der biologischen Funktion von Stickoxid dicht auf den Fersen.“
Die Enttäuschung der Frau war deutlich herauszuhören. „Lachgas? Was hat denn das mit ...“
„Gnädige Frau!“, Frankenthalers Diplomatie verflüchtigte sich zusehends. „Lachgas ist Distickstoffoxid, N2O, wie der Chemiker sagt, oder Distickstoffmonoxid. Wir arbeiten mit Stickoxid, NO, auch Stickstoffoxid genannt. Oder, genauer gesagt, mit Stickstoffmonoxid. Um ganz genau zu sein“ – ohne es zu bemerken, hatte sich Frankenthaler auf den schlüpfrigen Pfad der chemischen Pedanterie begeben – „arbeiten wir und viele andere an der biologischen Funktion verschiedener Redoxformen von Stickoxid ... Redoxformen“, setzte er eilends hinzu, „bedeuten schlicht, dass Elektronen ausgetauscht wurden, was aber bei dem, was ich Ihnen erläutern möchte, ohne Belang ist.“
Vermutlich wäre es nur eine Frage von Sekunden gewesen, bis Frankenthaler gemerkt hätte, dass die meisten seiner Zuhörer ihm nicht mehr folgen konnten, doch der Mann ihm gegenüber rettete die Situation.
„Ich dachte, Stickoxid sei ein Industriegas und ein giftiges obendrein. Hat es nicht etwas mit Autoabgasen, der Zerstörung der Ozonschicht und dem sauren Regen zu tun?“
„Genau!“, rief Frankenthaler aus. „Aber ist Ihnen bekannt, dass es auch von Fruchtfliegen, Hühnern, Forellen und Molukkenkrebsen produziert wird? Und sogar vom Menschen? Es ist schon erstaunlich, dass ein Molekül mit einer derart einfachen chemischen Struktur und einer derartigen Vielzahl von biologischen Funktionen sich bis vor wenigen Jahren der Entdeckung entzogen hat. Trotz seiner äußerst kurzen Halbwertszeit – dem Hauptgrund, weshalb die Produktion von NO im Körper so lange übersehen wurde – steht heute fest, dass NO in kleinsten Mengen einer der wichtigsten biologischen Botenstoffe ist.“ Er hielt inne, da er sicher sein wollte, dass seine Worte sich allen einprägten. Was sie auch taten. Seine Zuhörer – ob sie nun wussten, was ein biologischer Botenstoff war, oder nicht – hatten aufgehört zu essen. Genau um so etwas zu hören zu bekommen waren sie schließlich hier.
„Stickoxid spielt eine Rolle bei der Blutgerinnung, bei der Zerstörung von Tumorzellen durch das körpereigene Immunsystem, bei der Neurotransmission und ganz besonders bei unserem Vorhaben.“ Frankenthaler sah die Frau, die sein Interesse an der männlichen Reproduktion angezweifelt hatte, direkt an. „Nämlich bei der Blutdruckregulierung.“
„Eines unserer Probleme“, fuhr er mit Verschwörermiene fort, als wüssten seine Zuhörer ganz genau, worum es ging, „besteht darin, dass wir noch nicht wissen, welche der verschiedenen Formen von Stickoxid – die neutrale, die negativ oder die positiv geladene – welche biologische Funktion hat.“
„Das mag ja alles hochinteressant sein“, sagte seine Tischnachbarin, „aber was hat das Ganze mit der Fortpflanzungsbiologie des Mannes zu tun?“
Frankenthaler war sprachlos. Wollte die Frau ihn auf den Arm nehmen? „Wissen Sie, was das Corpus cavernosum ist?“, erkundigte er sich, wobei ein leicht verschlagenes Lächeln um seine Lippen spielte.
„Nein“, erwiderte sie. „Buchstabieren Sie es.“
„Das tut nichts zur Sache. Das Corpus cavernosum, auch Schwellkörper genannt, ist das wichtigste erektile Gewebe des Penis.“
„So, so“, sagte sie und grinste zum ersten Mal. „Darüber müssen Sie uns mehr erzählen.“
„Stickoxid spielt eine Rolle bei der Entspannung der glatten Muskulatur des Schwellkörpers ...“
„Sagten Sie ‚Entspannung‘?“, unterbrach sie ihn. „Ich dachte, Sie wollten, dass er ...“
„Gnädige Frau!“ Gott sei Dank ist das keine Studentin von mir, dachte er. „Lassen Sie mich ausreden. Ich wollte sagen, dass aufgrund der durch Stickoxid bewirkten Entspannung der glatten Muskulatur des Schwellkörpers mehr Blut in den Penis fließt, wodurch“, er verbeugte sich in Richtung der Frau, als wollte er sie zum Tanz auffordern, „genau das erzielt wird, woran Ihnen so viel liegt: das Anschwellen des Penis. Anders ausgedrückt, Sie bekommen einen steifen ...“ Die Frau hatte ihn so irritiert, dass er versucht war, Schwanz zu sagen, sich aber gerade noch zurückhalten konnte. „Penis“, schloss er etwas lahm.
„Sprechen Sie nur weiter“, sagte sie mit einer Handbewegung, die den ganzen Tisch einschloss, „wir sind alle ganz Ohr. Was machen Sie, hier an der Brandeis-Universität, denn nun, um steife Schwänze zu bekommen?“
Frankenthaler lief rot an. „Einer meiner gescheitesten Postdoktoranden“, sagte er so ruhig, wie es ihm unter den gegebenen Umständen möglich war, „versucht derzeit, Stickoxid freisetzende Substanzen zu entwickeln, die für den Penis geeignet sind. Zur Behandlung von Impotenz“, erläuterte er.
„Ich wusste es ja!“, rief die Frau triumphierend aus. „Weibliche Fortpflanzungsbiologie heißt für Sie schlicht und einfach Empfängnisverhütung. Aber wenn ihr Männer euch mit eurem eigenen Geschlechtsapparat befasst, dann macht ihr euch nur Sorgen um ...“
„Moment mal!“ Inzwischen war es Frankenthaler völlig egal, dass er potenziellen Geldgebern eigentlich Honig um den Bart schmieren sollte. „Wenn Sie ihn nicht hochkriegen“, fauchte er, „kriegen Sie ihn auch nicht rein. Und erst dann fangen wir an, uns um Verhütungsmittel Sorgen zu machen. Und zu Ihrer Information, die Person, die in meinem Labor daran arbeitet, ist eine Frau!“
Von da an verlief die Unterhaltung nur noch schleppend.
„Renu“, erkundigte sich Frankenthaler einige Wochen nach dem Debakel bei dem Bankett, „könnten Sie sich entschließen, für einige Monate nach Israel zu gehen?“
„Warum Israel?“
Jedes Mal, wenn Renu Krishnan Zeit zum Nachdenken brauchte, stellte sie eine Frage.
Frankenthaler schwang sich auf einen Laborhocker. „Sie arbeiten in einem der aufregendsten Labors, die es in der Stickoxid-Biologie gibt, aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen: Brandeis hat zwar das hervorragende Rosenstiel Basic Medical Sciences Research Center, in dem Sie die Ehre haben zu arbeiten“, sagte er und zwinkerte ihr verschwörerisch zu, „aber keine medizinische Fakultät. Und wie wir beide wissen, sind die meisten Kliniker in Boston nur an Frauen interessiert und nicht an Männern.“ Großer Gott, dachte er, ich klinge ja wie dieses unmögliche Weib auf dem Bankett. „In Israel dagegen könnten Sie auf einen der besten Andrologen der Welt zurückgreifen, auf Jehuda Davidson am Hadassah Medical Center. Er ist Kliniker, ein wahrer Meister, was Unfruchtbarkeit beim Mann und Impotenz betrifft.“
„Und wie lange soll ich dort arbeiten?“
Frankenthaler wedelte entwaffnend mit den Händen. „Das überlasse ich ganz Ihnen. So lange Sie eben brauchen um herauszufinden, wie sich Stickoxid-Releaser klinisch am besten verabreichen lassen. Ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr?“
„Wann?“
„Anfang nächsten Jahres, schlage ich vor. Jerusalem ist im Frühling sehr schön. Außerdem werde ich wahrscheinlich so lange brauchen, um die nötigen Mittel aufzutreiben.“
„Wie wollen Sie das anstellen?“ Renu Krishnan war erst seit etwas über einem Jahr als Postdoktorandin bei ihm, hatte jedoch schon herausgefunden, dass Geschick bei der Beschaffung von Drittmitteln ebenso wichtig war wie alles, was sie im Labor lernen konnte. „Der Stichtag für Anträge auf NIH-Gelder war doch bereits. Und der nächste ist erst im Januar, stimmt’s? Bis die Bürokraten eine Entscheidung treffen, ist es Sommer oder Herbst.“
Frankenthaler nickte beifällig. Ist doch schön, wenn eine Postdoktorandin die Feinheiten der Geldbeschaffung zu würdigen weiß, dachte er. „Ich will mich nicht mit staatlichen Stellen herumschlagen. Schließlich geht es ja um keinen großen Betrag, sondern um etwa 25 000 Dollar. Ich werde es bei der REPCON versuchen. Jede Wette, dass sie mitmachen, vor allem wenn sie hören, dass sie dadurch eine Frau unterstützen, die auf dem Gebiet der männlichen Reproduktion arbeitet. Auch wenn es dabei mehr um Impotenz als um Empfängnisverhütung geht“, setzte er nachträglich hinzu, als spräche er noch immer seine Kritikerin von dem Bankett an.
„Und warum sollte die REPCON so viel schneller reagieren, selbst wenn sie Ihren Antrag genehmigt?“
Frankenthaler taxierte die junge Frau mit einem prüfenden Blick. Es ist an der Zeit, ein paar Weisheiten weiterzugeben, dachte er. „Zunächst einmal gibt es bei einer privaten Stiftung wie der REPCON weniger Bürokratie. Zweitens finanzieren sie nur Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Reproduktionsbiologie, vorzugsweise solche, die sich auf den Menschen anwenden lassen. In unserem Antrag werden wir unterstreichen, dass wir uns genau darauf konzentrieren.“ Er hob warnend den Zeigefinger. „Und was das Wichtigste ist: 25 000 Dollar sind ein Betrag, der im freien Ermessen der Leiterin der Stiftung liegt. Der Antrag muss also keine Ausschüsse durchlaufen und keine Termine einhalten.“
„Kennen Sie die Dame?“
Professor Felix Frankenthaler erlaubte sich, wiederum verschwörerisch zu zwinkern, was er in Gegenwart seiner anderen Postdoktoranden niemals getan hätte. Doch er fand, dass Renu Krishnan es an diesem Nachmittag verdient hatte.
„Allerdings. Ich kannte sie schon, als sie noch mit Justin Laidlaw verheiratet war.“
4
„Hätten Sie Lust, nach der Abendsitzung mit uns in die Sauna zu kommen?“, sagte Menachem, als er den Stuhl vom Tisch zurückschob. Im Speisesaal herrschte Aufbruchstimmung, da es Zeit wurde, sich in die Schule zu begeben, wo die Abendveranstaltung stattfand.
„Uns?“, fragte Melanie. „Wer ist uns?“ Seine Frage hatte beiläufig geklungen, als erkundigte er sich lediglich, ob sie Lust hätte, mit ihm einen Kaffee trinken zu gehen. Dennoch schaltete sich Melanies geistiges Radar ein und begann zu arbeiten, wenn auch, wie sie bemerkte, nicht ganz so gründlich wie sonst. Dieses Mal schien es eher oberflächlich abzutasten.
Menachems Antwort klang entwaffnend genug. „Wer weiß? Aber es ist bestimmt eine amüsante Gesellschaft.“
„Das klingt so, als ob das eine Tradition wäre.“
„Ist es auch“, sagte er nickend. „Ich war dabei, als sie begründet wurde – 1973 auf der Konferenz in Aulanko, nördlich von Helsinki. Damals hatten die finnischen Gastgeber an einem nahe gelegenen See natürlich auch eine mit Holz geheizte Sauna mit allem Drum und Dran zur Verfügung gestellt, einschließlich der obligatorischen Birkenzweige.“ Er lachte in sich hinein. „Auf die Selbstkasteiung habe ich allerdings verzichtet. Die einzigen Frauen, die die Sauna am Anfang benutzten, waren die Skandinavierinnen – Ehefrauen, Studentinnen aus dem Mitarbeiterstab, und alle ungeniert splitterfasernackt.“ Menachem grinste dabei spitzbübisch und bildete anerkennend mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis. „Das hat sich bald herumgesprochen, und gegen Ende der Tagung war die Sauna der Ort geworden, wo man sich nach der Abendveranstaltung in gemischter Gesellschaft traf – zumindest die abgehärteten Typen, denen es Spaß machte, in den eiskalten See zu springen.“ Menachem lümmelte sich wieder auf seinen Stuhl, da er vergessen hatte, dass sie eigentlich gehen mussten.
„Jemand, ich glaube, es war Karl Popper, hat einmal gesagt, die meisten Naturwissenschaftler seien bescheiden. Vielleicht hat er das auch nur über die Großen gesagt. In beiden Fällen ist es eine lobenswerte Erfindung – aber eben eine Erfindung. Sehen Sie sich nur mal auf dieser Tagung um. Unter den ganzen menschlichen Eigenschaften, und es gibt hier eine Menge davon, ist die Bescheidenheit am seltensten zu finden. Bescheidenheit gehört einfach nicht zu ihrem intellektuellen Marschgepäck.“ Er lachte entwaffnend. „Ich weiß nicht, warum ich von ‚ihrem‘ spreche; schließlich gilt das auch für mich. Aber was immer auch das Gegenteil von Bescheidenheit sein mag, es geht verloren, sobald man nackt in der Sauna sitzt. Im schwachen dunstigen Licht wird ein schmerbäuchiger nackter Mann mit dicken Brillengläsern auf das Wesentliche reduziert.“ Wieder lachte er. „In Israel war ich nie in die Sauna gegangen, aber jetzt bin ich süchtig danach. Und die hiesigen Organisatoren haben es irgendwie geschafft, eine zu installieren. Ich bin schon gespannt, wer alles da sein wird.“
„Kommen auch Frauen?“, fragte sie.
„Einige von den Skandinavierinnen und den Deutschen bestimmt.“ Er zuckte die Schultern. „Und Sie? Waren Sie schon einmal in einer Sauna?“
Natürlich war sie schon in einer Sauna gewesen. Seit sie vor zwei Jahren mitten nach Manhattan gezogen war, hatte sich Joggen – ihr liebster Ausgleichssport – als zu kompliziert erwiesen. Tagsüber war sie zu beschäftigt, und um abends zu joggen, war sie zu allein stehend. Melanie war daher in einen Fitnessclub für Frauen eingetreten, wo sie Aerobic machte und schwamm und anschließend in die Sauna ging. Sie wusste, was Menachem meinte, als er von süchtig sprach. Bei Melanie war nicht nur die Sauna zur Sucht geworden, sondern auch die Nacktheit – eine Nacktheit, die nur wenig von der feuchtheißen Schwüle gemildert wurde, in der sich kein Make-up und kein äußerer Schein aufrechterhalten ließen.
Es machte Melanie Freude, die vielförmigen Körper in der Sauna ihres Clubs zu betrachten, besonders weil sie sich ihres eigenen nicht zu schämen brauchte. Er gefiel ihr sogar ausgesprochen. Ihre Muskeln waren fest und gut proportioniert und hatten, wie man so sagt, „Definition“. Alle Stellen, auf die es ankam, waren genau richtig: Bauch, Oberschenkel, Gesäß, selbst ihre eher kleinen spitzen Brüste.
Aber Männer? Seit Justins Tod hatte sie keinen nackten Mann mehr gesehen. Doch der Gedanke, den Mann nackt zu sehen, der sie erst vor ein paar Stunden gefragt hatte, ob sie mit ihm schlafen wolle, reizte sie. Er reizte sie deshalb, weil ihr, nach Überwindung einer Phase akuter Verlegenheit, dämmerte, dass Dvirs im Grunde unverfrorene Bemerkung sie so aufgegeilt hatte wie schon seit Monaten nichts mehr. Oder war das etwa schon Jahre her? In ihrer Eigenschaft als geschäftsführende Direktorin der REPCON-Stiftung kam sie ständig mit Männern in Kontakt, aber auf die eine oder andere Weise wollten alle meistens nur Geld von ihr. Mehr als einmal hatte sie sich in die Doris Dukes und Barbara Huttons dieser Welt hineinversetzt gefühlt, die nie sicher sein konnten, dass ein Mann etwas anderes als ihre Millionen sah.
Bei Menachem war das anders gewesen. Als sie sich kennen lernten, hatte er keine Ahnung, wofür REPCON stand. Das hatte Menachem in Melanies Augen zu einem so seltenen akademischen Vogel gemacht, dass sie bereit war, über alle Unvollkommenheiten seines Gefieders hinwegzusehen. Aber was war die Kleiderordnung in einer gemischten Sauna auf einer Kirchberg-Konferenz? Oder überhaupt in einer gemischten Sauna? Melanie war noch nie in einer gewesen.
„Kommen Sie?“, fragte Menachem auf dem Weg zur Plenarsitzung in der Turnhalle der örtlichen Volksschule, die die Konferenz während der langen Sommerferien für eine Woche gemietet hatte. Die kleineren Arbeitsgruppen, in denen jeweils höchstens zwanzig Personen saßen, tagten in den Klassenzimmern.
„Mal sehen“, sagte sie.
Auf der Plenarsitzung konnte sie Menachem nirgends entdecken. Fast hätte sie die Idee mit der Sauna aufgegeben, nachdem sie eine Anwältin von einer Washingtoner Denkfabrik gefragt hatte, ob sie anschließend mit ihr in die Sauna käme. Die Frau schien den Vorschlag in Erwägung ziehen zu wollen, bis Melanie erwähnte, dass auch Männer anwesend sein würden.
„Dann lieber doch nicht“, sagte die Frau nach kurzem Zögern. „Außerdem habe ich keinen Badeanzug dabei.“
Das Wort „Badeanzug“ erhöhte die Hemmschwelle für Melanie nur noch mehr. Trug man hier etwa Badeanzüge in der Sauna? In ihrem Fitnessclub waren Badeanzüge in der Sauna verpönt; Frauen, denen ihre Cellulitis allzu peinlich war, bedeckten die anstößigen Bereiche schlicht mit einem Handtuch. Vergiss die Sauna, dachte sie, der Aufwand lohnt sich nicht.
Doch als sie dann in ihrem Zimmer im Gasthof zur Steinwand war und die Hose ausgezogen hatte, hielt sie plötzlich inne. Vielleicht hing ihr Zögern mit einem Gefühl gereizter Unerfülltheit zusammen oder aber mit dem Anblick, den sie im Ganzkörperspiegel an der offenen Badezimmertür erhaschte. Wann immer Melanie auf einen Spiegel stieß, betrachtete sie sich prüfend mit einer gesunden Mischung aus Selbstzufriedenheit und Unsicherheit. Als sie an diesem Abend auf ihr Spiegelbild starrte, ertappte sie sich dabei, dass sie sich vorzustellen versuchte, wie sie auf einen Mann wirkte. Zu der Hose hatte sie silberne Lurex-Kniestrümpfe und schwarze, halbhohe Sandaletten getragen. Ohne die Hose lag nichts als nacktes Fleisch zwischen dem oberen Rand ihrer glitzernden Strümpfe und ihrem Bikini-Slip. So wie sie da stand, in ihrem schwarzen Rollkragenpulli und teilweise entblößt, sah sie eindeutig wie eine Stripperin aus. Die Verwandlung der berufstätigen Akademikerin in eine elegante Nutte, bewirkt allein durch das Ablegen einer gut geschnittenen Hose, verblüffte sie. Sie zog den Pulli aus und begann sich wieder zu mustern, wobei sie sich langsam um die eigene Achse drehte und den Büstenhalter ablegte, um ihre Brüste zu zeigen.
Sie brauchte nur wenige Minuten, um Hose und Pullover wieder anzuziehen, sich die Zähne zu putzen (wieso das denn vor der Sauna, hätte sie sich unter anderen, weniger von einem plötzlichen Impuls bestimmten Umständen gefragt), ein Badetuch zu schnappen und die Tür hinter sich zuzuschlagen. Obwohl Melanie normalerweise zwanghaft ordentlich war, machte sie sich nicht die Mühe, den abgelegten Büstenhalter in einer Schublade zu verstauen, sondern ließ ihn auf dem Bett liegen. Dies geschah unbewusst, nicht aber, dass sie den Zimmerschlüssel mitnahm, statt ihn an der Rezeption abzugeben.
Im einzigen Umkleideraum sah es wüst aus. Die Wasserpfützen auf dem Boden und die Kleidungsstücke, die auf der Bank herumlagen oder an Wandhaken hingen, gaben einem das Gefühl, in einem Umkleideraum für Männer zu sein. Melanie widerstand dem Drang, durch das kleine Fenster der schweren Holztür in die Sauna zu spähen, deren trübes Licht die Szene drinnen nur ungenügend beleuchtete. Statt dessen inspizierte sie die Kleidungsstücke. Von einer Ausnahme abgesehen – einem grünen Wollrock, der sorgfältig gefaltet auf intimeren Kleidungsstücken lag – handelte es sich um die übliche Unisex-Kollektion aus Jeans und Pullovern. Eine rasche Zählung der Schuhe deutete auf acht Saunagäste hin, darunter mindestens eine Frau.
Was soll’s, dachte sie, ich kann mich genauso gut auch ausziehen. Das alles andere als üppige Badetuch bedeckte ihr dichtes Schamhaar und ihre Brüste nur knapp, würde aber, wie sie hoffte, im Sitzen seinen Zweck erfüllen.
In der feuchtheißen, schwach beleuchteten Sauna konnte Melanie kaum etwas sehen. So blieb sie in der offenen Tür stehen und starrte blind vor sich hin. Erst der knappe Befehl „Tür zu!“ trieb sie hinein, wo sie sich tastend zurechtfinden musste.
Die untere Bank, auf der hinten jemand lag und vorne vier weitere Personen saßen, schien voll zu sein. Auf der oberen Stufe, die den übrigen Anwesenden vermutlich zu heiß war, hatte sich ein einzelner Gast ausgestreckt, neben dessen Beinen sich Melanie nun zusammenkauerte. Das Geschlecht ihres Kojengenossen war eindeutig zu erkennen, das der unteren Stufe, wo alle wie im Wartezimmer aufgereiht saßen, dagegen weniger augenfällig. Die nackten Brüste und das zu einem Turban gebundene Handtuch der Person direkt unter ihr gab Melanie das tröstliche Gefühl, dass zumindest noch ein weiteres weibliches Wesen anwesend war. Aber wer waren die anderen? Von ihrer hohen Warte aus lieferten das gelegentliche Gemurmel zweier Gestalten und die nur undeutlich erkennbaren Silhouetten der übrigen kaum Anhaltspunkte.
„Ganz schön heiß“, sagte sie laut zu niemand Speziellem, in der Hoffnung, dass ihre Stimme irgendwen auf ihre Anwesenheit aufmerksam machen würde. Und wo war eigentlich Menachem, fragte sie sich. Fast wie auf Kommando ging die Tür auf und zwei nackte Männer stürmten herein.
„Ist das kalt!“, rief Menachem aus. „Verzeihung“, sagte er, während er an der Frau mit dem Turban vorbei nach dem Wasserkübel griff und ihn über den heißen Steinen ausleerte. Die zischend aufsteigende Dampfwolke raubte Melanie praktisch die Sicht auf die beiden Männer, die auf ihren Balkon geklettert kamen, auf dem es plötzlich ziemlich eng zu werden drohte. „Sie gestatten“, murmelte Menachem, der den Bereich hinter Melanie zu erreichen versuchte.
„Da sind Sie ja!“, rief er aus. „Ich dachte schon, Sie würden nicht kommen.“
„Ich war noch nicht müde, als ich ins Hotel kam“, erwiderte sie.
„Mir fallen zwar wesentlich bessere Gründe ein, um herzukommen, aber egal. Herzlich willkommen. Sie kennen sich?“, fragte er und deutete auf den anderen nackten Mann, der sofort die Hand ausstreckte.
„Guten Abend“, sagte Melanie und merkte, dass das Handtuch von ihren nassen Brüsten glitt, als der Mann, an Menachem vorbei, ihre Hand schüttelte und nicht mehr loslassen wollte. Die Art und Weise, wie er ihre Brüste betrachtete, ließ sie wünschen, sie könnte das Handtuch enger um sich ziehen.
„Genug“, sagte Menachem lachend und trennte sie wie ein Ringrichter. „Bleiben wir ein paar Minuten sitzen, bis ich wieder richtig aufgeheizt bin. Danach können Sie ja mit mir in den See hüpfen. Sie können doch schwimmen, oder?“
Melanie nickte nur. Zwei von den Männern unter ihr gingen, desgleichen schließlich auch der liegende schweigsame Typ hinten, sodass sie sich ausbreiten konnten. Melanie schwang sich mit geschlossenen Beinen herum, das Handtuch um die Mitte gelegt. In diesem Stadium ihre Brüste zu bedecken erschien ihr ziemlich sinnlos. Wer immer ihre Brüste hatte beäugen wollen, hatte dazu reichlich Gelegenheit gehabt. Außerdem ließen sie sie jünger aussehen. Jedenfalls hatte Justin das immer gesagt.
Wie auf ein Stichwort hin erhob sich die andere Frau, was die Galerie veranlasste, ihre Aufmerksamkeit ihr zuzuwenden. Nach Melanies Einschätzung war sie um die Sechzig und Skandinavierin in Anbetracht der Nonchalance, mit der sie nun nackt dastand, das Handtuch über dem Arm, als wäre sie im Begriff, einen Salon zu verlassen. Nach ihrem Weggang waren nur noch sie drei in der Sauna.
„Kennen Sie diese Leute?“, fragte Melanie, bemüht, ein unverfängliches Gesprächsthema zu finden, nachdem sie nun praktisch allein waren.
„Nur ein paar davon“, erwiderte Menachem und drehte sich um, die Arme um ein angewinkeltes Knie gelegt. Sein Penis, den Melanie deutlich sehen konnte, war genügend erigiert, um seine beschnittene Vorhaut zu betonen. Einen Moment lang ließ er seine Augen in einer ausgedehnten visuellen Liebkosung über Melanie wandern. Obwohl sein Blick weder lüstern noch besonders aufdringlich war, hinderte er sie doch daran, Menachem zu mustern. „Sie sehen toll aus“, sagte er schließlich anerkennend. „Einfach toll. Inzwischen ist Ihnen sicher ganz schön heiß. Gehen wir ins Wasser“, sagte er und drehte sich dann um, um schnell einige Sätze mit dem Mann hinter ihnen zu wechseln.
„Was für eine Sprache war das?“, fragte sie. Sie schwammen im Teich, beide im Bruststil, und tauchten wie Delphine in regelmäßigen Abständen zum Luftholen auf.
„Arabisch“, sagte er und drehte sich auf den Rücken, um sich treiben zu lassen.
„Und wer war der Mann?“
Menachem rollte sich herum und betrachtete sie mit humorvollem Blick. „Wollen Sie seinen Namen wissen? Den gibt er nicht so leicht preis. Ein Chemiker aus Tunis. Dass er Chemiker ist, hätte ich auch erraten, wenn er es mir nicht gesagt hätte. Er hat sich nämlich die Hände gewaschen, bevor er urinieren ging. Das tun nur Chemiker.“
„Wo haben Sie denn diese nützliche Information aufgeschnappt?“
Menachem, der Wasser zu treten begonnen hatte, grinste sie an. „Ich habe eben gelernt, auf derlei Dinge zu achten.“
„Ach so“, sagte sie. „Aber ich wusste gar nicht, dass wir einen tunesischen Vertreter unter uns haben.“
„Er ist kein Tunesier. Er kommt nur aus Tunis.“
„Wie darf ich das verstehen?“
„Er ist Palästinenser und erst im letzten Moment zu den arabischen Delegierten hinzugekommen. Deshalb steht er auch nicht auf der ursprünglichen Teilnehmerliste. Gehen wir noch einmal in die Sauna. Vielleicht haben wir sie jetzt ganz für uns.“
„Im Nahen Osten küsst man die Hand, die man nicht abhacken kann“, sagte Menachem, während er die Socken anzog. „Es gibt in meiner Regierung viele, die zumindest eine Hand abhacken wollen, aber ich halte das nicht für sehr realistisch. Genauso wenig wie die Obsession der PLO, uns beide Hände abzuhacken. Ich glaube, Ahmed Saleh gehört zu den Küssern, aber das finde ich bestimmt noch heraus.“
„Genug davon“, fuhr er fort. „Ich möchte Ihnen etwas sagen. Als ich Sie in der Sauna sah, war ich überrascht und glücklich.“
„Das konnte man sehen“, sagte Melanie trocken.
„Als ich Sie nach dem Abendessen einlud, mit in die Sauna zu kommen, war mein Motiv gewissermaßen salomonischer Art.“
„So?“, sagte Melanie gedehnt, um dem Wort einen koketten Beiklang zu geben.
„So ähnlich wie bei Salomo, als er die Königin von Saba aufforderte einzutreten.“
„Aha! Jetzt bekomme ich also endlich den berühmten Menachem-Dvir-Vortrag zu hören, den ich mir, wie Le Gourou meinte, nicht entgehen lassen dürfe.“
Menachem hatte sich gerade die Schuhe zugeschnürt. Als er sich aufrichtete, erhaschte Melanie einen unerwarteten, fast schüchternen Ausdruck in seinem Gesicht.
„Hier?“, fragte er. „Im Umkleideraum?“
Melanie musste lachen. „Sie haben Recht. Der Ort ist weder sehr romantisch noch besonders sauber. Dann erzählen Sie es mir eben, während Sie mich in mein Hotel begleiten.“
Es war eine klare Nacht. Menachem schlug vor, den Weg durch den Wald zu nehmen. „Sie scheinen sich hier auszukennen“, bemerkte Melanie.
„Ich war schon einmal zu einer Tagung hier. Und das Einzige, was es bei uns im Negev nicht gibt, sind solche Wälder. Darum erkunde ich sie immer, wenn ich in Europa bin.“
Sie gingen einige Minuten schweigend weiter, ehe Menachem fortfuhr: „Gewöhnlich gehe ich allein spazieren – auch zu Hause. Aber heute ...“ Er zögerte und griff dann nach ihrer Hand. „Darf ich?“
„Aber natürlich.“ Sie drückte seine Hand. „Und jetzt“, sagte sie und drückte sie noch einmal, „müssen Sie mir von Salomo und der Königin von Saba erzählen.“
„Na schön“, sagte er glucksend in der Dunkelheit, „aber nur die Kurzversion. Ich kann doch keinen Vortrag halten, während ich Händchen haltend mit einer Frau spazieren gehe.“
Melanie zog ihre Hand zurück. „Wenn das Ihr einziges Problem ist, lasse ich Sie gerne los.“
„Nein“, sagte er schnell und griff wieder nach ihr. „Jetzt, wo ich Sie berührt habe, brächte ich ohne Körperkontakt kein einziges Wort heraus.“
Komisch, dachte sie, nachdem wir vorhin nackt nebeneinander gesessen haben, benehmen wir uns jetzt wie romantische Teenager. Doch sie verstand es, war sogar sicher, dass auch Menachem den Unterschied zwischen vorhin und jetzt verstand. Als sie zum Teich gelaufen waren, hatte sie das Handtuch erst im letzten Moment fallen lassen. Und hinterher hatte sie ihn gebeten, noch im Wasser zu bleiben. „Bitte warten Sie ein paar Minuten, Menachem. Ich möchte mich nur rasch anziehen.“
„Klar“, hatte er gesagt und war wieder in die Dunkelheit hinausgeschwommen.
„Von den vielen Versionen, die es gibt, ist das die Kürzeste, doch sie sagt am meisten über den König als Mann aus. Salomo hatte gehört, dass die Königin von Saba sehr schön war, dass aber ihre Beine und Füße so haarig waren wie die Beine eines Esels.“
„Jetzt machen Sie aber einen Punkt, Menachem!“, rief Melanie aus. „Woher wissen Sie, dass die Füße eines Esels haarig sind?“
„Sie unterschätzen offenbar meine Qualifikation als Sabaist. Und wie jeder Sabaist weiß, stammt eine der saftigeren Versionen dieser Geschichte aus dem Koran, und genau dort heißt es: ‚Ihre Beine und Füße waren haarig wie die Beine eines Esels.‘ Der Koran schildert auch, wie sie sich Salomos Thron nähert. Ich zitiere wieder.“ Er drückte ihre Hand und blieb stehen, um Luft zu holen.
Sie konnte nur die Umrisse seines markanten Gesichts mit den tief liegenden Augen, den hohen Wangenknochen und den tiefen Furchen darunter sehen. Sie wirkten wie der Missgriff eines Bildhauers, der Grübchen anbringen wollte, mit dem Daumen aber abgerutscht war, sodass stärkere Kerben entstanden, die die Wangenknochen drastisch hervortreten ließen.
„‚Der Boden des Palastes aber war aus weißem, durchsichtigem Glas, unter dem Wasser floss, darin Fische schwammen. Und da sie dies sah, glaubte sie, es sei ein tiefes Wasser, und sie entblößte ihre Beine, um alsbald hindurchzuwaten; und Salomo saß auf seinem Thron am oberen Ende des Palastes, und er sah, dass ihre Beine und Füße wohlgestaltet waren.‘“
„Eine hübsche Geschichte. Und was geschah dann?“
Menachem streckte die Hand aus, um ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen. Die flüchtige Berührung seiner Finger ließ sie erschauern – freudig erschauern.
„Erzählen Sie mir Ihre Version“, sagte er. „Hier im Wald.“
„Erst müssen Sie mir sagen, ob Sie mich deshalb in die Sauna eingeladen haben. Um zu sehen, ob ich haarige Beine habe?“
„Nicht direkt.“
„Sondern?“, drängte sie.
„Sondern“, wiederholte er, „weil Ihr Körper, als wir uns kennen lernten, verhüllt war wie der der Königin von Saba.“
„Und Sie wegen der Hose und des Pullis nicht mit Bestimmtheit sagen konnten, wie ich aussehe?“
„Nicht im Einzelnen.“
Sie hatten die Stelle erreicht, wo der Waldweg auf die Hauptstraße stieß. Als sie eine Straßenlaterne passierten, zog Melanie ihre Hand aus seiner.
„Das hat Ihnen doch hoffentlich nichts ausgemacht?“, fragte er.
„Meinen Sie Ihr Interesse für körperliche Einzelheiten?“
„Das und dass ich Sie wegen der Sauna gefragt habe.“
„Wenn es mir etwas ausgemacht hätte, wäre ich nicht gekommen.“
Sie fragte sich, was er als Nächstes sagen würde, doch Menachem war in Schweigen verfallen. Er hatte die Hände in die Taschen gesteckt, und seine Schritte hallten auf dem Kopfsteinpflaster.
„Wo wohnen Sie?“, fragte sie schließlich. „Mein Gasthof liegt gleich da vorn.“
„Drüben bei der Schule.“ Er deutete mit dem Kopf in die entsprechende Richtung. Er nahm eine Hand aus der Tasche und legte sie sanft auf Melanies Ärmel. „Sie wollten mir doch erzählen, wie die Geschichte mit der Königin von Saba Ihrer Meinung nach weiterging. Ich würde gerne Ihre Version hören.“
„Na schön“, sagte sie und ging weiter. „Sie werden eine noch viel kürzere Variante zu hören bekommen, weil wir nämlich fast da sind. Also: Salomo verliebte sich auf der Stelle in sie und machte ihr einen Heiratsantrag.“
„Entweder sind Sie eine Romantikerin oder Sie mogeln!“, rief Menachem aus.
„Ich bin zwar tatsächlich romantisch – das heißt, wenn die Umstände es zulassen –, aber warum bezichtigen Sie mich der Mogelei?“
„Weil in der Passage, die ich zitiert habe, genau das steht.“ Er schien enttäuscht zu sein. „Kannten Sie die schon?“
„Nein“, sagte sie rasch. „Ich habe mich nur anstelle Salomos auf den Thron versetzt.“
„Nicht an die Stelle der Königin von Saba?“
„Wie denn? Sie hat bislang ja noch nichts gesagt.“
„Stimmt“, sagte er etwas besänftigt. „Ganz so romantisch wie Sie ist der Koran allerdings nicht. Aber da wären wir.“ Er blieb einige Schritte vor dem beleuchteten Schild des Gasthofs zur Steilwand stehen.
„Sie können doch jetzt nicht aufhören!“, rief Melanie aus. „Ich möchte schließlich wissen, wie nahe ich an die Sache herangekommen bin. Ich möchte den Rest der Geschichte hören. Und warum Sie – ein Jude – den Koran zitieren und nicht die Bibel.“
Sie hatte in neckendem Ton gesprochen, doch in Menachems Gesicht spiegelte sich nichts von ihrer Fröhlichkeit wider. „Es ist spät“, erwiderte er, „und es würde zu lange dauern.“
„Sind Sie müde?“, fragte sie.
„Nein, aber ich dachte ...“
„Dann kommen Sie mit rein.“ Sie deutete auf den Eingang. „Ich bin noch hellwach.“
„Nehmen Sie Platz“, sagte sie und zeigte auf den einzigen Stuhl in dem spärlich möblierten Zimmer. „Ich setze mich aufs Bett.“ Beide sahen gleichzeitig den Büstenhalter dort liegen. Melanie setzte sich ungerührt darauf und schlug die Beine übereinander.
„Und jetzt den Rest der Geschichte. Ich möchte wissen, wie Salomo ihr einen Heiratsantrag gemacht hat.“
„Richtig.“ Menachem ließ sich im Stuhl zurücksinken und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er genoss es offensichtlich, die Sache in die Länge zu ziehen. „Als Romantikerin werden Sie vielleicht enttäuscht sein. ‚Er begehrte sie zum Weibe, doch ihm missfielen die Haare auf ihren Beinen.‘“
„Moment mal!“, rief Melanie. „Sie sagten doch, ihre Beine seien wohlgeformt gewesen.“
„Ich spreche von den Haaren auf ihren wohlgeformten Beinen. Im Koran heißt es: ‚Also machten die Dämonen ihm ein Enthaarungsmittel aus gebranntem Kalk, mit welchem sie die Haare entfernte ...‘ Sie scheinen enttäuscht zu sein, Melanie.“
„Das bin ich auch.“ Sie zog eine Schnute.
„Nun, Sie brauchen sich wegen Ihrer Beine keine Sorgen zu machen.“
Melanie drohte ihm mit dem Finger. „Wir wollen doch bei der Königin von Saba bleiben. Wie ging es weiter?“
„Dem Koran zufolge ‚suchte er sie jeden Monat einmal auf und blieb drei Tage bei ihr‘.“
„Ist das alles? Typisch Mann.“
„Man betrachte den Charakter der Besuche, nicht ihre Zahl.“
„Zitieren Sie noch immer den Koran?“, fragte sie skeptisch.
„Nein“, sagte er und stand auf. „Dieser Teil der Geschichte stammt von mir.“
„Und der Heiratsantrag?“, fragte sie und sah zu ihm auf, als er vor ihr stehen blieb.
„Ich bin nicht Salomo, Melanie.“
5
„Halt!“ befahl Melanie. „Was ist mit einem Kondom?“
„Wenn du noch lange redest, wird die ganze Sache akademisch.“
Sie hielt seinen rapide schlaffer werdenden Penis krampfhaft fest, als gelte es, ein weiteres Schrumpfen zu verhindern. „Das sollten wir aber“, murmelte sie.
„Ich benutze keine Gummis“, keuchte er. „Ich bin unfruchtbar.“
Viele Wochen später sollte sich Melanie an die Wahl des Wortes erinnern: „unfruchtbar“ hatte er gesagt, nicht „steril“. Doch in diesem Moment in Kirchberg prägte es sich nur tief in ihrem Unterbewusstsein ein. „Aber was ist mit ...“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!