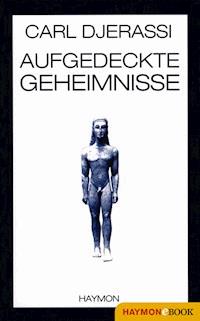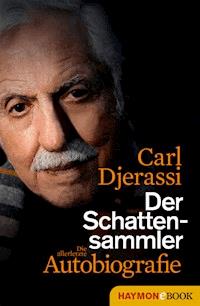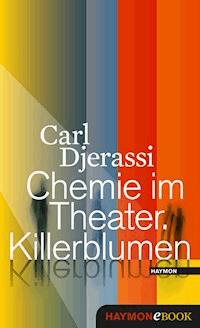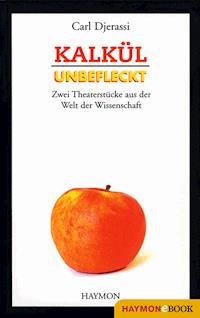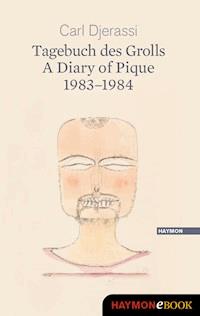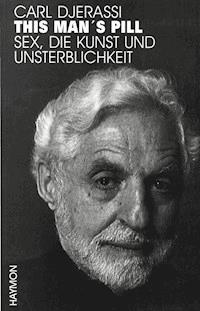
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dem Autor ist am 15. Oktober 1951, in einem kleinen Labor in Mexico City der entscheidende Schritt zur synthetischen Herstellung des Hormons Gestagen gelungen, was die "Antibabypille" ermöglicht hat. In diesem Buch verfolgt Djerassi genauer, als er das bisher getan hat, die Geschichte der "Pille" mit ihren Vorstufen, etwa den Forschungen und Ergebnissen des Innsbrucker Biologen Prof. Ludwig Haberlandt aus den zwanziger Jahren, schildert die Auswirkungen seiner Erfindung auf Gesellschaft und Politik und sinniert über die sich abzeichnende Trennung von Sex und Fortplanzung. Auch persönliche Erinnerungen an die turbulenten fünfziger und sechziger Jahre breitet der vorzügliche Erzähler Djerassi vor dem Leser der zwölf Essays aus. Aus dem Amerikanischen von Ursula-Maria Mössner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl Djerassi:: This Man’s Pill
Carl Djerassi
This Man’s Pill
Sex, die Kunst und Unsterblichkeit
Aus dem Amerikanischenvon Ursula-Maria Mössner
Haymon Verlag
© 2001HAYMON Verlag, lnnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
ISBN 978-3-7099-3716-7
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Die Deutsche Bibliothek- CIP-EinheitsaufnahmeDjerassi, Carl: This man’s pill: Sex, die Kunst und Unsterblichkeit I Carl Djerassi.
Aus dem Amerikanischen von Ursula-Maria Mössner.
Umschlag: Benno Peter, Porträtfoto von Michael Birt
Das Buch erschien im Herbst 2001 unter dem Titel „THIS MAN’s PILL“.Reflections on the 50th Birthday of the Pill“ im Verlag Oxford University Press.
Satz: Haymon-Verlag
Diesen Roman erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhaltsverzeichnis
1. Dreißig Auserwählte: Murasaki & Konsorten
2. Genealogie und Geburt der Pille
3. Bittere Pillen
4. Die japanische Sicht der Dinge
5. Sex und Unsterblichkeit
6. Von der Pille zum PC
7. Science-in-Fiction ist keine Science-Fiction. Ist es Autobiographie?
8. Hinter dem Schleier der literarischen Fiktion
9. Der weichere Chemiker
10. Die Pille und Paul Klee
11. Naturwissenschaft auf der Bühne
12. Was wäre, wenn?
Biographischer Abriß
Bibliographie
Für Diane Middlebrook, „La Ultima“
Wer Perfektion verlangt, verhindert das Mögliche.
1
Dreißig Auserwählte: Murasaki & Konsorten
Am 12. September 1999 veröffentlichte das Londoner Sunday Times Magazine in seiner Titelgeschichte „The Top Thirty“ des zurückliegenden Jahrtausends. Diese von fünfzehn britischen und amerikanischen Gelehrten erstellte Hitliste der dreißig wichtigsten Personen war, gelinde ausgedrückt, exzentrisch, um nicht zu sagen bizarr; in anderen Worten ein weiteres Symptom des Rummels um den Millenniumswechsel.
Ganz oben auf der chronologisch angeordneten Liste stand der Name der einzigen Frau in der ansonsten reinen Männerriege. Obwohl gegen diese Wahl nichts einzuwenden ist, hatte ihre Aufnahme in den erlauchten Kreis vermutlich mehr mit political correctness und Effekthascherei zu tun als mit Logik. Ich kann mir schwerlich vorstellen, daß Murasaki Shikibu – selbst in Japan – von einer breiten Öffentlichkeit in diese Dreißigerbande gewählt worden wäre. Aber mit ihr zu beginnen nahm nicht nur dem unvermeidlichen Vorwurf männlicher Voreingenommenheit die Spitze, sondern auch dem des Eurozentrismus: Asien war nur durch Murasaki Shikibu und den osmanischen Sultan Mohammed II. vertreten. Dschingis Khan, Mahatma Gandhi und Mao Tse-tung fehlten völlig. Warum fiel die Wahl von Rupert Murdochs Experten auf Napoleon und Lenin, aber auf keinen dieser asiatischen Führer? Der kurze Prozeß, der mit Nord- und Südamerika, von der Baffin Bay bis hinunter nach Patagonien, gemacht wurde, bewies nur, daß der Ethnozentrismus der Jury unparteiisch war. Kein Cortez, Bolívar, Washington, Lincoln oder Roosevelt; der ganze Kontinent tauchte nur ein einziges Mal auf: mit Thomas Alva Edison. Es versteht sich wohl von selbst, daß Afrika für diese intellektuellen Forschungsreisenden ein dunkler Kontinent blieb.
Daß geographische Aspekte und das weibliche Geschlecht keine Berücksichtigung fanden, mochte irgendwie verständlich sein; weit auffallender jedoch war die schiere Willkürlichkeit dieser Liste. Am eklatantesten war das völlige Fehlen von Musikern – kein Bach, kein Mozart, kein Verdi, nicht einmal die Beatles – und anderen Künstlern, abgesehen von Leonardo da Vinci, dessen Aufnahme offenbar in erster Linie seinen Referenzen als Naturwissenschaftler und Ingenieur zu verdanken war. Etwas besser sah es im Bereich Literatur aus: Neben Murasaki fand sich dort die klar auf der Hand liegende Entscheidung für Shakespeare und die fast ebenso unvermeidliche Nennung von Dante und Chaucer. Die Aufnahme von Jean Jacques Rousseau, dem einzigen weiteren Vertreter dieser Gattung, erschien durchaus gerechtfertigt, aber nur, bis man sich zu fragen begann, warum er und nicht, sagen wir, Goethe oder Tolstoi.
Die Liste tendierte stark in Richtung Naturwissenschaft und Technik. Unter den fünfzehn Naturwissenschaftlern und Erfindern waren Bacon, Newton, Kopernikus, Galilei, Darwin, Pasteur und Einstein. Daß sie aufgenommen wurden, erscheint absolut einleuchtend, auch wenn einige andere – z. B. Planck, Maxwell, Watson & Crick (die vermutlich eliminiert wurden, weil man sonst zwei kostbare Plätze vergeudet hätte) – genauso plausibel gewesen wären. Daß Großbritannien unverhältnismäßig stark vertreten war, konnte man vielleicht noch nachvollziehen, denn schließlich handelte es sich hier um die Londoner Times, nicht um die New York Times. Und von der fünfzehnköpfigen „Expertenjury“ kamen elf aus Großbritannien und nur vier aus den Vereinigten Staaten. Folglich war es auch nicht weiter verwunderlich, daß die abschließende Wahl des primus inter pares – der Numero Uno des Millenniums – auf Isaac Newton fiel. Allerdings entbehrte es nicht einer gewissen Ironie, daß auf dem Titelblatt, das die Wahl verkündete, kein visuell hagiographisches Porträt des Physikers erschien (von denen es genügend gibt), sondern eine Fotografie von Eduardo Paolozzis übermannsgroßer Statue Newtons am Eingang der British Library, einer Skulptur, die auf William Blakes berühmtem Aquarell von 1795 basiert. Ob dem Fotoredakteur wohl bekannt war, daß Blakes Ansichten über Newton und dessen Rationalismus alles andere als schmeichelhaft waren? „Wer das Unendliche in allen Dingen sieht, sieht Gott. Wer nur die Vernunft sieht, sieht nur sich selbst.“
Natürlich hat die Auswahl der Times keinerlei Bedeutung. Es kann nicht den wichtigsten Menschen eines Jahrtausends geben: weder ein einzelnes Kriterium noch eine Reihe von Kriterien würden jemals auf allgemeine Zustimmung stoßen. Es gibt keine Gemeinschaft gelehrter Männer oder Frauen mehr (falls es sie überhaupt je gegeben hat), für die eine solche Person oder Liste repräsentativ sein könnte. Und damit komme ich zu dem entscheidenden Punkt – der nicht von mir stammt –, daß nämlich Newton, Galilei, Einstein und all die anderen Leuchten der Wissenschaft nicht als Personen auf dieser Liste stehen – in dem Sinne, wie Murasaki und Skakespeare dort erscheinen –, sondern vielmehr als Repräsentanten und Surrogate für Entdeckungen und Erfindungen.
Newtons bedeutendste Entdeckungen, beispielsweise die Gesetze der Gravitation und der Planetenbewegung, hätten vielleicht noch einige Jahre auf sich warten lassen, wenn er nie geboren worden wäre, aber entdeckt worden wären sie unweigerlich, wie Leibniz’ zeitgleiche Erfindung der Integralund Differentialrechnung – um nur eines von vielen derartigen Beispielen zu nennen, die die Geschichte der Naturwissenschaften kennt – eindeutig beweist. Gewiß, Kopernikus, Galilei, Darwin und Einstein waren mit ihren bahnbrechenden Erkenntnissen jeweils die ersten auf ihrem Gebiet, aber auch hier hätte ein anderer die gleichen allgemeingültigen Regeln innerhalb einer Zeitspanne aufgestellt, die im Rahmen der Menschheitsgeschichte getrost als vernachlässigbar zu bezeichnen wäre. Letzten Endes kommt es in den Naturwissenschaften, anders als in der Kunst, nicht auf den einzelnen Menschen an.
Jedenfalls fast nie. Es sei denn, dieser Mensch ist man selbst. Die Hitliste der Times endet mit einem lebenden Relikt. Auf den ersten Blick scheint es absolut grotesk, daß dort der Name Carl Djerassi erscheint, bis man sich darauf besinnt, daß er als Surrogat für die Pille steht. Kaum jemand würde bestreiten, daß die Einführung steroidaler oraler Verhütungsmittel große Auswirkungen in den letzten vier Jahrzehnten des zurückliegenden Millenniums hatte. Viele davon, wenn auch gewiß nicht alle, waren positiv. Andere medizinische Entdeckungen und Erfindungen – wie die Röntgenstrahlen oder Antibiotika – kamen mehr Menschen zugute, obgleich die Pille auch in dieser Hinsicht nicht zu unterschätzen ist: In den USA wurde und wird sie von 80% aller nach 1945 geborenen Frauen benutzt! Bezüglich des soziokulturellen Einflusses jedoch, von der Religion bis zur Frauenbewegung, nimmt die Pille mit Sicherheit eine Spitzenposition ein. Indem sie den Geschlechtsakt von der Verhütung trennte, setzte sie eine der umwälzendsten Veränderungen der jüngsten Zeit in Gang, nämlich die allmähliche Auflösung der Einheit von Sex und Fortpflanzung. Das darauffolgende Aufkommen von In-vitro-Befruchtungstechniken hat die völlige Trennung zwischen Sex und Fortpflanzung – in anderen Worten die Schaffung neuen Lebens ohne Geschlechtsverkehr – Realität werden lassen. Die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen dieser Entkoppelung sind gewaltig und beginnen erst jetzt diskutiert zu werden. Obgleich diese Revolution auf dem Gebiet der Fortpflanzung durch die Einführung der Pille initiiert wurde, waren für die Eltern der Pille keineswegs alle Konsequenzen vorherzusehen, die im reiferen Alter ihres mittlerweile fünfzigjährigen Sprößlings auftraten.
„Fünfzig Jahre?“ höre ich fragen. Wann genau war denn der Geburtstag der Pille? Und wo wurde sie geboren? Und, was noch viel wichtiger ist, wo fand ihre Empfängnis statt? Wenn die Beantwortung der letztgenannten Frage selbst Eltern echter Babys Probleme bereitet, um wieviel mehr dann in diesem Fall, wo selbst die Identität der Eltern oft angezweifelt wird. Dennoch gibt es darauf eine klare Antwort. Die Idee einer Pille, die Sex ohne Befruchtung gestattet, tauchte um 1920 in Österreich auf. Ich war zur Zeit der Empfängnis der Pille noch gar nicht geboren, und dennoch behaupte ich, daß ich, als organischer Chemiker, bei der Geburt der Pille am 15. Oktober 1951 in Mexico City die Rolle einer Mutter spielte.
Das vorliegende Buch hat jedoch weniger mit mütterlicher Chemie zu tun, sondern stellt vielmehr eine Bewertung des Einflusses dar, den die Pille auf die Welt um uns herum und insbesondere auf mich hatte. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn entgegen allen Erwartungen – insbesondere seitens der Eltern der Pille – hat sich die Empfängnisverhütung im Laufe der letzten fünfzig Jahre kaum verändert, und es hat auch nicht den Anschein, als ob sie sich in den nächsten Jahrzehnten rein technisch gesehen fundamental verändern würde. Vielleicht sind wir sogar im Begriff mitzuerleben, wie das Thema „Kontrazeption“ allmählich in den Hintergrund tritt, da wir uns inzwischen mit einer ganz anderen Zukunft der menschlichen Fortpflanzung konfrontiert sehen.
Aber auch auf einer rein persönlichen Ebene hat die Pille enorme Auswirkungen auf mich gehabt. Sie hat mich von einem „harten“ Naturwissenschaftler – einem organischen Chemiker, angetrieben von wissenschaftlicher Wißbegierde und der dazugehörenden geballten Portion Ehrgeiz, aber auch dem Verlangen nach Anerkennung seitens der Kollegen, über das ich in meinen Romanen ausführlich geschrieben habe – in einen „weicheren“ verwandelt. Ich begann mich in zunehmendem Maße mit Fragen zu beschäftigen, die eigentlich heikler und schwieriger waren als die Herausforderung, Kohlenstoffatome zu bislang unbekannten und oft nützlichen Molekülen zu verbinden: nämlich mit den gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich aus wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen ergeben. Der letzte große Sprung, den ich machte, zunächst zum Verfasser von Romanen und später von Bühnenstücken, geht auf meine Suche nach neuen Wegen zurück, wissenschaftliche Gedankengänge und Probleme einem breiteren Publikum nahezubringen. Dabei half mir, daß ich das Glück hatte, an dieser entscheidenden Erfindung beteiligt gewesen zu sein, als ich noch keine Dreißig war, so daß ich noch ein halbes Jahrhundert später darüber nachsinnen kann, wie sich diese Entdeckung auf mich persönlich ausgewirkt hat. Folglich ist der englische Titel dieses Buches, „This Man’s Pill’: kein Pochen auf irgendwelche Eigentumsrechte – und schon gar nicht Wichtigtuerei oder simples Macho-Gehabe –, sondern vielmehr das Destillat einer Selbstprüfung, die längst noch nicht abgeschlossen ist.
Nun könnte man sich fragen, warum ich es für notwendig erachte, meine Schlußfolgerungen mit anderen zu teilen. Warum begnüge ich mich nicht damit, etwas über mich erfahren zu haben? Oder gehe zum Psychoklempner, falls der Drang, mich über diese Themen auszulassen, allzu übermächtig sein sollte? Schließlich habe ich schon vor zehn Jahren eine Sammlung von Erinnerungen (Die Mutter der Pille) veröffentlicht, die so autobiographisch war, wie es mein verbliebener Sinn für Zurückhaltung zuließ.
Meine Antwort darauf lautet schlicht: Ich bin jetzt zehn Jahre älter und somit zehn Jahre weiser. Im Herzen bin ich Pädagoge und überzeugt, daß sich aus meinem Leben so manches lernen läßt – Positives wie Negatives. So ist es in unserer ständig geriatrischer werdenden Welt beispielsweise sinnvoll, darauf hinzuweisen, daß man auch im Alter von 60 Jahren noch eine neue Karriere starten kann und mit 75 eine weitere. Mein Labor ist inzwischen geschlossen; ich kann es mir leisten, die Ereignisse der Vergangenheit durch den Filter und Schleier eines guten halben Jahrhunderts zu betrachten und dazu aus einer Distanz, die einen auf tieferen Einsichten beruhenden Blick in die Zukunft gestattet. Für mich ist dieses Buch zu einer Art öffentlicher Buße für frühere Unterlassungssünden geworden, weil ich als Naturwissenschaftler zuviel zu tun hatte, um mir die Zeit zu nehmen, mich einem breiteren Publikum mitzuteilen, und zu beschäftigt war, die Welt als Ganzes zu analysieren, um die ausgefeilten analytischen Fähigkeiten des Wissenschaftlers für Selbstbetrachtungen aufzubieten. Welcher Zeitpunkt wäre dafür besser geeignet als der 50. Geburtstag der Pille?
Jede wissenschaftliche Abhandlung beginnt mit einem sogenannten Abstract, einer knappen Zusammenfassung. Ich bin zu sehr Gewohnheitstier, um mit dieser schönen Tradition hier zu brechen. Doch Traditionen lassen sich anpassen, und so möchte ich diesem sehr persönlichen Buch als Abstract eine Autobiographie voranstellen, die ich in freien Versen am 60. Geburtstag von Robert Maxwell schrieb, dem anderen Großvater meines einzigen Enkels, Alexander Maxwell Djerassi. Dieser Abriß in Gedichtform hat den Vorzug, nicht nur knapp, sondern auch brutal ehrlich zu sein.
Die Uhr läuft rückwärts
An seinem sechzigsten Geburtstag,Umringt von Frau, Kindern und Freunden,Packt der Mann, der alles hat,
Seine Geschenke aus.
Zwischen Briefbeschwerern, Zigarren,Büchern, silbernen Dosen,
Kristallvasen,
Erscheint eine Uhr,
Hergestellt von KOOL Designs
In limitierter Auflage.
Eine Uhr, die rückwärts läuft.Eine Uhr mit Namen LOOK.
Amüsant.
Genau das Geschenk
Für den Mann, der alles hat.
Wie faustisch, dachte der Freund,
Selbst bald sechzig werdend.
Und falls sie wirklich die Zeit durchmißt?
Als die Zeiger die Fünfzig erreichten,
Hielt er sie an.
Bücher, Hunderte von Artikeln, Dutzende von Ehren.
Nicht schlecht, dachte er: Die Uhr gefallt mir.
Doch fünfzig war auch die Zeit,
Als seine Ehe zerbrach.
Er ließ die Uhr weiterlaufen.
Achtundvierzig Jahre, fünfundvierzig,
Dann einundvierzig.
Ach ja, die Jahre des Sammelns:
Gemälde, Skulpturen und Frauen.
Besonders Frauen.
Doch war das nicht auch die Zeit,Als seine Einsamkeit begann?Oder war das schon früher?Warum sollte man sonst sammeln,Außer um eine Leere zu füllen?
Halt nicht die Zeiger an!
Die Dreißiger waren die besten:
Berge von Arbeit. Erfolg. Anerkennung.
Professor an Elite-Universität,
Geburt seines Sohnes – nun der einzige Überlebende.
Und wie war’s mit achtundzwanzig?
Ach ja – fast hätte er’s vergessen:
Das Jahr der PILLE.
Der Pille, die die Welt veränderte.
Nein – zu anmaßend, zu eingebildet.
Dennoch veränderte er das Leben von Millionen,
Millionen von Frauen, die seine Pille nehmen, dachte er.
Die Uhr läuft weiter zurück.
Siebenundzwanzig Jahre:
Erstmalig Vater, einer Tochter,
Später seine einzige Vertraute.
Nun tot. Von eigener Hand.
Der Beginn seiner zweiten Ehe.
Die erste aufgelöst.
Frühe Stigmata künftigen Erfolges:
Das Doktorat mit einundzwanzig;
Der erste Studienabschluß mit achtzehn.
Und der Trugschluß, sich für reif zu halten:
Noch keine zwanzig und schon Bräutigam.
Noch früher: Europa. Krieg.
Hitler. Wien.
Kindheit.
Halt! Halt! HALT!
Der Paterfamilias,
Umringt von Frau, Kindern, Freunden,
Der Mann, der alles hat,
Packt noch immer Geschenke aus.
Mehr Briefbeschwerer, mehr Silber,
Mehr Bücher, zehn Pfund Stilton-Käse,
Und noch eine Uhr.
Gott sei Dank, diese läuft vorwärts,
Dachte der Freund,
Der einsame,
Der selbst bald sechzig wird.
Und lächelte die Frau an seiner Seite an,
Die Frau, die er gestern kennengelernt hatte.
Die gestern gesagt hatte:
„Ja, ich komme mit nach Oslo.“
Und sie kam.
Doch allzu kurz.
2
Genealogie und Geburt der Pille
WOLFSON: Was verstehen Sie heute, das Sie mit neunzehn oder zwanzig noch nicht verstanden haben?
DJERASSI: Meinen Sie auf wissenschaftlichem Gebiet oder allgemein?
WOLFSON: Das überlasse ich Ihnen.
DJERASSI: Ich lebe nicht in einem Vakuum. Wenn ich die letzten fünfzig Jahre auf einer einsamen Insel verbracht hätte, dann, glaube ich, wäre die Antwort etwas Inwendiges, aber die Antwort, die ich Ihnen geben muß, kann nur auf einer Reflexion dessen beruhen, wie ich die Welt, in der ich lebe, wahrnehme. Es ist eine niederschmetternde Tatsache, daß es bei meiner Geburt 1,9 Milliarden Menschen auf dieser Welt gab. Jetzt sind es 5,8 Milliarden, und an meinem 100. Geburtstag werden es voraussichtlich 8,5 Milliarden sein. Das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben – daß sich im Laufe eines einzelnen Lebens die Weltbevölkerung mehr als vervierfacht hat. Und das wird es auch nie wieder geben.
WOLFSON: Was haben Sie persönlich, inwendig, in dieser Zeit gelernt?
DJERASSI: Inwendig müßte ich mir die übliche Frage stellen: Was würde ich anders machen, wenn ich mein Leben noch einmal zu leben hätte? Meine Antwort wäre, daß ich nicht das Leben führen würde, das ich geführt habe. Ich wäre nicht mehr ein solcher Workaholic. Ich wäre nicht mehr so hektisch. Ich würde schlicht akzeptieren, daß man nicht alles tun kann, was man sich im Leben vornimmt, auch wenn ich noch immer von dem Gedanken besessen bin, nicht mehr genug Zeit für alles zu haben. (Pause.) Ich glaube, es wäre interessant, jetzt eine Frau zu sein. Eine moderne Frau zu sein, könnte sehr interessant sein, weil sich viel verändert hat.
Obiges stammt aus einem langen Interview, das Jill Wolfson, eine Reporterin der San Jose Mercury News, mit mir Anfang des Jahres 1997 für eine Artikelserie über technische Beiträge einiger Oldtimer des Silicon Valley führte, zu denen man auch mich zählte. Warum bediene ich mich gerade dieses Auszugs, um ein Kapitel zu beginnen, das meine Ansichten über den Ursprung der Pille enthält? Weil er zwei entscheidende Fakten des letzten halben Jahrhunderts anspricht – die globale Bevölkerungsexplosion und das Aufkommen der Frauenbewegung –, ohne die orale Verhütungsmittellediglich ein weiterer interessanter medizinischer Fortschritt gewesen wären und nicht eine Erfindung mit umwälzenden gesellschaftlichen Folgen.
I
Während ich dies schreibe, sind es nur noch wenige Monate bis zum 50. Geburtstag der Pille. In den zurückliegenden vier Jahren hat man mich anläßlich des 35. sowie des 40. Geburtstags der Pille interviewt, gefilmt und anderweitig um meine Auslassungen gebeten. Aber wie kann man die Geburtstage von fünfzehn Jahren in nur vier Jahren feiern?
Zu den Ironien im Leben der Pille gehört, daß sich ihre eigene Empfängnis so schwer festlegen läßt; es hängt immer davon ab, wer zählt (wie jeder Geburtshelfer bestätigen wird). 1997 sprach ich auf einem Medizinerkongreß in Wien, auf dem der 35. Jahrestag der Pille in Österreich begangen wurde – keine unpassende geographische Wahl, wie ich gleich erläutern werde –, während ich im Mai 2000 von zahlreichen amerikanischen Zeitungs –, Rundfunk- und Fernsehreportern mit Anfragen bombardiert wurde, etwas zum 40. Geburtstag (!) der Pille zu sagen. Zuerst war ich etwas verdutzt, doch dann wurde mir klar, daß sie das Debüt der Pille mit der offiziellen Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA, die für die Zulassung von Medikamenten zuständige Bundesbehörde der USA) gleichsetzten. Derartige Daten mögen Anlässe für Feierlichkeiten sein, aber „Geburtstage“ sind sie nicht. Die Veranstaltung in Wien war das Gegenstück zur Feier der Ankunft eines Kindes in einer Stadt, die nicht sein Geburtsort ist, und der 40. Geburtstag, um den die amerikanischen Medien einen solchen Wirbel machten, ließe sich mit dem Tag vergleichen, an dem in Washington die Taufurkunde ausgestellt wurde.
Was mich betrifft (und ich war betroffen), war das tatsächliche Geburtstagsdatum der Pille der 15. Oktober 1951, der Tag, an dem unser Labor die erste Synthese eines Steroids abschloß, das schließlich zur oralen Empfängnisverhütung verwendet werden sollte. Einige Tage später waren die ersten kostbaren Milligramm „Norethindrone“ – der gebräuchliche amerikanische Name von 17a-ethinyl-19-nortestosteron, wie die Substanz chemisch korrekt heißt (in Deutschland bekannt unter dem Namen „Norethisteron“, der im Folgenden verwendet wird) – von den Forschungslabors der Firma Syntex in Mexico City bereits per Post zu Dr. Elva G. Shipley von Endocrine Laboratories Inc. – einer kommerziellen Einrichtung in Madison, Wisconsin – unterwegs, mit der Bitte, das Präparat auf seine orale gestagene Wirksamkeit zu untersuchen.
Ich erwähne Dr. Shipley hier in erster Linie deshalb, weil ihre frühe Mitwirkung an der Entstehung der Pille der häufig aufgestellten Behauptung widerspricht, die mit der Entwicklung oraler Kontrazeptiva befaßten Wissenschaftler seien ausnahmslos Männer gewesen. Dieser Irrglaube macht vielen Frauen seit Jahrzehnten zu schaffen. Wie Margaret Mead es in den 60er Jahren ausdrückte: „[Die Pille] ist ausschließlich die Erfindung von Männern. Und warum haben sie sie erfunden? ... Weil sie ausgesprochen ungern Versuche mit ihrem eigenen Körper anstellen ... aber dafür umso lieber mit dem weiblichen Körper ... Es wäre sehr viel sicherer, an Männern herumzuexperimentieren, statt an Frauen herumzupfuschen.“ Meads Verärgerung mag verständlich sein, stellt aber nichtsdestoweniger eine grobe Vereinfachung dar, die außer Acht läßt, daß die Natur den Wissenschaftlern einen entscheidenden Hinweis geliefert hatte, auf dem sie aufbauen konnten – nämlich daß Frauen aufgrund der ständigen Sekretion von Progesteron während einer Schwangerschaft nicht schwanger werden können –, während ein vergleichbarer Anhaltspunkt in der reproduktiven Biologie des Mannes fehlt.
Dr. Shipleys Beitrag ist noch aus einem anderen Grund bedeutsam, der Margaret Meads Entrüstung teilweise erklären könnte: Vor fünfzig Jahren waren Frauen noch von vielen wissenschaftlichen Forschungsbereichen weitgehend ausgeschlossen. Auf einem Gebiet, das unbestreitbar eine Domäne der Männer war, mußte Dr. Shipley ihrer Arbeit in einem kommerziellen Labor nachgehen, das sie in nächster Nähe der University of Wisconsin gegründet hatte, wo ihr Mann als Professor für Zoologie lehrte und Nepotismus an Universitäten noch absolut tabu war.
Die Ironie dieses historischen männlichen Vorurteils hat verschiedene Autoren und Journalisten veranlaßt, die Annalen der Pille nach weiblichen Helden zu durchforschen. Ihre Favoritin ist Margaret Sanger, vermutlich aus Gründen, die im letzten Absatz von David Kennedys definitiver Biographie genannt sind: „Dennoch schien die Anerkennung, die Margaret Sanger zuteil wurde, häufig in keinem Verhältnis zu ihrer Leistung zu stehen. Zweifellos gingen die Lobeshymnen zum Teil auf ihre magnetische Anziehungskraft zurück, der es fast immer gelang, diejenigen, die sie persönlich kennen/ernten, in ihren Bann zu ziehen. Doch ein größerer Teil spiegelte die symbolische Befriedigung eines vorherrschenden psychologischen Bedürfnisses durch Frau Sanger wider. Die amerikanische Gesellschaft hat ihr häufig verkündetes Ideal der Gleichberechtigung der Frau in diesem fahrhundert nicht verwirklicht. Vielleicht spiegelt die Verherrlichung einer feministischen Heidin wie Margaret Sanger somit das Eingeständnis der Gesellschaft wider, daß Frauen weiterhin unterdrückt werden, und das Verlangen, auf irgendeine Art eine Erlöserin zu finden. Für diese Rolle war Margaret Sanger, in ihrer besten wie in ihrer schlechtesten Form, hervorragend geeignet.“
Dennoch würde Sangers historische, wenn auch gewiß nicht wissenschaftliche Rolle als Vorkämpferin der Geburtenkontrollbewegung in den USA ihre Wahl zu einer der Großmütter rechtfertigen. Eine romantisch verklärtere Kandidatin ist Katherine McCormick, eine wohlhabende Philanthropin, die Anfang der 50er Jahre von Sanger dazu bewegt wurde, biologische Forschungsprojekte an der Worcester Foundation for Experimental Biology zu finanzieren, einer Einrichtung, die unter der Leitung von Gregory Pincus in hohem Maße zur Entwicklung der Pille beitrug. So lobenswert philanthropische Aktivitäten dieser Art auch sind, Katherine McCormick zu einer der „unbestreitbaren Mütter der Pille“ zu küren (wie es Bernard Asbell in Die Pille und wie sie die WC!t veränderte tat, was dann von vielen aufgegriffen wurde) ist so weit hergeholt, wie John D. Rockefeller zu einem der „Väter der Pille“ zu erklären. (Die Rockefeller Foundation und ihr Ableger, der Population Council, unterstützten wesentlich mehr Forschungsarbeiten über Reproduktion und Kontrazeption, als Mrs. McCormick dies je tat.)
Finanzielle Unterstützung, so wertvoll sie auch sein mag, hat nie den gleichen Stellenwert wie Kreativität; sonst müßte man ja die Medicis als die größten Künstler der Renaissance betrachten. Statt dessen möchte ich dem Stammbaum der Pille den Namen Elva G. Shipley hinzufügen, die buchstäblich als erster Biologe – ob männlich oder weiblich – die hohe gestagene Wirksamkeit von oral verabreichtem Norethisteron nachwies. Wenn ihre Ergebnisse negativ gewesen wären, hätten wir das Projekt fallenlassen und das Material nicht an weitere Biologen geschickt, weder an Roy Hertz noch an Gregory Pincus, der, wie ich im Folgenden erläutern werde, mit Fug und Recht ein „Vater der Pille“ zu nennen ist.
Da die Pille so eng mit der menschlichen Fortpflanzung verknüpft ist, wenn auch im Sinne ihrer Verhinderung, möchte ich mich bei der Erstellung ihrer Genealogie der Fortpflanzung als Metapher bedienen. Nehmen wir an, die Pille sei ein Kind, und verfolgen wir dessen Entstehung von den ersten – erfolglosen – Versuchen einer Empfängnis (1) über die Ovulation einer reifen Eizelle (2), die Ejakulation von Spermien (3), die erfolgreiche Befruchtung (4), die Einnistung des Embryos (5) und die Entwicklung des Fötus (6) bis hin zur Geburt des Kindes (7). Geographisch gesehen fand der erste Schritt in Österreich statt, der zweite in Mexiko, Schritt drei bis fünf in den kontinentalen Vereinigten Staaten und die letzten in Puerto Rico – was in unserer hochmobilen Gesellschaft für ein Kind gar nicht so ungewöhnlich ist.
II
Die unbekannteste Person in der Geschichte der Pille ist jedoch keine Frau, sondern Ludwig Haberlandt, Professor für Physiologie an der Universität Innsbruck. Er führte bereits 1919 ein ganz entscheidendes Experiment durch, indem er die Eierstöcke eines trächtigen Kaninchens einem anderen weiblichen Kaninchen einpflanzte, das, trotz häufigen Paarens, mehrere Monate unfruchtbar blieb – ein Resultat, das Haberlandt „hormonale temporäre Sterilisierung“ nannte. (Parteigänger von Mrs. McCormick mögen bitte zur Kenntnis nehmen, daß diese und spätere Arbeiten Haberlandts von der Rockefeller Foundation finanziell unterstützt wurden.) Das Problem bei diesem Verfahren (abgesehen von dem erforderlichen chirurgischen Eingriff) wie auch bei späteren Versuchen, den chirurgischen Eingriff durch Verwendung von „Drüsenextrakten“ zu umgehen, war, daß diese Extrakte nicht aus dem reinen Hormon bestanden, auf dem die empfängnisverhütende Wirkung beruhte. Vielmehr handelte es sich um eine Mischung aus Hormonen und anderen Proteinen, die für die Empfängerin unter Umständen toxisch sein konnte. Bemühungen, diese Extrakte „rein“ zu machen, bildeten die nächste Hürde, die auf dem Weg zu einem brauchbaren oralen Verhütungsmittel zu überwinden war.
In zahlreichen Versuchen und Veröffentlichungen im Laufe der folgenden zehn Jahre unterstrich Haberlandt – der in auffallendem Gegensatz zu dem heute bei Wissenschaftlern obligatorischen Pluralis majestatis stets die erste Person Singular benutzte – die offenkundige Anwendbarkeit seiner Tierversuche bei der menschlichen Kontrazeption. Er erkannte, daß der verantwortliche Faktor ein Bestandteil des Corpus luteum oder Gelbkörpers war – des Hohlraums, der in der Oberfläche des Eierstocks zurückbleibt, nachdem das Ei freigesetzt wurde –, bei dem es sich, wie der deutsche Gynäkologe Ludwig Fraenkel (auf Anregung seines Lehrers Gustav Born) 1903 nachgewiesen hatte, um eine hormonabsondernde endokrine Drüse handelt. In seinem 1931 erschienenen bemerkenswerten Buch Die hormonale Sterilisierung des weiblichen Organismus, das keine 15 000 Wörter umfaßt und das heutzutage kaum jemand gelesen zu haben scheint, skizzierte Haberlandt erstaunlich detailliert die dreißig Jahre später stattfindende Revolution auf dem Gebiet der Empfängnisverhütung. Er wies darauf hin, daß eine orale Verabreichung, wie er an Mäusen tatsächlich demonstrierte, die ideale Methode ist und auch das notwendige periodische Absetzen des Hormons erlaubt, um das Eintreten der Menses zu gewährleisten. Er forderte die Verwendung einer solchen Empfängnisverhütung aus klinischen und eugenischen Gründen und argumentierte, daß sie Eltern befähigen würde, die gewünschte Anzahl gesunder Kinder zu haben. Einwände von Leuten wie dem Sexualforscher van de Velde, daß zu viele Frauen von der hormonalen Kontrazeption Gebrauch machen könnten, wurden von Haberlandt mit dem Argument pariert, daß es sich dabei um ein verschreibungspflichtiges Präparat handeln werde, das nicht allgemein erhältlich sein würde. Er beendete sein Manifest mit einer visionären Behauptung: „So ist es wohl zweifellos, daß die praktische Auswertung der temporären hormonalen Sterilisierung des Weibes wesentlich beitragen wird zur Erreichung jenes idealen Zustandes in der menschlichen Gesellschaft, von dem in treffender Voraussage schon vor einem Menschenalter Sigmund Freud (I 898) folgendes geschrieben hat: ‘Theoretisch wäre es einer der größten Triumphe der Menschheit, wenn es gelänge, den verantwortlichen Akt der Kinderzeugung zu einer willkürlichen und beabsichtigten Handlung zu erheben.’“
Haberlandt beschränkte seine Publikationen nicht auf die wissenschaftliche Literatur. Er veröffentlichte auch in der populären Presse und gab Interviews, die zu dicken Schlagzeilen führten wie„ Mein Ziel: Weniger Kinder, aber vollwertige!“(so im Berliner Acht Uhr Abendblatt vom 20. Januar 1927), begleitet von den entsprechenden Kommentaren der inzwischen vertrauten Riege von Ärzten, Juristen und Theologen. Seine obsessive Beschäftigung mit den therapeutischen Möglichkeiten der Corpusluteum-Extrakte war so bekannt, daß seine Studenten folgendes Banner vor seinem Haus aufhängten: „Verdirb nicht Deines Vaters Ruhm mit Deinem Corpus Luteum. „
Doch Haberlandt gab sich nicht mit der Rolle des Visionärs zufrieden. Er setzte sich mit mehreren Pharmaunternehmen in Verbindung, um beständig aktive und nichttoxische Corpusluteum- und Plazenta-Extrakte für klinische Versuche am Menschen zu erhalten. In seinem 1931 erschienenen Buch konnte er mit den folgenden Worten schließlich Erfolg vermelden: „Ich bin seit fast drei Jahren mit der therapeutischen Fabrik Gideon Richter in Budapest in Verbindung [ein Unternehmen, das bis heute auf dem Gebiet der Steroide tätig ist], und es dürfte in nächster Zeit ein geeignetes Sterilisierungspräparat unter dem Namen ‘Infecundin’ für interne Verabreichung zur klinischen Prüfung gelangen, wie ich dies bereits anläßlich des 4. Kongresses der Weltliga für Sexualreform zu Wien [September 1930] ankündigen konnte. „Er bestätigte, daß bei Versuchen mit oral verabreichtem „Infecundin“ bei Mäusen eine temporäre Unfruchtbarkeit ohne toxische Reaktionen nachgewiesen werden konnte, „denn nur in dieser Form wird wohl die neue Methode Aussichten auf vollen klinischen Erfolg haben können’:
Im Jahr darauf starb der 47jährige Ludwig Haberlandt, doch der Name „Infecundin“ überdauerte. 1966 wurde er zum Markennamen des ersten oralen Verhütungsmittels, das in Ungarn von eben dem Unternehmen hergestellt wurde, mit dem sich Haberlandt vierzig Jahre davor in Verbindung gesetzt hatte.
Zwei Jahre nach seinem Tod wurde reines Progesteron bereits in nicht weniger als vier Laboratorien in Deutschland, den USA und der Schweiz isoliert, seine chemische Struktur war von Karl Slotta (der später vor den Nazis nach Brasilien floh) ermittelt worden, und seine Synthese aus dem Sojasterin Stigmasterin war abgeschlossen. Hätte Haberlandt zu der Zeit noch gelebt, dann hätte er seinen Traum von der temporären hormonalen Sterilisierung von Frauen zweifellos ohne die Verwendung von Drüsenextrakten weiterverfolgt. Aber auch mit reinem Progesteron hätte er nur beweisen können, daß sich die Ovulation mittels Injizierung verhindern läßt, wie der amerikanische Forscher mit dem passenden Namen A.W. Makepeace 1937 bei Kaninchen und E.W. Dempsey bei Meerschweinchen nachwiesen. Da Progesteron im Körper synthetisiert wird, fehlen ihm die chemischen Eigenschaften, die es befähigen würden, eine orale Aufnahme unbeschadet zu überstehen – die vielfältigen Enzyme und Säuren, die sich zwischen unserem Blutkreislauf und der Welt um uns herum befinden. Aus diesem Grund hätte er noch ein weiteres Steroid benötigt, das nicht in der Natur vorkommt, aber darauf wartete, synthetisiert zu werden – was weitere zwanzig Jahre dauerte.
Folglich geschah zunächst nichts, und Haberlandts Werk geriet so völlig in Vergessenheit, daß der nächste Biologe, der sich der Sache annahm, nämlich Gregory Pincus (der es eigentlich besser hätte wissen müssen), sich nicht einmal verpflichtet fühlte, Haberlandt unter den 1459 Quellen seines Hauptwerks The Control of Fertility (1965) zu nennen. Genauso wenig wie Pincus’ klinischer Mitarbeiter John Rock, dessen Buch The Time has come (1963) zwar die Arbeit von Makepeace anführt, nicht jedoch Haberlandts bahnbrechende frühere Forschungen. Doch wenn es je einen Großvater der Pille gegeben hat, dann gebührt diese Ehre vor allen anderen Ludwig Haberlandt.
III
Eine ganz andere Ergänzung der frühen Genealogie der Pille stellt der Name Russell Marker dar, der Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Pennsylvania State College war. Was die Journalisten und TV-Filmemacher veranlaßte, Marker auf die Liste der Väter der Pille zu setzen, war vermutlich Markers Ruf als Außenseiter. Da ihm das „Sesam-öffne-dich“ eines Dr. rer. nat. fehlte, wurde Markers wahrer Rang als einer der Giganten der Steroidehemie erst zwei Jahrzehnte nach seinem plötzlichen und völligen Rückzug aus der Chemie, als er noch in den Vierzigern war, anerkannt. Doch trotz seines authentischen Anspruchs auf Größe auf dem Gebiet der Steroide allgemein würde ich ihn, was die orale Kontrazeption speziell betrifft, nur als einen entfernten Verwandten bezeichnen.
Was nicht heißen soll, daß Marker nicht eine wichtige, wenn auch indirekte Rolle dabei spielte, die Rohmaterialien der Kontrazeptiva-Forschung leichter verfügbar zu machen. Bis Mitte der 40er Jahre wurde das gesamte klinisch verwendbare Progesteron auf die eine oder andere Weise aus Sojasterinen oder Cholesterin gewonnen, was zunächst die Umwandlung dieser Sterine in Zwischenprodukte erforderte, aus denen schließlich Progesteron gewonnen wurde. Diese Zwischenstufen stellten einen Engpaß dar, da sich nur begrenzte Mengen der notwendigen Substanzen auf einmal herstellen ließen. Kein Wunder, daß die geringe Ausbeute dafür sorgte, daß der Preis für Progesteron sehr hoch blieb (etwa 80 US-Dollar pro Gramm Anfang der 40er Jahre). All dies änderte sich drastisch, als Marker die chemische Herstellung von Progesteron revolutionierte. Dank seines Verfahrens sank der Preis für Progesteron binnen weniger Jahre, so daß das Präparat billig genug wurde, um als Ausgangsmaterial für die Synthese anderer Steroide (beispielsweise Cortison) zu dienen und nicht mehr nur als klinisch nützliches Medikament bei Menstruationsstörungen. Aber worin genau bestand Markers Entdeckung?
In den späten 30er und frühen 40er Jahren untersuchte Marker eine Gruppe von Steroiden, die sogenannten „Sapogenine“. Diese Verbindungen pflanzlichen Ursprungs erhielten ihren Namen deshalb, weil sie in ihrer in der Natur vorkommenden Form (wo sie in Verbindungen namens „Saponine“ mit Zuckern verknüpft sind) in Wasser seifenartige Eigenschaften entfalten. Die Eingeborenen Mexikos und Mittelamerikas hatten sie schon seit langem zum Wäschewaschen und zum Betäuben oder Töten von Fischen verwendet. Marker konzentrierte sich unter anderem auf die chemische Zusammensetzung eines Mitglieds dieser Gruppe namens Diosgenin, das in bestimmten Arten ungenießbarer Yamswurzeln (Gattung Dioscorea) vorkam, die in Mexiko wild wuchsen. Es gelang ihm, ein Verfahren zu entwickeln, um aus Diosgenin über fünf Zwischenstufen eine hohe Ausbeute an Progesteron zu erhalten.
Um Markers Weggang vom Pennsylvania State College während des Zweiten Weltkriegs und seine Übersiedelung nach Mexiko ranken sich allerlei merkwürdige Geschichten, darunter viele, die von einem mysteriösen Verschwinden im mexikanischen Dschungel, in Zeitungspapier eingewickelten Päckchen, in denen sich der gesamte Progesteron-Vorrat der Welt befand, und dergleichen mehr handeln. Doch 1979 (kurz vor seinem 80. Lebensjahr) besuchte er mich an der Stanford University und gestattete mir, unser Gespräch aufzuzeichnen. Ich gebe die folgende Abschrift in ihrer unbearbeiteten Form wieder, weil sie etwas vom Charakter dieses Mannes einfängt.
DJERASSI: Heute ist der 3. Oktober 1979 und ich lerne endlich den großen Russell Marker kennen, der mir sagen kann, was damals in Mexiko wirklich geschah. Erzählen Sie mir doch noch einmal, wie Sie in Mexiko rund zehn Tonnen Dioscore sammelten ...
MARKER: Als mir klar war, daß Parkedavis [das amerikanische Pharmaunternehmen, das Markers chemische Forschungsarbeit am Pennsylvania State College unterstützte, es jedoch ablehnte, eine industrielle Anwendung dieser Arbeit in Betracht zu ziehen] nicht einsteigen würde, versuchte ich es bei anderen Unternehmen. So zum Beispiel bei Merck, und die sagten, wenn Parke-Davis mir einen Korb gegeben hat, dann könnten sie sich auch nicht darauf einlassen ... Daraufhin habe ich beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und habe auf der Bank die Hälfte meiner nicht gerade üppigen Ersparnisse abgehoben und bin nach Mexiko gegangen, wo ich mir neun oder zehn Tonnen Wurzeln von den Eingeborenen besorgte, die die ursprünglichen zwei Pflanzen für mich gefunden hatten. Ich sammelte alles zwischen Cordova und Orizaba, in der Nähe von Fortin. Der Mann, der sie ursprünglich gesammelt hatte ... der hatte einen kleinen Laden und eine kleine Kaffeetrocknerei gleich gegenüber. Wir sammelten Material, er zerhackte es wie Kartoffelchips, ließ alles an der Sonne trocknen, und ich nahm es mit rauf nach Mexico City und ließ es mahlen. Ich fand einen Mann, der dort eine primitive Extraktionsapparatur hatte, und der extrahierte es mit Alkohol und verdampfte alles zu einem Sirup. Und den brachte ich zu einem Freund von mir in den Vereinigten Staaten, der ein Labor hatte. Ich vereinbarte mit ihm, daß wenn er die restliche Finanzierung übernahm und mich sein Labor benutzen ließ, dann würde ich ihm ein Drittel des Progesterons geben, das wir erhielten. Ich sagte ihm, daß ich mit etwas über zwei Kilo rechnete. Aber am Ende hatten wir etwas über drei Kilo, und er nahm ein Kilo davon. Damals bekam er dafür 80 Dollar pro Gramm.
DJERASSI: Aber wie haben Sie den Abbau von Diosgenin in Pseudodiosgenin durchgeführt [der erste Schritt laut Markers veröffentlichtem chemischen Verfahren], denn das erfordert doch eine Reaktion im Autoklav?
MARKER: Er hatte einen Autoklav aus Metall.
DJERASSI: In welchem Maßstab machten Sie das zunächst? Wieviel Diosgenin konnten Sie abbauen?
MARKER: Etwa zwei Kilo auf einmal.
DJERASSI: Hatten Sie es in diesem Umfang auch schon am Penn State gemacht?
MARKER: Ja.
DJERASSI: Wie haben Sie Somlo kennengelernt? [Ein aus Ungarn stammender Anwalt und Geschäftsmann und früherer Haupteigentümer des kleinen mexikanischen Pharmaunternehmens Laboratorios Hormona, der später einer der Gründer von Syntex wurde.]
MARKER: Ich ging zu mehreren Leuten in Mexiko in der Hoffnung, daß jemand interessiert wäre. Ich nahm mir das Telefonbuch vor, als ich im Hotel Geneve wohnte ...
DJERASSI: ... und suchten unter „Hormona“?
MARKER: Nein, ich suchte unter „Laboratorios“ und fand Laboratorios Hormona und dachte, die müssen doch daran interessiert sein, Hormone herzustellen. Also schnappte ich mir ein Taxi und fuhr hin, und Lehmann [der wissenschaftliche Leiter und Minderheitenaktionär der Laboratorios Hormonal war da. Er sah mich an – anscheinend hielt er mich für verrückt, als ich reinkam, und dann entschuldigte er sich und ging raus, und als er wiederkam, sagte er: „Ach so, Sie sind der Marker, der diese Papers veröffentlicht hat?“ [Marker hatte alle seine Arbeiten früher im Journal of the American Chemical Society veröffentlicht.] Er sagte, er hätte gleich das Gefühl gehabt, daß er meinen Namen schon mal gesehen habe.
DJERASSI: Und da nahm er Sie ernst?
MARKER: Da nahm er mich ernst und wollte wissen, ob ich noch ein paar Tage in der Stadt bin. Er sagte, daß Dr. Somlo, dem die Firma gehörte, in New York sei. Also rief er Dr. Somlo an und sagte ihm, er müsse unverzüglich zurückkommen. Und Dr. Somlo kam am nächsten oder übernächsten Tag zurück, und ich hatte eine Unterredung mit ihm. Sie haben einen kleinen Vertrag aufgesetzt, daß wir mit der Produktion beginnen würden und daß wir eine neue Firma gründen würden, sobald ich zur Verfügung stand, und mehr dergleichen. Ich sagte ihnen, daß ich da noch ein Forschungsprojekt hätte, das ich abschließen wollte, bevor ich nach Mexiko kam, und daß sie es finanzieren würden.
DJERASSI: Und wußten sie, daß Sie Progesteron schon in den Staaten hergestellt hatten?
MARKER: Nein, davon habe ich ihnen nichts gesagt. Also bin ich einige Monate später wieder nach Mexiko gekommen, und als ich ging, sagte ich Lehmann, daß ich in den Staaten mehrere Kilo Progesteron hergestellt hatte. Das war eine große Überraschung für ihn und er wollte wissen, was ich damit gemacht hatte. Ich sagte ihm, daß es sich noch in meinem Besitz befand, und als ich wieder in den Staaten war, bekam ich einen Anruf von Somlo; er wollte wissen, ob ich das Progesteron immer noch hatte. Ich sagte ihm, daß dem so sei. Er sagte: „Treffen wir uns in einigen Tagen in New York“, und ich war einverstanden. Darauf sagte er: „Wir werden in Mexiko eine Firma für 500 000 Pesos gründen“, was zu der Zeit etwas über 100 000 Dollar waren – ein Peso war ungefähr 21 Cents wert, und er sagte: „Wir treffen ein Abkommen, daß Sie 40% der Aktien bekommen, aber Sie müssen kein Geld dafür bezahlen.“ Er sagte: „Sie geben mir das Progesteron, und wir beginnen, das Progesteron in dieser Firma zu verkaufen.“ Und auf dieser Basis einigte ich mich mit ihm, und er sagte, wir würden die ersten 40 000 Dollar herausnehmen, die ich für die 40% an der Firma schuldete, die wir gründen wollten. Zu der Zeit hatte sie noch keinen Namen. Und das übrige Geld, das wir dafür bekommen – immerhin verkauften wir es damals für 80 Dollar das Gramm –, das fließt in die Gewinne der Firma, und die Gewinne werden so aufgeteilt, daß ich 40% bekomme, Lehmann 8% und er 52%.
DJERASSI: Wer dachte sich den Namen Syntex aus? Somlo oder Sie?
MARKER: Somlo kam eines Tages rein, kurz bevor wir die Firma gründen wollten, und sagte, daß er einen Namen für die Firma hätte. Er wollte sie „Synthesis“ nennen. Ich fragte ihn, wo wir doch in Mexiko waren, warum nicht lieber etwas, das andeutete, daß sie in Mexiko war. Er sagte: „Na gut, dann Syntex.“ So fing es an.
DJERASSI: Wo richteten Sie Ihr Labor dort ein, in der Laguna Mayran [die Straße in Mexico City, in der sich die Laboratorios Hormona befanden.]?
MARKER: In der Laguna Mayran – das war damals das alte Hormona-Gebäude. Sehen Sie, es gab da ein unbebautes Grundstück an einer Ecke direkt neben der Hormona, und im Laufe des Jahres stellten sie dort ein paar Labors hin, wo ich arbeiten konnte, und eine Halle für die Extraktionsanlagen. Na ja, nach einem Jahr ging ich zu Somlo. In der Zwischenzeit hatte ich mein ganzes Geld ausgegeben und meine Frau war in Mexiko und ich mußte sie zurückschicken, weil mir das Geld fehlte und es für sie billiger war, in State College zu wohnen [dem Standort des Pennsylvania State College, wie die Universität damals noch hieß] als in Mexiko – sogar damals. Er wollte mir genug Geld zum Leben geben. Von Zeit zu Zeit bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt: „Ich bin knapp bei Kasse, ich brauche Geld, um die Hotelrechnung zu bezahlen, und muß meiner Frau was schicken.“ Dann gab er mir gewöhnlich tausend Dollar oder so, bis ich das nächste Mal zu ihm kam.
DJERASSI: Heißt das, daß er Ihnen nicht einmal ein Gehalt gezahlt hat?
MARKER: Stimmt genau, kein Gehalt, gar nichts.
DJERASSI: Warum haben Sie sich darauf eingelassen?
MARKER: Die Vereinbarung, die wir hatten – also wir wollten uns doch die Gewinne teilen, und am Ende des Jahres, das war vermutlich im Februar oder März, bin ich zu ihm gegangen und habe nach den Gewinnen gefragt, weil ich genau wußte, daß wir saftige Gewinne gemacht hatten. Ich hatte mindestens 30 Kilo Progesteron hergestellt, die ich ihm ausgehändigt hatte, und ein Teil davon ging nach Argentinien und wurde während des Krieges nach Deutschland weiterverschifft. Das war auch so eine Sache, die mir nicht paßte, daß das Produkt nach Deutschland verschifft wurde; ich weiß von mindestens zwei Kilo, die so dorthin gelangten. Ich fragte ihn also nach dem Gewinn, weil das Progesteron zu der Zeit noch immer für 25 bis 30 Dollar das Gramm verkauft wurde; er hatte den Preis etwas reduziert, aber bei 30 Kilo – da mußten wir doch einen Gewinn von schätzungsweise einer halben Million Dollar oder so ähnlich haben. Er sagte: „Was für Gewinne?“ Ich sagte: „Die Gewinne, die wir mit Syntex gemacht haben.“ Und ich fragte, ob ich die Bücher sehen kann. Und er sagte: „Nein, die würden Sie sowieso nicht verstehen.“ Ich sagte zu ihm, daß ich mir jemand besorgen würde, der Spanisch spricht und sich die Bücher anschaut. Er sagte: „Ich weigere mich, Ihnen die Bücher zu zeigen, weil Sie sie nicht interpretieren könnten.“ Zuletzt wurde er richtig wütend auf mich und sagte: „Es gibt überhaupt keinen Gewinn.“ Ich fragte ihn, wo die Gewinne geblieben seien. Er sagte: „Ich habe sie als Gehalt entnommen, und dagegen können Sie gar nichts machen.“ Da habe ich beschlossen wegzugehen.
Als Marker die Abschrift unseres aufgezeichneten Gesprächs vorgelegt wurde, fügte er den folgenden Absatz an, der seine industrielle Tätigkeit in Mexiko schildert, nachdem er Syntex verlassen hatte bzw. kurz bevor er sich Ende der 40er Jahre ganz aus der Chemie zurückzog:
„Als ich Syntex im Mai 1945 verließ, gründete ich in Texcoca eine Firma namens Botanicamex und stellte dort Progesteron her, bis die Produktion etwa im März 1946 nach Mexico City zu Gideon Richter verlegt wurde [das ungarische Unternehmen, mit dem Haberlandt zwei Jahrzehnte zuvor Verbindung aufgenommen hatte], die eine Firma namens Hormosynth gründeten, später umbenannt in Diosynth. Während meiner Zeit in Texcoca stellte ich etwa 30 Kilogramm Progesteron her, annähernd die gleiche Menge, die ich während meiner Zeit bei Syntex hergestellt hatte.“
Das Gespräch mit Marker endete etwas deprimierend. Ein Chauffeur war gekommen, um ihn von meinem Büro in Stanford zum Flughafen San Francisco zu fahren, von wo aus er zu einem kurzen Besuch nach Mexico City fliegen wollte. Er fragte nach der Herrentoilette, und als ich ihn hinführte, erkundigte er sich plötzlich: „Sagen Sie, wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Worüber haben wir gesprochen?“ Da ich befürchtete, er könnte plötzlich einen Gedächtnisverlust erlitten haben, griff ich in seine Jackentasche und holte sein Flugticket heraus. Nachdem ich ihm behutsam erklärt hatte, wo er war, gab ich das Ticket dem Chauffeur und bat ihn, Marker am Flughafen nicht einfach abzusetzen, sondern dafür zu sorgen, daß er das Flugzeug tatsächlich bestieg. Einige Wochen später erfuhr ich, daß Marker einen leichten Herzanfall erlitten hatte und in Texas aus dem Flugzeug in ein Krankenhaus gebracht worden war.
Mein aufgezeichnetes Gespräch mit ihm hatte im Beisein meines Kollegen Harry Mosher stattgefunden, heute Professor emeritus der Chemie in Stanford, der am Penn State promoviert und im gleichen Labor wie Marker gearbeitet hatte. Nachdem Marker gegangen war, sagte Mosher zu mir: „Es gibt auch andere Versionen.“ Und einige Zeit später, nachdem ich eine Autobiographie veröffentlicht hatte, in der Marker erwähnt wird, erhielt ich den Brief eines Lesers, eines amerikanischen Chemikers, der inzwischen in Israellebt und ebenfalls am Penn State im gleichen Labor gearbeitet hatte. Er schrieb erstaunlich verbittert und führte Beweise an, die seine Ansicht bestätigten, daß Marker bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ein virulenter Antisemit gewesen war, eine Behauptung, die später von einem weiteren unparteiischen Zeugen aus den frühen 40er Jahren bestätigt wurde.
Im Hinblick auf die chemische Geschichte der Pille (wenn auch nicht in den Augen eines Mannes, der vor Hitler fliehen mußte wie ich selbst) scheint Markers angeblicher Antisemitismus irrelevant zu sein. Bei den ihm unterstellten Vorurteilen gibt es jedoch einen interessanten Aspekt. Sein Doktorvater an der University of Maryland war Morris Kharasch, einer der ersten jüdischen Professoren, der vor dem Zweiten Weltkrieg an einer der von weißen angelsächsischen Protestanten dominierten chemischen Fakultäten Amerikas lehrte. Aus Gründen, die nie vollständig aufgeklärt wurden, erwarb Marker in Maryland nicht den Doktorgrad, sondern verbrachte nach einem kurzen Abstecher in die Industrie bei der Ethyl Corporadon sechs Jahre am Rockefeller Institute, wo er unter einem weiteren bekannten jüdischen Chemiker, Phoebus Levene, tätig war. Diese Zusammenarbeit endete unter so bitterbösen Umständen, daß Marker – als letzte Geste der Auflehnung gegenüber seinem Vorgesetzten – die Beschriftung faktisch sämtlicher Proben entfernte, die er zurückließ, als er seine neue Stelle am Pennsylvania State College antrat. Nur das Verbrennen der eigenen Laborbücher würde in Chemikerkreisen als ein noch größerer Vandalismus betrachtet.
Der Leser mag sich fragen, ob ich hier nur einen weiteren Faden der Marker-Legende ausspinne, an der schon so viele Journalisten gestrickt haben. In diesem Fall sind die Indizien persönlicherer Art, denn das Gespräch in Palo Alto war nicht das erste Mal, daß sich unsere Wege kreuzten. Etwa zwanzig Jahre nach Markers Tätigkeit in Levenes Labor setzte ich mich mit Alexander Rothen, seinem Nachfolger am Rockefeller Institute, in Verbindung. Zu der Zeit interessierte ich mich nicht für Marker selbst; ich war hinter rein wissenschaftlicher Beute her, nämlich einer Sammlung optisch aktiver Kohlenwasserstoffe, die Marker synthetisiert hatte, als er zwischen 1928 und 1934 bei Levene arbeitete. Als Antwort auf meine Bitte wurden mir mehrere Kisten mit Glasfläschchen präsentiert, die die kostbaren Proben enthielten; man stelle sich meine Gefühle vor, als ich entdeckte, daß die meisten unbeschriftet waren! Natürlich verstehen sich Chemiker darauf, die Identität unbekannter Substanzen herauszufinden – man bezeichnet das als „Strukturaufklärung“ –, und ich war ziemlich gut darin. Aber es war ein so ärgerlicher und unnötiger Zeitaufwand – die ganze Prozedur durchzumachen, bevor ich auch nur mit der Arbeit beginnen konnte, die mich zu der Bitte veranlaßt hatte –, daß ich mich immer gefragt habe, was Marker zu dieser Tat bewogen hat. Ob Antipathie gegen Juden etwas damit zu tun hatte? Interessanterweise endete die jüdische Verbindung nicht am Rockefeller Institute. Markers Partner bei der Gründung von Syntex und dem späteren bitteren Bruch waren beide jüdische Emigranten aus Europa.
Das einzige weitere Mal begegnete ich Marker im Jahre 1984, als die jährlich stattfindenden „Russell Marker Lectures in the Chemical Sciences“ der Pennsylvania State University ins Leben gerufen wurden. Er bat darum, daß ich die erste Vorlesungsreihe hielt, und ich benutzte die Gelegenheit, ihm in seinem Beisein mit einer freien Wiedergabe meines „Marker in Stanford“-Interviews Tribut zu zollen. Körperlich und geistig war er in guter Verfassung, und es freute mich, daß es sein Wunsch gewesen war, daß ich die Vorlesungsreihe eröffnete, die ihm zu Ehren eingeführt worden war. Dennoch fragte ich mich, ob er wußte, daß ich Jude bin.
Markers bleibender Beitrag zur modernen Chemie, und indirekt auch zur Pharmakologie und Medizin, beruht auf seiner Entdeckung, daß sich Steroidhormone aus einer in der Natur vorkommenden und billigen pflanzlichen Quelle synthetisieren lassen – eine Forschungsarbeit, die ich für so wichtig hielt, daß ich Marker bei einer Gelegenheit für den Nobelpreis vorschlug.
Um die Bedeutung von Markers Arbeit richtig würdigen zu können, muß man den Unterschied zwischen „totaler“ und „partieller“ Synthese kennen. Für den Chemiker bedeutet „Totalsynthese“, ein Molekül aus einfachsten Stoffen herzustellen, im wesentlichen aus Luft, Kohlenstoffquellen (wie Kohle oder Erdöl), Wasser und anderen elementare Substanzen – ähnlich wie man aus Lehm und Holz, Eisen und Sand ein Haus baut. Bei der „Partialsynthese“ dagegen beginnt man mit einem bereits vorhandenen Gebilde – sagen wir, einer Scheune – und baut es dann zu einem bewohnbaren Haus mit sanitären Einrichtungen und Zentralheizung um. Bei Markers Synthese war das Bauwerk, das entstehen sollte, ein „Steroid“ – ein Wort, das man heutzutage nur allzu oft hört, aber (außerhalb von Seminaren in organischer Chemie) selten genau erklärt bekommt. Vermutlich deshalb, weil die Definition nicht ganz einfach ist; ich will es dennoch versuchen, gemäß Einsteins berühmtem Diktum: „Alles sollte so einfach wie möglich gemacht sein, aber nicht einfacher.“