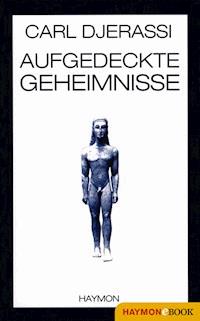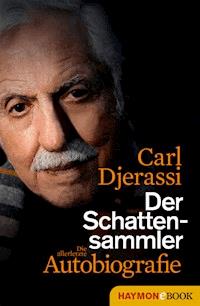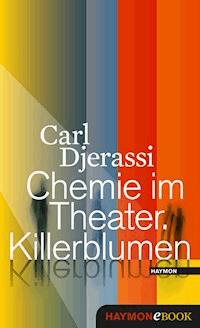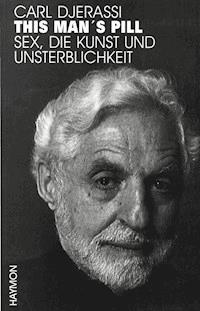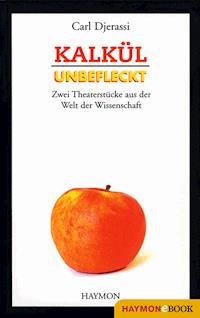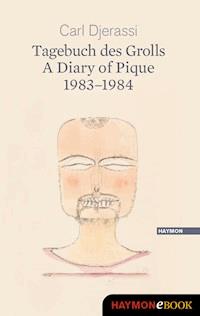Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor zehn Jahren hat Carl Djerassi seinen Roman "Marx, verschieden" über die Obsessionen eines erfolgreichen Autors geschrieben, der, anstatt sich über sein Selbstwertgefühl klar zu werden, seinen eigenen Tod in Szene setzt. In seinem neuesten Theaterstück "EGO" greift Djerassi das Thema wieder auf. Das Buch vereint beide Versionen. Der letzte Roman des Schriftstellers Stephen Marx wurde vom Starkritiker Noah Berg - früher einmal sein Entdecker und Förderer - derart verrissen, daß Marx auf Rache sinnt. Wie, wann und warum wurde aus dem Bewunderer ein Verfolger? Gönnt der Kritiker seinem Schützling den Erfolg nicht? Genau das wird für Marx zum zentralen Problem, zur fixen Idee. Der Literaturbetrieb als Tummelplatz beleidigter und beleidigender Eitelkeiten. Die Urteilskraft ist durch Sympathien und Antipathien getrübt. Erst wenn der Autor gestorben, sein Werk damit abgeschlossen und die Ausstrahlung der Persönlichkeit erloschen ist, kann der Schriftsteller auf gnädige Richter hoffen. Das will der Autor Marx, und er inszeniert sein eigenes Ableben ... In seinen vorangehenden Romanen und Theaterstücken waren es vor allem Probleme und Eitelkeiten der Wissenschaft und ihrer Protagonisten, die Carl Djerassi zum Thema seiner literarischen Arbeit machte. Erstmals seziert der Naturwissenschaftler und Literat in diesem Buch Gedankenwelt und Erfolgsstreben vieler seiner Schriftstellerkollegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CARL DJERASSI
EGO
ROMAN UND THEATERSTÜCK
Aus dem Amerikanischenvon Ursula-Maria Mössner
Der Roman mit dem neuen Titel „Ego“ erschien erstmals 1994 unter dem Titel „Marx, verschieden“ im Haffmans Verlag.
© 2004HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7501-5
Die Aufführungsrechte für das Stück „Ego“ liegen beim Bühnen- und Musikverlag Hans Pero, Bäckerstraße 6, A-1010 Wien, Tel.: 0043/1/5123467, E-Mail: [email protected]. Der Text des Stücks in diesem Buch darf zu Bühnenzwecken, Lesungen oder Vereinsaufführungen nur benutzt werden, wenn vorher das Aufführungsrecht vom Verlag Hans Pero erworben wurde.
Umschlag: Benno PeterSatz: Haymon Verlag
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhalt
Vorwort
Ego Roman
Ego Theaterstück
Über den Autor
Vorwort
„Ego“ ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen ein sehr vielschichtiges Wort. Wenn man es im Oxford English Dictionary oder im Duden-Wörterbuch nachschlägt und dann mit einem anderen wichtigen Wort mit drei Buchstaben vergleicht, nämlich „Sex“, wird man feststellen, daß es letzteres an Vieldeutigkeit und subtilen Nuancen bei weitem übertrifft. „Ego“ schließt eine Fülle von Bedeutungen ein, von Standarddefinitionen wie Selbstachtung und Eigendünkel bis hin zu der komplizierten Freudschen Bestimmung als der bewußte Teil unserer Psyche im Gegensatz zum unbewußten und libidinösen Es. Alle diese Definitionen schwingen in meinem EGO mit.
Als ich mich auf eine kreative Reise begab, die mich, den in der Forschung tätigen Naturwissenschaftler, zunächst zum Romancier und in jüngster Zeit zum Bühnenautor führte, hatte ich nicht bewußt den Plan gefaßt, über Ego oder Egoisten zu schreiben. Doch wenn ich heute die Themen Revue passieren lasse, die ich im Laufe meines literarischen Lebens während der letzten 15 Jahre in fünf Romanen und vier Theaterstücken behandelt habe, wird mir klar, daß es im Grunde irgendwie immer um „Ego“ geht. Das ist nicht verwunderlich, denn ich bin von der Kultur der naturwissenschaftlichen Forschung geprägt, wo das Ego stark in Erscheinung tritt. Was uns Naturwissenschaftler antreibt, ist die Befriedigung unserer Neugier, deren Begleiterscheinung aber nur allzuoft die Befriedigung des eigenen Egos ist, was sich im allgemeinen in dem zwanghaften Verlangen nach namentlicher Bekanntheit und Priorität beim Publizieren äußert. Doch allzu viele Naturwissenschaftler tun so, als ob das Ego bei ihrem Streben nach Ruhm und Anerkennung keine Rolle spiele, und verleugnen es bewußt, als wäre es ein Charakterfehler, den es zu verheimlichen gilt. Ein Charakterfehler ist es in der Tat, den aber fast jeder in der naturwissenschaftlichen Zunft aufweist, doch das muß daraus nicht automatisch eine Beleidigung oder eine Sünde machen; kein Wunder, daß meine „Science-in-Fiction“-Tetralogie voller Egoisten ist und in zwei meiner „Science-in-Theatre“-Bühnenwerke, nämlich in Oxygen (in Zusammenarbeit mit Roald Hoffmann) und Kalkül, einige der größten Egoisten der Naturwissenschaften auftreten, zum Beispiel Lavoisier, Leibniz und Newton.
Die Funktion der Berühmtheit in der Welt der Naturwissenschaften hatte schon früh mein Interesse erregt. Mit der Zeit veranlaßten mich meine Erfahrungen als Schriftsteller, der Frage nachzugehen, was Berühmtheit in der Welt der Literaten bedeutet. Das gab den Anstoß zu meinem Roman Marx, verschieden, in dem ich mein vertrautes, hauptsächlich von Naturwissenschaftlern bevölkertes Revier verließ und mich auf ein Gebiet begab, in dem Schriftsteller, Kritiker und Journalisten heimisch sind. Hier ein Auszug aus dem Vorwort des besagten Romans, dessen deutsche Ausgabe seit langem vergriffen ist:
Ein immer wieder auftretendes Thema meiner Romane ist der zwanghafte Drang in der Forschung tätiger Naturwissenschaftler nach Anerkennung durch ihre Standeskollegen und namentlicher Bekanntheit – das Streben, sich einen Namen zu machen, der für wissenschaftliches Arbeiten heutzutage ausschlaggebend ist. Dieser Drang, sich eine Reputation zu erwerben, hat viele Auswirkungen auf die Kultur der Naturwissenschaften, doch ein Aspekt hat bislang wenig Aufmerksamkeit erregt (Unterlassungen bleiben ja meist unbemerkt): Naturwissenschaftler veröffentlichen niemals anonym. Und genau da sehe ich einen Berührungspunkt zwischen zwei Gruppen, die wir nicht oft miteinander in Verbindung bringen, nämlich zwischen dem kreativen Künstler und dem in den harten Naturwissenschaften tätigen Forscher. Doch in Bereichen, in denen Überschneidungen bestehen, muß nicht unbedingt auch Übereinstimmung herrschen. Der Berührungspunkt zwischen den beiden Kulturen deckt somit zwar gewisse Konvergenzen auf, offenbart aber zugleich auch entscheidende Unterschiede.
Auch Schriftsteller haben fast immer das Bedürfnis, von ihren Kollegen anerkannt zu werden. Die zwanghafte Beschäftigung meines Romanciers Stephen Marx mit seinem eigenen Image unterscheidet sich nur unwesentlich von dem bohrenden Verlangen des Naturwissenschaftlers nach Bestätigung durch seinesgleichen. In beiden Fällen ist dieser Drang sowohl Nahrung als auch Gift für den kreativen Geist.
Doch Schriftsteller sind darüber hinaus bestrebt, auch außerhalb der eigenen Zunft anerkannt zu werden. Anders als Naturwissenschaftler, die auf Gedeih und Verderb von der Kritik ihrer Kollegen abhängig sind, muß ein Schriftsteller in erster Linie den Beifall der breiten Öffentlichkeit finden. Selbst die positive Beurteilung durch Kritiker und Rezensenten, nach der Autoren so lechzen, ist für die Aufnahme in die Bestsellerlisten nicht unbedingt erforderlich. Hier sind Naturwissenschaftler im Vorteil: Sie haben es nicht mit berufsmäßigen Kritikern zu tun, weil es die in ihrer intellektuellen Welt gar nicht gibt – die, nebenbei bemerkt, auch die breite Öffentlichkeit ausschließt. In dieser Hinsicht besteht zwischen den beiden Gruppen jedoch ein entscheidender Unterschied, der mich am meisten beschäftigt, da er meiner Meinung nach den eigentlichen Kern der Sache trifft. Es geht um die Identität des Individuums – um das Ego, den wahren Ursprung allen Erfolgsdenkens … Die Frage der Berühmtheit ist nicht müßig, weil sie letzten Endes über das Ego hinausgeht und die Qualität des Werkes selbst betrifft.
Wenn der eigentliche Zweck darin besteht, öffentliche Anerkennung zu ge winnen, kommt es dann darauf an, welcher Name letztendlich bejubelt wird? Ich denke an das Beispiel anglo-amerikanischer Schriftsteller wie Eric Blair und David Cornwell, Mary Ann Evans oder William Sidney Porter – war und ist es für sie von Bedeutung, daß sie für ihr Publikum George Orwell und John Le Carré, George Eliot und O. Henry sind? Wenn man berühmt wird, welche Beziehung besteht dann zwischen der Reputation des Betreffenden und seiner wahren Identität und Bedeutung?
Fragen dieser Art wecken in Stephen Marx, dem Helden meines Romans, letzten Endes den Wunsch, seine eigenen Nachrufe zu lesen, Mäuschen zu spielen und herauszufinden, was man in Wahrheit von ihm hält. Diesen Traum hegen gewiß auch andere ehrgeizige und phantasiebegabte Menschen, nicht zuletzt ich selbst. Doch Stephen Marx, ein bekannter New Yorker Schriftsteller, begnügt sich nicht damit, zu träumen: Er schreitet zur Tat und täuscht seinen Tod bei einem Segelunfall vor. Als die Trauerfeierlichkeiten vorbei und die Nachrufe geschrieben sind, steht Marx vor der Frage: Was nun? Er taucht unter dem geschlechtslosen Namen D. Mann in San Francisco unter und beginnt ein neues literarisches Leben.
Obwohl ich Marx, verschieden vor über zehn Jahren schrieb, haben mich der Roman und seine Hauptperson, der angebliche Selbstmörder Stephen Marx, immer wieder beschäftigt. Als ich Theaterstücke zu schreiben begann und nachdem ich drei Stücke über Naturwissenschaften und Naturwissenschaftler verfaßt hatte, beschloß ich, diesen Roman wieder aufzugreifen und daraus ein Stück mit dem Titel EGO zu machen. Darin setze ich mich mit dem Thema des literarischen Weiterlebens nach dem Tod und der anonymen Berühmtheit auseinander (scheinbar ein Widerspruch in sich selbst), diesmal jedoch im anspruchsvolleren Kontext der Heteronomie – einer Erfindung des portugiesischen Lyrikers Fernando Pessoa, der nicht nur in der Gestalt mindestens dreier Autoren gleichzeitig schrieb, sondern auch in deren Identität schlüpfte.
Und damit komme ich zum eigentlichen Zweck dieses Vorworts. Ich bin überzeugt, daß ein Stück zu lesen, statt es nur hin und wieder auf der Bühne zu sehen, genauso herausfordernd und anregend sein kann wie die Lektüre konventionell geschriebener Romane oder Biographien. Dennoch lesen wir so gut wie nie zeitgenössische Theaterwerke, sondern beschränken uns hauptsächlich (vor allem im Schulunterricht) auf die Werke der Dramatiker des Kanons, wie Shakespeare, Schiller, Tschechow und Molière oder ihre Vorläufer, die griechischen Klassiker. Dabei muß man sich nur einmal in einer gut ausgestatteten Theaterbuchhandlung umsehen, beispielsweise der des Royal National Theatre in London, um eine wahre Fundgrube an breitgefächertem Lesestoff zu entdecken, der ausschließlich in direkter Rede vorliegt. Und da Naturwissenschaftler ihre wissenschaftlichen Arbeiten nie in Dialogform verfassen, ist es bei mir fast zur Obsession geworden, mich gegen dieses Tabu unserer Zunft aufzulehnen, indem ich „Science-in-Theatre“-Texte schreibe und sie in Buchform veröffentlichen lasse. Die positive Aufnahme meiner ersten drei Theaterstücke durch Leser, statt nur durch Theaterbesucher, hat mich angespornt, weiterhin tatkräftig Werbung für Theatertexte als Lektüre zu machen.
Die Verwandlung von Marx, verschieden in das Theaterstück EGO vermittelte mir neue Einblicke in den Protagonisten und sein übermächtiges Ego. Stephen Marx ist keine sympathische Figur – kaum jemand mit stark ausgeprägtem Ego ist das –, aber eine interessante und komplizierte Persönlichkeit. Ihn zu analysieren rief in mir viele auto-psychoanalytische Resonanzen hervor, die vermutlich der Grund sind, weshalb in dem Theaterstück „der Therapeut“ als wichtige neue Figur auftritt und warum ich dem Roman, der seit Jahren vergriffen ist, nun ebenfalls den Titel EGO gegeben habe. Aus Stephen Marx’ Verhalten läßt sich manches lernen, so daß die Metamorphose von EGO, dem Roman, zu EGO, dem Theaterstück, die Aufmerksamkeit des Lesers verdient. Ich vermute sogar, daß sie dem aufmerksamen Leser auch einiges über den Autor des Romans und des Theaterstückes verrät.
Carl Djerassi
San Francisco, 1. Januar 2004
EGO
Roman
Für Brett Millier und Terrence Holt
CAVEAT LECTOR
Abendgesellschaften, die auf ersten Versuchen basieren, die Soufflé-Rezepte aus Kapitel 20 nachzukochen, werden aller Voraussicht nach unerwartete Konsequenzen haben, für die keine Verantwortung, weder juristischer noch moralischer Art, übernommen werden kann. An den Autor gerichtete Reklamationen gehen ungelesen an den Absender zurück. Der Eingang faszinierender Verbesserungsvorschläge wird unter Umständen bestätigt.
„Erst der Tod des Autorsermöglicht die Geburt des Schreibens.“
Roland Barthes
1
„Rocco.“ Die Stimme am Telefon war barsch, das rollende R röhrend wie ein Ferrari im ersten Gang.
„Ich rufe wegen einer Reservierung an“, sagte er. „Für zwei Personen. Kommenden Donnerstag, 19 Uhr.“
„Name?“
„Marx.“
„Buchstabieren Sie das.“
O Gott, nicht schon wieder, dachte er. „Marx, wie Karl Marx.“
„Mit C oder K?“
„Das war nur zur Erläuterung: Karl Marx, Groucho Marx … Mein Name ist Stephen, nicht Karl.“
Die barsche Stimme ging in die Defensive. „Also noch mal von vorn. Nachname?“
„MARX.“
„Alles klar.“
Stephen Marx klang erleichtert. „Ich hätte gerne eine Nische, nicht einen Tisch in der Mitte, und wenn möglich in einer Ecke, wo man ungestört ist.“
„Geht klar.“
„Saint.“
Ambrose McPhearson lächelte, als er ihm über den Tisch hinweg die Hand reichte. Nur Freunde und Verwandte von Marx benutzten diesen Spitznamen. Diesmal nahm er an, daß es herzlich gemeint war.
Spitznamen entstehen gewöhnlich in der Kindheit, doch Stephen Marx war bereits Anfang Zwanzig, als er den Namen „Saint“ bekam. Kurz nach Abschluß des Studiums in Yale, während eines einjährigen Studienaufenthalts in Zürich, hatte auf dem ersten Brief, der auf deutsch an ihn adressiert war, gestanden: Herrn St. Marx. Nachdem er erfahren hatte, daß St. die deutsche Abkürzung für Stefan war, hatte er sich prompt Briefpapier und Umschläge mit dem Aufdruck St. Marx, Dreidingstrasse 43, Zürich bestellt. Als er dann, fließend Deutsch sprechend, in die Staaten zurückkehrte, hatte sich der Spitzname „Saint“ bei Angehörigen und Freunden bereits eingebürgert.
„Schön, dich zu sehen“, sagte McPhearson. „Es ist Monate her.“
„Schön, dich zu sehen, Bos“, erwiderte Marx. „Gewöhnlich bekommt man dich ja nicht derart kurzfristig zu sehen.“ McPhearson lächelte. In der Bank nannte ihn niemand „Bos“; dafür war er dort viel zu sehr der Boß. „Du weißt doch: Ob man ‚beschäftigt‘ ist, hängt davon ab, wer fragt. Für dich bin ich immer zu sprechen. Wie geht’s Miriam? Was habt ihr zwei denn so getrieben?“
„Es geht ihr gut“, sagte Marx schulterzuckend. „Sie steckt bis hier in ihrem Party-Service.“ Er hob die Hand in Höhe des Nasenrückens.
„Und was macht deine Arbeit?“
„Hast du die Rezensionen meines letzten Buches gesehen?“
„Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich sie nicht gesehen habe“, erwiderte McPhearson. „Wie waren sie?“
Marx’ Versuch, nonchalant zu wirken, ging in einer aufsteigenden Woge des Zorns unter. „Du weißt ja, wie das mit Rezensionen ist. Die meisten waren gut bis hervorragend, aber dann hat mich die von Noah Berg so geärgert, daß ich beinahe wünschte, Duelle wären noch in Mode.“
McPhearson zog die Augenbrauen hoch. „Wirklich? Was hat er denn geschrieben?“
In Cohens Dilemma geht es darum, was geschieht, wenn sich herausstellt, daß eine – für den betreffenden Wissenschaftler – „tolle“ Theorie durch einen manipulierten Versuch „nachgewiesen“ wurde. Dramatisch wird die Sache, wenn sich herausstellt, daß der Schuldige der Lieblingsassistent von Professor I. Cohen (genannt I. C., was alles besagt) ist, und wenn die zweifelhaften Ergebnisse Cohen und dem Assistenten am Ende auch noch den Nobelpreis einbringen.
Der ernste Teil der Handlung – obgleich der Autor seinen Roman zweifellos für ein durch und durch ernstes Buch hält – zeigt auf, wie sehr Cohen moralisch und persönlich von der Meinung seiner Kollegen abhängig ist. Der gute Ruf und seine Schatten und Mängel bilden das zentrale Thema, aber die Art und Weise, wie Marx es hier behandelt, könnte einen zu der Auffassung verleiten, der gute Ruf sei ein Preis, der widerwillig verliehen wird und beim geringsten Zweifel vollständig ruiniert ist. Entweder man hat ihn, oder man hat ihn nicht. Von Marx hätte man eigentlich mehr Subtilität erwartet.
Aber vielleicht hat er zu sehr den Nobelpreis im Kopf.
Das hatte in der Rezension gestanden, und weil er sie geradezu zwanghaft wieder und wieder gelesen hatte, kannte er den Text fast auswendig. Er widerstand dem Drang, ihn laut zu wiederholen: Die Worte waren bitter genug, auch ohne daß er sie aussprach.
„Lassen wir das“, sagte er. „Ich habe dich nicht eingeladen, um über eine Rezension zu schimpfen. Bestellen wir lieber.“
Abgeschirmt durch die aufgeschlagenen Speisekarten, entging den Männern die Ankunft von zwei Frauen, die in der Nische neben ihnen Platz nahmen. Beide waren in den Zwanzigern: die eine groß und dünn, Typ Mannequin; die andere von Größe und Gewicht her eher durchschnittlich, auf den ersten Blick nicht besonders auffallend – zumindest nicht im Vergleich zu dem Mannequin.
„Also, was gibt’s, Saint?“ fragte McPhearson, als der Kellner die Bestellungen aufgenommen hatte und gegangen war. „Was hat dich nach all den Monaten zu dieser Einladung zum Abendessen veranlaßt? Hast du mich nur vermißt oder brauchst du eine kostenlose Finanzberatung?“
Marx beugte sich vor. „Hast du gewußt, daß Hemingway es fertiggebracht hat, seine eigenen Nachrufe zu lesen?“
McPhearson warf ihm einen abschätzenden Blick zu und sagte dann gelassen: „Ja.“
„Ja?“ Marx schien verblüfft zu sein. „Woher weißt du das?“
McPhearson tat es mit einer Handbewegung ab. „Ich habe am Dartmouth College einmal eine Seminararbeit über Hemingway geschrieben.“ Er beugte sich über den Tisch und sagte in vertraulichem Ton: „Würdest du mir bitte sagen, warum du das wissen willst?“
„Wäre es nicht aufregend, wenn man seinen eigenen Nachruf lesen könnte?“
„Aufregend? Ich sehe meinen Nachruf schon vor mir: Ambrose Samuel McPhearson, geboren am 16. April 1939 in Pocatello, Idaho; Studium in Dartmouth und an der Wharton School. Dann steht hoffentlich noch da, daß ich in der Bankenwelt zu Rang und Würden gelangt bin, was für ein As ich im Aushandeln von Unternehmensfusionen war und wie sehr ich von meiner trauernden Ehefrau Jessica, meinen drei Kindern und meinen zahlreichen untröstlichen Freunden vermißt werde. Alles in allem wäre ich aber doch lieber am Leben.“
„Wer spricht denn von Sterben? Ich spreche davon, den eigenen Nachruf zu lesen, während man noch am Leben ist – genau wie Hemingway.“
McPhearson sah ihn an. „Warum dieses plötzliche Interesse für Hemingway, Saint? Hat das vielleicht etwas mit Konkurrenzneid zu tun?“
„Es geht mir ja gar nicht um Hemingway. Außerdem hat er die Sache verpatzt, wie du ganz genau zu wissen scheinst. Er ist zu früh wieder aufgetaucht, kein Mensch hatte Zeit, eine kritische Beurteilung seines Werkes auf den Markt zu werfen. Aber wenn er die Sache nun besser gedeichselt hätte?“ Marx beugte sich vor, die Hände flach auf die Tischdecke gelegt. „Was wäre, wenn man seinen eigenen Tod inszenieren und tot bleiben könnte? So lange, bis die ernsthaften Kritiker aus ihren Löchern kriechen und nicht nur die journalistischen Schreiberlinge.“
Seine Stimme war immer lauter geworden. Auf der anderen Seite der Trennwand hatte eine der Frauen den Kern des Zwiegesprächs der Männer mitbekommen. Sie überließ das Reden ihrer Begleiterin und hörte lieber den beiden zu.
Marx senkte die Stimme. „Ein Banker kann das wahrscheinlich nicht verstehen. Ihr seid entweder finanziell erfolgreich oder Versager – dazwischen gibt es kaum etwas. Das Urteil eurer Kollegen ist nicht weiter wichtig. Das einzige, worauf es ankommt, sind Zahlen: Dollars, Gewinne oder Verluste; was unter dem Strich rauskommt.“
„Na, hör mal!“ protestierte McPhearson. „Du bist ganz schön eingebildet.“
„Ich bin nicht eingebildet. Es geht doch nur um den Unterschied zwischen Bankern und Leuten wie mir – Leuten, deren Selbstachtung von der Meinung anderer abhängt.“
„Jetzt redest du aber wirklich Schwachsinn, Saint. Seit wann hängt denn deine Selbstachtung von irgendeinem anderen Menschen ab?“
„Etwa nicht?“ sagte Marx düster. „Hast du jemals darüber nachgedacht, wie das ist, wenn man auf einem Gebiet tätig ist, auf dem sich Erfolg nicht quantifizieren läßt? Welche Unsicherheit damit verbunden ist? Welche Verunsicherung? Warum solltest du auch. Ich habe ja selbst erst darüber nachgedacht, als ich Monate damit verbrachte, Wissenschaftler für Cohens Dilemma zu interviewen. Und dabei ist mir vom ersten Moment an aufgefallen, wie sehr sie alle auf die Meinung ihrer Kollegen fixiert sind. Einstein wußte nur deshalb, daß er ein großer Physiker war, weil andere Physiker es ihm bestätigten. Hätten sie es nicht getan, so wäre er bis zum Ende seiner Tage ein kleiner Angestellter im Berner Patentamt geblieben. Als ich an Cohen arbeitete, dachte ich natürlich, das sei eben so ein Tick der Wissenschaftler. Aber inzwischen …“ Marx lehnte sich zurück, die Hände in den Hosentaschen vergraben, und starrte auf etwas unter der Tischdecke, von dem McPhearson nur annehmen konnte, daß es seine Schuhe waren. „Inzwischen entdecke ich es überall. Bühnenautoren und Schauspieler, die nach der Premiere kaum das Erscheinen der Zeitungen erwarten können. Komponisten, Architekten. Und Schriftsteller wie ich, die Magengeschwüre bekommen, während sie darauf warten, daß die ‚Times‘ ihr neuestes Buch rezensiert. Du machst dir sogar Sorgen, auf welcher Seite sie es bringen werden.“
Marx verstummte. Er merkte, daß er dozierte – was nicht seinem üblichen rhetorischen Stil entsprach, ganz gleich, was seine Freunde sagen mochten –, aber er konnte einfach nicht anders: Er verspürte den unwiderstehlichen Drang, es McPhearson – irgend jemandem – verständlich zu machen. Aber wie sollte er das bange Gefühl erklären, das ihn seit der Beendigung von Cohens Dilemma beschlichen hatte, nämlich ob sein literarisches Werk etwas taugte. Der Ausdruck des Rezensenten Der gute Ruf und seine Schatten und Mängel hatte sich wie ein Krebsgeschwür in ihm festgefressen, bis der Schmerz fast spürbar geworden war. Stephen Marx, der Autor von dreizehn Romanen, hatte einen guten Ruf, aber was taugte er als Schriftsteller wirklich? Wie sollte er das jemals erfahren?
„Als John O’Hara starb“, sagte er leise, „schrieb Cheever in ‚Esquire‘ über ihn; sechs Monate nach Cheevers Tod schrieb Saul Bellow einen ungemein einfühlsamen Artikel über ihn in der ‚New York Review of Books‘; oder Philip Roths Reminiszenzen an Bernard Malamud in der ‚Times‘. Jede Wette, daß O’Hara, Cheever und Malamud diese Worte nur zu gern gelesen hätten.“
McPhearson hatte seinem Freund zugehört, ohne ihn aus den Augen zu lassen. „Was ist mit den Kritikern? Gewiß, ihr habt eure Noah Bergs, aber es gibt ja auch andere Kritiker. Könnt ihr da nicht eine gewisse Übereinstimmung erreichen?“
„Genau darum geht es doch“, sagte Marx gereizt. „Ich bin davon überzeugt, daß die meisten Kritiker einen Schriftsteller nicht so sehr danach beurteilen, was er macht, sondern danach, in welchem Stadium seiner Karriere er sich befindet – als ob es einen einheitlichen Maßstab für Leistung gäbe. Wenn du ein Neuling bist, gehen sie behutsam mit dir um. Nicht unbedingt aus Hochherzigkeit; Kritiker sind sich darüber im klaren, daß es ziemlich witzlos ist, einen Unbekannten zu verreißen.“ Die Gnocchi auf Marx’ Gabel hatten fast seinen Mund erreicht, doch im letzten Moment legte er sie wieder hin. „Die zweite Phase beginnt, wenn sie einen bekannten Autor besprechen, vorzugsweise einen, der schon Bestseller geschrieben hat. Dann fangen die Kritiker an, die Messer zu wetzen; einige von ihnen versuchen, raffiniert zu sein, andere sind brutal; einige bleiben natürlich schmeichelhaft, und du wirst ihr Liebling.“
„Saint“, warf McPhearson ein, „nun iß endlich deine verdammte Pasta.“
„Tut mir leid“, sagte Marx. Er blickte auf seine Gabel, als wäre er nicht sicher, wozu sie diente, und legte sie dann weg. „Aber was mich fasziniert, ist die dritte Phase: die posthume Beurteilung. Da erst lernt man die wahre Meinung dieser Herren kennen. Ich wüßte zu gern, was gewisse Leute – auch Berg – wirklich von mir halten; was sie schreiben würden, wenn ich tot wäre.“
Aber selbst als er sich endlich seinem Essen zuwandte, hatte Marx noch Zweifel. Werde ich meinen wahren Wert selbst dann erfahren? Er erinnerte sich an die abschließenden Worte des Nachrufs der ‚Times‘ auf John O’Hara, der in seinen letzten Lebensjahren von den ernsthaften Kritikern ziemlich schäbig behandelt worden war: „… John O’Haras umfangreiches Werk wird vielleicht wesentlich länger überdauern, als wir prophezeit haben.“ War es das, was der Mäuschen spielen wollende Marx über sich lesen wollte? Daß ich Bestand haben werde?
McPhearson hörte auf zu essen; Verwirrung machte sich auf seinem Gesicht breit. „Ich habe das dumme Gefühl, daß du etwas ganz Bestimmtes im Sinn hast“, sagte er und starrte seinen Freund an. „Ist das der Grund, weshalb wir heute abend hier sind?“
Die Frau hatte längst aufgehört, ihrer Begleiterin zuzuhören. Wer ist dieser Mann, dachte sie, der seinen eigenen Nachruf lesen will? Er muß prominent sein; sonst würde er sich deswegen keine Gedanken machen. Sie wollte ihn sich unbedingt genauer ansehen. Ein Gang zur Toilette würde Gelegenheit dazu bieten. Aber die weiteren Einzelheiten waren viel zu faszinierend, um sie zu verpassen.
„Saint, du machst mir Sorgen. Du hast deine Gnocchi kaum angerührt. Ich habe dich schon früher in diesem Ton über deine Arbeit sprechen hören, aber diese Nachrufgeschichte …“ Er schüttelte den Kopf. „Ich komme da nicht mit.“
Marx probierte eine Gabelvoll Gnocchi und verzog das Gesicht. „Kalte Gnocchi sind das Letzte.“ Er schob den Teller weg. „Hast du gewußt, daß Agatha Christie einmal ihren eigenen Tod inszeniert hat?“
„Mhm. Aber das hatte nichts mit dem Wunsch zu tun, den eigenen Nachruf zu lesen. Sie wollte sich rächen, weil ihr Mann im Begriff war, sie zu verlassen.“
Marx schenkte dem keine Beachtung. „Eine interessante Sache“, sagte er nachdenklich. „Sie hat ihr Verschwinden sehr sorgfältig geplant, aber sich keine plausible Methode für ihr Wiederauftauchen ausgedacht. Am Ende fiel ihr nichts Besseres ein als ‚zeitweiliger Gedächtnisschwund‘.“
McPhearson legte Messer und Gabel weg. „Willst du einen Roman darüber schreiben oder meinst du es etwa ernst?“ Marx trank einen Schluck Wein. „Ernst. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Ich brauche deine Hilfe.“
„Du willst doch nicht etwa andeuten, daß…“McPhearson sah ihn mit einem Blick an, der Marx das Gefühl gab, mit seinen Zahlungen im Verzug zu sein. „Du erwägst doch wohl nicht allen Ernstes, mich darum zu bitten, dir bei den Vorbereitungen für deinen Tod zu helfen?“
„Reg dich ab, Bos. Was ich vorhabe, verstößt nicht gegen das Gesetz. Für dich ist damit keinerlei Risiko verbunden. Ich brauche lediglich deine Hilfe.“
„Ich glaube nicht, daß die Hilfe eines Bankfachmanns das ist, was du im Moment brauchst, mein Lieber.“ McPhearson grinste, als er das sagte, aber es war ein Grinsen, das die Zähne zeigte.
„Ich mache keine Witze, Ambrose. Ich bin davon überzeugt, daß es meine weitere Arbeit ungeheuer beeinflussen wird. Selbst wenn das nicht der Fall ist, bin ich von dieser Idee derart besessen, daß ich eine monumentale Schreibblockade habe. Bitte hör mich an.“ Marx streckte die Hand über den Tisch und faßte seinen Freund am Ärmel. „Fangen wir mit der Grundvoraussetzung an: Wenn man seinen eigenen Nachruf lesen will, muß man eine plausible Form des Verschwindens wählen, etwas, bei dem jeder sofort davon ausgeht, daß man tot ist, auch wenn die Leiche nicht gefunden wird. Richtig?“
„Ich glaube, ich höre nicht recht.“
Marx packte McPhearsons Handgelenk. „Richtig?“
„Schon möglich“, sagte McPhearson widerstrebend. „Sprich weiter. Und laß mich los.“
Marx ließ sein Handgelenk los. „Wie gesagt, geht es mir nicht um einen simplen Nachruf. Ich möchte detaillierte, kritische Rückblicke von bedeutenden Kritikern …“
„Wie Berg?“
„Berg?“ Die Unterbrechung schien Marx einen Moment lang aus der Fassung zu bringen. „Ich scheiß auf Berg“, zischte er. „Er ist Rezensent, und Rezensieren hat nichts mit einer kritischen Beurteilung zu tun. Ich zitiere jetzt Henry James“, setzte er in ruhigerem Ton hinzu.
„,Kritiker sind die Läuse in den Locken der Literatur‘“, sagte McPhearson lachend. „Es ist erstaunlich, was einem aus der Schulzeit so alles im Gedächtnis bleibt. Tennyson soll das über die Kritiker gesagt haben.“
„Oder die Pomade, die ihre eigenen Locken zum Glänzen bringt. Weißt du, wer das gesagt hat?“
„Wer?“
„Meine Wenigkeit. Ist mir gerade eingefallen. Aber eine kritische Beurteilung – ob lausig oder glänzend – braucht Zeit, allerwenigstens einige Wochen, wenn nicht Monate. Wenn man sich schon die Mühe macht, einen glaubwürdigen Tod zu inszenieren, dann sollte man daraus auch möglichst viel Kapital schlagen …“
„Sind Sie fertig, Sir?“
Die Stimme des Kellners ließ Stephen Marx zusammenzucken.
„Ich glaube, ja“, murmelte er mit einem Blick auf die kaum angerührten Gnocchi auf seinem Teller.
„Dessert? Kaffee?“ fragte der Kellner.
Marx schüttelte den Kopf und wartete ungeduldig, während McPhearson sich mit dem Kellner beriet. „Einmal Tiramisu und zwei Gabeln. Und zwei Cappuccino.“
Marx war erleichtert, als der Kellner ging. „Laß mich fortfahren. Der tote Autor muß einige Monate tot bleiben. Und dabei brauche ich deine Hilfe.“
„Was?“ knurrte McPhearson.
„Ich brauche etwa fünfundzwanzig Riesen, aber ich kann diese Summe nicht von meinem Konto abheben, ohne daß es auffällt. Ich zahle es dir am Tag meiner Rückkehr zurück. Zum Vorzugszins plus zwei Prozent“, fügte er verlegen hinzu. „Und würdest du außerdem ein Auto auf deinen Namen mieten und es mich in der Zwischenzeit fahren lassen? Ich kann ja nicht gut selbst eines mieten, wenn ich angeblich tot bin, und ich möchte nicht gegen das Gesetz verstoßen, etwa indem ich mir einen gefälschten Führerschein besorge.“
„Was ist, wenn du von der Polizei angehalten wirst?“
„Ich muß eben vorsichtig fahren und hoffen, daß keiner auf mich drauffährt. Bos, bist du bereit, mir zu helfen?“
„Das bezweifle ich“, erwiderte McPhearson. „Erst mußt du mir erklären, wie du deinen Tod inszenieren willst. Und wie du nach ein paar Monaten wieder auftauchen willst, ohne zuzugeben, daß alles nur eine Farce war.“
„Ich habe mir alles genau überlegt“, erwiderte Marx. Er beugte sich vor und sah seinem Freund direkt in die Augen. „Wie ich zurückkomme, erzähle ich dir später. Laß mich erst einmal erklären, wie ich sterben werde. Denn dabei brauche ich deine Hilfe.“
„O nein“, unterbrach ihn McPhearson. „Ich laß mich von dir nicht in einen Todesfall verwickeln, weder in einen echten noch in einen imaginären.“
„Nun warte doch“, bat Marx flehentlich. „Laß mich ausreden. Du weißt, daß ich oft allein segle. Die Leute im Mamaroneck Yacht Club kennen mich; niemand wäre überrascht, wenn ich mitten in der Woche allein hinausfahren würde. Vergiß nicht: Ich bin der berühmte Autor, der keine festen Arbeitszeiten hat. Angenommen, ich sage, daß ich den ganzen Tag im Long-Island-Sund segeln will und daß ich nachmittags um fünf wieder zurück bin. Du folgst mir in deinem Motorboot. Wir suchen uns einen scheußlichen, windigen Tag aus, an dem sonst niemand auf dem Wasser ist. Sobald wir von der Küste aus nicht mehr zu sehen sind, steige ich auf dein Boot um und lasse die Schwimmweste zurück.“ Marx’ Stimme hatte einen flehenden Ton angenommen, als bettelte er darum, daß man ihm Glauben schenkte. „Du weißt ja, wie viele Bootsfahrer keine Schwimmweste anlegen, besonders wenn sie einen Sicherheitsgürtel tragen. Du bringst mich dort an Land, wo dein Mietwagen steht, und ich mache mich aus dem Staub. Der Sicherheitsgürtel wird aussehen, als ob er gerissen wäre; also liegt es auf der Hand, daß ich ins Wasser gefallen bin. Wir begehen kein Verbrechen; du behauptest ja nicht, daß ich tot bin. Ich verschwinde lediglich, und du gehst einfach nach Hause.“
„Und dann?“ fragte McPhearson.
„Dann mache ich mich auf den Weg nach San Francisco. Ich werde vorsichtig fahren, weil ich das Tempolimit nicht überschreiten will. Ich bin erst ein einziges Mal an der Westküste gewesen, vor Jahren. Niemand kennt mich dort. Ich nehme mir ein Postfach in San Francisco und laß dich wissen, wie du dich mit mir in Verbindung setzen kannst.“
„Du hast dir alles ganz genau zurechtgelegt“, sagte McPhearson leise.
„Ich glaube schon“, sagte Marx.
„Was ist mit deinen Freunden und Verwandten? Und mit Miriam?“
2
„Verdammt noch mal, Saint.“
Niemand hätte den Ton, in dem Miriam das letzte Wort ausspuckte, für Zuneigung gehalten. Als sie weitersprach, war ihre Laune eindeutig, aber worauf die Debatte hinauslief, war Stephen immer noch nicht klar.
„Wenn du Essen mit Frauen assoziierst – oder heißt es Frauen mit Essen? –, dann geht es um die Befriedigung infantiler Bedürfnisse. Aber sobald es Männer betrifft, muß es natürlich ein Ausdruck von Genialität sein. ‚Selbst gekocht‘ ist das größte Kompliment, das du einer Frau machen kannst, aber für einen männlichen Küchenchef wäre das eine Beleidigung. Die Behauptung, es gäbe keine großen weiblichen Küchenchefs, ist ein Ausdruck von schamlosem männlichem Chauvinismus. Was ist mit Julia Child? Alice Waters?“
„Wer ist Alice Waters?“ fragte Stephen, ohne zu merken, daß er die Gereiztheit seiner Frau damit nur schürte.
„Du bist nicht nur ein Chauvinist, du bist auch so ein verdammter New Yorker, daß du nicht einmal weißt, daß es eine kalifornische Küche gibt.“ Miriam kochte.
„Also wirklich, Miriam.“ Stephen versuchte seine Frau zu besänftigen. „Was ist denn so schlimm daran, New Yorker zu sein?“
Miriam hielt inne, um Luft zu holen, was Stephen erkennen ließ, daß er ihr besser keine so große Angriffsfläche hätte bieten sollen. „Nehmen wir Julia Child“, sagte er rasch. „Sie unterrichtet Kochen. Große Köche unterrichten nicht, die bekommen Wutanfälle.“
„Wie alle genialen Männer, nehme ich an. Du mußt es ja wissen.“
Er hatte Miriam ablenken wollen, aber das Thema hatte ihn selbst von der Debatte abgebracht und seine Gedanken in eine nur allzu vertraute Richtung wandern lassen. „Sie hüten ihre Geheimnisse“, fügte er hinzu.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!