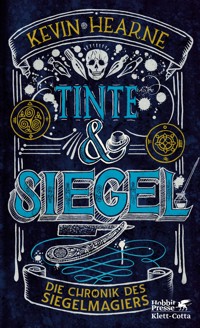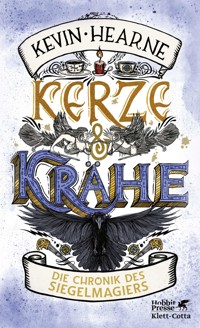13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chronik des Eisernen Druiden
- Sprache: Deutsch
Über kurz oder lang muss ein Druide zwangsläufig mit dem einen oder anderen Vampir in Konflikt geraten. Oder auch ganzen Legionen von ihnen. Tatsächlich haben sich die blutrünstigen Unruhestifter zu einem riesigen Problem ausgewachsen – das nach einer Lösung schreit. Dieser Band enthält außerdem die Erzählung »Vorspiel zum Krieg« Atticus könnte Beistand gebrauchen: Den Vampiren rund um ihren Anführer Theophilus muss das Handwerk gelegt werden. Doch seine Verbündeten haben eigene Sorgen. So wird der Erzdruide Owen Kennedy von seiner Troll-Vergangenheit eingeholt und Granuaile kämpft verzweifelt darum, sich vom Brandzeichen des nordischen Gottes LOKI zu befreien. Als Atticus im Zug seines Kampfes gegen Theophilus in Rom eintrifft, erscheint ihm die Ewige Stadt als passender Ort für das Ende des Unsterblichen. Doch das hat seinen Preis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kevin Hearne
Aufgespießt
DIE CHRONIK DES EISERNEN DRUIDEN 8
Aus dem Amerikanischenvon Friedrich Mader
Klett-Cotta
Impressum
Für Nigel in Toronto
Die für die Handlung wichtigsten Götternamen sind
in VERSALIEN gesetzt.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»staked. The Iron Druid Chronicles 8«
im Verlag Ballantine Books, New York.
»Prelude to War« in »Three Slices«
© 2015/2016 by Kevin Hearne
Für die deutsche Ausgabe
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung der Illustration des Originalverlags © Gene Mollica
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98133-9
E-Book: ISBN 978-3-608-11019-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Die Chronik des Eisernen Druiden Was bisher geschah
Atticus O’Sullivan, im Jahr 83 vor Christus als Siodhachan Ó Suileabháin geboren, war einen Großteil seines Lebens als Druide auf der Flucht vor AENGHUS ÓG, einem Gott aus den Reihen der TUATHA DÉ DANANN. AENGHUS ÓG wollte Fragarach zurückhaben, ein magisches Schwert, das Atticus im zweiten Jahrhundert gestohlen hatte, und die Tatsache, dass Atticus gelernt hatte, dauerhaft jung zu bleiben, und einfach nicht sterben wollte, war ihm ein Dorn im Auge.
Als AENGHUS ÓG Atticus in seinem Versteck in Tempe, Arizona, aufspürt, entschließt sich Atticus zum Kampf, statt weiter zu fliehen. Mit dieser schicksalhaften Entscheidung löst er ohne sein Wissen eine Kettenreaktion von Ereignissen aus, die über ihn hereinbrechen wie eine Lawine.
In Gehetzt gewinnt er in Granuaile eine Schülerin, birgt eine Halskette, die der indischen Hexe Laksha Kulasekaran als Zufluchtsort für ihren Geist dient, und entdeckt, dass ihn seine Eisenaura vor dem Höllenfeuer schützt. Mit Unterstützung der MORRIGAN, BRIGHIDS und des örtlichen Werwolfrudels besiegt er AENGHUS ÓG. Dabei fügt er jedoch einem Hexenzirkel Schaden zu, der den Einzugsbereich von Phoenix bisher vor gefährlicheren Bedrohungen schützte.
Mit den Folgen sieht sich Atticus im zweiten Band Verhext konfrontiert, als ein rivalisierender und weitaus tödlicherer Zirkel den Schwestern der Drei Auroras ihr Territorium streitig macht und eine Gruppe von Bacchantinnen in Scottsdale Fuß zu fassen versucht. Atticus trifft Vereinbarungen mit Laksha Kulasekaran und dem Vampir Leif Helgarson, damit sie ihm helfen, die Stadt von diesen Bedrohungen zu befreien.
Im dritten Band Gehämmert muss Atticus seine Versprechen einlösen. Sowohl Laksha als auch Leif verlangen, dass Atticus nach Asgard zieht und den ASEN in ihren Methallen die Stirn bietet. Mit einem handverlesenen Team von Recken fällt Atticus zweimal in Asgard ein, obwohl ihn die MORRIGAN und JESUS warnen, dass das keine gute Idee ist und er stattdessen lieber sein Wort brechen sollte. Es kommt zu einem epischen Blutbad mit großen Verlusten aufseiten der ASEN: unter anderem sterben die NORNEN und THOR, und ODIN wird schwer verwundet. Der Tod der NORNEN, die einen Aspekt des Schicksals darstellen, führt dazu, dass die alten Prophezeiungen über den Endkampf Ragnarök nicht mehr zutreffen und dass die Unterweltgottheiten HEL und LOKI sich ohne große Gegenwehr der ASEN an ihr finsteres Werk machen können. Allerdings wird Atticus bei einem seltsamen Zusammentreffen mit dem finnischen Helden Väinämöinen auch an eine andere Prophezeiung erinnert – die der Sirenen an Odysseus. Von nun an treibt ihn die Sorge um, dass es vielleicht nur noch dreizehn Jahre dauern könnte, bis die Welt bei einem alternativen Ragnarök in Flammen aufgeht.
Weil ihm die Konsequenzen seines leichtfertigen Handelns immer stärker auf den Nägeln brennen und er zudem für die Ausbildung seiner Schülerin Zeit braucht, täuscht Atticus im vierten Band Getrickst mithilfe von COYOTE seinen Tod vor. Tatsächlich taucht HEL auf, die Atticus für die dunkle Seite zu gewinnen hofft, nachdem er so viele ASEN getötet hat. Atticus weist ihr Angebot schroff zurück. Später wird er von Leif Helgarson verraten und entrinnt nur knapp dem Mordanschlag eines alten Vampirs namens Zdenik. Dennoch endet das Buch mit der Hoffnung, dass Atticus seine Schülerin Granuaile ungestört ausbilden kann.
In der Erzählung »Zwei Raben und eine Krähe« erwacht ODIN aus seinem langen Genesungsschlaf und geht eine Art Waffenstillstand mit Atticus ein, unter der Bedingung, dass der Druide THORS Rolle im Endkampf Ragnarök übernimmt, falls es dazu kommt – und sich bis dahin vielleicht noch um ein paar weitere Details kümmert.
Im fünften Band Erwischt ist Granuaile nach zwölf Jahren Ausbildung bereit für ihre Bindung an die Erde, doch es hat den Anschein, als hätten die Feinde des Druiden nur auf sein Wiedererscheinen gewartet. Atticus muss sich mit Vampiren, Dunkelelfen, Feenwesen und dem römischen Gott BACCHUS herumschlagen. Vor allem Letzteres weckt die Aufmerksamkeit eines der ältesten und mächtigsten Pantheons der Welt.
Sobald Granuaile eine vollwertige Druidin ist, muss Atticus mit ihr durch ganz Europa fliehen, um den Pfeilen von DIANA und ARTEMIS zu entrinnen, die ihm übelnehmen, wie er BACCHUS und die Dryaden am Olymp im fünften Buch behandelt hat. Damit Atticus, der im sechsten Buch Gejagt wird, einen Vorsprung bekommt, opfert die MORRIGAN ihr Leben. Rennend und kämpfend entzieht er sich einem koordinierten Mordkomplott und gelangt nach England, wo er sich die Hilfe von Herne dem Jäger und von FLIDAIS, der irischen Jagdgöttin, sichert. Dort gelingt es Atticus, die OLYMPIER zu besiegen und mit ihnen ein fragiles Bündnis gegen HEL und LOKI auszuhandeln. Am Ende des Buchs entdeckt er, dass sein Erzdruide in Tír na nÓg auf einer Zeitinsel gefangen ist. Als er ihn befreit, ist die Laune seines alten Lehrers so schlecht wie eh und je.
Im siebten Buch Erschüttert findet der Erzdruide Owen Kennedy einen Platz im Tempe-Rudel und hilft Atticus und Granuaile bei der Vereitelung eines gegen BRIGHID gerichteten Putschversuchs in Tír na nÓg. Granuaile hat in Indien eine harte Auseinandersetzung mit LOKI, die sie für immer verändert, und ein Sendbote des alten Vampirs Theophilus ermordet einen von Atticus’ ältesten Freunden.
Außerdem kommen im Verlauf der Handlung gelegentlich auch Pudeldamen und Würste zur Sprache.
1
Ich hatte keine Zeit, um den Überfall mit der gebührenden Theatralik durchzuziehen. Ich hatte nicht einmal eine coole Sonnenbrille. Eigentlich hatte ich nur diesen Tarantino-Soundtrack im Kopf, einen von diesen Songs mit Bläsern, fettem Bass und einer Gitarre, die Waka-Tschaka-Waka-Tschaka machte, als ich über den Asphalt tappte mit dem unangenehmen Gefühl, dass sich gerade jemand an einer voyeuristischen Nahaufnahme meiner Füße weidete.
Auch mein Plan war nicht besonders meisterhaft. Ich wollte das Ding einfach mit einem Eisen-Elementargeist namens Ferris schaukeln, der mir jeden Wunsch erfüllte, weil er wusste, dass ich ihn irgendwann später dafür mit magischer Nahrung belohnen würde. Vielleicht mit einer Fee als Snack oder einem anderen verzauberten Wesen. Ferris stand auf solche Sachen – vielleicht bekam er von Magie ja so was Ähnliches wie einen Zuckerrausch. Bevor ich loslegte, setzte ich mich in einem Park über die Erde mit ihm in Verbindung und erklärte ihm mein Vorhaben. Dafür musste er sich durch die toten Fundamente von Toronto filtern und mir folgen, bis es Zeit für seinen Einsatz war. Ihm fiel so etwas leichter als den meisten anderen Elementargeistern. Beton wurde heutzutage häufig mit Eisen verstärkt, außerdem war Ferris inzwischen so stark, dass es ihm keine Mühe bereitete, sich durch den leblosen Untergrund einer modernen Stadt zu wühlen.
Oberon und meine Schuhe ließ ich in einer schattigen Nebenstraße zurück und legte einen Tarnzauber über mich, ehe ich hinaus auf die belebte Kreuzung Front und York Street in Toronto trat, wo mich ansonsten viele verschiedene Überwachungskameras erfasst hätten, nicht nur die der Royal Bank of Canada. Denn genau in diese Bank wollte ich, und als sie öffnete, schlüpfte ich unbemerkt hinter jemandem durch die Tür. Ferris folgte mir im Untergrund; ich spürte sein Schwirren unter meiner nackten rechten Fußsohle.
Im Foyer waren Wachleute, allerdings völlig unbewaffnet. Sie waren weniger zum Verhindern von Verbrechen anwesend als zum Beobachten, damit sie später höfliche und belastende Zeugenaussagen liefern konnten. Die Kanadier wollten um keinen Preis Bürger im Foyer einer Bank gefährden, daher zogen sie es vor, die Räuber aufzuspüren und zu stellen, wenn sie allein waren. Hier könnte man natürlich einwenden, dass Wachleute überflüssig sind, wenn sie sowieso bloß rumstehen, aber das stimmt nicht ganz. Kameras erfassen nicht alles. Und manchmal funktionieren sie gar nicht, wenn die Angreifer in ihrem Team einen anarchistischen Hacker mit einer oralen Fixierung auf Dauerlutscher haben. Doch selbst falls die Kameras laufen und das Verbrechen aufzeichnen, können Wachleute Dinge bemerken, die die Kameras nicht festhalten: Stimmen, Augenfarbe, Details an der Kleidung und so weiter.
Etwas weiter hinten, rechts von den Schaltern, blieb die Tür zum Tresorraum geschlossen. Bisher hatte noch niemand einen Besuch seines Schließfachs angemeldet. Ich hatte vor, mich bei der ersten Gelegenheit hineinzuschleichen. Dummerweise musste ich damit rechnen, dass ich länger warten würde, als meine Tarnung vorhielt. Und die Uhr tickte bereits, was den Nutzen meines Plans anging; je eher ich das Gewünschte in Händen hatte, desto mehr Schaden konnte ich damit anrichten. Also zeigte ich Ferris die Tresorraumtür und bat ihn, sie auseinanderzunehmen. Sollten die Alarmsirenen ruhig anschlagen.
Es ist beeindruckend, wenn man in Echtzeit beobachten kann, wie eine Tresortür zerfließt und die Leute deswegen ausflippen. Der Soundtrack in meinem Kopf schaltete auf volle Lautstärke, als ich über die geschmolzene Schlacke stieg und mich dem nächsten Hindernis zuwandte: einer Glastür, durch die ich die Schließfächer erkennen konnte. Sie war kugelsicher, zumindest gegenüber kleineren Waffen; schwerkalibrigen Geschossen hätte sie wohl nicht standgehalten. Ferris konnte sie nicht zerlegen wie den Tresoreingang, doch das war auch gar nicht nötig; es reichte, dass der Schließmechanismus aus Metall war, und diesen hatte er im Nu aufgelöst. Sofort stieß ich die Tür auf und machte mich auf die Suche nach dem Fach mit der Nummer 517, die mir genannt worden war. Ich entdeckte es links, knapp über dem Boden. Es war breit und flach, mit einem Schloss für den Kunden und einem für die Bank. Ein weiterer Eingriff von Ferris, und beide Schlösser waren erledigt. Schnell öffnete ich das Fach, schnappte mir das schmale Ringbuch darin und schob es in meinen getarnten Rucksack, bevor mir jemand in den Tresorraum folgen konnte. Gerade als ich das Fach wieder zugestoßen hatte, spähten zwei Wachleute durch den geschmolzenen Eingang zum Tresor und bemerkten die offene Glastür. Der eine war ein aufgeschwemmter Weißer, groß und wabbelig, der andere ein harter, drahtiger Latino.
»Hallo?«, ließ sich der Aufgedunsene vernehmen. »Ist da jemand?«
Der sehnige Wachmann unterstellte einfach, dass es so war. »Da drinnen werden Sie bei jedem Schritt gefilmt. Sie können sich nicht verstecken.«
Irrtum.
»Warum sollte ihn das interessieren?«, fragte Wabbelbauch. »Willst du ihm damit zu verstehen geben, dass er aufhören soll, weil er gefilmt wird?«
Mit finsterer Miene fauchte Hartbauch seinen Kollegen an. »Ich muss doch irgendwas sagen! Was würdest du ihm denn erzählen?«
»Ergeben Sie sich lieber«, rief Wabbelbauch in den Tresorraum, »sonst wird auf Sie geschossen. Wenn Sie weglaufen, kommen die Jungs mit den Kanonen.«
»Du bist ein Arsch, Gary«, brummelte Hartbauch.
Gary – ein viel besserer Name als Wabbelbauch – blinzelte. »Entschuldige, was war das?«
»Ich sagte, du bist ein Ass, Gary. So hätte ich den Räuber anreden sollen, den wir nicht sehen können.«
Gary schien nicht davon überzeugt, dass er sich verhört hatte.
Doch sein Kollege gab ihm keine Gelegenheit zum Nachhaken und trat über die Schwelle zum Tresorraum. »Vielleicht ist er hinten in der Aufenthaltskammer.«
Ich wandte mich um, weil ich wissen wollte, was er meinte. Tatsächlich erspähte ich am hinteren Ende eine weitere Tür. Diese Aufenthaltskammer war wohl dazu da, dass sich die Kunden eine Weile ungestört mit dem Inhalt ihres Schließfachs beschäftigen konnten, bevor sie ihn wieder wegsperrten. Hartbauch steuerte auf die Tür zu, und ich drückte mich flach an die Reihe von Kundensafes, damit er mich nicht streifte.
Gary folgte ihm nur bis zur Glastür und stellte sich so hin, dass er mir den Weg blockierte. Stirnrunzelnd starrte er auf das zerschmolzene Schloss. »Da muss jemand sein. So was passiert doch nicht von alleine.«
Hartbauch probierte die hintere Tür und stellte fest, dass sie verschlossen war. Auf einer daneben angebrachten Tastatur gab er einen Zahlencode ein und spähte kurz hinein, als offen war.
»Siehst du was, Chuy?« Mit seiner Frage verriet mir Gary endlich auch den zweiten Namen.
»Nix.«
»Was ist da bloß los, verdammt? Ist dieser Typ ein Ninja oder was?«
Als ich mir Oberons Begeisterung über diese Bemerkung ausmalte, entfuhr mir ein leises Glucksen, das mich sicher verraten hätte, wenn sie so schlau gewesen wären, die Alarmanlage abzustellen und zu lauschen. So aber konnte ich mich im Schutz des elektrischen Kreischens bis knapp vor Gary schleichen. Da ich meine Tarnung mit dem begrenzten Akku meines Bärenanhängers betrieb, konnte ich nicht einfach geduldig abwarten, bis er den Weg freigab. Bald war mit dem Eintreffen richtiger Polizisten zu rechnen, und mit denen wollte ich mich nicht herumschlagen müssen.
Also stieß ich Gary mit beiden Händen nach links über die Schwelle, sodass ich freie Bahn zur Tresorraumtür hatte. »Chuy hat dich als Arsch beschimpft, Gary«, rief ich ihm im Vorbeilaufen zu. »Ich hab’s genau gehört.« Ich lachte, denn Gary musste alles melden, was der Täter gesagt hatte – also auch Chuys abfällige Bemerkung über ihn.
Wütende Flüche der Wachleute begleiteten meinen Abgang. Direkt vor dem Tresorraum hing ein Managertyp am Telefon und unterhielt sich mit der Polizei. »Ja, verzeihen Sie. Wir haben hier in der Bank einen seltsamen Vorfall. Unsere Tür ist geschmolzen. Tut mir leid.«
Nach dem Auslösen des Alarms hatte sich der Eingang zur Bank automatisch verriegelt, doch dank der erneuten Hilfe von Ferris war ich wenig später draußen auf der Straße. Auch wenn die Kameras vage Bewegungen von mir erfassten, für eine Identifizierung würde es nicht reichen.
Ich bedankte mich bei dem Elementargeist für seine tatkräftige Unterstützung und bat ihn, in der Gegend zu bleiben, damit ich ihn entsprechend belohnen konnte. Ich musste unbedingt etwas Köstliches für ihn auftreiben, bevor ich verschwand.
›Das war schnell‹, erklärte Oberon über unsere mentale Verbindung, als ich in der Nebenstraße meine Tarnung ablegte und ihn unterm Kinn kraulte. ›Ich hatte noch gar nicht richtig mit meinem Nickerchen angefangen.‹
»Ging nicht anders. Mit jeder weiteren Sekunde am Tatort wären die Chancen gestiegen, dass sie mich erwischen. Bist du bereit für ein kleines Frühstück?«
Oberon hatte seine letzte Mahlzeit im Hochland von Äthiopien bei Mekera genossen. Erst durch ihre tyromantische Weissagung war ich auf die Existenz des Ringbuchs aufmerksam geworden, das ich soeben gestohlen hatte. Für ihr Ritual hatten wir ihr Lab besorgt und seither nichts mehr zu uns genommen.
›Natürlich bin ich bereit! Wann wäre ich einmal nicht bereit fürs Essen gewesen, Atticus?‹
»Da ist was dran.«
Üblicherweise ist es so, dass man sich nach einem Banküberfall in einer unscheinbaren Lagerhalle oder Garage verkriecht. Ich entschied mich für einen Besuch bei Tim Hortons – liebevoll Timmie’s genannt –, weil mir nach etwas Heißem und Kaffeeartigem zumute war und ich keinen dicken Jutebeutel voll Geld mit mir herumschleppte, der mich als niederträchtigen Schurken verraten hätte. Mit meinem Rucksack und dem irischen Wolfshund an der Leine sah ich aus wie ein Student aus der Stadt und nicht wie der geheimnisvolle Dieb, der den Wachleuten der Royal Bank of Canada im Zentrum von Toronto durch die Finger geschlüpft war.
Das Timmie’s an der York Street besaß eine grelle grün und gelb gestreifte Markise, einen Hydranten gleich vor der Tür für den Fall eines Donut-Öl-Brands und ein praktisches Hinweisschild zur nächsten öffentlichen Parkmöglichkeit.
»Welches gottlose Frühstücksfleisch möchtest du von hier?«, fragte ich Oberon, als ich die Leine an dem Pfosten festmachte.
›Die Religion des Fleischs hat keine Auswirkung auf seinen Geschmack.‹ In die Stimme meines Hundes schlich sich ein leicht pedantischer Tonfall.
»Was?«
›Schinkenspeck schmeckt immer gleich, ob göttlich oder gottlos, Atticus.‹
»Dann also Schinkenspeck. Jetzt sei schön lieb zu den Leuten, die dich so ängstlich anstarren. Kein Pinkeln an den Hydranten und auch kein Bellen, bitte.«
›Och. Dabei seh ich so gern, wie sie hüpfen. Und manchmal quieken sie auch noch.‹
»Ich weiß. Leider können wir uns im Augenblick kein Aufsehen erlauben.« Durch die Glas- und Stahlschluchten kreischten die Sirenen der Streifenwagen, die zur Bank rasten. Ich bemerkte zwei Fahrrad-Polizisten, die entgegen der Einbahn-Regelung durch die York Street strampelten. Sie würden sicher noch vor ihren motorisierten Kollegen am Tatort eintreffen. »Bin gleich wieder da, dann können wir essen.«
Ich erntete einen herablassenden Blick von dem Teenager an der Kasse, als ich fünf Sandwiches mit Bacon und Ei und einen Donut bestellte, dessen Glasurfarben auf einen Fall von Biogefährdung hindeuteten. Ich las in ihren Augen: Für einen Rothaarigen ganz nett, aber keine Spur von Ernährungsbewusstsein.
Nun, wie Oberon vielleicht gesagt hätte, ich hatte mir einen kleinen Leckerbissen verdient. Ich nahm meinen weinroten Becher Kaffee und eine Tüte fetttriefender Sandwiches mit nach draußen und setzte mich neben meinen Hund auf den Gehsteig. Während ich sein Frühstück auspackte, kamen nach und nach Leute aus dem Lokal und fragten sich mit lauter Stimme, was denn die Polizei so in Aufruhr versetzt hatte.
»Du glaubst es nicht, Ed«, sagte jemand hinter mir. Mit einem flüchtigen Blick über die Schulter bemerkte ich einen Mann, der bei meinem Eintreten noch nicht da gewesen war. Zusammen mit einem Freund stand er vor dem Schaufenster. Beide hielten weinrote Becher wie ich, beide trugen Jeans, Arbeitsstiefel und leichte Jacken. »Sirenen! Das heißt, es ist ein Verbrechen passiert. In Trahno.« Ich grinste über die Angewohnheit der Einheimischen, den Namen von Toronto auf zwei Silben zu verkürzen.
»Yep«, antwortete Ed. Ich wartete, doch anscheinend waren Eds Gedanken zu dem Thema damit erschöpft.
›Hey!‹ Mit diesem vorwurfsvollen Aufschrei verschlang Oberon sein erstes Sandwich. ›Das ist normaler Bacon!‹
Du wolltest doch Bacon. Ich antwortete ihm lieber mental, damit sich Ed und sein Freund keine Sorge um meine geistige Gesundheit machten, wenn sie mich laut mit meinem Hund sprechen hörten.
›Ich dache, es ist kanadischer Bacon! Sind wir nicht in Kanada?‹
Sicher, aber da warst du vielleicht ein bisschen zu schlau. Die Leute in Kanada nennen dieses Gericht nicht kanadischen Bacon, so wie die Belgier ihre Waffeln nicht als belgische Waffeln bezeichnen.
›Egal, schmeckt trotzdem gut. Danke.‹
Ich machte mich über den Donut her und schlürfte ein wenig Kaffee, dann zog ich den Grund für all die Anstrengungen heraus: ein Ringbuch voller Namen und Adressen, viele davon im Ausland. Es gab keine praktische Titelseite zur Erklärung ihrer Bedeutung. Immerhin war alles alphabetisch geordnet, und ich blätterte zum Abschnitt H. Dort stieß ich auf einen Eintrag zu Leif Helgarson mit seiner früheren Anschrift in Arizona. Daraus konnte ich zwei Schlüsse ziehen. Erstens handelte es sich, wie erhofft, um ein Verzeichnis aller Vampire auf der Welt, offline gespeichert und damit für Hacker unangreifbar. Zweitens war dieses Verzeichnis nicht mehr aktuell. Zur Zeit von Granuailes Bindung an die Erde war Leif dem Namen nach noch der Vampirherrscher über die sonnengeküssten Menschen von Arizona gewesen. Danach war er zweimal in Europa aufgetaucht – einmal in Griechenland und das andere Mal in Frankreich. Auch in Deutschland, wenn ich seine handschriftliche Nachricht an einem Baum mitrechnete. Offenbar war er in Bewegung, und das Gleiche galt wohl auch für die Träger vieler anderer Namen auf der Liste, seit Feenkiller in meinem Auftrag systematisch Vampire eliminierten. Spätestens wenn sich herumsprach, dass das Ringbuch verschwunden war, würden sie sich in Bewegung setzen. Damit es mir überhaupt etwas nützte, musste ich also schnell handeln, bevor sie von dem Diebstahl erfuhren. Ein USB-Stick mit einer Datei wäre natürlich praktischer gewesen, aber genau aus diesem Grund waren die Informationen ausschließlich in dieser Form aufbewahrt worden.
Die zwei, die als Erste von der Sache Wind bekommen und dann wohl auch die anderen verständigen würden, waren die Inhaber des Schließfachs: der uralte Vampir Theophilus und der arkane Lebenszehrer Werner Drasche. Letzterer war wahrscheinlich noch in Äthiopien, wo ich ihn fluchend zurückgelassen hatte, und buchte den nächstmöglichen Flug nach Toronto. Theophilus seinerseits würde sicher nicht über einen Ozean reisen, um Jagd auf mich zu machen.
Ich blätterte zur Sektion T, fand jedoch keinen Eintrag unter Theophilus. Verdammt. Entweder benutzte er einen anderen Namen, oder er war gar nicht aufgeführt.
»Darf ich mich zu Ihnen setzen, Mr O’Sullivan?«, fragte plötzlich eine Stimme mit russischem Akzent.
Ich riss den Kopf herum, denn mit diesem Namen hätte mich eigentlich niemand mehr ansprechen dürfen. Vor mir stand ein völlig schwarz gewandeter chassidischer Jude mit einem Becher Kaffee in der einen und einer kleinen Papiertüte in der anderen Hand. Von unserem letzten Aufeinandertreffen erinnerte ich mich noch gut an seinen schwarzen Bart. Jetzt war er mit grauen Strähnen durchzogen, die zu beiden Seiten des Kinns nach unten hingen. »Rabbi Yosef Bialik.« Ich stutzte. »Was machen Sie denn hier?«
»Ich teile das Frühstück mit Ihnen, wie ich hoffe«, erwiderte er. »Ich versichere Ihnen, dass Sie nichts von mir zu befürchten haben. Unsere vergangenen Streitigkeiten können begraben bleiben.«
»Sind Sie allein?« Vorsichtshalber hielt ich Ausschau nach anderen Gestalten in Schwarz mit Waffen in Bartform. Bei unserer letzten Begegnung war er mit den anderen Hämmern Gottes über mich hergefallen.
»Ich bin allein.«
»Na gut, setzen Sie sich und sagen Sie mir, was Sie zu mir führt.«
Er warf seine Tüte neben mir auf den Gehsteig und stützte sich ächzend mit der freien Hand ab, als er sich halb kauernd, halb fallend neben mir niederließ. »Alt werden ist nicht schön«, bemerkte er. »Sie sehen wirklich gut aus. Völlig unverändert sogar. Wie machen Sie das?«
»Das verrate ich Ihnen, sobald Sie mir sagen, wie Sie mich gefunden haben. Ich bin erst seit wenigen Stunden in der Stadt.«
»Ach, es war ganz leicht! Die Hämmer Gottes sind Hexenjäger, nicht wahr?«
»Aha.«
»Wir sind empfindlich für den Einsatz von Magie. Jede Art von Magie. Wir spüren es, wenn in unserer Nähe Magie verwendet wird. Und Ihre Magie ist mir schon einmal begegnet. Sie hat ein ganz eigenes Aroma. Zwei Blocks weiter haben Sie ziemlich viel davon eingesetzt.«
»Und Sie waren rein zufällig in Toronto?«
»Ja. Ich lebe hier. Im Ruhestand.«
»Ruhestand? Hier?«
Er zuckte die Achseln. »Toronto ist eine großartige Stadt. Viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Speisen, wenige Übel mit Ausnahme der örtlichen Regierung. Die Eishockeymannschaft ist schlecht, man kann eben nicht alles haben. Und ich bin inzwischen verheiratet. Meine Frau ist von hier.«
»Oh, meinen Glückwunsch!«
»Vielen Dank.«
»Verstehen Sie mich nicht falsch, Rabbi, es freut mich ehrlich, dass Sie mir mal nicht an die Wäsche gehen, aber … was wollen Sie dann von mir?«
Er griff nach seiner Tüte und fischte einen Würz-Bagel mit Frischkäse heraus. Die Tüte knisterte laut, und er antwortete erst, nachdem er sie zu einer Kugel zusammengeknüllt und neben sich abgelegt hatte. »Ich hätte gern eine rechtzeitige Warnung, falls hier etwas Schreckliches passieren wird. Sie und schrecklich passen nämlich zusammen wie eingelegte Gurken und Sandwiches.«
Ich verkniff mir die Bemerkung, dass das auch für ihn galt. »Nichts wird passieren. Zumindest habe ich nichts geplant. Ich reise in ein paar Tagen wieder ab.«
»Dann möchte ich eine Entschuldigung vorbringen.«
»Ach? Weswegen?«
›Weil er mir nie ein Leckerli geschenkt hat.‹
Er kennt dich doch noch gar nicht, Oberon.
›Spielt keine Rolle. Einfach eine Frage der Höflichkeit.‹
Über gute Manieren können wir uns später unterhalten.
»Für mein Verhalten vor vielen Jahren«, antwortete der Rabbi. »Ich habe viele Dinge getan, die mir vielleicht nie verziehen werden.«
»Zum Beispiel dass Sie das jüngste und schwächste Mitglied der Schwestern der Drei Auroras mit diesen verdammten Cthulhu-Barttentakeln umgebracht haben? Entschuldigung, ich wollte mich nicht so echauffieren. Es ist bloß so, dass ich noch immer Albträume davon habe.«
»Ihr Zorn ist verständlich. Und berechtigt. Es war dieser Vorfall und der nächste mit diesem Mann, der sich als JESUS ausgegeben hat …«
»Ähm, das war wirklich JESUS.«
»Wie Sie meinen.«
»Na ja, jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass er selber es auch meint. Aber wenn es ihn gibt, heißt das noch lange nicht, dass damit die Existenz Ihres Gottes oder irgendwelcher anderer Gottheiten widerlegt oder entkräftet wird. Er ist einfach da. Genauso wie JAHWE, BRIGHID und die anderen.«
Er nickte, und zum Glück bewegte sich sein Bart dabei nicht von allein. »Heute kann ich das akzeptieren. Damals war mir das nicht möglich. Es erfordert eine gewisse Flexibilität des Denkens, nicht wahr? Eine Offenheit gegenüber der Vorstellung, dass Menschen ihren eigenen Weg zum Heil beschreiten und mir dabei nicht unbedingt auf meinem folgen müssen. Ich bin einfach zu weit gegangen mit meinem Glauben.« Er schüttelte den Kopf. »Es fällt mir schwer, an mein früheres Ich zu denken. Die Erinnerungen machen mir zu schaffen. Ich war erfüllt von Zorn und hatte den kontemplativen Frieden des Kabbalismus verloren. Erst nach den Begegnungen mit Ihnen habe ich meine Haltung überdacht. Unter anderem habe ich aus der Ferne verfolgt, wie sich die Schwestern der Drei Auroras verhalten, und erkannt, dass mein Urteil über sie falsch war. Ich hätte sie nicht verurteilen dürfen. So etwas kann sich nur ein vollkommenes Wesen anmaßen.«
»Wahrscheinlich. Heißt das, dass die Hämmer Gottes keine Hexen mehr verfolgen – obwohl im zweiten Buch Mose steht, dass man Hexen nicht leben lassen soll?«
Er nahm einen Schluck Kaffee, bevor er antwortete. »Manche tun es noch. Ich persönlich nicht. Aber ich habe viele von ihnen überzeugt, dass es moralisch viel vertretbarer ist, wenn wir uns auf offenkundig böse Wesen konzentrieren – zum Beispiel Dämonen, die sich in diesem Gefilde herumtreiben –, statt Hexen zu verfolgen, die noch immer erlöst werden können.«
»Freut mich zu hören.«
»Ja, es ist erfreulich. Ich weiß nicht, ob es zur Sühne meiner früheren Taten reichen wird. Die Schuld ist eine schwere Bürde. Wenn ein Mann ins Feuer springt, wie viele Schritte braucht er, um wieder herauszufinden? Sind Sie schon einmal in die Irre gegangen, Mr O’Sullivan?«
»Ach, Götter der Unterwelt, ganz furchtbar sogar. Für manche Fehltritte büße ich noch immer. Und bei anderen wartet die Abrechnung noch. Trotzdem, ich bemühe mich, dass ich es wieder hinkriege.«
»Was sind denn das für Schwierigkeiten, wenn ich fragen darf?«
Ich schnaubte angesichts der Tragweite seiner Frage. »Ich habe eine Menge Schwierigkeiten – im Augenblick bereiten mir vor allem die Vampire Sorgen. Sie wollen mir unbedingt an den Kragen, und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich ihnen das ausreden kann. Sie machen richtiggehend Jagd auf mich.«
Die Haarhecke über den Augen des Rabbis senkte sich, und sein Oberlippenbart schien vor meinen Augen zu verwelken. »Es gibt Vampire hier? Sind Sie deswegen in der Stadt?«
»Bestimmt sind einige in der Gegend, aber der Grund meiner Reise hierher ist das.« Ich deutete auf das Ringbuch. »Namen und Adressen von Vampiren aus aller Welt.«
Der Rabbi erstarrte. Nur sein Bart regte sich, obwohl kein Wind wehte. Offenbar war das ein Anzeichen für seinen inneren Aufruhr. Ich musste einen Schauder unterdrücken, weil ich die Vorstellung von empfindungsfähigem Haar beunruhigend fand.
»Wie sind Sie in den Besitz dieser Unterlagen gelangt?«, fragte er.
»Mithilfe der Magie, die Sie gespürt haben. Ich habe das Buch drüben aus der Bank an der Kreuzung Front und York gestohlen. Das sind Tausende von Namen. Vielleicht sogar Zehntausende – der Druck ist ziemlich klein. Allerdings habe ich keine Ahnung, wer die Anführer sind. Und ich weiß auch nicht, ob ich viel damit ausrichten kann, bevor die Liste ihre Gültigkeit verliert. Die Führung wird bald erfahren, dass ich die Liste habe, und alle zur Flucht auffordern. Vielleicht sind einige so dumm, dass sie die alten Namen behalten. Das wäre dann eine kleine Möglichkeit, sie aufzuspüren.«
»Erstaunlich.« Ohne den Blick von dem Ringbuch abzuwenden, hob der Rabbi seinen zerdrückten Würz-Bagel an den Mund. Zwischen den Rändern quoll der Frischkäseaufstrich hervor, und ein dicker Klecks, der unbeachtet nach unten platschte, blieb im Abgrund seines Bartes wie verirrtes Frozen Yogurt, das nie den Weg in die Waffel gefunden hatte. Er pendelte mechanisch auf und ab, während der Rabbi angestrengt nachdachte.
›Schau dir das an, Atticus. So was von unhöflich. Hat mir nicht mal einen Bissen angeboten.‹
Du hast doch gerade erst fünf Bacon-Sandwiches zum Frühstück verputzt.
›Schon, aber was ist mit dem zweiten Frühstück?‹
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Rabbi ein Tolkien-Fan war. Deshalb antwortete ich meinem Hund: Ich glaube, das kennt er nicht.
»Vielleicht … nun. Mr O’Sullivan, ich würde Ihnen gern meine Hilfe anbieten, falls das für Sie in Frage kommt.«
»Sie würden dafür aus dem Ruhestand zurückkehren?«
»Unbedingt. Vampire sind eines der eindeutigen Übel, die die Hämmer Gottes noch immer bekämpfen. So eine Gelegenheit würden wir liebend gern beim Schopf packen.«
»Wir? Sie sprechen für alle?«
»Ich glaube sagen zu können, dass sie sich mir voller Begeisterung anschließen werden. In letzter Zeit haben wir bereits ein vermehrtes Aufkommen von Vampiren beobachtet. Irgendetwas muss sie aufgescheucht haben.«
»Dafür bin wohl ich verantwortlich. Ich habe Jäger auf sie angesetzt. Einige Vampire haben sich verkrochen, andere versuchen, das Machtvakuum zu füllen, das die bereits Gepfählten hinterlassen haben.«
»Wunderbar. Dann stehen wir auf der gleichen Seite.« Unter dem Bart blitzte ein kurzes Grinsen auf. »Erfrischend, nicht wahr?« Er nickte beim Reden, und der Klecks Frischkäse fiel auf seine Jacke.
Ich hatte den Impuls, ihn darauf hinzuweisen, andererseits wollte ich diesen Moment des Einvernehmens nicht stören. »In der Tat. Wie viele von Ihren Freunden könnten da mitmachen?«
»Wir sind mehrere Hundert und über die ganze Welt verstreut.«
»Also schön. Rabbi Yosef, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir scannen die Unterlagen ein, und Sie können sie dann an Ihre Verbündeten weiterleiten. Für tausend Vampire, die von den Hämmern Gottes erledigt werden, bekommen Sie von mir fünf Jahre Jugend.«
»Wie soll das gehen?«
»Mit Immortali-Tee. Besteht nur aus natürlichen Kräutern und ein paar Bindungen. Kein Teufelswerk dabei. Sie sehen das Ergebnis vor sich.«
»Hm. Wenn es in unseren Kräften steht, würden wir die Vampire ohnehin pfählen. Das ist unsere Pflicht.«
»Super, dann ist es für beide Seiten ein Gewinn. Vermutlich können Sie Vampire nicht spüren, so wie Sie mich spüren?«
»Nein. Unsere Macht kommt vom kabbalistischen Baum des Lebens, daher sind sie als tote Wesen für uns nicht wahrnehmbar. Und ich möchte betonen, dass wir auch Sie nicht als Person spüren, sondern ausschließlich den Gebrauch Ihrer Magie, die stark auf das Leben abgestimmt ist.«
»Ja.« Ich lächelte ihn an. »Das hat was mit der Bindung an GAIA zu tun. Äh, Sie haben da übrigens einen kleinen Fleck …«
»Ach? Danke für den Hinweis.«
Danach besprachen wir das weitere Vorgehen. Für das Scannen und Verschicken der Unterlagen mussten wir mehrere Stunden veranschlagen. Und spätestens am Abend würde Werner Drasche erfahren, dass sie in unserem Besitz waren. Somit blieb den Hämmern Gottes nur ein kurzes Zeitfenster zum Handeln.
»Sie sollten noch vor Sonnenuntergang gegen die Vampire in dieser Hemisphäre vorgehen«, erklärte ich, »da haben Sie die besten Chancen. Die in Europa – die wirklich alten und mächtigen – sind gerade wach. Sie werden sicher bald von den gestohlenen Dokumenten hören und sofort untertauchen.«
»Dann müssen wir uns eben mit dem begnügen, was uns der Allmächtige gibt.«
»Auf jeden Fall müssen Sie Ihre Leute warnen«, mahnte ich ihn. »Möglicherweise warten unter diesen Adressen keine Vampire, sondern Fallen auf sie. Mir liegt sehr daran, dass dieser Schlag ausnahmsweise zu einem vollen Erfolg für die gute Seite wird.«
»So möge es sein.« Ein Zucken in den Tiefen seines Bartes ließ erahnen, dass der Rabbi zufrieden war. »Und selbst wenn wir keinen Einzigen erschlagen, bin ich froh über unsere heutige Begegnung, Mr O’Sullivan. Sie zeigt mir, dass es richtig war, einen stilleren, ruhigeren Weg zu wählen. Die gute Tat, die wir heute vollbringen können, wäre nicht möglich gewesen, hätte ich an meinem Fanatismus festgehalten.«
Vermutlich war das eine höfliche Umschreibung dafür, dass wir uns heute nicht gemeinsam auf die Jagd nach Vampiren hätten machen können, wenn er mich vor zwölf Jahren getötet hätte. Ich verkniff mir eine entsprechende Bemerkung, weil ich seine Schuldgefühle wegen der Vergangenheit nicht noch vertiefen wollte. Ich hatte kein Recht, ihn zu verurteilen. Die Götter wussten, dass ich mir in meinem langen Leben viel mehr Verfehlungen geleistet hatte als er. Zum Abschied tauschten wir Telefonnummern aus wie alte Freunde.
In dem Wissen, dass ich die Vampire gehörig in Aufruhr versetzt hatte und dass auf einige von ihnen dank der Hämmer Gottes vielleicht bald die endgültige Vernichtung wartete, ging ich einkaufen. Zweifellos war der arkane Lebenszehrer schon auf dem Weg hierher, und ich musste meine Vorkehrungen treffen. Nigel in Toronto zu sein, war alles andere als angenehm, doch wenn ich Werner Drasche unschädlich machen wollte, musste ich noch ein letztes Mal in diese Rolle schlüpfen. Mit ein bisschen Glück würde mich dieses Kapitel meiner Vergangenheit danach nie wieder verfolgen.
Zuerst besorgte ich ein paar Dinge in der Kräuterapotheke an der Roncesvalles Avenue, dann schaute ich mich im Bekleidungsgeschäft Jerome’s an der Yonge Street nach einem geeigneten Kostüm um. Eigentlich handelte es sich bloß um einen formellen Anzug, doch er fühlte sich wie ein Kostüm an, sobald ich mich hineingezwängt und den Schlips um meinen Hals geschlungen hatte. Der Herrenausstatter verriet mir, dass Ascot-Krawatten ja anscheinend wieder im Kommen waren, und ich widersprach: nein, nein, das musste ein Missverständnis sein. Schließlich erstand ich in dem Laden auch noch eine goldene Taschenuhr und Rasierzeug – beides wichtige Requisiten für meine Wiederaufnahme der Nigel-Rolle.
Mit all diesen Errungenschaften zogen wir uns in ein Hotel im Stadtzentrum zurück. Dort, unter dem grellen Schein einer weißen Glühbirne, der auf die gelbe Tapete und einen Waschtisch aus schwefelgrünem Granit fiel, machte ich mich mit bekümmerter Miene daran, meinen Spitzbart abzurasieren.
Oberon versuchte, mich mit improvisierten Gesängen zu trösten. ›In einem fleischlosen Hotel, wo sein Bart heruntermuss! / Und keine Soße weit und breit! Da kriegt er den Nigel-Blues!‹
»Oberon, das ist wirklich sehr freundlich von dir, aber es macht mir die Sache auch nicht leichter.«
›Dabei wollte ich gerade mit meinem Katzenjaul-Solo loslegen. So was macht mir normalerweise alles leichter.‹
»Bitte nicht. Hab Erbarmen.« Ich wusch mich ab und trocknete mein nacktes Kinn. Dann begann der zweite Teil, für den ich die Einkäufe aus der Kräuterapotheke, einen Plastikbecher des Hotels, mehrere Tropfen Ethylalkohol und einen Rührlöffel benötigte.
›Boah, was machst du denn da? Hoffentlich nicht so ein fieses Gebräu, das ich trinken muss?‹
»Nein, das wird kein Tee, sondern eine Tinktur. Du hast doch vorhin mitgekriegt, wie ich in der Apotheke Mörser und Stößel benutzt habe.«
›Ja. Die haben dir einen Haufen Fragen gestellt.‹
Tatsächlich waren die Angestellten ziemlich neugierig gewesen, und ich log ihnen was von einer Salbe vor. In Wirklichkeit sollte die Mischung für kurze Zeit meinen Bartwuchs anregen. Immer wenn ich nicht mehrere Monate warten konnte, sondern schnell altern oder mir in wenigen Tagen ein bärenhaftes Gestrüpp wachsen lassen musste, griff ich auf diese Mixtur zurück. Mit einigen Tropfen Alkohol und GAIAS Magie änderte ich sie ab – so ähnlich wie bei den ganz gewöhnlichen Kräutern, aus denen ich mit ein wenig Nachjustierung den Immortali-Tee zubereitete. Sorgfältig darauf bedacht, dass nichts danebenging, trug ich die Tinktur auf beide Wangen auf. Dort würde mich morgen früh eine Haarpracht begrüßen wie nach mehreren Wochen durchgehender Rasierabstinenz – buschige Koteletten direkt aus dem neunzehnten Jahrhundert. In meinem vornehmen Aufzug, mit der Taschenuhrkette an der grauen Nadelstreifenweste und dem pomadisierten Haar, würde ich aussehen wie der junge Kerl, der hier in Toronto 1953 in solche Schwierigkeiten geraten war.
»Das dient bloß dazu, dass es überzeugend wirkt. Schließlich habe ich diese Rolle zuletzt vor siebzig Jahren gespielt.«
›Du meinst die Rolle als Nigel? Was hat es damit überhaupt auf sich? Die Geschichte hast du mir noch immer nicht erzählt.‹
»Ach, dir steht der Sinn nach einer Geschichte? Nun, wir sind gerade im Bad, und du bist noch immer ziemlich schmutzig von dem vielen Schlamm in Äthiopien.«
Oberon wedelte mit dem Schwanz. ›Heißt das, ich kriege eine Story über den historischen Atticus zu hören?‹
»Na los, hüpf rein, dann erzähl ich dir, warum man lieber nicht Nigel in Toronto sein sollte.«
›Klasse!‹ Oberons ganze hintere Hälfte schwenkte hin und her, und er sprang so überstürzt in die Wanne, dass er den Duschvorhang herunterriss. ›Ach, das Ding war sowieso total hässlich‹, meinte er. ›Und im Weg.‹
2
Asgard ist ein merkwürdiger Ort, ganz anders als alles, was man in Filmen, Comics oder Fantasy-Bildern sieht. Es hat etwas Aquarellartiges, wie auf strahlend weißes Papier geklatschte Pigmente mit klar abgegrenzten Rändern, die zur Mitte hin ineinanderlaufen. So ähnlich hat es auch Atticus beschrieben. Das Licht ist kalt, angestrengt und welk. Ganz anders als in Tír na nÓg, das die Wärme und Fülle eines Gemäldes von John William Waterhouse ausstrahlt. Ich merke, dass ich nicht hierhergehöre, und möchte möglichst bald wieder weg.
Doch Orlaith und ich müssen Geduld haben, denn ich bin auf ODINS Hilfe angewiesen. Er soll LOKIS Mal von meinem Arm entfernen.
Er hat mir erklärt, dass das Mal ein auf LOKIS genetische Signatur abgestimmter Schirmzauber ist. Allein der Gott der Lügen kann durch diesen Schirm blicken, wenn er es wünscht. Auch HEL und Jörmungandr tragen dieses Mal, und das ist der Grund, weshalb Götter wie ODIN und MANANNAN MAC LIR nicht in der Lage sind, ihren Aufenthaltsort durch Weissagung zu bestimmen. Nur LOKI weiß jederzeit, wo sie sind, genau wie er auch weiß, dass ich gerade in Asgard bin. Sicher würde es ihn brennend interessieren, was ich hier mache – das hat er selbst gesagt und sogar Orlaith bedroht, damit ich ihm den Grund meiner ersten Reise hierher verrate.
Bei dieser Gelegenheit erklärte mir ODIN, dass er zur Tilgung meines Mals Genmaterial von LOKI benötigt. Also kehrte ich nach Colorado zurück, wo LOKI bereits auf mich wartete. Er wollte mich überraschen, doch unsere Hütte war mit starken Bannsprüchen gegen Feuer geschützt, und so war ich es, die ihn überrumpelte. Er bekam von mir einen Tomahawk in den Rücken und einen satten Schlag gegen den Kiefer, und ich bekam von ihm Blut, Zähne und eine gewisse Genugtuung für die Schmach, die er mir angetan hatte.
Leider bedeutet das, dass unsere Hütte in Colorado nicht mehr sicher ist, weil LOKI jetzt davon weiß. Bis unser neues Haus in Oregon fertig ist, können noch Tage oder Wochen vergehen. Dennoch, im Grunde fügt sich das alles gar nicht so schlecht. Atticus versucht, den Mörder seines Freundes aus Alaska zu stellen, und ich bin erst einmal hier beschäftigt. Nicht dass ich irgendwelche Aufgaben zu erfüllen hätte, denn ich kann eigentlich nur warten, bis ODIN eine Lösung gefunden hat. Ich rede von meiner persönlichen Entwicklung. Ich muss einen neuen Kopfraum erschaffen und entscheiden, ob ich für dieses literarische Gerüst auf eine Sprache zurückgreife, in der ich schon eine gewisse Geläufigkeit besitze, wie das Russische, oder etwas völlig Neues lerne. FRIGG hat mir freundlicherweise eine Auswahl von Werken aus einer »Bibliothek in Midgard« besorgt, und so lese ich gerade Dostojewskis Aufzeichnungen aus dem Untergrund. Hier und da stoße ich auf Stellen, die mir zusagen: Die Natur bittet nicht um unsere Erlaubnis; sie interessiert sich nicht für unsere Wünsche oder dafür, ob wir ihre Gesetze mögen oder nicht. Wir müssen die Natur hinnehmen, wie sie ist, und damit auch ihre Konsequenzen. Das ist nicht schlecht, doch nach dem ekstatischen Optimismus von Walt Whitman kommt mir Dostojewski ein bisschen wie schlichtes Hafermehl vor: ballaststoffreich und gesund, aber nicht gerade aufregend. Allerdings lässt sich das beim Vergleich mit Whitman wohl fast von jedem sagen. Wie auch immer, ich muss mehr in der Sprache lesen, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Wenn ich die Texte eines Autors unter großen Mühen auswendig lernen will, müssen sie in meinem Kopf einen transzendenten Widerhall auslösen.
Was in meinem Kopf ständig nachhallt, obwohl mir Stille lieber wäre, ist die Stimme meines jüngeren Ich, die danach schreit, meinem Stiefvater die längst verdiente Abreibung zu verpassen. Er ist ein Mann, der wie die Natur aus Dostojewskis Kosmos nicht um Erlaubnis bittet, der sich nicht dafür interessiert, was andere wollen oder ob sie ihn mögen. Er plündert und verseucht die Welt und lacht alle aus, die nicht den Mumm haben, sich einfach alles zu nehmen, wie es ihnen passt.
Einmal musste ich Atticus sogar gestehen, dass es mir bei meiner Sehnsucht nach einem Leben als Druidin auch darum ging, meinen Stiefvater in die Schranken zu weisen, weil die menschlichen Gesetze dazu nicht in der Lage sind. Atticus hielt mir entgegen, dass die Verfolgung einzelner Umweltverschmutzer nicht rational ist, und das sehe ich auch ein. Natürlich hat er recht. Dummerweise drängt aber auch ein nicht rationales Bedürfnis ganz emotional nach Erfüllung. Ich kann es nicht einfach auf sich beruhen lassen und mich anderen Dingen zuwenden. Mein Stiefvater ist mehr als nur ein Umweltverschmutzer. Er ist ein Scheißkerl, der bloß darüber lacht, wenn bei seinen Ölkatastrophen Tiere umkommen.
Trotzdem fürchte ich, dass ich, befangen in meinen Rachefantasien, riesige Warnschilder auf meinem Weg übersehe mit Aufschriften wie VERHÄNGNISVOLLER FEHLER VORAUS und HIER WARTET DER TOD MIT FIESEN GROSSEN REISSZÄHNEN. Eigentlich sollte ich meinen Verstand endlich von diesem Gift befreien und es einfach hinter mir lassen. Doch manchmal tun wir Dinge, die nur in der verborgenen Infinitesimalrechnung unserer Gefühle einen Sinn ergeben. Und wenn wir in einer Therapie oder in der Religion Linderung für unsere Wunden suchen, berauben wir uns unserer Chance auf Selbstheilung und betäuben nur alte Schmerzen mit neuen Mitteln. Irgendwie werde ich etwas gegen ihn unternehmen müssen, obwohl ich bereits ahne, dass es nicht so ausgehen wird wie erhofft. Entscheidend ist jedenfalls, dass ich mich von seinem lastenden Schatten befreie.
Wie viel Macht er noch immer auf mich ausübt, zeigt allein die Tatsache, dass ich in so einer Umgebung an ihn denke. So fremd ich mich in Asgard auch fühle, ich könnte mir für meine Studien keine herrlichere Couch wünschen; mein Quartier ist großzügig mit Blumen, Obst und Licht ausgestattet, und es gibt sogar eine Thermalquelle zum Baden, falls ich einen Luxus gegen den anderen tauschen möchte.
Nach zwei Tagen einsamer Dekadenz werde ich in ODINS Halle gerufen. Er glaubt, eine Lösung gefunden zu haben. Bei ihm sind seine Frau FRIGG und der zwergische Runenskalde Fjalar.
ODIN hält einen Steinstempel hoch, der mir beängstigend vertraut ist, und spricht mit seiner rauchigen Whiskeystimme. »Wenn wir dich von LOKIS Mal befreien wollen, müssen wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Fjalar hat mir bei der Schaffung einer Aschenrune geholfen, die wegbrennen wird, was in dich eingebrannt ist. Dank der Zähne, die du uns gebracht hast, ist sie durchtränkt mit LOKIS genetischem Code. Das wird das Siegel aufschließen und die Verwandlung erlauben.«
Das klingt nach mehr, als ich will. »Ähm … Verwandlung in was?«
»In einen freien Menschen. Und in eine Niederlage für LOKI.« Über ODINS Lippen huscht ein Lächeln.
In dieser Einschätzung kann ich ihm nicht ganz folgen. LOKI hat mich dort unten in dem Erdloch bei Thanjavur nicht nur gebrandmarkt, sondern auch zwei äußerst mächtige Waffen an sich gebracht: die Verlorenen Pfeile VAYUS und Fuilteach, meine von den Yetis geschaffene Wirbelklinge. Quitt bin ich mit LOKI erst, wenn ich ihm diese Waffen wieder abgenommen habe.
ODIN reicht den Steinstempel an Fjalar weiter, der ihn zwischen die Backen einer Eisenzange legt und in die brennenden Kohlen im Herd des Allvaters schiebt. Mir schießen gleich mehrere Filmszenen durch den Kopf, in denen der Schurke den Helden mit ähnlichen Verrichtungen in Angst und Schrecken versetzen will. Ich hingegen freue mich schon. Ich würde jeden Schmerz auf mich nehmen, wenn ich dafür LOKIS Mal loswerde. Schmerz lässt nach, Freiheit hingegen ist eine dauerhafte Freude. Zugegeben, mir geht es hier um eine eher abstrakte Freiheit: Ich möchte meine Privatsphäre wiederhaben. Das Wissen, dass ich von einem Widerling beobachtet werde, lässt sich nicht vergleichen mit einem echten Kerker; dennoch ist es, als läge mein Bewusstsein in Ketten.
Ungefähr zehn Sekunden lang starren wir gemeinsam ins Feuer, dann merken wir alle, dass es peinlich wäre, die ganze Zeit zu schweigen, bis der Stempel erhitzt ist.
FRIGG räuspert sich und wendet sich an Fjalar: »Brichst du bald nach Svartálfheim auf?«
»Sehr bald«, antwortet er.
Bevor ich mich nach dem Grund seines Besuchs bei den Dunkelelfen erkundigen kann, schaltet sich ODIN ein, in der erkennbaren Absicht, möglichst schnell das Thema zu wechseln. »Sag mir, Granuaile, hat LOKI noch irgendetwas anderes geäußert, woraus wir vielleicht schließen können, wann er zuschlagen will?«
»Nein. Eigentlich habe fast nur ich geredet. Ich habe keinen Zweifel daran gelassen, dass ich ihn bei unserem nächsten Aufeinandertreffen umbringen will. Er konnte zwar nicht mehr antworten, aber ich nehme an, das beruht auf Gegenseitigkeit.«
Nachdenklich richte ich meinen Blick auf den Zwerg. Bei unserer letzten Begegnung arbeitete der Runenskalde an Äxten, die Dunkelelfen in ihrer Rauchgestalt treffen und sie zurück in ihre körperliche Erscheinung zwingen sollten. Wenn er jetzt einen Ausflug nach Svartálfheim plant, dann vielleicht nicht unbedingt mit harmlosen Absichten.
Fjalar lässt kein weiteres Gespräch zu. »Es ist fertig.« Der Stein leuchtet schwach rot, als er ihn aus dem Feuer zieht. Er ist nicht hell orange wie der LOKIS, trotzdem werde ich die Hitze bestimmt spüren. »Deinen Arm, bitte. Schnell.«
Orlaith, gleich werde ich starke Schmerzen haben und ein bisschen schreien. Es muss sein. Also reg dich nicht auf.
›Gut, wenn du es sagst.‹
Ich rolle meinen linken Ärmel hinauf bis über den linken Bizeps, wo mich LOKI gebrandmarkt hat.
Fjalar packt meine Hand und klemmt sie sich unter die linke Achsel, während er meinen ausgestreckten Arm am Ellbogen packt. »Beweg dich so wenig wie möglich. Kämpfe gegen den Instinkt an.«
»Gut.« Ich nicke ihm zu und stecke die Zunge fest hinter die Zähne. Ich will sie mir nicht abbeißen, wenn mich der Schmerz trifft. Und ich bin mir völlig sicher, dass er mich treffen wird, selbst wenn ich versuche, ihn auszublenden. Bei LOKI habe ich es auch gespürt, obwohl ich mich mit allen Kräften dagegen wehrte; sein Stempel verbrannte nicht nur die Haut – wenn ich ODIN richtig verstanden habe, versengte er meine Aura und brandmarkte mich auf einer Ebene jenseits des Körperlichen. Wahrscheinlich wird es mit Fjalars Aschenrune genauso sein. Zumindest hoffe ich es, denn auf weitere Versuche möchte ich bei so etwas lieber verzichten.
Ich spüre die von dem Stein ausstrahlende Hitze an den Wangen und am Arm, als Fjalar den Stempel über dem Bizeps in Stellung bringt.
»Tu es«, fordere ich mit zusammengebissenen Zähnen, und er zögert nicht. Meinen Ellbogen fest im Griff, presst er den Stempel direkt auf LOKIS Mal. Der zischende Schmerz ist stärker als alles, was ich mir vorstellen konnte. Es brennt überall, nicht bloß am Arm, meine Muskeln verkrampfen, und nicht einmal aus meiner Kehle dringt etwas anderes als der unwillkürliche Schrei des ersten Schocks. Doch mit diesem kurzen Ächzen öffnet sich mein Mund, und dann nützt alle Vorbereitung nichts, und ich beiße mir auf die Zunge. Ich schmecke kupferiges Blut, und überall am Körper bricht mir blitzartig der Schweiß aus.
»Gah!« Aus meinem Mund spritzt Blut und trifft Fjalar im Gesicht. Er drückt die Rune viel länger auf meinen Arm als LOKI. Oder es kommt mir bloß so vor.
In meinem Kopf schreit Orlaiths Stimme. ›Hey, Granuaile! Das ist Blut. Er soll aufhören! Er darf dir nicht so wehtun!‹
Obwohl ich ihr aus vollem Herzen zustimme, antworte ich mühsam: Es dauert nicht mehr lang. Dann kann ich heilen.
»Wir müssen sichergehen, dass wir alles wegbrennen.« Fjalar lässt nicht locker.
»Es … geht durch die Haut!«
»Ja! So muss es sein.« Endlich reißt er die Rune weg und mit ihr gleich noch mehrere Streifen Haut. Dann lässt er meinen Arm los und wendet sich an zwei Dienerinnen. »Bringt das Wasser.«
Ich kriege nicht mit, woher sie kommen und wie lang sie brauchen – ich schwebe in einer Ewigkeit aus Schmerz. Schließlich erscheinen die beiden Frauen mit einer großen Vase mit kaltem Wasser. Schnell stecke ich den Arm hinein, und das glühende Brennen lässt ein wenig nach. Dann schalte ich die Nerven ab, ziehe ihn erleichtert heraus und betrachte das Loch in meinem Bizeps. Von LOKIS Mal ist keine Spur mehr übrig – nur die knusprige Haut von Granuaile. Obwohl ich meinen Arm nicht beugen kann, fange ich befreit an zu lachen. Der Gott der Lügen hat ein dunkles Ungeheuer auf mich angesetzt, das mir fast alle Knochen brach, und dann brandmarkte er mich, in der Absicht, auch meinen Geist zu brechen und mich in eine willfährige Sklavin zu verwandeln. Pech für ihn, dass es nicht geklappt hat.
»Haha. Hahahahaha. Ich scheiß auf dich, LOKI.« Breit grinsend wende ich mich ODIN zu, und es ist mir völlig egal, ob ich genauso entfesselt aussehe, wie ich mich fühle. »Bin ich wieder gesund?«
3
Während das Badewasser einlief, wickelte ich eine dieser lächerlich kleinen Hotelseifen aus. Dann inspizierte ich den eingetrockneten Schmutz in Oberons Fell, vor allem am Bauch. Obwohl es ganz offenkundig eine Ausgangslage war wie bei David und Goliath, blieb mir nichts anderes übrig, als darauf zu setzen, dass das winzige Seifenstückchen doch irgendwie den Sieg erringen würde.
»Also schön, Kumpel, dann legen wir mal los.« Ich bespritzte ihn zuerst von der Unterseite, dann goss ich ihm tassenweise Wasser auf den Rücken. »Bitte nicht schütteln, bis wir fertig sind.«
›Hihi! Aber es kitzelt, Atticus! Du musst dich beeilen und mich ablenken.‹
»Gut, fangen wir an.«
Damit du begreifst, was mir passiert ist, musst du zuerst ein wenig über die Geschichte von Toronto erfahren.
Ich kam im Herbst 1953 als Medizinstudent in die Stadt. Nach dem ausführlichen Geballer in zwei Weltkriegen und einem weiteren Krieg in Korea hatten die Menschen beim chirurgischen Zusammenflicken viel dazugelernt, daher dachte ich, dass ich da vielleicht was Nützliches aufschnappen könnte. So schrieb ich mich unter dem Namen Nigel Hargrave an der University of Toronto ein, mit der Absicht, mich ein paar Jahre lang einem ernsthaften Medizinstudium zu widmen. Dass ich dann bloß ein paar Monate blieb, liegt an einem grusligen alten Gebäude und einer Tragödie im neunzehnten Jahrhundert.
Die University of Toronto war eigentlich eine ganze Ansammlung alter Hochschulen, viele davon mit religiöser Ausrichtung. Eine davon – heute das Royal Conservatory of Music an der Bloor Street – war vor langer Zeit ein Baptistenseminar. Es ist ein schauriger, roter Backsteinkasten aus dem Jahr 1881, der unweigerlich die Vorstellung heraufbeschwört, dass der Architekt beim Einatmen der bleihaltigen Farbdämpfe in manisches Lachen ausgebrochen ist. Spitze Türme, steile Dächer und große Fenster. Knarrende Holzböden, auf denen jeder Schritt widerhallt. Dieses Priesterseminar nun besuchte im späten neunzehnten Jahrhundert ein junger Mann namens Nigel, der Verlobte der dunkelhaarigen Gwendolyn aus Winnipeg, die mit eifersüchtigem Auge über ihn wachte.
Oberon unterbrach meinen Erzählfluss mit einer Frage. ›Hey, gibt es da nicht so ein Monster mit dem Namen Eifersucht? Du hast mir mal davon erzählt, und ich erinnere mich daran, weil es eine ungesunde Einstellung zum Essen hat.‹
»Ja, natürlich, das ist aus Shakespeares Othello. Eifersucht ist das grüngeäugte Scheusal, das besudelt die Speise, die es nährt.«
›Also ein ziemlich unvernünftiges Monster.‹
»Stimmt.«
Vor langer Zeit – in der Ära vor der Motorisierung, als die Menschen noch in Kutschen herumfuhren oder einfach zu Fuß gingen – überquerte Gwendolyn an einem Sommertag die festgetretene Erde der Bloor Street, weil sie ihren Nigel besuchen wollte. Sie hatte extra einen Kuchen gebacken und trug ein rotes Kleid mit einem dünnen, dazu passenden Tuch um die Schultern. Dieses Kleid hatte ihr Nigel geschenkt, und sie wusste, dass er heute den grauen Nadelstreifenanzug anhatte, den sie für ihn gekauft hatte. Bestimmt dachte sie, dass sie ein hübsches Paar mit erlesenem Geschmack abgaben. Vor lauter Angst, ihren Kuchen fallen zu lassen, überquerte sie die Straße zum Seminar nicht schnell genug. Und sie achtete nicht auf ihre Umgebung. Deshalb entging ihr, dass sich eine Kutsche näherte, und sie wurde überfahren.
Umgestoßen und niedergetrampelt von einem Pferd, das eine Vierteltonne wog, dann überrollt von schweren Rädern. Mit zerschmetterten Rippen und inneren Blutungen unter einem einengenden Korsett hatte Gwendolyn nur den einen Gedanken: Nigel noch ein letztes Mal zu sehen. Zuerst allein, dann mithilfe eines Passanten schleppte sie sich zu den flachen Stufen des Seminars und tat ihren letzten Atemzug, wenige Sekunden bevor Nigel erschien, der nachsehen wollte, was es mit den lauten Hilferufen auf sich hatte. Als er das wächserne Gesicht seiner toten Verlobten und den kaltschnäuzigen Kutscher bemerkte, der einfach weiterfuhr, als wäre nichts geschehen, packte ihn ein für einen angehenden Geistlichen ungebührlicher Zorn. Das Liebste in seinem Leben war ihm genommen worden, und er wollte Gleiches mit Gleichem vergelten. Oder den Übeltäter zumindest zu Brei schlagen. Also stürzte er dem Mann nach, der seine Verlobte überfahren hatte, und stellte ihn schließlich. Da der Kutscher allerdings mit einem Revolver bewaffnet war und keine Lust auf einen Faustkampf gegen einen Rotschopf mit buschigem Backenbart hatte, der einen grauen Nadelstreifenanzug und eine goldene Taschenuhr trug, war auch Nigel kurz darauf tot.
Sein Geist zog vernünftigerweise weiter an den für ihn bestimmten Ort und registrierte wahrscheinlich gar nicht mehr, dass ihm gerade auf handfeste Weise vorgeführt worden war, warum es in manchen Fällen besser ist, die andere Wange hinzuhalten. Gwendolyn hingegen hatte noch eine Aufgabe zu erledigen. Der schrecklich zerschundene Kuchen war wie ein Zeichen ihrer unsterblichen Liebe. Sie konnte mit dem Leben nicht abschließen, solange sie mit Nigel nicht ein letztes Mal den Schwur ewiger Liebe ausgetauscht hatte.
Daher zog ihr Geist in das Seminargebäude ein und spukte dort jahrzehntelang als Dame in Rot auf der Suche nach Nigel umher.
›O nein, das wird schlecht für dich ausgehen‹, unkte mein Hund, als ich ihn einseifte.
»Meinst du?«
›Auf jeden Fall. Du bist dem Tod geweiht.‹
»Ja, du hast recht.«
Als ich 1953 das Universitätsgebäude betrat, hatte mich niemand vor der Dame in Rot gewarnt. Dafür gab es auch gar keinen Grund. Sie war ein scheuer, zurückgezogener Geist, der nach einem rothaarigen Mann namens Nigel mit buschigen Koteletten und einem grauen Anzug Ausschau hielt. Solange man diesen Kriterien nicht entsprach und nicht zufällig bei einem ihrer Anfälle von Selbstmitleid über sie stolperte, bekam man sie gar nicht zu Gesicht.
Zu dieser Zeit befand sich das Gebäude in einer Art Schwebezustand und wurde von der Universität nur für Verwaltungsaufgaben und Prüfungen genutzt, die nirgendwo sonst untergebracht werden konnten. Das Royal Conservatory of Music zog erst in den Siebzigerjahren ein. Ich musste zum Ablegen von Prüfungen hin und stellte gleich bei meinem ersten Besuch fest, dass viele Räume unbenutzt und ideal für heimliche Verabredungen waren. Solche Orte erfreuten sich bei den Studenten großer Beliebtheit, weil die Schlafsäle zur Verhinderung »unzüchtiger und unmoralischer Handlungen« streng überwacht wurden.
Irgendwann ergab sich schließlich die Gelegenheit zu einem Treffen mit einer Kommilitonin, die eine merkwürdige Schwäche für Jungs hatte, die Nigel hießen. Meine Fitness war für sie bloß ein Bonus; das Attraktivste in ihren Augen war der Name Nigel Hargrave, den sie prachtvoll und aristokratisch fand, wie sie mir gestand. Vielleicht war es das, worauf sie eigentlich stand: Aristokratie. Ich weiß es nicht, ich bin nie so richtig schlau aus ihr geworden. Aber ich war einsam und nicht besonders sittenstreng, also verabredeten wir uns in dem alten Seminargebäude. Die Prüfungen waren auf dem Schwarzen Brett in der Eingangshalle angeschlagen, daher war es kein Problem, einen leerstehenden Raum im ersten Stock zu finden. Ich knackte das Schloss, und wir machten uns auf einem Schreibtisch an unser einvernehmliches Vergnügen.
Als wir uns dann – halb bekleidet und voller Begeisterung – diesem Vergnügen hingaben, entdeckte Gwendolyn, die Dame in Rot, endlich einen Mann, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihrem Verlobten Nigel hatte. Dass er sich mitten im Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau befand, gefiel ihr weniger. Und sie wusste ganz bestimmt, dass es ihr Nigel war, denn seine Gespielin rief immer wieder begeistert diesen Namen. Außerdem hatte er die rötlichen Koteletten und den gleichen grauen Anzug, den sie bei ihrem Besuch mit dem Liebeskuchen erwartet hatte. All das zusammen führte dazu, dass das scheue, zurückgezogene Gespenst zu einem hemmungslos tobenden Poltergeist wurde. Sämtliche Tische in dem Raum setzten sich in Bewegung, auch der, auf dem wir zugange waren. Stühle flogen durch die Luft, zunächst wild und ungenau wie die imperialen Sturmtruppen in Cloud City, dann immer präziser. Der nicht enden wollende Schrei einer Betrogenen tat ein Übriges.
Bereits als wir uns in die Luft erhoben, hatte meine Gespielin aufgehört, meinen Namen zu rufen, und der Schrei gab ihr den Rest. Halb bekleidet rannte sie aus dem Zimmer, und ich sah sie nie wieder.
»Nnnnigel! Wwwwie konntest du nuuuuur!«, hauchte mir eine ätherisch zornige Stimme zu.
»Ich, äh … ich glaube, das ist eine Verwechslung. Wer sind Sie?«
Wirbelnd verdichtete sich die rote Erscheinung zu einer gesitteten, anmutigen Gestalt, bis ich Einzelheiten ihres Kleids erkannte, mit deren Hilfe ich später ihren Ursprung herausfand. Nur der Mund entsprach nicht dem Eindruck von Gesittetheit. Unnatürlich weit auseinanderklaffend, rief er: »Ich bin deine Verlobte Gwendolyyyynnn!«
»Was? Hey, ich bin nicht der, nach dem du suchst. Und ich heiße in Wirklichkeit auch gar nicht Nigel!«
»Lügneeeerrr!«
Jetzt wurden die Möbel so richtig aggressiv und fuhren von allen Seiten auf mich los. Mir blieb nichts anderes übrig, als Fersengeld zu geben. Gegen Geister kommt ein Druide nicht an. Sie haben nichts Materielles an sich, das man binden oder auflösen könnte, und auch mein Eisenamulett ist für sie bloß ein Klumpen Metall.
Das heißt jedoch nicht, dass Geister völlig unabhängig sind. In der Regel sind sie an den Ort ihres Todes gebunden, wenn auch mit immateriellen Fesseln, die nichts mit der Erde zu tun haben. Um Gwendolyn zu entrinnen, musste ich nur aus dem Gebäude fliehen. Dachte ich zumindest.
Als ich durch den Korridor und dann über die breite Treppe hinunter zum Ausgang raste, folgten mir zusammen mit ihren Schreien alle möglichen Papiere, Bücher und Staubteufel. Einmal knallte mir ein Lehrbuch an die Schläfe, und ich fiel hin, doch ich rappelte mich wankend wieder hoch. Völlig außer Rand und Band jagte sie mich bis zur Tür, und dann hetzte sie mich zu meinem Entsetzen einfach weiter. Offenbar hatte sie sich, nachdem sie ihren Nigel endlich gefunden hatte, mit mir verknüpft und sich von dem Gebäude gelöst. Ich musste dringend Leine ziehen, was vielleicht die beste Umschreibung dafür ist, dass man möglichst viel Abstand zwischen sich und einen vor Eifersucht rasenden Poltergeist bringen sollte. Wo heute die juristische Bibliothek der Universität ist, stand früher eine riesige alte Eiche, die ich mit Tír na nÓg verbunden hatte. Mithilfe des Baums wechselte ich das Gefilde. Von dort aus stellte ich dann Nachforschungen über die Dame in Rot an.
Später kehrte ich zurück und war auf einen Angriff gefasst. Doch Gwendolyn der Poltergeist lauerte nicht neben der Eiche. Wahrscheinlich hatte sie wieder in ihrer alten Wirkungsstätte Einzug gehalten. Verständlicherweise hatte ich keine Lust, das zu überprüfen. In meiner Unterkunft sammelte ich meine wenigen Habseligkeiten zusammen und verschwand, bevor sie mich erneut aufspüren konnte. Danach habe ich keinen Fuß mehr nach Toronto gesetzt.
›Diese rote Gwendolyn-Dame könnte sich also noch immer dort rumtreiben?‹, erkundigte sich Oberon, als ich ihn abwusch.
»Ja.«
›Und sie könnte immer noch wütend auf Nigel sein?‹
»Damit ist zu rechnen. Für einen Geist hat sie ein beeindruckendes Gedächtnis.«
›Und da willst du dich absichtlich als Nigel Hargrave verkleiden?‹
»Genau. Bloß dass ich diesmal als ihr Original-Nigel auftreten will und nicht als der Medizinstudent, den sie mit ihm verwechselt hat. Sie kann sprechen. Sie möchte Nigel dringend etwas mitteilen, verstehst du, und ich muss ihr auch was sagen.«
›Du solltest ihr ein Liebeslied vorsingen. Musik beschwichtigt das empörte Gespenst.‹
»Äh, das heißt Brust, Oberon. Die empörte Brust, nicht das empörte Gespenst. Der Spruch stammt ursprünglich von William Congreve und wird oft falsch zitiert.«
›Kein Wunder. Mir ist noch nie eine empörte Brust untergekommen. Schmackhaft, ja, knusprig gebraten und mit viel Soße. Aber empört? Nie.‹
»Du warst wirklich sehr geduldig beim Baden. Jetzt wollen wir dich mal abtrocknen, und dann kriegst du eine Wurst oder auch zwei.«