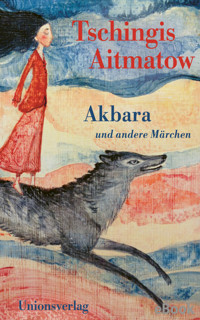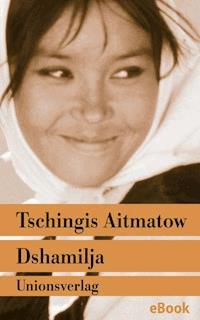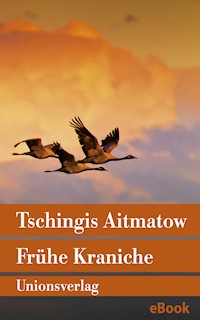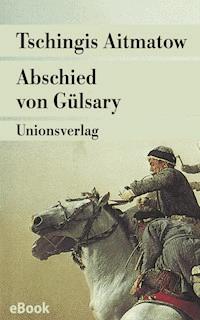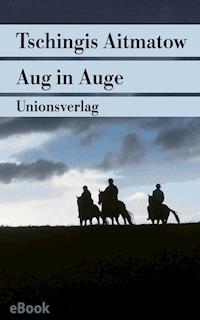
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Militärzug mitten in der Nacht bei der kleinen kirgisischen Bahnstation anhält, löst sich ein Schatten von einem Waggon. Ismail ist als Deserteur heimlich von der Front zurückgekehrt. Sejde will zu ihm halten. Welche Frau hat in diesen Tagen schon das Glück, ihren Mann bei sich zu haben! Sie versteckt ihn und bietet dem ganzen Dorf und den Polizeikommissaren die Stirn. Im tiefsten Winter schleppt sie Nahrung in die Berge, wo sie selbst und das ganze Dorf doch Hunger leiden. Aber Furcht, Existenznot und Misstrauen verändern den Menschen. Etwas Ungutes taucht in den Tiefen von Ismails Augen auf. Aug in Auge ist Aitmatows Erstling und ein Jahr vor Dshamilja erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Als der Militärzug in der Nacht bei der kleinen kirgisischen Bahnstation anhält, löst sich ein Schatten von einem Waggon. Ismail ist als Deserteur heimlich von der Front zurückgekehrt. Seine Frau Sejde will zu ihm halten. Aber Furcht, Existenznot und Misstrauen verändern den Menschen. Etwas Ungutes taucht in den Tiefen von Ismails Augen auf.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Aug in Auge
Erzählung
Aus dem Russischen von Hartmuth Herboth
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die russische Erstausgabe erschien 1958 unter dem Titel Licom k licu.
Für diese Ausgabe erweiterte der Autor die Erstfassung.
Originaltitel: Licom k licu (1958)
© by Tschingis Aitmatow 1989
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Wladimir Murawjew
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30744-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 17:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
AUG IN AUGE
Um die einzige Laterne der kleinen Bahnstation wirbeln …Es dauert nicht mehr lange, der Frühling ist …Mehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Liebe
Zum Thema Asien
Zum Thema Krieg
Um die einzige Laterne der kleinen Bahnstation wirbeln dichte Schwärme nasser Pappelblätter zur Erde.
In dieser Nacht verloren die Pappeln ihr Laub. Schlank und rank wie Ladestöcke wiegten sie sich federnd im Wind, und das Rauschen ihrer hohen Wipfel erinnerte an fernes Meeresbrausen.
Dunkel war die Nacht in der Bergschlucht Tschornaja Gora. Doch noch undurchsichtiger war sie auf der kleinen Bahnstation am Fuße des Gebirges. Von Zeit zu Zeit erzitterte die Finsternis unter dem Licht und dem Donnern durchfahrender Eisenbahnzüge. Die Züge rollten davon, und wieder war es auf der Station dunkel und menschenleer.
Militärzüge fuhren nach Westen. Eben nahte wieder eine lange Kette verstaubter Wagen. Aus dem spaltbreit geöffneten Feuerloch der Lokomotive blitzte eine rote Flamme; die Puffer stießen aufeinander, und der Zug hielt.
Niemand stieg auf dem kleinen Bahnhof aus, niemand rief: Wie heißt die Station? Die Soldaten schliefen in den Wagen, erschöpft von der langen Fahrt. Nur die heißen Achsen ächzten noch leise.
Während der Bahnhofsvorsteher, seine Laterne schwenkend, in schweren Stiefeln zur Spitze des Zuges stapfte, steckte ein Wachposten den Kopf aus dem vorletzten Waggon. Hinter seiner Schulter blinkte ein aufgepflanztes Bajonett. In der Tür stehend, starrte er mit vorgestrecktem Hals in die Finsternis und lauschte. Aus der Schlucht wehte, wie immer, ein scharfer Wind; unten am Steilhang plätscherte müde ein unsichtbarer Fluss. Über das Gesicht des Postens glitt ein kaltes Pappelblatt, es war, als berühre die bebende Hand eines Menschen seine Wangen. Er prallte zurück und warf einen Blick ins Wageninnere. Dann sah er wieder hinaus. Keine Menschenseele, nur Nacht und Wind.
Einige Minuten später löste sich verstohlen ein Schatten von dem Waggon. Er huschte zu den Büschen am Bewässerungsgraben und verbarg sich darin. Ein durchdringender Pfiff ertönte. Der Mann im Gebüsch wollte aufspringen und flüchten, doch er zuckte sofort zurück und duckte sich. Der Stationsvorsteher hatte nur den Pfiff zur Abfahrt gegeben. Die Wagen stöhnten schwer auf, und der Zug machte sich wieder auf seinen weiten Weg. Dumpf dröhnten die Brückenbogen über dem Fluss. Dann kam der Tunnel. Die Lokomotive brüllte lauthals zum Abschied.
Als das Echo in den Felsen verstummt war und sich die aufgeschreckten Dohlen in den Bahnhofsbäumen endlich wieder beruhigt hatten, richtete sich der Mann im Gebüsch auf. Er atmete laut und gierig, als wäre er lange unter Wasser gewesen.
Immer dumpfer und verhaltener klopften die Schienen im Takt der sich entfernenden Räder.
Laut ächzten die Pappeln. Von den Bergen wehte der Geruch herbstlicher Viehweiden.
Dunkle Nacht lag über der Schlucht Tschornaja Gora.
Seit Sejde geboren hatte, schlief sie so kurz und leicht wie ein Vogel. Sie hatte den Kleinen trockengelegt und saß nun beim Licht der Öllampe neben der Wiege. Ihre braune, volle Brust war entblößt und hing weich über dem Kinderköpfchen.
In einer Ecke des Raumes schlief die Schwiegermutter unter ihrer Bettdecke, über die sie noch einen Bauernmantel gebreitet hatte. Sie war alt und schwach und ächzte wie ein krankes Schaf. Ihre Kräfte reichten gerade noch aus, um zu Gott zu beten. Selbst im Traum murmelte sie: »O Schöpfer, in deine Hände befehle ich unser Schicksal!« Wenn Sejde zur Arbeit ging, behütete die Alte den Enkel. Das war immerhin eine Hilfe. Sie trug ihn auch aufs Feld hinaus, damit seine Mutter ihm die Brust gebe, doch ihr Atem ging röchelnd dabei, und ihre Hände zitterten. Es war schwer für sie, aber sie beklagte sich niemals. Wer sollte den Erstling ihrer einzigen Schwiegertochter denn hüten, wenn nicht sie?
Mitternacht war längst vorüber, und noch immer fand Sejde keinen Schlaf. Wer hätte gedacht, wer erwartet, dass solche Zeiten anbrechen würden? Es waren Wörter aufgekommen, die man früher nie gehört hatte: Deutscher, Faschist, Gestellungsbefehl. Im Ail verging kein Tag, an dem man nicht jemandem das Geleit gab. Mit Satteltaschen und Feldsäcken auf dem Rücken versammelten sich die Männer auf der Dorfstraße. Auf Fuhrwerken zusammengepfercht, riefen sie beim Abschied: »Nun hört schon auf zu weinen!« Die Wagen fuhren an, die Männer winkten mit ihren bunten Kirgisenkappen. »Kosch! Kajyr kosch! Auf Wiedersehen, lebt wohl!« Weinende Frauen und Kinder, zu einem Häuflein zusammengedrängt, standen auf dem Hügel, bis das Fahrzeug ihren Blicken entschwand; dann gingen sie schweigend auseinander. Was sollte nun werden, was würde die Zukunft bringen? Würden die Männer aus dem Krieg zurückkehren?
Im vergangenen Sommer, als Sejde, die Tochter eines Hirten, in die Sippe ihres Mannes aufgenommen worden war, hatte an ihrem Haus noch viel gefehlt. Die Wände waren noch nicht ausgeschmiert und verputzt, das Dach war noch nicht mit Lehm übergossen. Wenn doch diese Tage noch einmal zurückkehrten! In ihrer Freizeit hatten sie an ihrem Haus gearbeitet, und vielleicht waren es vor allem diese Stunden gewesen, in denen sich Sejde in den Strahlen ihres kurzen Glücks gesonnt hatte. Sie erinnerte sich, wie das warme Wasser aus dem Aryk, dem Bewässerungsgraben, strömte und wie sie beide, ihr Mann und sie, den Ketmen schwangen und die Spreu mit gelber Erde vermischten. Die Beine bis zu den Oberschenkeln entblößt, standen sie im schmatzenden Lehm und kneteten ihn. Es war eine schwere Arbeit; Sejdes neues Satinkleid verlor in wenigen Tagen die Farbe, doch sie spürten keine Müdigkeit.
Auch ihr Mann war damals froh und zufrieden; er nahm seine Frau des Öfteren bei den vollen braun gebrannten Armen und zog sie an seine Brust oder trat ihr aus Übermut im Lehm auf den Fuß. Sejde riss sich los und lief ihm lachend davon. Wenn er sie fing, zeigte sie sich zum Schein ungehalten.
»Lass mich doch los, lass mich! Wenn deine Mutter uns sieht – schämst du dich nicht?« Dabei schlüpfte sie hinter seine Schultern und presste für einen Augenblick ihre festen, geschmeidigen Brüste an seinen Rücken. »Genug, sage ich! Ach, wie du aussiehst, dein ganzes Gesicht ist voll Lehm!«
»Und du? Guck dich erst mal an!«
Und Sejde holte aus der kleinen Brusttasche ihres Beschmets, der achtlos im Schatten eines Baumes lag, einen kleinen runden Spiegel hervor. Der Spiegel war ihr ständiger Begleiter. Jedes Mal, wenn sie sich verlegen von ihrem Mann losgemacht hatte, betrachtete sie darin glücklich ihr errötetes, lehmverschmiertes Gesicht. Aber Lehm schadet ja der Schönheit nicht – man braucht ihn nur abzuwaschen. Sejde lachte in den Spiegel, lachte vor Glück. Was taten ihr schon die paar Lehmspritzer!
Abends, nach einem Bad im Aryk, legte sie sich unter dem Aprikosenbaum schlafen. Ihr Körper bewahrte noch lange den Duft und die Kühle des fließenden Wassers. Über ihr im dunklen Blau der Nacht schimmerte der schneebedeckte schartige Gebirgskamm wie mattes Perlmutt; im Luzernefeld hinter dem Aryk blühte frische, duftende Minze, und irgendwo im Gras ganz in der Nähe schlug eine Wachtel. Sejde war völlig von dem beseligenden Gefühl ihrer eigenen Schönheit und der Schönheit alles sie umgebenden Lebens gefangen genommen, sie schmiegte sich noch enger an ihren Mann und legte ihre Hand sanft auf seinen Hals. Was schmiedeten sie in jener Zeit nicht alles für Pläne! Sie würden das Haus fertig bauen und sich einrichten, sie würden Sejdes Eltern zu Gast laden, ihnen Geschenke machen. Das alles war das Glück. Die Zeit verging wie im Fluge – man merkte kaum, wie die Nacht den Tag ablöste.
Als sie die Hauswände mit Lehm verschmiert hatten, brach der Krieg aus. In aller Eile verputzten sie innen noch alles, dann wurden die ersten Dshigiten zur Armee geholt.
Niemals würde Sejde jenen Tag vergessen. Noch empfand sie den Trennungsschmerz so, als wäre es gestern gewesen. Der ganze Ail hatte die Einberufenen bis über die Ortsgrenze hinaus begleitet. Sejde hatte sich vor den Leuten geschämt und es nicht gewagt, sich von ihrem Mann so zu verabschieden, wie sie es gern getan hätte; sie war ja hier noch eine ganz neue Schwiegertochter. Sie hielt ihm nur linkisch die Hand hin und senkte den Blick, aus Angst, ihre Tränen zu zeigen. So gingen sie auseinander. Doch als die Dshigiten in der Steppe verschwanden, da fühlte sie plötzlich schmerzhaft, dass sie auf ihr Herz hätte hören und ihren Mann – vielleicht zum letzten Mal – innig umarmen und küssen sollen. Welch bittere Vorwürfe machte sie sich da! Sie hatte es nicht einmal fertiggebracht, ihm etwas von ihrer stillen Hoffnung ins Ohr zu flüstern, dass sie schwanger sei. Nun war es zu spät. Was verloren ist, kehrt nicht zurück. Längst hatte sich fern in der Steppe der Staub wieder auf die Straße gesenkt.
Seit der Zeit flossen die Tage träge und freudlos dahin. Alles, was Sejde beim Abschied unterdrückt hatte, bohrte jetzt wie ein Stachel in ihrer Brust; was sie auch tat, immer spürte sie die brennende, quälende Wunde.
Der Docht brannte nieder. Sie brachte es nicht über sich, dem Kleinen die Brust zu entziehen: Er war beim Saugen so schön eingeschlafen. Von Zeit zu Zeit bewegte er sich plötzlich, und dann begann er wieder behaglich zu schmatzen. Sejdes Gedanken entglitten in weite Ferne.
Da klopfte jemand behutsam an das Fenster zum Hof. Sejde hob erschrocken den Kopf und lauschte.
Nochmals das leise, abgehackte Klopfen.
Sie bedeckte rasch ihre Brust, streifte den Übermantel von den Schultern und ging mit leisen Schritten zum Fenster, wobei sie mechanisch ihr Kleid zuknöpfte. Durch die niedrigen Scheiben war nichts zu sehen, der Hof lag in tiefer Finsternis.
Sejde zog fröstelnd die Schultern zusammen. Der Schmuck in ihrem Haar gab einen leichten Klang.
»Wer ist da?«, fragte sie argwöhnisch.
»Ich. Mach auf, Sejde!«, antwortete eine heisere Stimme gedämpft und ungeduldig.
»Wer bist du denn?«, fragte sie unsicher zurück, wich zur Seite und warf einen erschrockenen Blick auf die Kinderwiege.
»Ich, ich bins! Sejde, mach auf!«
Sie neigte sich zum Fenster, schrie leise auf und stürzte, sich an den Kopf fassend, zur Tür.
Mit bebender Hand tastete sie in der Dunkelheit nach dem Riegel. Sie riss die Tür auf und sank dem vor ihr stehenden Mann lautlos an die Brust. »Sohn meiner Schwiegermutter! Sohn meiner Schwiegermutter!«, flüsterte sie nach altem Brauch, doch sie fand nicht länger die Kraft, sich zu beherrschen, und nannte ihn beim Namen: »Ismail!« Sie begann zu weinen. Was für ein Glück, was für ein unerwartetes Glück! Ihr Mann war lebendig und unbeschadet zurückgekehrt! Hier stand er, Ismail! Ein kräftiger Machorkageruch ging von ihm aus. Der Kragen seines Uniformmantels kratzte sie im Gesicht wie ein Rosshaarlasso.
Warum schwieg er? Vielleicht vor Freude?
Er atmete schwer und strich ihr wie ein Blinder tastend über Schultern und Kopf. »Komm ins Haus!«, flüsterte er rasch. Er legte den Arm um sie und überschritt mit ihr die Schwelle.
Erst jetzt dachte Sejde an die Schwiegermutter. »Ach, ich bin wohl verrückt geworden! Mutter, Sujuntschu! Dein Sohn ist zurückgekehrt!«
»Scht!« Ismail hielt sie fest. »Warte! Wer ist im Haus?«
»Nur wir und dein Sohn in der Wiege!«
»Warte noch, lass mich erst verschnaufen!«
»Die Mutter wird gekränkt sein.«
»Später, Sejde!«
Sie konnte es immer noch nicht fassen, dass ihr Mann zurückgekehrt war, umarmte ihn ungestüm, presste sich an ihn. In der Dunkelheit sahen sie einander nicht, aber mussten sie sich denn sehen? Sie hörte sein Herz unter dem Uniformmantel in kurzen, ungleichmäßigen Stößen schlagen. Es war kein Traum, sie küsste wirklich seine wetterharten, rauen Lippen.
»Ich hatte solche Sehnsucht nach dir! Wann bist du angekommen? Haben sie dich ganz entlassen?«, fragte sie.
Ismail nahm ihre Hände von seiner Schulter und sagte dumpf: »Ich komme direkt vom Bahnhof. Warte hier auf mich.«
Er ging auf den Hof und schlich, sich nach allen Seiten umsehend, zum Schuppen. Nach einer Weile kehrte er mit einem Gewehr zurück. Er tastete mit dem Fuß nach dem Reisighaufen in der Ecke und schob die Waffe darunter.
»Was tust du?«, fragte Sejde verwundert. »Stell es doch ins Zimmer.«
»Sprich leiser, Sejde!«
»Warum?«
Ohne auf die Frage zu antworten, nahm Ismail sie bei der Hand.
»Komm, zeig mir unseren Sohn.«
Fast jeden Abend schleppte Sejde in der Dämmerung von fernen, mit Steppengras und Salzkraut überwucherten Wiesen große Reisigbündel nach Hause. Lange lief sie auf kaum erkennbaren Schafspfaden über Berg und Tal, und wenn der Ail nicht mehr weit war, setzte sie sich auf eine Anhöhe, um zum letzten Mal zu rasten. Sie lockerte den Strick über ihrer Brust, atmete erleichtert auf und lehnte sich mit dem Rücken an das Bündel. Es war schön, so zu sitzen, eine Minute lang alles zu vergessen und ruhig in den Himmel zu schauen. Unten im Ail ratterten Fuhrwerke, Reiterstimmen drangen von der Straße herauf. Der Wind trug den vertrauten Geruch von verbranntem Trockenmist, faulendem Stroh und geröstetem Mais heran. Doch heute fand Sejde nicht die gewohnte Ruhe. Aus der Ferne hallte der Pfiff einer Lokomotive herüber. Sejde erschrak; sie zog den Strick an, hob mit einem Ruck das Bündel von der Erde und ging unter seiner Last rasch weiter. Das Pfeifen der Lokomotive hatte sie an Ismails Flucht erinnert. Ein banges Gefühl kommenden Unheils presste ihr die Brust zusammen.
Auf der Straße war sie darauf bedacht, niemandem zu begegnen, der sie anhalten könnte. Wenn doch die Mondnächte bald ein Ende hätten! dachte sie. Dann brauchte sie nicht jeden Tag Reisig zu schleppen und Ismail Essen in sein Versteck zu bringen. Gott mochte verhüten, dass plötzlich jemand Verdacht schöpfte! Die Frauen hatten sie schon mehrfach bedrängt, ihnen doch die Stelle zu zeigen, wo sie das Reisig holte. Aber sie konnte sie doch nicht mitnehmen, denn dort war Ismail. Tagsüber lag er in einer Höhle, in dunklen Nächten aber kam er nach Hause. Wenn er da war, verhängten sie die Fenster, verschlossen die Türen. Für alle Fälle hatte Sejde unter den Schlafpritschen eine Grube ausgehoben und sie mit einer Matte aus Steppengras und mit Schaffilz zugedeckt.
So lebten sie nun. Die alte Mutter konnte sich nicht an dieses Leben gewöhnen. Schwerhörig, wie sie war, lauschte sie angestrengt auf jedes Geräusch. Andauernd fuhr sie auf und sah Ismail aus verweinten roten Augen mitleidig und ängstlich an. Heimlich seufzend, schien sie zu sagen: Ach, du mein Sohn, mein armer Sohn!
Ismail erkundigte sich manchmal, was im Ail vor sich gehe, hörte aber nur mit halbem Ohr zu. Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut, saß meist schweigend und finster, mit hängenden Schultern da und starrte ungeduldig auf den kochenden Kessel. Sejde musste ihm möglichst schnell etwas zu essen geben, damit er vor dem Morgengrauen seine Höhle wieder erreichte.
Sie hantierte hastig am Herd und machte sich ihre eigenen Gedanken. Ihr Mann tat ihr leid; sie fürchtete auch, ihn zu verlieren und mit der kranken Alten und dem vaterlosen Säugling allein zu bleiben. Ismail hatte sich sehr verändert. In der Höhle sah er keine Sonne, atmete er keine frische Luft; sein Gesicht war aschfahl, und auf seinen aufgedunsenen Wangen spross ein struppiger Bart. Sein Blick war verzagt und hilflos wie der eines gehetzten Pferdes; dann wieder wurden seine Augen hart und schmal, die schwarzen Pupillen blitzten in verhaltener Wut, und seine Unterlippe, in die er die Zähne grub, erbleichte. Das Grauen packte einen, wenn man ihn ansah. In solchen Minuten vergaß Ismail sogar seinen Sohn auf dem Arm.
War das noch derselbe Ismail wie im vergangenen Sommer? Von der Sonne schwarz gebrannt, sehnig wie ein Kranich, hatte er gearbeitet, ohne die Hände auch nur einen Augenblick sinken zu lassen. Damals hatten sie das Haus gebaut. Damals war in ihrem Leben alles klar und einfach gewesen, nichts hatte sie gestört oder in Sorge versetzt. Sie brauchten nur zu leben und zu schaffen. »Wenn wir erst das Haus fertig haben, riegele ich unseren Hof mit einer Lehmmauer vor fremden Augen ab!«, hatte Ismail oft gesagt und dabei ihr Anwesen voller Besitzerstolz betrachtet. Und nun war er ein Deserteur. Nun schlich er nachts heimlich in sein eigenes Haus. Und kaum war er da, trieb es ihn schon wieder weg.
Sejde bemühte sich, nicht daran zu denken. In den seltenen Nächten, wenn ihr Mann kam und, den Sohn auf dem Arm, vor ihr saß, war ihr einziger Wunsch, alles zu vergessen, alles, und wenigstens eine kurze Stunde wirklich glücklich zu sein.
Meinetwegen soll er ein Deserteur sein!, tröstete sie sich, während sie den Teig auf dem Brett ausrollte. Ein Mann weiß schon, was er zu tun hat. Ismail sagt ja: »Jedem ist sein Leben lieb, und in diesem Krieg kommt nur der mit heiler Haut davon, der selbst für seinen Kopf sorgt.« Es steht mir nicht an, ihn zu belehren, sicherlich muss das alles so sein, er weiß es schließlich besser. Soll ich ihn denn mit eigenen Händen von mir wegstoßen? Nein, das kann ich nicht. Er sagt doch selbst: »Mag kommen, was will, ich halte meine Brust keiner Kugel hin! So gehört doch wenigstens jeder Tag mir, ich bin zu Hause! Was habe ich denn dort an der Front verloren, irgendwo am Ende der Welt? Unsere Vorväter haben diese Gegenden nicht mal im Traum gesehen. Soll jeder tun, was er für richtig hält, ich jedenfalls brauche das nicht und will es auch nicht. Was ändert sich denn, wenn ich hingehe? Ich allein bezwinge den Feind nicht, die schaffen es auch ohne mich.«
Das stimmt sicherlich, sie werden es schaffen. Ismail allein macht den Staat nicht ärmer. Gut, er ist geflohen, na und? Niemandem schadet es etwas, wenn er sich in Sicherheit bringt, wenn er keine Lust hat, sich umbringen zu lassen! Wenn bloß erst der Winter überstanden wäre! Sie hatten wenig Mais im Haus, und die Zeit bis zum Frühjahr war lang. Den anderen Familien im Ail ging es nicht besser, das Volk lebte jetzt nicht so wie früher, das Brot war bei allen knapp. Ob es bis zum Frühjahr reichte, wusste niemand. Schwere Zeiten standen bevor.
Morgens war der Wermut an den Aryks mit flaumigem Reif bedeckt, und seine gefrorenen Samenkügelchen lagen wie gesät auf der Erde. Von Zeit zu Zeit fiel auch schon Schnee. Die Schafe liefen mit feuchtem Vlies umher, aus dem bräunlicher Dampf aufstieg wie aus einem Misthaufen. Elstern flogen dicht über ihnen und betrachteten frech ihre zottigen Flanken. Der Winter nahte, neblig, düster. Und das Ende des Krieges war noch nicht abzusehen, immer mehr junge Burschen gingen an die Front. Jetzt schickte man schon die allerjüngsten fort, die eben erst die Altersgrenze erreicht hatten, halbe Kinder noch, ganz ohne Flaum unter der Nase.
»Mein Gott, gestern noch sind sie barfuß umhergetollt, und heute sind sie plötzlich erwachsen! Da ziehen sie nun in den Krieg, ohne die Freuden des Lebens gekostet zu haben. Elender Deutscher, der Teufel soll dich holen!«, sprachen die Greise und Greisinnen bekümmert und stießen zornig ihre Krückstöcke auf den Boden. Sie standen vor dem Hof, in dem Busa ausgeschenkt wurde. Hier kamen die Einberufenen zum letzten Mal mit den Mädchen und den Kelins, den jungverheirateten jungen Frauen, zusammen. Pausenlos klappten die Türen der Stube, in der die Scheidenden mit trunkener Stimme sangen. Ihre Lieder griffen einem ans Herz. Aus ihnen klang Trauer und Entschlossenheit, trunkene Verwegenheit und Besinnung.
Die Alten wischten sich die Tränen von den Wimpern.
»Ach, ihr lieben Kinder, käme doch bald der Tag, an dem wir wieder eure Lieder hören!«
Auch Sejde saß unter den Burschen. Früh am Morgen war Dshumabai, ein jüngerer Bruder aus der Sippe ihres Mannes, angeheitert zu ihr gekommen.
»Mach dich fertig, Dshene. Wir haben Busa bestellt und wollen noch einmal lustig sein. Komm mit!«
Sejde wollte den Jungen nicht kränken. Trotzdem versuchte sie, ihm abzusagen. Sie mahlte gerade mit der steinernen Handmühle Talkan für Ismail. »Es passt mir jetzt nicht, sei mir nicht böse. Ich begleite euch dann auf der Straße.«
»Wieso passt es dir nicht? Du musst doch mit mir Abschied feiern, mit deinem Kajyn! Nein, komm nur, schon wegen Ismail! Vielleicht steckt er gerade im heißesten Kriegsgetümmel! Wenn ich ihn an der Front treffe, sage ich ihm: ›Sie war selbst mit auf unserer Abschiedsfeier und lässt dich grüßen!‹ Bin ich denn schlechter als die anderen? Alle haben ihre Verwandten dabei, und ich?«
Sejde wusste nicht, was sie antworten sollte.
Dshumabai bemerkte ihre Verlegenheit. »Was ist denn? Schämst du dich? Aber, aber! Komm!«
Und nun saß sie also in der Stube und wagte nicht, den Blick zu heben, als hätte sie sich vor all den Jungen schuldig gemacht. Am liebsten hätte sie sich in den äußersten Winkel verkrochen. Sie presste ihr Tuch vor den Mund und schwieg.
Wie teuer einem ein Mensch ist, fühlt man in ganzer Schärfe erst bei der Trennung. All diese jungen Burschen, die jetzt lärmten, sich Scherzworte zuriefen und Lieder sangen, würden morgen dem Tod ins Auge schauen. Vielleicht waren sie einem gerade deshalb so lieb wie noch nie. Sie dachten in diesen Minuten weniger an sich, an ihr eigenes Schicksal, als an die Menschen, die im Ail zurückblieben. Sie wünschten ihnen zum Abschied Gesundheit und Glück, und sie wollten für sie etwas Großes, Schönes vollbringen, ja sogar ihr Leben hingeben.
Jetzt erhob sich Dshumabai von seinem Sitzkissen, hochrot im Gesicht und von der Busa in ausgelassener Stimmung. Wenn man ihn so sah, war er noch immer der unbeholfene, schlaksige Junge. Er nahm seinen Becher in die Hand, die Reihe war an ihm, zum Abschied ein Lied zu singen.
Einer seiner Brüder, Myrsakul, der Sänger, war unlängst von der Front zurückgekehrt. Er hatte einen Arm verloren und war jetzt Vorsitzender des Dorfsowjets. Seine Lieder wurden selbst von den kleinen Kindern gesungen, und wer sie hörte, dem griffen sie ans Herz.
Dshumabai sang ein Lieblingslied seines Bruders. Es hatte eine getragene, besinnliche Melodie.
He-he-he!
Sechzig Waggons auf einmal
zieht die geflügelte Lok.
Ich verlasse den Ail,
lebt wohl, meine Dsheneler!
Siebzig Waggons auf einmal
führt die Lok davon wie der Wind.
Ich verlasse den Ail,
lebt wohl, meine Dsheneler!
»Bravo, Dshigit!«, riefen lobende Stimmen einmütig. »Sollst als Sieger heimkehren!«
Dshumabai hatte sich vor aller Augen verändert, er war rauer und männlicher geworden. Stolz reckte er die Schultern und blickte durch das Fenster auf die geliebten Berge; es schien, als habe er jetzt erst begriffen, dass der heimatliche Ail in einer Stunde bereits hinter ihm liegen sollte. Er sang weiter:
Wir fahren in weite Fernen,
doch unser Blick bleibt bei dir, Alatau!
Lang noch begleiten uns
deine blau-weißen Schneefelder.
»Bravo, Dshigit!«, rief man ihm zu. »Wo gibt es solche Berge wie unseren Alatau!«
Jetzt sangen alle, die Jungen, die Kelins und die Mädchen. Auch Sejde, bisher in ihre eigenen Gedanken versunken, vergaß in diesem Augenblick alles auf der Welt. Sie sah einen Militärzug jenseits des Tunnelberges durch die endlose kasachische Steppe rasen. Dicht gedrängt standen Dshigiten an den Türen der Waggons; sie sangen und winkten zum Abschied zu den blau-weißen Schneehöhen des Alatau hinauf, die sich wie eine Karawane am Horizont dahinzogen. Immer weiter entfernten sich die Berge, bis sie im Dunst verschwanden. Sejde lief hinter dem Zug her, um ihn einzuholen; schließlich, als sie nur noch allein in der Steppe war, lehnte sie sich erschöpft an einen Telegrafenmast. Ihr Ohr vernahm sein Summen: Es war, als spiele jemand auf dem Komus die »Klage der Kamelstute«.
Gerührt von dem gemeinsamen Abschiedslied, hob Sejde vorsichtig den Kopf. Die Dshigiten rüsteten schon zum Aufbruch. Einige hatten Tränen in den Augen, andere lachten trunken, doch alle hielten sich tapfer. Sie wünschten einander laut, dass sie als Sieger zurückkehren mögen, und verhielten sich wie leibliche Brüder.
In Sejde erwachte ein Gefühl mütterlicher Liebe zu ihnen, sie empfand Mitleid, Schmerz und zugleich Stolz. Wenn sie ihnen doch helfen könnte! Sie stellte sich vor, sie würde jetzt aufstehen und vor aller Ohren sagen: Bleibt hier, Dshigiten! In der Blüte eurer Kraft wollt ihr den heimatlichen Ail verlassen. Aber ihr sollt leben! Lasst mich hingehen und für euch sterben!
In diesem Augenblick fiel ihr ein, dass sie heute noch Ismail den Talkan bringen musste. Ismail erwartete sie. Und sie senkte wieder den Kopf; ihre Gedanken wanderten nach Hause. Der Talkan war noch nicht fertig gemahlen, das Kind noch nicht gestillt. Sie hatte sich zu lange hier aufgehalten. Die Dshigiten traten auf die Straße. Die Menschenmenge bei den Fuhrwerken geriet in Bewegung, strömte ihnen entgegen.
»Wir wollen sie segnen!«, rief Barpy, der Pferdehirt, ein breitwangiger ergrauter Alter, mit überschnappender Stimme vom Sattel herab. Er zügelte sein Pferd und hob segnend die zitternden verarbeiteten Hände.
»Der Geist der Vorväter helfe euch! Kehrt als Sieger zurück!«
Dann holte er mit der Reitpeitsche aus und sprengte davon, den kräftigen Hals gebeugt und mit zuckenden Schultern. Ein Mann darf seine Tränen nicht zeigen.
Unter dem Lärm der sich drängenden Menge rollten die Fuhrwerke bergab, und bald waren sie im Nebel verschwunden. Eine Zeit lang hörte man noch das Rattern der Räder auf der hart gefrorenen Straße und den Gesang der Dshigiten:
Ich verlasse meinen Ail,
lebt wohl, meine Dsheneler!