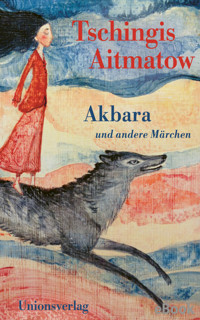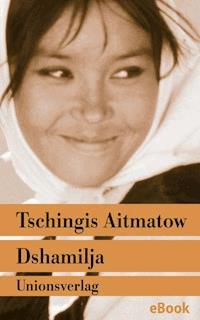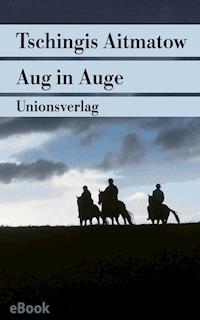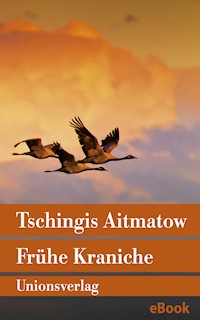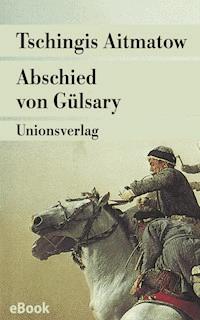16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dshamilja begründete Tschingis Aitmatows Weltruhm. Die Erzählung von der beginnenden Liebe zwischen der jung verheirateten Dshamilja und dem kriegsversehrten Danijar, die mit allen Konventionen brechen, gehört zu den berührendsten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Sie zeugt von einem beinahe archaischen Glauben an die Liebe - und an die Macht der Kunst; denn es ist Danijars wundervoller Gesang, mit dem der melancholische Außenseiter nicht nur die Gefühle Dshamiljas weckt, sondern auch den fünfzehnjährigen Ich-Erzähler überwältigt und selbst zum Künstler werden lässt. Auch Du meine Pappel im roten Kopftuch erzählt von unverfälschten Gefühlen und der Bereitschaft, sich von Althergebrachtem loszusagen: Die Brautwerber haben mit den Eltern bereits den Preis für die junge Asselj ausgehandelt, als sie dem Fernfahrer Iljas begegnet und mit ihm aus dem Dorf flieht. Aug in Auge sodann ist Aitmatows Erstling: Ismail, der heimlich als Deserteur von der Front zurückgekehrt ist und von seiner aufopfernden Frau, die allen im Dorf die Stirn bietet, versteckt wird. Die beiden hoffen auf einen Neuanfang, doch Krieg und Misstrauen haben Ismail verändert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Dshamilja begründete Tschingis Aitmatows Weltruhm. Wie auch Du meine Pappel im roten Kopftuch handelt die Erzählung von unverfälschten Gefühlen und der Bereitschaft, sich von Althergebrachtem loszusagen. Aug in Auge sodann ist Aitmatows Erstling. Drei Liebesgeschichten, die zu den schönsten der Weltliteratur gehören, in einem Band vereinigt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Juri Elperin (*1917) war Zeit seines Lebens als Übersetzer aus dem Russischen und Deutschen für Verlage in der Sowjetunion, der DDR und Westdeutschland tätig.
Zur Webseite von Juri Elperin.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Liebesgeschichten
Dshamilja; Du meine Pappel im roten Kopftuch; Aug in Auge
Erzählungen
Aus dem Russischen von Hartmut Herboth und Juri Elperin
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Dshamilja: © by Tschingis Aitmatow 1958 Übernahme der Übersetzung von Hartmt Herboth mit freundlicher Genehmigung des Verlags Volk und Welt, Berlin.
Du meine Pappel im roten Kopftuch: © by Tschingis Aitmatow 1970 Übernahme der Übersetzung von Juri Elperin mit freundlicher Genehmigung des Verlags Volk und Welt, Berlin.
Aug in Auge: © by Tschingis Aitmatow 1989 Übernahme der Übersetzung von Hartmt Herboth mit freundlicher Genehmigung des Verlags Volk und Welt, Berlin.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hoang Bao Nguyen (Dreamstime)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-30761-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 16:30h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LIEBESGESCHICHTEN
DshamiljaDu meine Pappel im roten KopftuchStatt eines PrologsDie Geschichte des FahrersDie Geschichte des StraßenmeistersStatt eines EpilogsAug in AugeWorterklärungenEditorische NotizMehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Juri Elperin
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Liebe
Zum Thema Asien
Dshamilja
Da stehe ich nun wieder vor dem kleinen Bild mit dem schlichten Rahmen. Morgen früh muss ich in den Ail fahren – ich betrachte es lange und unverwandt, als könnte es mir ein gutes Geleit geben.
Ich habe dieses Bild noch nie auf einer Ausstellung gezeigt, ja, ich verberge es, wenn Verwandte aus dem Ail zu mir kommen. Es stellt nichts Anstößiges dar, aber es ist alles andere als ein Kunstwerk. Schlicht und einfach ist es wie die Landschaft, die es wiedergibt.
Den Hintergrund bildet der sich neigende fahle Herbsthimmel. Der Wind treibt rasch dahineilende scheckige Wölkchen über eine ferne Gebirgskette. Davor wogt die mit Wermut bewachsene rotbraune Steppe. Eine Straße, noch schwarz und feucht vom letzten Regen, durchzieht sie. Zu ihren Seiten liegt in dichten Büscheln verdorrtes umgeknicktes Steppengras. Der ausgewaschenen Räderspur folgen, je weiter, desto verschwommener, die Fußstapfen zweier Wanderer. Die beiden Fußgänger selbst scheinen nur noch einen Schritt machen zu müssen, um hinter dem Rahmen zu verschwinden. Der eine von ihnen … Doch ich greife vor.
Es war in meiner frühen Jugend. Der Krieg tobte das dritte Jahr. An den fernen Fronten irgendwo bei Kursk und Orjol kämpften unsere Väter und Brüder, und wir Halbwüchsigen, etwa fünfzehn Jahre alt, arbeiteten im Kolchos. Die schwere Arbeit der Männer lastete auf unseren noch nicht erstarkten Schultern. Das spürten wir besonders in der Erntezeit. Wochenlang kamen wir nicht nach Hause; Tag und Nacht waren wir auf dem Feld, dem Dreschplatz oder unterwegs zur Eisenbahnstation, wo das Korn verladen wurde.
An einem dieser heißen Tage, die Sicheln glühten vom Ernten, kehrte ich mit dem leeren Wagen vom Bahnhof zurück und beschloss, zu Hause einzukehren.
Nahe der Furt, dort, wo die Straße endete, lagen auf einer Anhöhe zwei Höfe, umgeben von einer Mauer aus Saman. Um das Anwesen herum ragten Pappeln empor. Das waren unsere Häuser. Seit langer Zeit lebten hier unsere beiden Familien in enger Nachbarschaft. Ich selbst gehörte in das Große Haus. Meine Brüder, beide älter als ich, beide unverheiratet, standen an der Front, und wir hatten schon lange keine Nachricht von ihnen.
Mein Vater, ein alter Zimmermann, pflegte im Morgengrauen den Namas zu verrichten und dann zum gemeinsamen Werkhof in die Tischlerei zu gehen. Erst spät am Abend kam er zurück.
Daheim blieben die Mutter und mein Schwesterchen.
Im Nachbarhaus oder dem Kleinen Haus, wie man es im Ail nannte, wohnten unsere nächsten Verwandten. Leibliche Brüder waren zwar nur unsere Urgroßväter, wenn nicht gar Ururgroßväter gewesen, doch ich nenne sie unsere nächsten Verwandten, weil wir als Familie zusammenlebten. Dergleichen war schon zu der Zeit üblich gewesen, als unsere Großväter noch gemeinsam die Nomadenlager aufschlugen und das Vieh hüteten.
Diese Tradition hatten wir gewahrt. Als die Kollektivierung in unseren Ail kam, ließen sich unsere Väter nebeneinander nieder.
Aber nicht nur wir gehörten zusammen; alle Siedler an der Araler Straße, die durch den Ail bis ins Zwischenstromland führte, waren unsere Stammesgenossen, sie alle entstammten einem Geschlecht.
Bald nach der Kollektivierung starb der Familienvater im Kleinen Haus. Seine Frau blieb mit zwei kleinen Söhnen zurück. Nach dem alten Adat, an das man sich damals im Ail noch hielt, durfte man die Witwe mit ihren Söhnen nicht im Stich lassen, und so verheirateten unsere Stammesgenossen sie mit meinem Vater. Das forderten die Geister der Ahnen, denn er war ja der nächste Verwandte des Verstorbenen.
So kamen wir zu einer zweiten Familie. Das Kleine Haus galt zwar als selbstständige Wirtschaft, es hatte einen eigenen Hof und eigenes Vieh, tatsächlich aber lebten wir zusammen. Auch das Kleine Haus schickte zwei Söhne in die Armee. Der älteste, Sadyk, ging bald nach seiner Hochzeit fort. Von beiden erhielten wir Briefe, wenn auch in großen Abständen.
Nun wohnten dort noch die Mutter, die ich Kitschi-apa, jüngere Mutter, nannte, und ihre Schwiegertochter, Sadyks Frau. Beide arbeiteten von früh bis spät im Kolchos. Die Kitschi-apa, eine gutmütige, nachgiebige Frau, die niemand etwas zuleide tat, stand den Jungen in der Arbeit nicht nach, weder beim Ausheben der Aryks, unserer Bewässerungsgräben, noch bei anderen Aufgaben. Mit einem Wort, sie konnte tüchtig zupacken. Das Schicksal schenkte ihr gleichsam als Belohnung für ihren Fleiß eine arbeitsame Schwiegertochter. Dshamilja arbeitete genauso unermüdlich und geschickt wie sie, doch war sie von anderer Art.
Ich liebte Dshamilja heiß, und auch sie hatte mich lieb. Wir hielten gute Freundschaft, doch wir wagten nicht, uns beim Namen zu nennen. Wären wir aus verschiedenen Familien gewesen, dann hätte ich sie natürlich Dshamilja genannt; so aber sagte ich Dshene zu ihr, Schwägerin, und sie nannte mich Kitschine-bala, Kleiner, obwohl ich durchaus nicht klein und der Altersunterschied zwischen uns beiden gering war. Aber so forderte es der Brauch in den Ails: Die Schwiegertöchter nannten die jüngeren Brüder des Mannes Kitschine-bala oder Kajyn.
Die Hauswirtschaft beider Höfe besorgte meine leibliche Mutter. Meine kleine Schwester, ein putziges Mädchen mit Fädchen in den Rattenschwanzzöpfen, half ihr dabei. Nie werde ich vergessen, mit welchem Eifer die Kleine in dieser schweren Zeit ihren Pflichten nachkam. Mal hütete sie hinter den Gemüsegärten die Lämmchen und Kälber der beiden Höfe, mal sammelte sie Kamelmist und Reisig, damit immer etwas zum Heizen im Haus war. Sie brachte Freude in die Einsamkeit der Mutter, mein liebes stupsnasiges Schwesterchen, und lenkte sie mit ihren Zärtlichkeiten von den traurigen Gedanken an die vermissten Söhne ab.
Das gute Einvernehmen und den Wohlstand im Haus verdankte die große Familie meiner Mutter. Sie war die unumschränkte Herrin beider Höfe, die Hüterin des häuslichen Herdes. Als blutjunges Mädchen war sie in die Sippe unserer nomadisierenden Großväter aufgenommen worden; sie hielt ihr Andenken heilig und lenkte die Familie nach Recht und Sitte. Im Ail galt sie als die achtbarste, lauterste und klügste Hausfrau. Sie gebot über alle im Haus. Offen gestanden, erkannte man im Ail den Vater nicht als Familienoberhaupt an. Oft konnte ich bei der einen oder anderen Gelegenheit jemand sagen hören: »Weißt du, geh lieber nicht zum Ustak«, so nennt man bei uns die Handwerker, »der kennt doch nur sein Beil. Bei denen hat die ältere Mutter zu bestimmen, sprich gleich mit ihr, da erreichst du mehr.«
Es sei noch erwähnt, dass auch ich mich trotz meiner Jugend häufig in häusliche Angelegenheiten einmischte. Das konnte ich mir nur erlauben, weil die älteren Brüder im Krieg waren. Man nannte mich deshalb, zuweilen scherzhaft, zuweilen aber auch im Ernst, den Dshigiten zweier Familien, den Beschützer und Ernährer. Ich war stolz darauf und fühlte mich für alles verantwortlich. Die Mutter unterstützte meine Selbstständigkeit. Ich sollte tüchtig und aufgeweckt werden, nicht so wie mein Vater, der tagaus, tagein schweigsam hobelte und sägte.
Ich hielt also mit meinem Wagen vor dem Haus im Schatten einer Weide an, lockerte die Zugriemen und ging zum Tor. Da erblickte ich auf dem Hof unseren Brigadier Orosmat, wie immer zu Pferd, die Krücke am Sattel. Neben ihm stand meine Mutter. Die beiden stritten über etwas. Als ich näher kam, hörte ich Mutters Stimme: »Kommt gar nicht infrage! Hast du denn keine Gottesfurcht? Wo hat man je gesehen, dass eine Frau Säcke fährt! Nein, mein Lieber, lass meine Schwiegertochter aus dem Spiel. Sie soll arbeiten wie bisher. Ich weiß ohnehin nicht, wo mir der Kopf steht, versuch du mal, auf zwei Höfen Ordnung zu halten! Ein Glück noch, dass mein Töchterchen herangewachsen ist. Seit einer Woche kann ich nicht gerade gehen, das Kreuz tut mir weh, als hätte ich eine Filzmatte gewalkt, und dabei vertrocknet der Mais draußen, er braucht Wasser«, schimpfte sie erregt und steckte fortwährend den Zipfel ihres Kopftuchs in den Kragen ihres Kleides. Das tat sie immer, wenn sie böse war.
»Was sind Sie bloß für ein Mensch!«, sagte Orosmat verzweifelt, sich im Sattel vorbeugend. »Wenn ich statt dieses Stumpfes noch mein Bein hätte, würde ich Sie da bitten? Ich würde selber, wie früher, die Säcke auf den Wagen werfen und loskutschieren! Ich weiß, es ist keine Frauenarbeit, aber wo soll ich denn Männer hernehmen? Es ist nun mal beschlossen worden, die Frauen der Soldaten heranzuziehen. Sie klammern sich an Ihre Schwiegertochter, und wir dürfen uns nachher von oben schelten lassen! Die Soldaten brauchen Brot, und wir lassen den Plan platzen. Das geht doch nicht! So darf mans doch nicht machen!«
Ich trat näher, die Peitsche auf der Erde nachschleifend. Als mich der Brigadier sah, hellte sich sein Gesicht merklich auf – ihm war offensichtlich ein Gedanke gekommen.
»Warum haben Sie eigentlich Angst um Ihre Schwiegertochter? Ihr Kajyn hier«, er zeigte erfreut auf mich, »lässt bestimmt niemand an sie heran, da können Sie sicher sein. Er ist doch ein Mordskerl, unser Seït. Die Jungen sind heutzutage unsre Ernährer, unsre ganze Stütze.«
Die Mutter ließ den Brigadier nicht weiterreden.
»Ja, wie siehst du denn aus, du Rumtreiber?«, jammerte sie. »Und die Haare, ganz verfilzt sind sie schon! Unser Vater ist mir der Richtige, findet nicht mal Zeit, seinem Sohn den Kopf zu scheren.«
»Nun, dann soll sich das Söhnchen heute mal einen guten Tag bei den Alten machen und sich den Kopf scheren lassen!«, meinte Orosmat, der Mutter schlau nach dem Munde redend. »Seït, bleib heute zu Haus, füttere die Pferde schön, und morgen früh geben wir Dshamilja einen Wagen, dann arbeitet ihr beide zusammen. Hör gut zu: Du bist für sie verantwortlich. Sie können ganz beruhigt sein, Baibitsche, Seït wird schon dafür sorgen, dass ihr niemand was zuleide tut. Und wenns sein muss, schicke ich auch noch Danijar mit. Sie kennen ihn doch, er ist kürzlich aus dem Krieg zurückgekehrt, ein stiller, ruhiger Kerl. Wenn sie zu dritt das Korn zum Bahnhof fahren, wer wird es dann noch wagen, Ihre Schwiegertochter anzurühren? Stimmts, Seït? Was meinst du? Wir wollen Dshamilja zum Fuhrmann machen, und die Mutter ist dagegen. Sprich du doch mal mit ihr.«
Mir schmeichelte das Lob des Brigadiers und seine Art, sich mit mir wie mit einem Erwachsenen zu beraten. Außerdem stellte ich mir sofort vor, wie schön es wäre, zusammen mit Dshamilja zur Bahnstation zu fahren. Daher sagte ich mit ernster Miene zur Mutter: »Ihr wird schon nichts passieren. Denkst du, die Wölfe fressen sie, oder was?« Ich spuckte wie ein alter Fuhrmann überlegen durch die Zähne und ging davon, die Peitsche hinter mir herschleifend und rhythmisch die Schultern wiegend.
»So ein Bengel!«, sagte die Mutter verwundert, aber wohl auch ein wenig stolz, doch im gleichen Augenblick schrie sie zornig: »Ich zeig dir noch Wölfe! Was weißt du denn schon, du Neunmalkluger?«
»Aber wer solls denn wissen, wenn nicht er, er ist doch der Dshigit zweier Familien! Ihr könnt stolz auf ihn sein!«, meinte Orosmat und sah die Mutter mit einem vorsichtigen Blick an, als fürchtete er, sie könnte sich wieder sträuben. Er wusste nichts mehr zu sagen und lächelte verlegen. Doch die Mutter widersprach ihm nicht. Sie ließ auf einmal den Kopf hängen und sagte mit einem tiefen Seufzer: »Ach, was heißt Dshigit, ein Kind ist er noch, und doch muss er Tag und Nacht arbeiten. Unsere guten Dshigiten sind Gott weiß wo! Und unsere Höfe vereinsamt wie ein verlassenes Nomadenlager.«
Ich war schon weit weg und hörte nicht mehr, was die Mutter noch sagte. Im Gehen schlug ich mit der Peitsche so heftig an die Hausecke, dass Staub aufwirbelte, und ohne das Lächeln meines Schwesterchens zu erwidern, das auf dem Hof mit klatschendem Geräusch Saman formte, trat ich festen Schrittes unter das Vordach. Dort hockte ich mich nieder und wusch mir in aller Ruhe die Hände, indem ich mir Wasser aus einem Krug darübergoss. Dann ging ich ins Haus und trank eine Tasse saure Milch; die zweite nahm ich mit zum Fensterbrett und brockte mir Brot hinein.
Die Mutter und Orosmat standen noch immer auf dem Hof. Doch sie stritten nicht mehr, sondern redeten ruhig und leise miteinander. Wahrscheinlich sprachen sie von meinen Brüdern. Die Mutter fuhr sich von Zeit zu Zeit mit dem Ärmel über die geschwollenen Augen, nickte nachdenklich als Antwort auf die Worte Orosmats, der sie offenbar tröstete, und schaute mit verschleiertem Blick in die Ferne, über die Bäume hinweg, als hoffe sie, ihre Söhne dort zu entdecken.
In ihrem Kummer schien die Mutter die Einwände gegen den Vorschlag des Brigadiers vergessen zu haben. Und dieser, zufrieden, dass er sein Ziel erreicht hatte, schlug das Pferd mit der Riemenpeitsche und ritt in schnellem Passgang vom Hof. Damals ahnten weder die Mutter noch ich, wie das alles enden sollte.
Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass Dshamilja mit dem zweispännigen Wagen fertig werden würde. Sie konnte mit Pferden umgehen, sie war ja die Tochter eines Pferdehirten aus Bakair, einem Ail in den Bergen. Auch unser Sadyk war Pferdehirt. Einmal im Frühling beim Wettrennen soll Dshamilja schneller gewesen sein als er. Wer weiß, ob es wahr ist, doch man sagte, dass der in seiner Ehre gekränkte Sadyk sie daraufhin entführte. Andere dagegen beteuerten, sie hätten aus Liebe geheiratet. Wie es auch immer gewesen sein mag, sie lebten nur ganze vier Monate zusammen. Dann begann der Krieg, und Sadyk wurde zur Armee einberufen.
Ich weiß nicht, wie es zu erklären war, vielleicht weil Dshamilja seit der Kindheit mit dem Vater, für den sie Tochter und Sohn zugleich war, Pferde jagte. In ihrer Art lag etwas Männliches, Schroffes, ja zuweilen sogar Grobes. Auch bei der Arbeit packte Dshamilja zu wie ein Mann. Mit den Nachbarinnen vertrug sie sich gut, doch wenn man sie ungerecht behandelte, dann konnte sie besser schimpfen als jede andere; es kam sogar vor, dass sie jemand an den Haaren zog.
Schon mehrmals hatten sich Nachbarn beklagt: »Was habt ihr nur für eine Schwiegertochter? Sie ist doch gerade erst in euer Haus gekommen, aber mit dem Mund ist sie schon sehr vorneweg! Die hat weder Achtung noch Schamgefühl!«
»Ist doch gut, sie macht es schon recht!«, antwortete dann die Mutter. »Sie sagt den Leuten gern die Wahrheit ins Gesicht. Das ist besser, als wenns einer heimlich tut und hinter dem Rücken die Zunge wetzt. Eure Schwiegertöchter spielen die Sanftmütigen, Stillen, dabei sind sie wie faule Eier: von außen rein und glatt, doch innen – da muss man sich die Nase zuhalten.«
Der Vater und die jüngere Mutter behandelten Dshamilja nie so streng und kleinlich, wie es Schwiegereltern gewöhnlich tun. Sie liebten sie und wünschten nur, dass sie Gott und ihrem Mann treu bliebe.
Ich konnte die beiden verstehen. Unsere Familien hatten vier Söhne in die Armee gegeben; mein Vater und die jüngere Mutter fanden Trost in Dshamilja, der einzigen Schwiegertochter auf unseren Höfen, deshalb war sie ihnen lieb und teuer. Meine leibliche Mutter hingegen verstand ich nicht. Sie war nicht der Mensch, der jemand so leicht ins Herz schloss. Sie hatte ein herrisches, raues Wesen. Nie wich sie von ihren Lebensregeln ab. Jedes Jahr stellte sie zu Beginn des Frühlings im Hof unsere Nomadenjurte auf, die mein Vater schon in seiner Jugend gebaut hatte, und räucherte sie mit Wacholder aus. Uns erzog sie zu strenger Arbeitsamkeit und Achtung vor den Alten. Von allen Familienmitgliedern verlangte sie unbedingte Unterordnung.
Dshamilja jedoch zeigte sich vom ersten Tag an, da sie zu uns gekommen war, nicht so, wie es der Schwiegertochter geziemte. Sie hörte wohl auf die Alten und verehrte sie, doch niemals verneigte sie sich vor ihnen. Dafür spöttelte sie aber auch nicht insgeheim, zur Seite abgewandt, über sie, wie die anderen jungen Frauen. Sie sagte stets geradeheraus, was sie dachte, und scheute sich nicht, ihre Meinung zu äußern. Die Mutter stimmte ihr oft zu und unterstützte sie, doch das entscheidende Wort behielt sie sich vor. Mir scheint, sie sah in Dshamilja, deren aufrechte Denkart und deren Sinn für Gerechtigkeit ihr wesensverwandt waren, einen ihr ebenbürtigen Menschen und träumte im Stillen davon, sie eines Tages auf ihren Platz zu stellen und aus ihr eine ebenso selbstbewusste Hausfrau, eine Baibitsche, eine Hüterin des häuslichen Herdes, zu machen, wie sie selbst es war.
»Danke Allah, meine Tochter«, belehrte sie Dshamilja, »du bist in ein ordentliches, gesegnetes Haus gekommen. Das ist dein Glück. Das Glück einer Frau besteht darin, dass sie Kinder gebiert und dass im Hause kein Mangel herrscht. Du bekommst, Gott sei Dank, alles, was wir, die Alten, erworben haben; ins Grab nehmen wir es ja nicht mit. Das Glück aber, das bleibt nur bei dem, der seine Ehre und sein Gewissen bewahrt. Denk daran, gib auf dich acht!«
Etwas störte jedoch die Mutter an Dshamilja trotz allem: Sie freute sich zu offenherzig, ganz wie ein Kind. Es geschah, dass sie plötzlich, scheinbar völlig ohne Grund, laut und herzhaft lachte. Wenn sie von der Arbeit kam, dann trat sie nicht ruhig und gesittet in den Hof, sondern sie sprang über den Aryk und rannte herein. Mir nichts, dir nichts umarmte und küsste sie bald die eine Schwiegermutter, bald die andere.
Dshamilja sang auch gern; stets trällerte sie vor sich hin, selbst in Gegenwart der Alten. Das alles vertrug sich natürlich nicht mit den üblichen Ansichten über das Verhalten einer Schwiegertochter in der Familie, doch beide Schwiegermütter beruhigten sich damit, dass sie mit der Zeit schon gesetzter werden würde, in der Jugend waren ja schließlich alle so. Für mich aber gab es niemand auf der ganzen Welt, der mir besser gefallen hätte als Dshamilja. Wir scherzten, jagten einander auf dem Hof und konnten ohne jeden Grund schallend lachen.
Hübsch war Dshamilja, schlank und wohlgebaut. Ihr straffes, dichtes Haar trug sie in zwei festen, schweren Zöpfen, und ihr weißes Kopftuch band sie so geschickt um, dass es ein wenig schräg über ihre Stirn lief, was sie sehr gut kleidete und die gebräunte Haut ihres glatten Gesichts hervorhob. Wenn sie lachte, glühten ihre blauschwarzen mandelförmigen Augen in jugendlichem Feuer; wenn sie aber plötzlich ein gepfeffertes Spottlied anstimmte, dann trat in ihre schönen Augen ein keineswegs mädchenhafter Glanz.
Ich bemerkte oft, dass die Dshigiten, besonders die Heimkehrer, ihr nachsahen. Dshamilja schäkerte selbst gern mit ihnen, doch wenn sich einer vergaß, schlug sie ihm auf die Finger. Trotzdem berührte mich so etwas jedes Mal schmerzhaft. Ich war eifersüchtig wie ein jüngerer Bruder auf die Freunde seiner Schwester, und wenn ich in Dshamiljas Nähe junge Männer erblickte, dann fuhr ich immer dazwischen. Ich plusterte mich auf, sah sie herausfordernd an, und mein Blick schien zu sagen: Scharwenzelt hier nicht herum, sie ist die Frau meines Bruders! Denkt ja nicht, dass sie keinen Beschützer hat!
In solchen Augenblicken mischte ich mich, ob es angebracht war oder nicht, betont nachlässig in die Gespräche ein mit der Absicht, die Verehrer lächerlich zu machen. Wenn das nicht gelang, verlor ich die Selbstbeherrschung und schnaubte vor Wut. Die jungen Männer brachen dann gewöhnlich in lautes Lachen aus und riefen: »Oje, nun seht euch den an! Sie ist seine Dshene, nein, so ein Spaß! Und wir habens gar nicht gewusst!«
Ich fasste mich, aber ich fühlte, dass sich meine Ohren verräterisch röteten und die Kränkung mir die Tränen in die Augen trieb. Doch Dshamilja, meine Schwägerin, verstand mich. Mit Mühe unterdrückte sie das aufsteigende Lachen, machte ein ernstes Gesicht und sagte: »Ihr dachtet wohl, die Dshene sei schutzlos? Vielleicht bei euch zu Hause, bei uns nicht! Komm, mein Kajyn, lass sie!« Sie nahm eine würdevolle Haltung an, warf stolz den Kopf zurück, zuckte herausfordernd mit den Schultern und ging still lächelnd mit mir davon.
Ich entdeckte in diesem Lächeln sowohl Unmut als auch Freude. Vielleicht dachte Dshamilja: Ach, du kleiner Dummer! Wenn ich wirklich einmal über die Stränge schlagen wollte, wer könnte mich daran hindern? Und wenn die ganze Familie aufpasste, ihr hieltet mich nicht! Ich schwieg in solchen Fällen schuldbewusst. Ja, ich war eifersüchtig, ich vergötterte Dshamilja, ich war stolz darauf, sie zur Schwägerin zu haben, ich war stolz auf ihre Schönheit und ihren unabhängigen, freien Charakter. Wir waren die innigsten Freunde und hatten kein Geheimnis voreinander.
Zu jener Zeit gab es wenig Männer im Ail. Das nutzten manche Burschen aus; sie näherten sich den Frauen in frecher Weise, ohne viel Federlesens zu machen, denn man brauchte ja, so meinten sie, nur mit dem kleinen Finger zu winken, und jede beliebige kam gelaufen.
Während der Heuernte wurde einmal Osmon, ein entfernter Verwandter von uns, bei Dshamilja zudringlich. Er war auch einer von denen, die glaubten, dass ihnen keine widerstehen könne. Dshamilja, die im Schatten eines Heuhaufens saß, um ein wenig auszuruhen, stieß unwillig seine Hand zurück und sprang auf.
»Lass mich in Ruhe!«, sagte sie traurig und wandte sich ab. »Ihr Herdenhengste habt ja nichts anderes im Sinn.«
Osmon streckte sich behaglich im Heu aus und verzog geringschätzig die feuchten Lippen.
»Der Katze stinkt das Fleisch am übelsten, das hoch oben an der Stange hängt! Warum zierst du dich? Du willst es doch selber brennend gern, was rümpfst du die Nase?«
Dshamilja drehte sich brüsk um.
»Vielleicht will ich es. Vielleicht will ich es sogar brennend gern.« Ihre Stimme bebte. »Unser Los ist schwer genug, und du Idiot, du freust dich noch. Selbst wenn ich hundert Jahre Soldatenfrau bleiben sollte, solche wie dich würde ich nicht einmal anspucken, das wäre mir schon zuwider. Ich möchte mal sehen, wer überhaupt mit dir reden würde, wenn kein Krieg wäre!«
»Das sage ich ja auch!«, grinste Osmon. »Der Krieg! Du wirst noch toll werden ohne die Peitsche des Mannes!« Seine Augen blitzten lüstern hinter den schmalen Lidspalten. »Wenn du meine Frau wärst, würde ich dich nackt ausziehen, du Großbrüstige, dann würdest du ein anderes Liedchen anstimmen.« Er streckte frech die Hand aus und schnippte mit den Fingern. Dshamilja wollte sich auf ihn stürzen, etwas sagen, doch sie schwieg. Sie wusste, dass es nicht lohnte, mit ihm Streit anzufangen, und warf ihm nur einen langen, hasserfüllten Blick zu. Dann spuckte sie voller Ekel aus, nahm die Heugabel und ging weg.
Ich stand währenddessen auf einem Karren hinter dem Heuhaufen. Als Dshamilja mich sah, wandte sie sich jäh zur Seite. Sie ahnte, in was für einer Verfassung ich war. Ich hatte das Gefühl, als sei nicht sie, sondern ich tödlich beleidigt worden, als hätte man mir die größte Schande angetan. Mit blutendem Herzen warf ich ihr vor: »Weshalb lässt du dich mit solchen Leuten ein, warum sprichst du mit ihnen?«
Bis zum Abend ging Dshamilja finster und mürrisch umher; sie wechselte kein Wort mit mir und lachte nicht wie sonst. Als ich mit dem Karren kam, stieß sie, um mir nicht Gelegenheit zu geben, von der furchtbaren Kränkung zu sprechen, die sie im Inneren verbarg, mit weit ausholender Bewegung die Gabel in einen Heuhaufen, hob ihn hoch und trug ihn, das Gesicht dahinter verborgen, vor sich her. Mit einem Ruck warf sie die Last ab und stürzte sich sogleich auf den nächsten Haufen. Der Karren wurde schnell voll. Als ich wegfuhr, sah ich mich noch einmal um. Dshamilja stand, auf den Stiel ihrer Heugabel gestützt, eine Zeit lang in sich versunken da, dann besann sie sich plötzlich und machte sich wieder an die Arbeit.
Als wir den letzten Karren beladen hatten, blieb sie wieder stehen und blickte lange in die untergehende Sonne. Sie schien die ganze Welt vergessen zu haben. Weit hinter dem Fluss, dort, wo die kasachische Steppe zu Ende ging, glühte die verblassende Abendsonne der Mahdzeit wie die Öffnung eines brennenden Tandyrs. Während sie langsam hinter den Horizont glitt, färbte sie die leichten Wölkchen am Himmel mit ihrem Schein purpurrot und sandte ihr letztes Licht über die lila schimmernde Steppe, in deren Mulden schon das Dunkel der frühen Dämmerung lag. Dshamilja blickte still verzückt in das Abendrot, als schaue sie ein märchenhaftes Traumbild. Liebreiz leuchtete aus ihrem Gesicht, kindlich weich lächelte ihr halb geöffneter Mund. Und da wandte sie sich um, als wolle sie auf meine unausgesprochenen Vorwürfe antworten, die sich mir noch immer auf die Lippen drängten. Sie sprach, als setzten wir ein Gespräch fort: »Denk doch nicht mehr daran, Kitschine-bala, lass ihn. Ist das etwa ein Mensch?« Sie verstummte, verfolgte mit dem Blick den versinkenden Rand der Sonne, seufzte und fuhr nachdenklich fort: »Woher soll denn so einer wie dieser Osmon wissen, was man im Herzen empfindet? Niemand weiß das. Vielleicht gibt es solche Männer gar nicht auf der Welt.«
Ehe ich die Pferde gewendet hatte, war Dshamilja schon zu den Frauen hinübergelaufen, die neben uns arbeiteten. Ihre lauten, fröhlichen Stimmen hallten zu mir herüber. Schwer zu sagen, was in ihr vorgegangen sein mochte, vielleicht war ihr leichter ums Herz geworden, als sie das Abendrot sah, vielleicht freute es sie, dass sie gut gearbeitet hatte. Ich saß hoch oben auf dem heubeladenen Karren und betrachtete sie. Sie hatte ihr weißes Kopftuch abgebunden und lief, die Arme weit ausgebreitet, über die bereits im Abendschatten liegende abgemähte Wiese hinter einer Freundin her. Ihr Kleid flatterte im Wind. Da war auch mein Kummer plötzlich verschwunden. Lohnte es sich denn, über das Geschwätz dieses Osmon nachzugrübeln? »Also, hü!«, rief ich eilig und schlug auf die Pferde ein.
An jenem Tag wartete ich also, wie der Brigadier angeordnet hatte, auf den Vater, damit er mir den Kopf schere. In der Zwischenzeit wollte ich einen Brief von Sadyk beantworten. Auch in dieser Hinsicht gab es bei uns bestimmte Regeln: Meine Brüder schickten die Briefe an den Vater, der Postbote händigte sie der Mutter aus, und ich hatte sie zu lesen und zu beantworten. Ich wusste jedoch schon im Voraus, was Sadyk schrieb, denn alle seine Briefe ähnelten einander wie die Lämmer einer Herde. Er begann stets mit den Worten: »Ich gebe euch Nachricht, dass ich gesund bin.« Dann ging es ganz sicher so weiter: »Ich schicke diesen Brief mit der Post meinen Verwandten, die im duftenden, blühenden Talas-Gebiet wohnen. Als Ersten grüße ich meinen lieben, teuren Vater Dsholtschubai.« Dann kam meine Mutter, dann die seine und danach wir anderen in strenger Rangordnung. Hierauf folgten die üblichen Fragen nach Gesundheit und Wohlbefinden der Aksakale und der näheren Verwandten, und erst ganz zum Schluss, wie in größter Eile hinzugefügt, fand sich der Satz: »Und auch meiner Frau Dshamilja sende ich einen Gruß.«
Wenn Vater und Mutter, Aksakale und die nächsten Verwandten im Ail lebten, dann war es nicht üblich, ja sogar anstößig, die Frau als Erste zu nennen oder gar einen Brief an sie zu richten. So denkt nicht nur Sadyk, sondern jeder Mann, der etwas auf sich hält; daran gab es nichts zu deuten, das war eben so eingeführt im Ail, und niemand stieß sich daran, ja es fiel niemand auf, zumal jeder Brief ein ersehntes, freudiges Ereignis war, über das man alles andere vergaß.
Die Mutter ließ sich jeden Brief mehrmals von mir vorlesen; dann nahm sie ihn mit frommer Rührung in ihre rauen Hände und hielt ihn fest wie einen Vogel, der jeden Augenblick davonflattern könnte. Endlich faltete sie ihn mit ihren ungelenken Fingern umständlich wieder zu einem Dreieck zusammen.
»Ach, meine Lieben, wie einen Talisman werden wir eure Briefe hüten!«, sagte sie mit tränenerstickter Stimme. »Da erkundigt er sich, wie es Vater, Mutter und den Verwandten geht. Was soll uns schon geschehen, wir sind ja zu Hause in unserem Ail. Aber ihr da draußen? Allein euer Schweigen tötet uns. Schreibt nur ein Wörtchen: Ich lebe, weiter nichts. Mehr brauchen wir nicht.«
Lange betrachtete die Mutter noch den dreieckigen Brief, dann steckte sie ihn in das Lederbeutelchen, in dem alle Briefe verwahrt wurden, und legte es in die Truhe.
Wenn Dshamilja gerade zu Hause war, gab man auch ihr den Brief zu lesen. Ich bemerkte, dass sie jedes Mal errötete, wenn sie ein solches zum Dreieck gefaltetes Blatt in die Hand nahm. Sie las begierig, hastig die Zeilen überfliegend. Doch je näher sie dem Schluss kam, desto schlaffer wurden ihre Schultern, und ihre geröteten Wangen erblassten. Sie zog die eigenwilligen Brauen zusammen und reichte den Brief, ohne die letzten Zeilen gelesen zu haben, so kühl und gleichmütig der Mutter, als gäbe sie etwas zurück, was sie geliehen hatte.
Die Mutter legte Dshamiljas Gebaren auf ihre Art aus und versuchte, sie zu ermutigen.
»Was hast du denn?«, sagte sie, während sie die Truhe verschloss. »Statt dich zu freuen, lässt du den Kopf hängen! Hast denn nur du einen Mann bei den Soldaten? Du bist ja nicht die Einzige, das ganze Volk leidet, ertrag es zusammen mit dem ganzen Volk. Denkst du vielleicht, es gibt welche, die sich nicht einsam fühlen, die sich nicht nach ihren Männern sehnen? Du kannst dich ja grämen, aber du darfst es nach außen hin nicht zeigen! Verbirgs in deinem Inneren!«
Dshamilja schwieg. Doch ihr offener, trauriger Blick schien zu sagen: Ihr könnt mich nicht verstehen, Mütterchen!
Der letzte Brief war, wie auch schon die vorherigen, aus Saratow gekommen. Dort lag Sadyk im Lazarett. Er schrieb, dass er, so Gott wolle, im Herbst wegen der Verwundung nach Hause kommen würde. Das hatte er auch schon früher mitgeteilt, und wir freuten uns alle auf das baldige Wiedersehen mit ihm.
Ich blieb an jenem Tag doch nicht zu Hause, sondern fuhr auf die Tenne. Dort übernachtete ich gewöhnlich. Die Pferde brachte ich auf das Luzernefeld und koppelte sie dort. Der Vorsitzende hatte verboten, das Vieh auf dem Luzernefeld zu weiden, doch damit meine Pferde kräftig blieben, übertrat ich das Verbot. Ich kannte eine verborgene Stelle in einer Mulde, und außerdem merkte nachts niemand etwas. Als ich aber diesmal die Pferde ausgespannt und auf das Feld geführt hatte, fand ich dort schon vier Pferde vor. Das empörte mich. Ich hatte schließlich einen zweispännigen Wagen zu kutschieren, und das gab mir das Recht, mich zu empören. Ohne lange zu überlegen, beschloss ich, die fremden Pferde wegzutreiben, um dem Frechling, der da in mein Revier eingedrungen war, eine Lehre zu erteilen. Da erkannte ich plötzlich zwei Pferde als die Danijars, des Mannes, von dem der Brigadier einige Stunden zuvor gesprochen hatte. Mir fiel ein, dass wir ja vom nächsten Tag an zusammen das Korn zum Bahnhof fahren sollten. Ich ließ seine Pferde in Ruhe und kehrte zum Dreschplatz zurück.
Hier fand ich Danijar. Er hatte eben die Räder seines Wagens geschmiert und zog jetzt die Muttern an den Achsen fest. »Danijar, sind das deine Pferde in der Mulde?«, fragte ich. Danijar drehte langsam den Kopf. »Zwei davon.«
»Und das andere Paar?«
»Die gehören … Wie heißt sie doch gleich … Dshamilja, nicht? Du bist ja mit ihr verwandt. Ist sie nicht deine Dshene?«
»Ja.«
»Der Brigadier hat sie selbst dorthin gebracht und mir aufgetragen, nach ihnen zu sehen.«
Wie gut, dass ich die Pferde nicht weggetrieben hatte!
Die Nacht brach herein. Der leichte Abendwind, der von den Bergen her wehte, legte sich. Auf der Tenne war es still geworden. Danijar machte es sich neben mir in einem Strohhaufen bequem, doch nach einiger Zeit stand er auf und ging zum Fluss. Er trat nahe an die Uferböschung heran und blieb dort stehen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, den Kopf seitwärts geneigt. Ich sah ihn von hinten. Seine hohe, eckige Gestalt hob sich im weichen Mondlicht scharf ab. Sie wirkte wie mit dem Beil aus einem Stück Holz gehauen. Er schien auf das Lärmen des Flusses zu horchen, der in der Nacht besonders laut über die Sandbänke rauschte. Vielleicht lauschte er auch anderen Tönen und Geräuschen der Nacht, die mir verborgen blieben. Er will wieder am Fluss übernachten, der Eigenbrötler!, dachte ich spöttisch.
Danijar lebte noch nicht lange in unserem Ail. Während der Heumahd hatte einmal ein kleiner Junge die Nachricht gebracht, dass ein verwundeter Soldat im Ail angekommen sei. Wie er hieß und in welche Familie er gehörte, das wusste der Junge nicht. Ach, war das eine Aufregung! Wie es so ist im Ail, wenn ein Soldat von der Front kommt, laufen alle ohne Ausnahme, Alt und Jung, in Scharen zusammen, um den Ankömmling zu sehen, ihm die Hand zu drücken, ihn nach Verwandten und Neuigkeiten zu fragen. Auch diesmal erhob sich ein unbeschreibliches Geschrei. Jeder riet herum: Vielleicht war der Bruder zurückgekehrt, vielleicht der Vater? Und auch die Schnitter eilten herbei, um zu erfahren, worum es ging.
Es stellte sich heraus, dass Danijar ein Stammesbruder von uns war und aus unserem Ail stammte. Man erzählte, er sei früh verwaist und habe drei Jahre lang auf verschiedenen Höfen in Armut gelebt, dann sei er zu den Kasachen in die Tschakmakische Steppe davongelaufen, seine Verwandten mütterlicherseits waren Kasachen. Nahe Verwandte, die ihn zurückholen konnten, hatte er nicht, und so vergaß man ihn. Wenn man ihn jetzt fragte, wie es ihm ergangen sei, nachdem er seine Heimat verlassen habe, antwortete er ausweichend, doch man merkte, dass er viel Leid erfahren und das Schicksal eines Waisenkindes ausgiebig kennengelernt hatte. Das Leben hatte ihn wie loses Steppengras in die verschiedensten Gegenden geweht. Lange Zeit hütete er in den Tschakmak-Salzsteppen Schafe; als er herangewachsen war, grub er in der Wüste Kanäle, oder er arbeitete in den neuen Baumwollsowchosen. Später verschlug es ihn in die Angrener Kohlengruben bei Taschkent, und von dort aus ging er zur Armee.
Über die Rückkehr Danijars in seine Heimat freuten sich die Leute im Ail. »Wenn er auch viel umhergeirrt ist, so hat er doch zurückgefunden, es war ihm also bestimmt, das Wasser aus dem heimatlichen Aryk zu trinken. Und auch seine Muttersprache hat er nicht vergessen, sie klingt ein bisschen nach dem Kasachischen hin, aber sonst spricht er ganz echt.«
Und die Aksakale meinten: »Tulpar, das Märchenross, wittert seine Herde selbst am Ende der Welt. Wer liebt nicht seine Heimat, sein Volk! Du hast recht daran getan, dass du zurückgekehrt bist. Wir und die Geister deiner Vorfahren sind zufrieden. So Gott will, werden wir die Deutschen schlagen und wieder in Frieden leben; du wirst, wie die anderen, eine Familie gründen, und aus deinem Herd wird Rauch aufsteigen.«
Sie erinnerten sich der Vorfahren Danijars und stellten genau fest, aus welcher Sippe er stammte. So tauchte in unserem Ail ein neuer »Verwandter« auf – Danijar.
Bald darauf brachte der Brigadier Orosmat den großen, ein wenig gebückt gehenden Soldaten, der das linke Bein nachzog, zu uns auf die Mahd. Den Uniformmantel über die eine Schulter geworfen, schritt er hastig aus, um nicht hinter der kleinen jungen Stute Orosmats zurückzubleiben. Der Brigadier wirkte neben dem langen Danijar durch seine untersetzte Gestalt und seine Beweglichkeit wie eine aufgescheuchte Uferschnepfe. Wir Kinder mussten sogar lachen.
Das verwundete Bein Danijars war damals noch nicht ganz verheilt, er konnte das Knie nicht beugen. Deshalb taugte er nicht als Schnitter; man setzte ihn bei uns Kindern am Grasmäher ein. Ehrlich gesagt, er gefiel uns nicht besonders. Vor allem passte uns seine Verschlossenheit nicht. Er sprach wenig, und wenn er schon einmal redete, dann hatte man das Gefühl, als denke er gleichzeitig an etwas ganz anderes, Fernliegendes, als hänge er seinen eigenen Gedanken nach, und man wusste nie, ob er einen überhaupt ansah, selbst wenn er einem mit seinen nachdenklichen, verträumten Augen offen ins Gesicht blickte.
»Der arme Kerl, er kann wahrscheinlich die Front immer noch nicht vergessen«, sagten die Leute von ihm.
Trotz seiner Versonnenheit arbeitete er schnell und zuverlässig. Ein Außenstehender konnte ihn für einen mitteilsamen und freimütigen Menschen halten. Vielleicht hatte ihn die schwere Waisenkindheit gelehrt, Gefühle und Gedanken zu verbergen, sich anderen gegenüber zu verschließen? Vielleicht war es das.
Seine schmalen Lippen waren stets fest geschlossen, sodass sich an den Mundwinkeln harte Falten bildeten; seine Augen blickten traurig und ruhig, nur die geschmeidigen, beweglichen Brauen belebten sein hageres, stets müdes Gesicht. Manchmal horchte er auf, als höre er etwas, was andere nicht wahrzunehmen vermochten, dann zog er die Brauen hoch, und seine Augen leuchteten in rätselhaftem Entzücken. Dann lächelte er lange und freute sich über irgendetwas. Uns kam das alles merkwürdig vor. Und das war es nicht allein, er hatte auch noch andere sonderbare Gewohnheiten. Abends spannten wir die Pferde aus, sammelten uns vor der Hütte und warteten, bis die Köchin das Essen fertig hatte; Danijar hingegen stieg auf den Wachthügel und blieb dort sitzen, bis es dunkelte.
»Was treibt er dort bloß? Ist er vielleicht als Wächter eingesetzt worden?«, riefen wir lachend aus.
Einmal folgte ich ihm aus Neugier. Ich konnte auf der Anhöhe nichts Besonderes entdecken. Ringsum dehnte sich die weite, in fliederblauem Dämmerlicht liegende Vorgebirgssteppe. Die dunklen, verschwommenen Felsen schienen sich langsam in der Stille aufzulösen. Danijar ließ sich durch mein Kommen nicht im Geringsten stören; er saß da, die Hände um die Knie gelegt, und schaute mit nachdenklichem, doch klarem Blick in die Ferne. Und wieder war mir, als lausche er gespannt irgendwelchen, meinem Ohr nicht wahrnehmbaren Klängen nach. Von Zeit zu Zeit horchte er auf, dann erstarrte er vollends mit weit geöffneten Augen. Ihn quälte etwas, und ich glaubte, er werde im nächsten Augenblick aufspringen und sein Herz ausschütten, aber nicht vor mir – mich bemerkte er gar nicht –, sondern vor etwas Großem, Unfassbarem, mir Unbegreiflichem. Doch gleich darauf erkannte ich ihn nicht wieder: Müde und zusammengesunken hockte er da, als ruhe er sich nur nach der Arbeit aus.
Das Grasland unseres Kolchos lag in den fruchtbaren Uferniederungen des Kurkurëu. Der Fluss brach unweit unserer Siedlung aus einer Schlucht hervor und ergoss sich dann als ungebändigter, wilder Strom in die Ebene. Zur Zeit der Heuernte führten die Bergflüsse Hochwasser. Auch in diesem Jahr wurde der Kurkurëu eines Abends trübe, und sein Wasser begann schäumend zu steigen. Um Mitternacht erwachte ich in der Hütte von dem machtvollen Dröhnen des Flusses. Unbewegt blickte die blaue Nacht mit ihren Sternen in die Hütte, mitunter wurde ein kühler Windhauch spürbar, die Erde schlief, nur der Fluss toste und schien sich drohend auf uns zuzuwälzen. Obgleich wir nicht unmittelbar am Ufer lagen, glaubte ich in dieser Nacht das Wasser so nahe, dass mich unwillkürlich Angst erfasste: Wird es uns und unsere Hütte plötzlich fortspülen? Meine Kameraden schliefen den tiefen Schlaf der Schnitter, ich aber fand keine Ruhe und trat ins Freie.
Schön und schrecklich ist die Nacht in den Niederungen des Kurkurëu. Hier und dort zeichnen sich auf den Wiesen die Silhouetten der gekoppelten Pferde ab. Sie haben sich an dem taufeuchten Gras satt gefressen, schnauben von Zeit zu Zeit und schlafen halb. Doch ein Stück weiter drängt der Kurkurëu über das Ufer, er zerrt an den zerzausten, nassen Purpurweiden, und seine Wasser reißen dröhnend die Steine mit sich fort. Der rastlose Fluss erfüllt die Nacht mit rasendem, schaurigem Lärm. Kaltes Grausen packt einen.
In diesen Nächten dachte ich immer an Danijar. Er übernachtete gewöhnlich in den Heuhaufen am Fluss.
Empfand er denn keine Furcht? Machte ihn das Getöse nicht taub? Ob er wohl schlief? Weshalb nächtigte er allein dort am Ufer? Was gefiel ihm daran? Ein merkwürdiger Mensch, nicht von dieser Welt. Wo mochte er jetzt sein? Ich sah mich nach allen Seiten um, doch ich konnte ihn nicht entdecken. In sanften Hügeln verliefen die Ufer in der Ferne. Die Gebirgskämme stiegen in der Dunkelheit auf. Dort oben auf den Gipfeln war es still, ruhig leuchteten über ihnen die Sterne.
Eigentlich wäre es für Danijar an der Zeit gewesen, im Ail Freundschaften zu schließen. Doch er blieb nach wie vor allein; ihm schienen die Begriffe Freundschaft und Feindschaft, Zuneigung und Hass fremd zu sein. Im Ail galt ein Dshigit aber nur dann etwas, wenn er für sich und andere eintreten konnte, wenn er zu Gutem und manchmal auch zu Bösem fähig war, wenn er sich vor den Aksakalen nicht duckte und auf Gelagen oder Gedenkfeiern das Wort führte, auch bei Frauen galten solche Burschen etwas.
Wenn sich jedoch einer wie Danijar stets abseits hielt und sich nicht um die Alltagsangelegenheiten des Ails kümmerte, dann beachtete man ihn einfach nicht mehr, oder man sagte herablassend von ihm: »Na ja, er schadet niemand, er nützt niemand, er lebt eben so dahin, der arme Tropf, lasst ihn halt.«
Ein solcher Mensch war in der Regel Gegenstand von Spötteleien oder von Mitleid. Wir Halbwüchsigen, die wir älter erscheinen wollten, als wir waren, um den richtigen Dshigiten gleich zu sein, machten uns ständig über Danijar lustig, wenn auch nicht in seinem Beisein, so doch unter uns. Wir spotteten sogar darüber, dass er seine Feldbluse selber im Fluss wusch. Wäscht sie aus und zieht sie wieder an – noch feucht: Es war ja seine einzige.
Sonderbarerweise aber geschah es nie, dass wir in der Unterhaltung mit dem stillen und duldsamen Danijar einen familiären Ton anschlugen. Das hatte seinen Grund nicht darin, dass er älter war als wir – genau betrachtet betrug der Unterschied zwischen ihm und uns ja höchstens drei oder vier Jahre, und wir machten sonst mit Männern seines Alters keine Umstände und duzten sie –, er behandelte uns auch nicht grob oder herablassend, was ja mitunter eine Art Hochachtung einflößt, nein, es lag etwas in seiner schweigsamen, finsteren Nachdenklichkeit, was uns, die wir sonst niemand verschonten, hemmte.
Vielleicht hatte ein Erlebnis mit ihm den Anlass für unsere Zurückhaltung gegeben. Ich war sehr neugierig und fiel den Erwachsenen oft mit meinen Fragen lästig; die Frontsoldaten auszufragen war eine wahre Leidenschaft von mir. Als Danijar während der Mahd bei uns auftauchte, suchte ich ständig nach einer Gelegenheit, um aus ihm, dem Neuen von der Front, etwas herauszuholen.
Eines Abends saßen wir nach der Arbeit am Feuer, aßen und ließen es uns wohl sein.
»Danike, erzähl uns doch was vom Krieg, bevor wir schlafen gehen«, bat ich.
Danijar schwieg zuerst und schien sogar gekränkt zu sein. Lang blickte er ins Feuer, dann hob er den Kopf und sah uns an.
»Vom Krieg, sagst du?«, fragte er, und als antworte er auf seine eigenen Gedanken, fügte er tonlos hinzu: »Nein, es ist besser, ihr wisst nichts vom Krieg!«
Dann wandte er sich ab, nahm eine Handvoll trockenes Unkraut, warf es ins Feuer und schürte die Glut, ohne einen von uns anzublicken.
Mehr sagte Danijar nicht. Doch schon durch seine wenigen Worte hatte er uns zu verstehen gegeben, dass der Krieg etwas war, worüber man nicht im Plauderton sprach, das keinen Stoff für unterhaltsame Geschichtchen vorm Schlafengehen abgab. Über den Krieg, der in des Menschen Adern das Blut erstarren ließ, redete es sich nicht so leicht. Ich schämte mich vor mir selbst. Und ich habe Danijar nie wieder nach dem Krieg gefragt.
Der Abend war indes schnell vergessen, ebenso schnell, wie das Interesse der Ailbewohner für Danijar erlosch.
Früh am nächsten Morgen brachten Danijar und ich die Pferde zur Tenne. Gleichzeitig mit uns kam auch Dshamilja dort an.
Als sie uns erblickte, rief sie schon von Weitem: »He, Kitschine-bala, bring meine Pferde hierher! Wo ist mein Geschirr?« Mit Kennermiene, als sei sie zeit ihres Lebens nichts anderes als Fuhrmann gewesen, prüfte sie ihren Wagen, wobei sie sich durch ein paar Fußtritte davon überzeugte, dass die Räder richtig auf den Achsen saßen.
Danijar und ich ritten auf sie zu. Unser Anblick erregte ihre Heiterkeit. Danijars lange, magere Beine staken in weitschäftigen Kirseistiefeln, die jeden Augenblick herabzufallen drohten, und ich trieb das Pferd mit nackten schwarzen Fersen an.
»Ihr seid mir ja ein schönes Paar!« Dshamilja warf ausgelassen den Kopf zurück. Und ohne Zögern kommandierte sie: »Nun mal ein bisschen lebhaft, damit wir vor der Hitze die Steppe hinter uns haben!«
Sie nahm die Pferde am Zaum, führte sie mit sicherer Hand zum Wagen und spannte sie ein. Ganz allein tat sie das, nur einmal fragte sie mich, wie man die Zügel anlegt. Von Danijar nahm sie überhaupt keine Notiz, als wäre er gar nicht da.
Die Entschlossenheit und das herausfordernde Selbstvertrauen Dshamiljas versetzten Danijar offensichtlich in Erstaunen. Er sah sie unfreundlich, doch gleichzeitig mit versteckter Bewunderung an, die Lippen abweisend aufeinandergepresst. Schweigend nahm er einen Sack mit Getreide von der Waage und trug ihn zu seinem Wagen. Doch da trat ihm Dshamilja in den Weg.
»Was denn, soll sich jeder allein abschinden? Nein, mein Lieber, das ist nicht das Rechte! Gib mir mal deine Hand! He, Kitschine-bala, was guckst du in die Luft, steig auf den Wagen und verstau die Säcke!«
Dshamilja ergriff Danijars Hand, und sie trugen den Sack gemeinsam auf den verschlungenen Händen. Der arme Danijar errötete vor Scham und Verlegenheit. Jedes Mal, wenn sie einen Sack brachten, wenn sie sich fest bei den Händen hielten und ihre Köpfe sich fast berührten, sah ich, wie quälend peinlich Danijar das war; er biss angespannt auf seine Lippen und bemühte sich, Dshamilja nicht anzusehen. Ihr hingegen machte das nichts aus. Sie schien ihren Partner gar nicht zu bemerken und scherzte mit der Frau an der Waage. Als schließlich die Fuhrwerke vollgeladen waren und wir die Zügel in die Hand nahmen, blinzelte sie verschmitzt und sagte lachend: »Na, Danijar, wie ists? Du bist doch wohl ein Mann, fahr du als Erster!«
Danijar setzte sich mit seinem Gespann schweigend in Bewegung. Oh, du Jammerlappen, schüchtern bist du also auch noch! dachte ich.
Wir hatten einen weiten Weg vor uns. Er führte etwa zwanzig Kilometer durch die Steppe und durch die Schlucht bis zur Bahnstation. Glücklicherweise ging es bis unmittelbar zum Ziel immer leicht bergab, sodass es die Pferde nicht schwer hatten. Unser Ail lag am Hang der Großen Berge. Seine dunkel schimmernden Baumgruppen sah man bis zur Einfahrt in die Schlucht.
Am Tag schafften wir nur eine Fahrt. Wir fuhren morgens ab und erreichten die Bahnstation nach Mittag.
Die Sonne brannte unbarmherzig, und auf der Verladestation war kaum durchzukommen, es wimmelte von säckebeladenen Wagen und Karren aus der Ebene, von hoch bepackten Maultieren und Ochsen aus fernen Gebirgskolchosen. Halbwüchsige Jungen oder die Frauen der Frontsoldaten hatten sie hergebracht, braun gebrannte Gestalten in ausgeblichenen Kleidern, mit bloßen Füßen, wund von den Steinen am Wege, und blutigen, von der Hitze und vom Staub aufgesprungenen Lippen.
Am Tor der Getreideerfassungsstelle hing ein verschossenes Tuch mit der Aufschrift: »Jede Ähre für die Front!« Im Hof drängten und stießen sich schreiend die Kutscher und Viehtreiber. Nebenan, hinter einer niedrigen Mauer aus Saman, rangierte eine Lokomotive; sie stieß dichte Dampfwolken aus und verbreitete den Dunst glutheißer Schlacke. Mit ohrenbetäubendem Gedröhn ratterten Züge vorüber. Die speichelnassen Mäuler aufreißend, brüllten die Kamele zornig und verzweifelt. Sie lagen auf der Erde und wollten sich nicht erheben. Unter einem heißen Blechdach lagerte ein riesiger Haufen Getreide. Man musste die Säcke über einen hölzernen Laufsteg bis unmittelbar unter das Dach hinaufschleppen. Der Getreidestaub und die drückende Schwüle nahmen einem den Atem.
»He, Burschen, passt auf!«, brüllte unten der Abnehmer, dessen geröteten Augen man ansah, dass er lange nicht geschlafen hatte. »Die Säcke müssen bis nach oben, ganz rauf!« Er drohte mit der Faust und ließ eine Schimpfkanonade vom Stapel.
Weshalb regte er sich auf? Wir wussten doch selbst, wo wir das Korn hinzutragen hatten, und wir wollten uns auch gar nicht davor drücken; schließlich brachten wir es von dem Feld, auf dem Frauen, Greise und Kinder mit saurer Mühe jedes einzelne Körnchen aufgezogen und geerntet hatten, auf dem sich auch jetzt der Kombinefahrer in glühender Hitze mit seinem klapprigen, längst ausgedienten Mähdrescher abplagte, auf dem Frauen unentwegt den Rücken über heiße Sicheln beugten und Kinderhände liebevoll jede verlorene Ähre sammelten.
Ich erinnere mich noch deutlich daran, wie schwer die Säcke waren, die ich damals auf meinem Rücken schleppte. Solch eine Arbeit stand den kräftigsten Männern an. Ständig in Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren, stieg ich über die knarrenden, sich durchbiegenden Bretter des Laufstegs nach oben, die Zähne in das grobe Leinen verbissen, um den Sack mit allen Mitteln zu halten, ihn nicht loszulassen. In meiner Kehle kratzte der Staub, auf dem Rücken drückte die Last, und vor meinen Augen standen feurige Kreise. Oft verzagte ich auf halbem Wege, wenn ich fühlte, dass der Sack erbarmungslos von meinem Rücken herunterrutschte; dann hätte ich ihn am liebsten abgeworfen und mich mit ihm den Getreideberg hinunterrollen lassen. Doch nach mir kamen andere Träger, die auch Säcke schleppten, Jungen wie ich oder Frauen, die Söhne in meinem Alter hatten. Wenn nicht Krieg gewesen wäre, hätte man ihnen dann erlaubt, sich solche Lasten aufzubürden? Nein, ich hatte nicht das Recht schlappzumachen, wo doch Frauen die gleiche Arbeit verrichteten.
Da geht Dshamilja vor mir, das Kleid bis über die Knie aufgeschürzt, und ich sehe, wie sich die festen Muskeln ihrer sonnengebräunten schönen Beine anspannen, wie sich ihr geschmeidiger Körper unter der Last des Sackes beugt und mit welcher Anstrengung sie sich aufrecht hält. Mitunter bleibt sie einen Augenblick stehen und sagt, als fühle sie, dass meine Kräfte mit jedem Schritt nachlassen: »Halt aus, Kitschine-bala, es ist nicht mehr viel!«
Dabei klingt ihre Stimme selbst dumpf, gepresst.
Manchmal kam uns Danijar entgegen, wenn wir unsere Säcke geleert hatten und zurückkehrten. Leicht hinkend, stieg er mit starken, gleichmäßigen Schritten den Laufsteg hinauf, wie immer einsam und schweigend. Wenn er mit uns auf gleicher Höhe war, musterte er Dshamilja mit finsterem, glühendem Blick, und sie streckte den müden Rücken und strich ihr zerdrücktes Kleid glatt. Er betrachtete sie jedes Mal, als hätte er sie noch nie gesehen, und Dshamilja tat immer wieder, als bemerke sie ihn nicht.
Ja, es hatte sich so eingespielt: Dshamilja machte sich entweder über ihn lustig, oder sie beachtete ihn nicht, je nachdem, wie sie gerade aufgelegt war. Da fahren wir so dahin, plötzlich fällt ihr ein, mir zuzurufen: »Los, schneller!« Die Peitsche über dem Kopf schwingend, feuert sie mit lauter Stimme die Pferde zum Galopp an. Ich jage ihr nach. Wir überholen Danijar und hüllen ihn in eine dichte Staubwolke, die sich lange nicht wieder legt. Obwohl das im Scherz geschah, hätte es sich wohl nicht jeder Mann ruhig gefallen lassen. Doch Danijar fühlte sich offenbar nicht gekränkt. Als wir an ihm vorbeirasten, musterte er die laut lachend in ihrem Wagen stehende Dshamilja mit mürrischem Entzücken. Ich drehte mich um. Selbst durch den Staub sah er ihr noch nach. Es war etwas Gutes, alles Vergebendes in seinem Blick, doch ich erriet in ihm auch noch etwas anderes: verborgene, unstillbare Trauer, wie man sie empfindet, wenn man etwas heiß ersehnt, das einem unerreichbar ist.
Weder Dshamiljas Spott noch ihre völlige Gleichgültigkeit ließ Danijar seine Zurückhaltung auch nur ein einziges Mal vergessen. Es war, als habe er sich geschworen, alles zu ertragen.
Anfangs tat er mir leid, und ich sagte mehrmals zu Dshamilja: »Warum machst du dich denn immer über ihn lustig, Dshene? Er tut doch niemand was.«
»Ach, der!«, lachte Dshamilja und winkte ab. »Es ist ja nur Spaß, das schadet dem alten Griesgram nichts.«
Später neckte und verspottete ich Danijar nicht weniger als Dshamilja. Allmählich beunruhigten mich seine seltsamen, beharrlichen Blicke. Wie starrte er Dshamilja an, wenn sie sich einen Sack auf die Schultern lud! Allerdings zog sie auch die Blicke anderer auf sich. Ihre Bewegungen waren in all dem Heidenlärm, dem Gedränge und Marktgetümmel des Hofes, inmitten der sich schiebenden und heiser schreienden Menschen so sicher und gewandt, ihr Gang so leicht, als berühre sie das alles gar nicht.
Man musste sie einfach ansehen. Wenn sie einen Sack vom Wagen ablud, reckte sie sich, hob die Schulter, um die Last aufzunehmen, und neigte den Kopf zur Seite, so tief, dass sich ihr schöner Hals entblößte und ihre in der Sonne rötlich schimmernden Zöpfe fast die Erde berührten. Danijar unterbrach wie zufällig seine Arbeit und folgte ihr mit dem Blick bis zur Tür. Wahrscheinlich glaubte er sich unbeobachtet, doch ich bemerkte alles, und sein Gehabe missfiel mir mehr und mehr. Ich fühlte mich sogar in gewisser Art beleidigt, denn in meinen Augen stand Dshamilja hoch über ihm.
Wenn sich selbst der schon in sie vergafft, dachte ich, aus tiefstem Herzen empört, was soll man da noch von den anderen erwarten! Und in meinem kindlichen Egoismus, den ich noch nicht abgelegt hatte, packte mich eine glühende Eifersucht. Ein Kind ist ja immer auf Fremde eifersüchtig, die sich seinen Angehörigen nähern. Und anstelle von Mitgefühl empfand ich jetzt für Danijar Feindseligkeit, sodass es mich freute, wenn sich jemand über ihn lustig machte.
Doch für Dshamilja und mich fanden einmal die Hänseleien, die wir uns vor Danijar herausnahmen, ein jähes Ende. Unter den Säcken, in denen wir das Getreide transportierten, war auch ein übermäßig großer aus grobem Wollgewebe, der sieben Pud fasste. Wir trugen ihn gewöhnlich zu zweit, für einen allein war er zu schwer. Eines Tages kam uns auf der Tenne der Gedanke, Danijar einen Streich zu spielen. Wir luden den großen Sack auf seinen Wagen und stapelten andere darüber. Auf dem Weg zur Bahnstation machten Dshamilja und ich bei einem russischen Dorf halt und holten uns in einem Garten eine gehörige Menge Äpfel. Dshamilja warf mit den Früchten nach Danijar, und wir lachten während der ganzen Fahrt. Dann überholten wir ihn wie gewöhnlich, und er verschwand in einer Staubwolke. Er holte uns erst hinter der Schlucht beim Bahnübergang ein. Die Schranke war geschlossen. So kamen wir zusammen auf dem Bahnhof an. Den Siebenpudsack hatten wir völlig vergessen. Wir dachten erst wieder daran, als das Abladen schon fast beendet war. Dshamilja stieß mich übermütig in die Seite und deutete mit dem Kopf auf Danijar. Er stand auf seinem Wagen, betrachtete besorgt den Sack und überlegte offensichtlich, was er mit ihm machen sollte. Dann sah er sich nach allen Seiten um.
Als er bemerkte, dass Dshamilja ein Lachen unterdrückte, wurde er über und über rot, er begriff, was gespielt wurde.
»Schnall dir die Hosen fest, sonst verlierst du sie unterwegs!«, rief Dshamilja.
Danijar warf uns einen zornigen Blick zu. Ehe wir uns besinnen konnten, hatte er den Sack über die Ladefläche zum Seitenbalken geschleift und auf die Kante gestellt; dann sprang er herab, den Sack mit einer Hand stützend, wälzte ihn sich auf die Schulter und ging los. Anfangs taten wir so, als sei dabei nichts Besonderes. Die anderen rührten sich natürlich erst recht nicht: Da trug ein Mann einen Sack, das tat ja hier jeder. Doch als Danijar den Laufsteg erreichte, lief Dshamilja hinter ihm her.
»Stell ihn ab! Es sollte doch nur ein Scherz sein!«
»Geh weg!«, erwiderte Danijar scharf und betrat die Planken.
»Sieh einer an, er schleppt ihn!«, sagte Dshamilja, wie um sich zu rechtfertigen. Sie lachte immer noch leise, doch es klang unnatürlich, als zwinge sie sich dazu.
Wir bemerkten, dass Danijar auf seinem verwundeten Bein stark zu hinken begann. Warum hatten wir bloß nicht vorher an sein Bein gedacht? Bis heute kann ich mir diesen dummen Streich nicht verzeihen, denn ich Narr hatte ihn ausgeheckt.
»Kehr um!«, schrie Dshamilja mit erstickendem Lachen. Doch das konnte Danijar nicht mehr, hinter ihm gingen schon andere.
Ich erinnere mich nicht genau an alles, was weiter geschah. Gebückt unter dem riesigen Sack, den Kopf tief gesenkt und die Zähne in die Unterlippe gepresst, schritt Danijar langsam voran, das verwundete Bein vorsichtig aufsetzend. Wenn er es belastete, empfand er offensichtlich einen so heftigen Schmerz, dass er jedes Mal mit dem Kopf zuckte und sekundenlang wie betäubt innehielt. Und je weiter er den Laufsteg hinaufstieg, desto stärker schwankte er von einer Seite auf die andere. Der Sack riss ihn hin und her. Der Anblick war mir so furchtbar, und ich schämte mich dermaßen, dass mir ganz trocken in der Kehle wurde. Starr vor Entsetzen, fühlte ich mit Leib und Seele die Schwere seiner Last und den unerträglichen Schmerz in seinem Bein nach. Jetzt riss es ihn wieder zur Seite, er schüttelte den Kopf, vor meinen Augen drehte sich alles, es wurde dunkel um mich, und der Boden schwankte unter meinen Füßen.