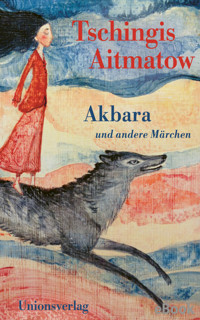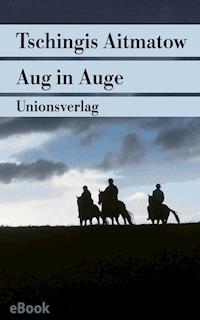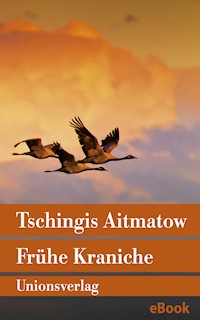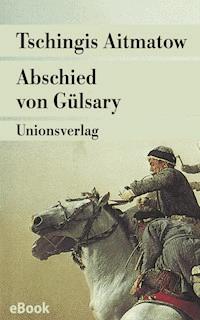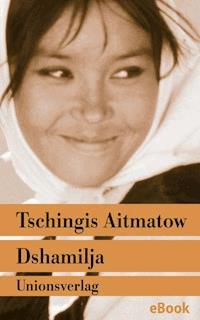
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die lebensfrohe Dshamilja lernt den träumerischen Danijar kennen und lieben. Mit den Augen eines Kindes, das zu verstehen beginnt, erzählt ihr junger Schwager Seït, welch eine Macht die Liebe sein kann. Tschingis Aitmatow arbeitete als Veterinärmediziner auf dem Experimentiergut des Viehzuchtforschungsinstituts von Kirgisien. Er hatte bereits einige kleinere Erzählungen veröffentlicht und absolvierte 1956 ein Praktikum am Maxim Gorki-Literaturinstitut in Moskau. Als Diplomarbeit verfasste er eine Geschichte, gab ihr den Titel Dshamilja, und seither geht sie um die ganze Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Die lebensfrohe Dshamilja lernt den träumerischen Danijar kennen und lieben. Mit den Augen eines Kindes, das zu verstehen beginnt, erzählt ihr junger Schwager Seït, welch eine Macht die Liebe sein kann.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Louis Aragon (1897–1982) war Dichter und Schriftsteller. Zusammen mit André Breton und Philippe Soupault begründete er 1924 den Surrealismus.
Zur Webseite von Louis Aragon.
Friedrich Hitzer (1935–2007) war freischaffender Autor, Übersetzer und Redakteur und engagierte sich als Kulturvermittler zwischen Europa, Russland und Mittelasien. 2006 wurde er mit der Puschkin-Medaille für sein Lebenswerk als Brückenbauer geehrt.
Zur Webseite von Friedrich Hitzer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Dshamilja – »Die schönste Liebesgeschichte der Welt«
Mit einem Vorwort und einer Erinnerung an die Entstehung dieser Erzählung von Tschingis Aitmatow
Nachwort von Louis Aragon
Erzählung
Aus dem Russischen von Hartmut Herboth und Friedrich Hitzer
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Übersetzung von Hartmut Herboth erschien 1960, sie wurde für die erste Ausgabe im Unionsverlag durchgesehen von Friedrich Hitzer nach der autorisierten Moskauer Werkausgabe von 1982.
Die Übersetzung beruht auf dem von A. Dmitrieva vom Kirgisischen ins Russische übersetzten Text.
Originaltitel: Djamila (1958)
© by Tschingis Aitmatow 1958
© für den Text von Louis Aragon by Editions Messidor
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30754-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 16:12h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
https://www.unionsverlag.com
mail@unionsverlag.ch
E-Book Service: ebook@unionsverlag.ch
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DSHAMILJA – »DIE SCHÖNSTE LIEBESGESCHICHTE DER WELT«
Gefährtin derer, die an die Liebe glaubenVorbemerkungDshamiljaDshamilja und Danijar – Wie diese Novelle entstandLouis Aragon Die schönste Liebesgeschichte der WeltWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Louis Aragon
Über Friedrich Hitzer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Liebe
Zum Thema 2. Weltkrieg
Zum Thema Asien
Zum Thema Krieg
Der 15-jährige Seït erzählt die Geschichte seiner jungen, verheirateten Schwägerin Dshamilja. Während ihr ungeliebter Ehemann an der Front steht, lernt die selbstbewusste, lebensfrohe Dshamilja den scheuen, träumerischen Danijar kennen und lieben.
Der junge Seït erzählt mit den Augen eines Kindes, das zu verstehen beginnt, welch eine Macht die Liebe sein kann. Denn Dshamilja sagt sich von ihrem Heimatort und den alten Traditionen los und zieht in die Ferne.
»Es gibt Bücher, die begleiten einen durch das ganze Leben. Bei jeder erneuten Lektüre wird man etwas erfahren, was vor Jahren noch unentdeckt geblieben ist. So ergeht es einem mit der Geschichte von Dshamilja.«
Pflege-Zeitschrift Stuttgart
Gefährtin derer, die an die Liebe glauben
Vorbemerkung
Zu seinen frühen Werken verhält sich ein Autor mit einer gewissen Herablassung oder gar mit verächtlicher Selbstironie. Ist doch klar, jung war er und unreif. Aber gegenüber der Novelle Dshamilja kann ich nicht so streng sein, obgleich seit dem Tag ihres Erscheinens mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen ist. Allzu viel bedeutete und bedeutet mir Dshamilja, diese unschuldige Erzählung über die reine Liebe aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und ich weiß nicht, ob es mir je gelingt, nochmals ein solches Werk zu schreiben, über die unverzagte, grenzenlose und alles verschlingende Liebe, die Menschen verwandelt und sie zeitweise zu schönen Idealen emporhebt, zu Tragödien und Dramen. Wer weiß, vielleicht fordert die Liebe als literarisches Thema vom Autor Jugend und Reaktionsvermögen. Vielleicht aber auch nicht, schließlich ist jeder Schriftsteller ein auf seine ganz eigene Weise eingestellter »Mechanismus«.
Ja, es ist wirklich einige Zeit vergangen. Dshamilja und ihr Geliebter Danijar wären längst alte Leute mit zahlreichen Enkelkindern. Außerdem hat sich in dieser Welt so viel verändert und verschlungen; sogar an den Orten, woher meine Helden stammen, in der mittelasiatischen Abgeschiedenheit, führen heute die Menschen ein völlig anderes Leben. Neue Sitten und Gebräuche, neue Kommunikationsmittel, überall Fernsehen und was sonst noch die Macht der allgegenwärtigen Massenkultur ausmacht – all das muss ja die heutigen Menschen beeinflussen, ihr Verhalten und ihre Einstellung zu geistigen, moralischen Werten und Traditionen, also auch darauf, wie sich Gefühle und Zuwendungen zeigen, die Dimensionen von Pflicht, Liebe und Freundschaft.
All das sage ich, weil der »moralische Verschleiß« der Literatur eine ebenso reale Erscheinung des Lebens ist wie alles, was in Raum und Zeit existiert. Aber es scheint hier Ausnahmen zu geben. Ich erlaube mir den Gedanken: Solch eine Ausnahme ist auch Dshamilja.
Als Autor nehme ich mit Freude zur Kenntnis, dass Dshamilja nicht verblüht, dafür sprechen die zahlreichen und beständigen Neuauflagen an verschiedenen Orten, in unterschiedlichen Ländern, dafür spricht die fortschreitende geografische Ausbreitung – von China und Indien bis zu den mexikanischen Ufern Amerikas.
Doch darum geht es eigentlich nicht, das Schicksal von Dshamilja bezeugt in jedem Fall, woran ich glauben möchte: Das Gefühl der Liebe gehört zum Höchsten und Ewigen, das der Menschengeist an sich entdeckt, sie verfügt über die erstaunliche Eigenschaft, unter allen Bedingungen und Prüfungen zu überleben, sie bewahrt sich beständig ihre Anziehungskraft in der Sphäre der Kunst.
Und das ist für die zeitgenössische Literatur und die ihr Dienenden gar nicht wenig.
Dshamilja lebt, das bedeutet, sie lebt im Leserinteresse … Worauf beruht das Geheimnis ihrer Popularität? Das ist doch arglose, romantische Liebe und nicht mehr, mir fällt schwer, es zu beschreiben. Aber viele Leser stehen zu ihr wahrhaft rührend und herzlich. Zum Beispiel in Zürich, im Herbst 1987; ich befand mich im Rundfunkgebäude und bereitete mich für die Sendung Karussell vor, das Telefon klingelte, und ein Mitarbeiter des Fernsehens teilte mir mit, eine Frau habe angerufen und gebeten, mir zu sagen, ihr Mann und sie hätten ihrem neugeborenen Sohn den Namen Danijar gegeben, der Dshamilja so sehr lieb hatte. Natürlich freute mich das sehr …
Aber es gibt für mich noch ernsthaftere Motive für die besondere Bedeutung von Dshamilja. Mit dieser Novelle verbinde ich drei mir liebe und teure Namen; Dshamilja hat, wenn man es so ausdrücken kann, drei Taufpaten. Veröffentlicht hat sie Alexander Trifonowitsch Twardowskij 1958 in der Zeitschrift Novyj Mir, er war damals Chefredakteur und hat mir damit den Weg in die große Literatur gebahnt. Die Novelle hatte ursprünglich Melodie geheißen, doch Twardowskij hatte mir vorgeschlagen, den Titel zu ändern, und mit seiner glücklichen Hand wurde er zu Dshamilja. Und seit der Zeit bin ich ständig Autor der Novyj Mir, worauf ich sehr stolz bin.
Der andere, mir nicht weniger teure Name ist Muchtar Auesow, der große kasachische Schriftsteller, der in jenen Tagen den jungen Autor mit guten Worten in der Presse begleitete.
Und schließlich Louis Aragon. Dass Aragon persönlich schon 1959 Dshamilja in die französische Sprache übersetzte und die Übersetzung mit einem bewegten Vorwort versah, spielte zweifellos die entscheidende Rolle dabei, dass Dshamilja Zugang zur internationalen Leserschaft fand.
Auch Bücher können wohl ein Glückslos ziehen …
Auf Dshamilja trifft das ganz und gar zu, sie wurde zur Gefährtin derer, die an die Liebe glauben.
Wie viel Wasser ist unterdessen den Berg hinabgeflossen, und nunmehr schreibe ich, als Autor, erstmals ein kurzes Vorwort zu einem meiner frühesten Werke – für die jüngste deutsche Neuauflage von Dshamilja, dieses Mal im Zürcher Unionsverlag, zu dem meine Arbeitsbeziehungen eine immer festere Gestalt annehmen.
Frunse, im Dezember 1987
Tschingis Aitmatow
Dshamilja
Da stehe ich nun wieder vor dem kleinen Bild mit dem schlichten Rahmen. Morgen früh muss ich in den Ail fahren – ich betrachte es lange und unverwandt, als könnte es mir ein gutes Geleit geben.
Ich habe dieses Bild noch nie auf einer Ausstellung gezeigt, ja, ich verberge es, wenn Verwandte aus dem Ail zu mir kommen. Es stellt nichts Anstößiges dar, aber es ist alles andere als ein Kunstwerk. Schlicht und einfach ist es wie die Landschaft, die es wiedergibt.
Den Hintergrund bildet der sich neigende fahle Herbsthimmel. Der Wind treibt rasch dahineilende scheckige Wölkchen über eine ferne Gebirgskette. Davor wogt die mit Wermut bewachsene rotbraune Steppe. Eine Straße, noch schwarz und feucht vom letzten Regen, durchzieht sie. Zu ihren Seiten liegt in dichten Büscheln verdorrtes umgeknicktes Steppengras. Der ausgewaschenen Räderspur folgen, je weiter, desto verschwommener, die Fußstapfen zweier Wanderer. Die beiden Fußgänger selbst scheinen nur noch einen Schritt machen zu müssen, um hinter dem Rahmen zu verschwinden. Der eine von ihnen … Doch ich greife vor.
Es war in meiner frühen Jugend. Der Krieg tobte das dritte Jahr. An den fernen Fronten irgendwo bei Kursk und Orjol kämpften unsere Väter und Brüder, und wir Halbwüchsigen, etwa fünfzehn Jahre alt, arbeiteten im Kolchos. Die schwere Arbeit der Männer lastete auf unseren noch nicht erstarkten Schultern. Das spürten wir besonders in der Erntezeit. Wochenlang kamen wir nicht nach Hause; Tag und Nacht waren wir auf dem Feld, dem Dreschplatz oder unterwegs zur Eisenbahnstation, wo das Korn verladen wurde.
An einem dieser heißen Tage, die Sicheln glühten vom Ernten, kehrte ich mit dem leeren Wagen vom Bahnhof zurück und beschloss, zu Hause einzukehren.
Nahe der Furt, dort, wo die Straße endete, lagen auf einer Anhöhe zwei Höfe, umgeben von einer Mauer aus Saman. Um das Anwesen herum ragten Pappeln empor. Das waren unsere Häuser. Seit langer Zeit lebten hier unsere beiden Familien in enger Nachbarschaft. Ich selbst gehörte in das Große Haus. Meine Brüder, beide älter als ich, beide unverheiratet, standen an der Front, und wir hatten schon lange keine Nachricht von ihnen.
Mein Vater, ein alter Zimmermann, pflegte im Morgengrauen den Namas zu verrichten und dann zum gemeinsamen Werkhof in die Tischlerei zu gehen. Erst spät am Abend kam er zurück.
Daheim blieben die Mutter und mein Schwesterchen.
Im Nachbarhaus oder dem Kleinen Haus, wie man es im Ail nannte, wohnten unsere nächsten Verwandten. Leibliche Brüder waren zwar nur unsere Urgroßväter, wenn nicht gar Ururgroßväter gewesen, doch ich nenne sie unsere nächsten Verwandten, weil wir als Familie zusammenlebten. Dergleichen war schon zu der Zeit üblich gewesen, als unsere Großväter noch gemeinsam die Nomadenlager aufschlugen und das Vieh hüteten.
Diese Tradition hatten wir gewahrt. Als die Kollektivierung in unseren Ail kam, ließen sich unsere Väter nebeneinander nieder.
Aber nicht nur wir gehörten zusammen; alle Siedler an der Araler Straße, die durch den Ail bis ins Zwischenstromland führte, waren unsere Stammesgenossen, sie alle entstammten einem Geschlecht.
Bald nach der Kollektivierung starb der Familienvater im Kleinen Haus. Seine Frau blieb mit zwei kleinen Söhnen zurück. Nach dem alten Adat, an das man sich damals im Ail noch hielt, durfte man die Witwe mit ihren Söhnen nicht im Stich lassen, und so verheirateten unsere Stammesgenossen sie mit meinem Vater. Das forderten die Geister der Ahnen, denn er war ja der nächste Verwandte des Verstorbenen.
So kamen wir zu einer zweiten Familie. Das Kleine Haus galt zwar als selbstständige Wirtschaft, es hatte einen eigenen Hof und eigenes Vieh, tatsächlich aber lebten wir zusammen. Auch das Kleine Haus schickte zwei Söhne in die Armee. Der älteste, Sadyk, ging bald nach seiner Hochzeit fort. Von beiden erhielten wir Briefe, wenn auch in großen Abständen.
Nun wohnten dort noch die Mutter, die ich Kitschi-apa, jüngere Mutter, nannte, und ihre Schwiegertochter, Sadyks Frau. Beide arbeiteten von früh bis spät im Kolchos. Die Kitschi-apa, eine gutmütige, nachgiebige Frau, die niemand etwas zuleide tat, stand den Jungen in der Arbeit nicht nach, weder beim Ausheben der Aryks, unserer Bewässerungsgräben, noch bei anderen Aufgaben. Mit einem Wort, sie konnte tüchtig zupacken. Das Schicksal schenkte ihr gleichsam als Belohnung für ihren Fleiß eine arbeitsame Schwiegertochter. Dshamilja arbeitete genauso unermüdlich und geschickt wie sie, doch war sie von anderer Art.
Ich liebte Dshamilja heiß, und auch sie hatte mich lieb. Wir hielten gute Freundschaft, doch wir wagten nicht, uns beim Namen zu nennen. Wären wir aus verschiedenen Familien gewesen, dann hätte ich sie natürlich Dshamilja genannt; so aber sagte ich Dshene zu ihr, Schwägerin, und sie nannte mich Kitschine-bala, Kleiner, obwohl ich durchaus nicht klein und der Altersunterschied zwischen uns beiden gering war. Aber so forderte es der Brauch in den Ails: Die Schwiegertöchter nannten die jüngeren Brüder des Mannes Kitschine-bala oder Kajyn.
Die Hauswirtschaft beider Höfe besorgte meine leibliche Mutter. Meine kleine Schwester, ein putziges Mädchen mit Fädchen in den Rattenschwanzzöpfen, half ihr dabei. Nie werde ich vergessen, mit welchem Eifer die Kleine in dieser schweren Zeit ihren Pflichten nachkam. Mal hütete sie hinter den Gemüsegärten die Lämmchen und Kälber der beiden Höfe, mal sammelte sie Kamelmist und Reisig, damit immer etwas zum Heizen im Haus war. Sie brachte Freude in die Einsamkeit der Mutter, mein liebes stupsnasiges Schwesterchen, und lenkte sie mit ihren Zärtlichkeiten von den traurigen Gedanken an die vermissten Söhne ab.
Das gute Einvernehmen und den Wohlstand im Haus verdankte die große Familie meiner Mutter. Sie war die unumschränkte Herrin beider Höfe, die Hüterin des häuslichen Herdes. Als blutjunges Mädchen war sie in die Sippe unserer nomadisierenden Großväter aufgenommen worden; sie hielt ihr Andenken heilig und lenkte die Familie nach Recht und Sitte. Im Ail galt sie als die achtbarste, lauterste und klügste Hausfrau. Sie gebot über alle im Haus. Offen gestanden, erkannte man im Ail den Vater nicht als Familienoberhaupt an. Oft konnte ich bei der einen oder anderen Gelegenheit jemand sagen hören: »Weißt du, geh lieber nicht zum Ustak«, so nennt man bei uns die Handwerker, »der kennt doch nur sein Beil. Bei denen hat die ältere Mutter zu bestimmen, sprich gleich mit ihr, da erreichst du mehr.«
Es sei noch erwähnt, dass auch ich mich trotz meiner Jugend häufig in häusliche Angelegenheiten einmischte. Das konnte ich mir nur erlauben, weil die älteren Brüder im Krieg waren. Man nannte mich deshalb, zuweilen scherzhaft, zuweilen aber auch im Ernst, den Dshigiten zweier Familien, den Beschützer und Ernährer. Ich war stolz darauf und fühlte mich für alles verantwortlich. Die Mutter unterstützte meine Selbstständigkeit. Ich sollte tüchtig und aufgeweckt werden, nicht so wie mein Vater, der tagaus, tagein schweigsam hobelte und sägte.
Ich hielt also mit meinem Wagen vor dem Haus im Schatten einer Weide an, lockerte die Zugriemen und ging zum Tor. Da erblickte ich auf dem Hof unseren Brigadier Orosmat, wie immer zu Pferd, die Krücke am Sattel. Neben ihm stand meine Mutter. Die beiden stritten über etwas. Als ich näher kam, hörte ich Mutters Stimme: »Kommt gar nicht infrage! Hast du denn keine Gottesfurcht? Wo hat man je gesehen, dass eine Frau Säcke fährt! Nein, mein Lieber, lass meine Schwiegertochter aus dem Spiel. Sie soll arbeiten wie bisher. Ich weiß ohnehin nicht, wo mir der Kopf steht, versuch du mal, auf zwei Höfen Ordnung zu halten! Ein Glück noch, dass mein Töchterchen herangewachsen ist. Seit einer Woche kann ich nicht gerade gehen, das Kreuz tut mir weh, als hätte ich eine Filzmatte gewalkt, und dabei vertrocknet der Mais draußen, er braucht Wasser«, schimpfte sie erregt und steckte fortwährend den Zipfel ihres Kopftuchs in den Kragen ihres Kleides. Das tat sie immer, wenn sie böse war.
»Was sind Sie bloß für ein Mensch!«, sagte Orosmat verzweifelt, sich im Sattel vorbeugend. »Wenn ich statt dieses Stumpfes noch mein Bein hätte, würde ich Sie da bitten? Ich würde selber, wie früher, die Säcke auf den Wagen werfen und loskutschieren! Ich weiß, es ist keine Frauenarbeit, aber wo soll ich denn Männer hernehmen? Es ist nun mal beschlossen worden, die Frauen der Soldaten heranzuziehen. Sie klammern sich an Ihre Schwiegertochter, und wir dürfen uns nachher von oben schelten lassen! Die Soldaten brauchen Brot, und wir lassen den Plan platzen. Das geht doch nicht! So darf mans doch nicht machen!«
Ich trat näher, die Peitsche auf der Erde nachschleifend. Als mich der Brigadier sah, hellte sich sein Gesicht merklich auf – ihm war offensichtlich ein Gedanke gekommen.
»Warum haben Sie eigentlich Angst um Ihre Schwiegertochter? Ihr Kajyn hier«, er zeigte erfreut auf mich, »lässt bestimmt niemand an sie heran, da können Sie sicher sein. Er ist doch ein Mordskerl, unser Seït. Die Jungen sind heutzutage unsre Ernährer, unsre ganze Stütze.«
Die Mutter ließ den Brigadier nicht weiterreden.
»Ja, wie siehst du denn aus, du Rumtreiber?«, jammerte sie. »Und die Haare, ganz verfilzt sind sie schon! Unser Vater ist mir der Richtige, findet nicht mal Zeit, seinem Sohn den Kopf zu scheren.«
»Nun, dann soll sich das Söhnchen heute mal einen guten Tag bei den Alten machen und sich den Kopf scheren lassen!«, meinte Orosmat, der Mutter schlau nach dem Munde redend. »Seït, bleib heute zu Haus, füttere die Pferde schön, und morgen früh geben wir Dshamilja einen Wagen, dann arbeitet ihr beide zusammen. Hör gut zu: Du bist für sie verantwortlich. Sie können ganz beruhigt sein, Baibitsche, Seït wird schon dafür sorgen, dass ihr niemand was zuleide tut. Und wenns sein muss, schicke ich auch noch Danijar mit. Sie kennen ihn doch, er ist kürzlich aus dem Krieg zurückgekehrt, ein stiller, ruhiger Kerl. Wenn sie zu dritt das Korn zum Bahnhof fahren, wer wird es dann noch wagen, Ihre Schwiegertochter anzurühren? Stimmts, Seït? Was meinst du? Wir wollen Dshamilja zum Fuhrmann machen, und die Mutter ist dagegen. Sprich du doch mal mit ihr.«
Mir schmeichelte das Lob des Brigadiers und seine Art, sich mit mir wie mit einem Erwachsenen zu beraten. Außerdem stellte ich mir sofort vor, wie schön es wäre, zusammen mit Dshamilja zur Bahnstation zu fahren. Daher sagte ich mit ernster Miene zur Mutter: »Ihr wird schon nichts passieren. Denkst du, die Wölfe fressen sie, oder was?« Ich spuckte wie ein alter Fuhrmann überlegen durch die Zähne und ging davon, die Peitsche hinter mir herschleifend und rhythmisch die Schultern wiegend.
»So ein Bengel!«, sagte die Mutter verwundert, aber wohl auch ein wenig stolz, doch im gleichen Augenblick schrie sie zornig: »Ich zeig dir noch Wölfe! Was weißt du denn schon, du Neunmalkluger?«
»Aber wer solls denn wissen, wenn nicht er, er ist doch der Dshigit zweier Familien! Ihr könnt stolz auf ihn sein!«, meinte Orosmat und sah die Mutter mit einem vorsichtigen Blick an, als fürchtete er, sie könnte sich wieder sträuben. Er wusste nichts mehr zu sagen und lächelte verlegen. Doch die Mutter widersprach ihm nicht. Sie ließ auf einmal den Kopf hängen und sagte mit einem tiefen Seufzer: »Ach, was heißt Dshigit, ein Kind ist er noch, und doch muss er Tag und Nacht arbeiten. Unsere guten Dshigiten sind Gott weiß wo! Und unsere Höfe vereinsamt wie ein verlassenes Nomadenlager.«
Ich war schon weit weg und hörte nicht mehr, was die Mutter noch sagte. Im Gehen schlug ich mit der Peitsche so heftig an die Hausecke, dass Staub aufwirbelte, und ohne das Lächeln meines Schwesterchens zu erwidern, das auf dem Hof mit klatschendem Geräusch Saman formte, trat ich festen Schrittes unter das Vordach. Dort hockte ich mich nieder und wusch mir in aller Ruhe die Hände, indem ich mir Wasser aus einem Krug darübergoss. Dann ging ich ins Haus und trank eine Tasse saure Milch; die zweite nahm ich mit zum Fensterbrett und brockte mir Brot hinein.
Die Mutter und Orosmat standen noch immer auf dem Hof. Doch sie stritten nicht mehr, sondern redeten ruhig und leise miteinander. Wahrscheinlich sprachen sie von meinen Brüdern. Die Mutter fuhr sich von Zeit zu Zeit mit dem Ärmel über die geschwollenen Augen, nickte nachdenklich als Antwort auf die Worte Orosmats, der sie offenbar tröstete, und schaute mit verschleiertem Blick in die Ferne, über die Bäume hinweg, als hoffe sie, ihre Söhne dort zu entdecken.
In ihrem Kummer schien die Mutter die Einwände gegen den Vorschlag des Brigadiers vergessen zu haben. Und dieser, zufrieden, dass er sein Ziel erreicht hatte, schlug das Pferd mit der Riemenpeitsche und ritt in schnellem Passgang vom Hof. Damals ahnten weder die Mutter noch ich, wie das alles enden sollte.
Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass Dshamilja mit dem zweispännigen Wagen fertig werden würde. Sie konnte mit Pferden umgehen, sie war ja die Tochter eines Pferdehirten aus Bakair, einem Ail in den Bergen. Auch unser Sadyk war Pferdehirt. Einmal im Frühling beim Wettrennen soll Dshamilja schneller gewesen sein als er. Wer weiß, ob es wahr ist, doch man sagte, dass der in seiner Ehre gekränkte Sadyk sie daraufhin entführte. Andere dagegen beteuerten, sie hätten aus Liebe geheiratet. Wie es auch immer gewesen sein mag, sie lebten nur ganze vier Monate zusammen. Dann begann der Krieg, und Sadyk wurde zur Armee einberufen.
Ich weiß nicht, wie es zu erklären war, vielleicht weil Dshamilja seit der Kindheit mit dem Vater, für den sie Tochter und Sohn zugleich war, Pferde jagte. In ihrer Art lag etwas Männliches, Schroffes, ja zuweilen sogar Grobes. Auch bei der Arbeit packte Dshamilja zu wie ein Mann. Mit den Nachbarinnen vertrug sie sich gut, doch wenn man sie ungerecht behandelte, dann konnte sie besser schimpfen als jede andere; es kam sogar vor, dass sie jemand an den Haaren zog.
Schon mehrmals hatten sich Nachbarn beklagt: »Was habt ihr nur für eine Schwiegertochter? Sie ist doch gerade erst in euer Haus gekommen, aber mit dem Mund ist sie schon sehr vorneweg! Die hat weder Achtung noch Schamgefühl!«
»Ist doch gut, sie macht es schon recht!«, antwortete dann die Mutter. »Sie sagt den Leuten gern die Wahrheit ins Gesicht. Das ist besser, als wenns einer heimlich tut und hinter dem Rücken die Zunge wetzt. Eure Schwiegertöchter spielen die Sanftmütigen, Stillen, dabei sind sie wie faule Eier: von außen rein und glatt, doch innen – da muss man sich die Nase zuhalten.«
Der Vater und die jüngere Mutter behandelten Dshamilja nie so streng und kleinlich, wie es Schwiegereltern gewöhnlich tun. Sie liebten sie und wünschten nur, dass sie Gott und ihrem Mann treu bliebe.
Ich konnte die beiden verstehen. Unsere Familien hatten vier Söhne in die Armee gegeben; mein Vater und die jüngere Mutter fanden Trost in Dshamilja, der einzigen Schwiegertochter auf unseren Höfen, deshalb war sie ihnen lieb und teuer. Meine leibliche Mutter hingegen verstand ich nicht. Sie war nicht der Mensch, der jemand so leicht ins Herz schloss. Sie hatte ein herrisches, raues Wesen. Nie wich sie von ihren Lebensregeln ab. Jedes Jahr stellte sie zu Beginn des Frühlings im Hof unsere Nomadenjurte auf, die mein Vater schon in seiner Jugend gebaut hatte, und räucherte sie mit Wacholder aus. Uns erzog sie zu strenger Arbeitsamkeit und Achtung vor den Alten. Von allen Familienmitgliedern verlangte sie unbedingte Unterordnung.
Dshamilja jedoch zeigte sich vom ersten Tag an, da sie zu uns gekommen war, nicht so, wie es der Schwiegertochter geziemte. Sie hörte wohl auf die Alten und verehrte sie, doch niemals verneigte sie sich vor ihnen. Dafür spöttelte sie aber auch nicht insgeheim, zur Seite abgewandt, über sie, wie die anderen jungen Frauen. Sie sagte stets geradeheraus, was sie dachte, und scheute sich nicht, ihre Meinung zu äußern. Die Mutter stimmte ihr oft zu und unterstützte sie, doch das entscheidende Wort behielt sie sich vor. Mir scheint, sie sah in Dshamilja, deren aufrechte Denkart und deren Sinn für Gerechtigkeit ihr wesensverwandt waren, einen ihr ebenbürtigen Menschen und träumte im Stillen davon, sie eines Tages auf ihren Platz zu stellen und aus ihr eine ebenso selbstbewusste Hausfrau, eine Baibitsche, eine Hüterin des häuslichen Herdes, zu machen, wie sie selbst es war.
»Danke Allah, meine Tochter«, belehrte sie Dshamilja, »du bist in ein ordentliches, gesegnetes Haus gekommen. Das ist dein Glück. Das Glück einer Frau besteht darin, dass sie Kinder gebiert und dass im Hause kein Mangel herrscht. Du bekommst, Gott sei Dank, alles, was wir, die Alten, erworben haben; ins Grab nehmen wir es ja nicht mit. Das Glück aber, das bleibt nur bei dem, der seine Ehre und sein Gewissen bewahrt. Denk daran, gib auf dich acht!«
Etwas störte jedoch die Mutter an Dshamilja trotz allem: Sie freute sich zu offenherzig, ganz wie ein Kind. Es geschah, dass sie plötzlich, scheinbar völlig ohne Grund, laut und herzhaft lachte. Wenn sie von der Arbeit kam, dann trat sie nicht ruhig und gesittet in den Hof, sondern sie sprang über den Aryk und rannte herein. Mir nichts, dir nichts umarmte und küsste sie bald die eine Schwiegermutter, bald die andere.
Dshamilja sang auch gern; stets trällerte sie vor sich hin, selbst in Gegenwart der Alten. Das alles vertrug sich natürlich nicht mit den üblichen Ansichten über das Verhalten einer Schwiegertochter in der Familie, doch beide Schwiegermütter beruhigten sich damit, dass sie mit der Zeit schon gesetzter werden würde, in der Jugend waren ja schließlich alle so. Für mich aber gab es niemand auf der ganzen Welt, der mir besser gefallen hätte als Dshamilja. Wir scherzten, jagten einander auf dem Hof und konnten ohne jeden Grund schallend lachen.
Hübsch war Dshamilja, schlank und wohlgebaut. Ihr straffes, dichtes Haar trug sie in zwei festen, schweren Zöpfen, und ihr weißes Kopftuch band sie so geschickt um, dass es ein wenig schräg über ihre Stirn lief, was sie sehr gut kleidete und die gebräunte Haut ihres glatten Gesichts hervorhob. Wenn sie lachte, glühten ihre blauschwarzen mandelförmigen Augen in jugendlichem Feuer; wenn sie aber plötzlich ein gepfeffertes Spottlied anstimmte, dann trat in ihre schönen Augen ein keineswegs mädchenhafter Glanz.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: