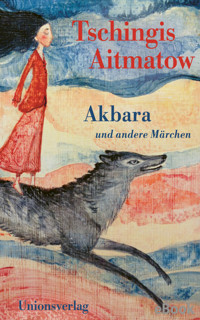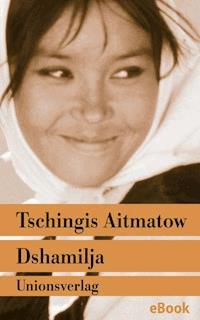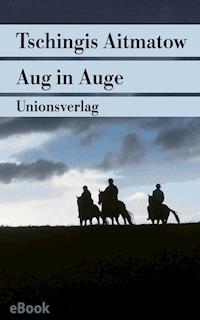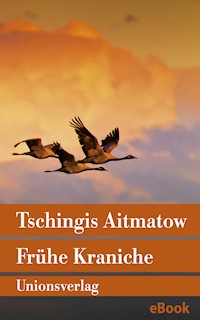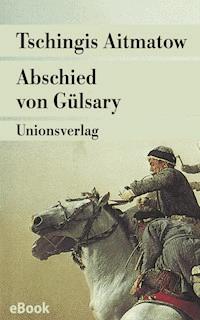9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus allen Werken von Tschingis Aitmatow spricht eine einzigartige Verbundenheit, ja, innere Verwandtschaft zwischen Tieren und Menschen, die durch eine gemeinsame Natur miteinander verknüpft sind. Inspiriert oft durch alte Volkssagen, erzählt er von Wölfen und Pferden, vom alternden Schneeleoparden, vom Flug der Ente Luwr, die die Welt erschaffen hat, der Gehörnten Hirschmutter, dem Ruf des Vogels Denenbai und vielen anderen. Bevor er Schriftsteller wurde, arbeitete Aitmatow als ausgebildeter Tiermediziner. Mit seinen Tiergeschichten will er eine Grenze überwinden: »In der Literatur wurden die Tiere bisher aus der menschlichen Sichtweise dargestellt, aber ich möchte die Welt mit ihren Augen betrachten.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Eine einzigartige Verbundenheit, ja innere Verwandtschaft zwischen Tieren und Menschen spricht aus Aitmatows Werken. Inspiriert durch alte Volkssagen, erzählt er von Wölfen und Pferden, vom alternden Schneeleoparden, vom Flug der Ente Luwr, die die Welt erschaffen hat, der Gehörnten Hirschmutter, dem Ruf des Vogels Denenbai und vielen anderen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Friedrich Hitzer (1935–2007) war freischaffender Autor, Übersetzer und Redakteur und engagierte sich als Kulturvermittler zwischen Europa, Russland und Mittelasien. 2006 wurde er mit der Puschkin-Medaille für sein Lebenswerk als Brückenbauer geehrt.
Zur Webseite von Friedrich Hitzer.
Charlotte Kossuth (*1925) war Russisch-Lektorin in Halle/Saale und fast dreißig Jahre lang Verlagslektorin für russische und sowjetische Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Charlotte Kossuth.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Tiergeschichten
Mit einem Nachwort von Irmtraud Gutschke zu Leben und Werk von Tschingis Aitmatow
Aus dem Russischen von Friedrich Hitzer, Leo Hornung und Charlotte Kossuth
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Natalia Lukiianova (Alamy Stock Photo)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31087-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 22.09.2022, 18:51h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TIERGESCHICHTEN
Gülsary der PassgängerDer Kamelhengst KaranarDie Träume der WölfinDschaa-Bars, der SchneeleopardDie Klage des ZugvogelsDie Ente LuwrDer Jäger KodshodshaschDer Selbstmord der WaleMit ihnen allen unter einem Himmel — Nachwort von Irmtraud GutschkeWorterklärungenTextnachweisMehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Friedrich Hitzer
Über Charlotte Kossuth
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Natur
Zum Thema Tier
Gülsary der Passgänger
Es war eine schöne Zeit für Tanabai und für den Passgänger. Mit dem Ruhm eines Rennpferds ist es wie mit dem Ruhm eines Fußballers. Der Junge, der gestern noch den Ball auf den Hinterhöfen vor sich hergetrieben hat, wird plötzlich der Liebling aller, Gesprächsthema für Kenner und Gegenstand der Begeisterung für die Masse. Solange er Tore schießt, wächst sein Ruhm ständig. Dann verschwindet er allmählich vom Spielfeld und wird vergessen. Und als Erste vergessen ihn diejenigen, deren Begeisterung am größten war. So ist es auch mit dem Ruhmeszug eines Rennpferds. Es ist berühmt, solange es ungeschlagen ist. Der Unterschied liegt nur darin, dass niemand das Pferd beneidet. Pferde können nicht neidisch sein, und die Menschen haben Gott sei Dank noch nicht gelernt, einem Pferd etwas zu neiden. Allerdings geht der Neid oft unbegreifliche Wege, und es haben schon Menschen Nägel in Pferdehufe getrieben, um ihren Widersachern zu schaden. O dieser schwarze Neid!
Die Prophezeiung des alten Torgoi erfüllte sich. In jenem Frühling stieg der Stern des Passgängers. Alt und Jung kannte ihn: Gülsary! Den Passgänger Tanabais. Die Zierde des Ails. Die dreckigen Steppkes, die noch kein R sprechen konnten, galoppierten durch die staubigen Straßen und schrien um die Wette: »Ich bin Gülsaly. – Nein, ich. Mama, sag, dass ich Gülsaly bin. Tschu, volwälts, a-iij, ich bin Gülsaly!«
Was Ruhm bedeutet und welche große Kraft ihm innewohnt, erkannte der Passgänger bei seinem ersten großen Rennen.
Es war am Ersten Mai.
Nach der Kundgebung auf der großen Wiese am Fluss begannen die Spiele. Von allen Ecken und Enden waren die Menschen zusammengeströmt, aus dem benachbarten Sowchos, aus den Bergen und selbst aus Kasachstan. Die Kasachen stellten ihre Pferde zur Schau.
Man sprach davon, dass es seit dem Krieg noch kein solches Fest gegeben hatte.
Schon am Morgen, als Tanabai ihn sattelte und mit besonderer Sorgfalt die Bauchgurte und die Befestigung der Steigbügel prüfte, spürte der Passgänger am Glanz der Augen und am Zittern der Hände seines Herrn, dass etwas Außergewöhnliches bevorstand. Der Herr schien sehr aufgeregt.
»Mach mir keine Schande, Gülsary«, flüsterte er, während er ihm die Mähne kämmte. »Wir können uns das nicht leisten, verstehst du! Du kannst dich nicht blamieren!«
Ein Ereignis lag in der von Stimmengewirr und geschäftigem Lärm erfüllten Luft. Neben ihnen sattelten die anderen Hirten ihre Pferde. Die Jungs waren ebenfalls hoch zu Ross, schreiend jagten sie umher. Dann saßen die Hirten auf, und alle ritten zum Fluss.
Gülsary stutzte, als er die Menschenmenge und die vielen Pferde auf der Wiese sah. Der Lärm und das Getöse drangen über den Fluss und die Wiesen bis zu den Hügeln. Die grell leuchtenden Tücher und Gewänder, die weißen Turbane auf den Köpfen der Frauen und die roten Fahnen flimmerten ihm vor den Augen. Die Pferde prunkten im besten Geschirr. Die Steigbügel klirrten, die Trensen klimperten, hell klangen die Silberanhängsel der Brustriemen.
Die Pferde mit ihren Reitern drängten einander, so eng standen sie. Sie stampften ungeduldig, zerrten am Zügel und scharrten mit den Hufen. Die Alten eröffneten die Spiele, sie bildeten einen Kreis und vollführten Reiterkunststücke.
Gülsarys Spannung wuchs, er bebte vor Kraft. Wie Feuer brannte es in ihm. Er wollte so rasch wie möglich in den Kreis stürzen und losjagen.
Als die Ordner das Zeichen gaben und Tanabai die Zügel lockerließ, trug ihn der Passgänger tänzelnd in die Mitte des Kreises. Durch die Reihen ging ein Raunen: »Gülsary! Gülsary!«
Alle, die am großen Rennen teilnehmen wollten, ritten vor. Es waren an die fünfzig Reiter.
»Bittet das Volk um den Segen!«, verkündete der Leiter der Spiele feierlich.
Die Reiter mit den glatt rasierten Köpfen und den straffen Stirnbinden ritten die Menge ab, hoben die geöffneten Hände, und wie ein Seufzer wallte das »Aameen« von einem Ende zum anderen. Hunderte von geöffneten Händen hoben sich an die Stirnen und senkten sich wie Wasserstrahlen über die Gesichter.
Dann zogen die Reiter zum Start, der sich in neun Kilometer Entfernung auf offenem Feld befand.
Die Spiele im Kreis begannen: Kämpfe zu Fuß und zu Pferde, Versuche, den anderen aus dem Sattel zu heben, Aufnehmen von Münzen in vollem Galopp und Ähnliches wurde geboten. Aber das war nur die Einleitung, der Hauptkampf begann dort draußen am Start, zu dem die Reiter aufgebrochen waren.
Gülsary erhitzte sich auf dem Weg. Er begriff nicht, warum sein Herr ihn zurückhielt. Neben ihm tummelten sich die anderen. Und da es so viele waren und alle vorandrängten, zitterte Gülsary vor Ungeduld.
Endlich standen alle in einer Reihe am Start, Kopf an Kopf. Der Starter ritt die Front ab und hob das weiße Tuch. Alles erstarrte vor Erregung und Anspannung. Das weiße Tuch senkte sich. Die Pferde rasten los, und mit ihnen stürmte Gülsary vorwärts. Die Erde dröhnte unter den Hufen, Staub wirbelte auf. Unter den antreibenden Zurufen der Reiter streckten sich die Pferde in wildem Galopp. Nur Gülsary ging im Passgang, darin lag seine Schwäche und seine Stärke.
Zunächst blieben alle beisammen, aber schon nach einigen Minuten zog sich das Feld auseinander, Gülsary sah, wie schnelle Pferde ihn überholten. Ihre Hufe schleuderten ihm heißen Schotter und trockene Lehmklumpen ins Gesicht. Überall galoppierten Pferde, schrien Reiter, pfiffen die Kantschus, wurde Staub hochgewirbelt. Zurück blieb eine Wolke über der Steppe.
Es roch nach Schweiß, stiebenden Funken und zerstampftem jungem Wermut.
So blieb es fast bis zum halben Geläuf. Vor dem Passgänger lag immer noch ein Dutzend Pferde. Kein Pferd lief auf gleicher Höhe mit ihm. Der Lärm der Zurückgebliebenen verhallte. Tanabai gab Gülsary die Zügel nicht frei, und das machte ihn wütend. Der Wind und die Erbitterung trübten ihm die Augen. Rasch glitt das Geläuf unter seinen Hufen dahin. Die Sonne rollte ihm als feuriger Ball entgegen. Sein Körper war in heißen Schweiß gebadet, und je mehr er schwitzte, desto leichter wurde ihm.
Die galoppierenden Pferde wurden müde und langsamer. Der Passgänger hatte die höchste Entfaltung seiner Kräfte noch nicht erreicht. »Tschu, Gülsary, tschu!«, hörte er die Stimme des Herrn, und die Sonne rollte ihm noch schneller entgegen. Wutverzerrte Reitergesichter, in der Luft stehende Peitschen, geöffnete, röchelnde Pferdemäuler flogen vorüber und blieben zurück. Die Macht der Trense war gebrochen. Gülsary spürte weder Sattel noch Reiter mehr, in ihm brauste nur der flammende Odem des Rennens.
Bald liefen nur noch zwei Pferde vor ihm, ein Grauschimmel und ein Fuchs, starke Rennpferde, und Gülsary holte sie lange nicht ein. Erst an einer Steigung ließ er sie hinter sich. Er nahm die Anhöhe, schwebend und schwerelos, als trüge ihn eine Meereswelle. In seiner Brust brannte es wie Feuer, und die Sonne strahlte noch heller, als er das Geläuf hinunterschoss. Doch bald hörte er hinter sich den Hufschlag aufkommender Pferde. Der Grauschimmel und der Fuchs forderten ihn. Sie schlossen von beiden Seiten dicht auf und gaben keinen Schritt mehr preis.
So jagten sie zu dritt Kopf an Kopf dahin. Gülsary schien es, als liefen sie nicht mehr, sondern als seien sie schweigend erstarrt. Er sah den Ausdruck der Augen, die angespannt vorgestreckten Mäuler, die Trensen, Zäume, Zügel. Der Grauschimmel blickte wild und trotzig, der Fuchs war unruhig, sein Blick unsicher. Er ließ als Erster nach. Sein umherirrendes Auge, das Maul, die geblähten Nüstern blieben zurück, und dann war er nicht mehr zu sehen. Der Grauschimmel quälte sich lange. Sein Auge funkelte in hilfloser Wut.
Dann blieb auch er zurück. Als die Gegner ausgeschaltet waren, wurde es leichter. Vorn schimmerte silbern der Fluss, grün leuchtete die Wiese, und schon drang das Tosen menschlicher Stimmen herüber. Die leidenschaftlichsten Zuschauer ritten johlend und schreiend am Geläuf entlang. Der Passgänger wurde plötzlich müde. Die große Entfernung machte sich bemerkbar, die Kräfte ließen nach.
Aber dort vorn rumorte und wogte die Menge. Das Schreien wurde immer stärker, und plötzlich hörte Gülsary klar und deutlich seinen Namen: »Gülsary! Gülsary!« Der Ruf verstärkte seine Kraft, riss ihn vorwärts.
Unter nicht enden wollendem Jubelgeschrei trabte Gülsary zwischen den Reihen hindurch, mäßigte den Gang und beschrieb auf der Wiese einen Kreis.
Aber das war noch nicht alles. Jetzt gehörten er und sein Herr nicht mehr nur sich allein. Während der Passgänger verschnaufte, lief die Menge zusammen, umschloss die beiden. Und wieder erklang der Ruf: »Gülsary, Gülsary, Gülsary!« Viele riefen auch: »Tanabai, Tanabai, Tanabai!«
Stolz und feurig trabte Gülsary in dem Kreis, mit hoch erhobenem Kopf und blitzenden Augen. Vom Hauch des Ruhmes trunken, beschrieb er tänzelnd ein Travers und fiel dann in eine Passage. Er spürte, dass er schön, stark und berühmt war.
Tanabai ritt mit den ausgebreiteten Armen des Siegers, und wieder wallte das »Aameen« wie ein Seufzer von einem Ende zum anderen, hoben sich Hunderte von geöffneten Händen an die Stirnen und senkten sich wie Wasserstrahlen über die Gesichter.
Unter den vielen Gesichtern war auch das jener Frau. Gülsary erkannte es sofort, obwohl es heute nicht von dem dunklen Schal, sondern von einem weißen Kopftuch umrahmt war. Sie stand in der vordersten Reihe, glücklich und voll Freude. Ihre Augen hingen an Ross und Reiter und schillerten wie die sonnenbeschienenen Steine im schnellen Wasser der Tränke. Gülsary zog es zu ihr hin, er wollte neben ihr stehen, und der Herr sollte mit ihr sprechen. Sie würde ihm zärtlich durch die Mähne streicheln und seinen Hals tätscheln, mit ihren wunderbaren Händen, geschmeidig und feinfühlig wie die Lippen jener kleinen braunen Stute mit der Blesse. Aber Tanabai lenkte ihn zur anderen Seite. Der Passgänger drängte und strebte zu ihr hin, und er verstand seinen Herrn nicht.
Auch der nächste Tag, der zweite Mai, gehörte Gülsary. Am Nachmittag fand am Fluss das Bockabjagen statt, eine Art Fußball zu Pferde. Als Ball dient ein ausgeweideter Ziegenbock ohne Kopf. Der Bock ist dazu geeignet, da er ein festes, langes Wollkleid besitzt und man ihn vom Pferd aus an den Beinen und am Balg packen kann.
Wieder hallte die Steppe von uralten Schreien wider, wieder dröhnte die Erde unter den Hufen. Die begeisterten Zuschauer jagten auf ihren Pferden johlend und schreiend um das Spielfeld. Wieder war Gülsary der Held des Tages. Von der Aureole des Ruhms umgeben, war er von Anfang an die stärkste Figur im Spiel. Tanabai schonte ihn jedoch für den Endkampf, für die Alaman-baiga, den Räuberritt: Wer schnell und geschickt war, der konnte den Bock in seinen Ail tragen. Auf den Räuberritt warteten alle, er war der Höhepunkt des Wettstreits, an ihm konnte jeder Reiter teilnehmen. Und jeder wollte sein Glück versuchen.
Inzwischen hatte sich die Maisonne tief über das ferne Kasachstan gesenkt, rund und dunkelgelb wie ein Eidotter. Man konnte in sie hineinsehen, ohne zu blinzeln.
Bis zum Abend jagten Kirgisen und Kasachen, in den Sätteln hängend, durch die Steppe, ergriffen im gestreckten Galopp den Bock, rissen ihn einander aus den Händen, drängten sich zu lärmenden Knäueln zusammen und stoben schreiend auseinander.
Erst als lange, bunte Schatten über der Steppe spielten, gaben die Alten den Räuberritt frei. Der Bock wurde in den Kreis geworfen, und es erscholl der Ruf: »Alaman!«
Von allen Seiten jagten die Reiter auf den Bock zu und versuchten, ihn an sich zu reißen. Das war im Gedränge nicht so leicht. Die Pferde drehten sich wie besessen, bleckten die Zähne und bissen um sich. Gülsary wurde es heiß bei der Rauferei, er strebte in den freien Raum, aber Tanabai gelang es nicht, den Bock zu fassen. Da erscholl der gellende Ruf: »Die Kasachen haben ihn!« Ein junger Kasache in zerfetzter Bluse brach auf einem wilden braunen Hengst aus dem Pferdegetümmel. Er hatte den Bock am Steigbügel.
»Haltet ihn! Den Braunen!«, brüllten die Reiter und jagten hinter ihm her. »Schnell, Tanabai, nur du kannst ihn einholen!«
Den baumelnden Bock am Bügel, galoppierte der Kasache geradewegs in die untergehende rote Sonne hinein.
Gülsary wusste nicht, warum Tanabai ihn zurückhielt. Der kasachische Dshigit sollte sich von Verfolgern lösen, und der Abstand zwischen ihm und seinen Landsleuten, die ihm zur Hilfe eilten, sollte größer werden. Denn gelang es ihnen, den Braunen schützend zu umgeben, würde niemand ihnen die Trophäe entreißen können. Nur im Kampf Reiter gegen Reiter konnte man auf einen Erfolg hoffen.
Nachdem er lange genug gewartet hatte, gab Tanabai die Zügel frei. Gülsary schmiegte sich an die der Sonne entgegeneilende Erde. Hufschlag und Stimmen blieben zurück, die Entfernung zum Braunen wurde immer kleiner. Der Hengst hatte den Bock zu schleppen. Tanabai lenkte den Passgänger an die rechte Seite des Braunen. Hier hing der Bock, der Stiefel des Reiters presste ihn an die Flanke. Als sie auf gleicher Höhe waren, beugte sich Tanabai aus dem Sattel und griff nach einem Bein des Bocks. Aber der Kasache warf den Bock geschickt auf die linke Seite. Die Pferde jagten immer noch auf die Sonne zu. Tanabai musste verhalten und in einem neuen Anlauf die linke Seite ansteuern. Es war schwer, den Passgänger bei voller Geschwindigkeit von dem Braunen zu lösen; aber es gelang. Da warf der Kasache den Bock wieder auf die rechte Seite.
»Prachtkerl!«, schrie Tanabai leidenschaftlich.
Und die Pferde jagten immer noch in die Sonne hinein.
Kein weiteres Risiko! Tanabai steuerte den Passgänger dicht an den Braunen heran und warf sich über den Sattelbug des Kasachen; der versuchte zu entkommen, aber Tanabai hielt ihn fest. Die Schnelligkeit und Wendigkeit des Passgängers erlaubten ihm, fast auf dem Hals des Hengstes zu liegen. So beugte er sich zum Bock hinunter und bekam ihn zu fassen. Als er den Bock fest im Griff hatte, brüllte er: »Halt dich fest, Bruder!«
»Gib nicht so an, Freund!«, antwortete der Kasache.
Die Pferde rannten wie besessen. Der Kampf tobte. Wie Adler krallten sich die Männer an der Beute fest, schrien aus Leibeskräften, ächzten und knurrten bedrohlich wie Raubtiere. Die Hände verkrampften sich ineinander, unter den Nägeln trat das Blut hervor. Wild jagten die durch den Zweikampf der Reiter aneinandergefesselten Pferde der purpurnen Sonne entgegen.
Gesegnet seien unsere Ahnen, die uns diese männlichen Spiele der Furchtlosen überliefert haben!
Der Bock war zwischen ihnen, sie hielten ihn mitten zwischen den Pferden. Die Entscheidung nahte. Schweigend, mit zusammengebissenen Zähnen, alle Kräfte anspannend, war jeder bemüht, den Bock unter den Steigbügel zu bekommen, um sich dann loszureißen und den Verfolger abzuschütteln. Der Kasache war stark. Er hatte mächtige sehnige Hände, und er war viel jünger als Tanabai. Aber viel wert ist Erfahrung. Überraschend nahm Tanabai den Fuß aus dem Steigbügel und drückte ihn dem Braunen in die Flanke. Während er den Bock zu sich heranzog, gab er dem Pferd einen Stoß, und die Finger des Gegners lösten sich.
»Halt dich fest!«, rief ihm der Besiegte noch zu.
Von dem starken Stoß wäre Tanabai fast aus dem Sattel geflogen. Aber er blieb oben. Ein Jubelschrei entrang sich seiner Brust. Mit einer harten Kehrtwendung machte er sich davon, die im ehrlichen Zweikampf erbeutete Trophäe unterm Steigbügel. Eine Schar brüllender Reiter kam ihm entgegen. »Gülsary! Gülsary hat gewonnen!«
Eine große Gruppe Kasachen ritt zur Gegenattacke.
Jetzt galt es, diesem Angriff zu entgehen und sich so rasch wie möglich unter den Schutz der eigenen Reiter zu begeben.
Tanabai wendete den Passgänger scharf und ließ die Angreifer stehen. Ich danke dir, Gülsary, du mein Guter, Kluger!, sagte er in Gedanken, während das Pferd der geringsten Bewegung seines Körpers folgte, sich von einer Seite zur anderen warf und so den Verfolgern auswich.
Fast an die Erde geschmiegt, brachte Gülsary die schwierigen Zickzacks hinter sich und gewann den freien Raum. Dort umringten ihn die Reiter aus Tanabais Ail, sie deckten ihn von allen Seiten, und als geschlossener Haufe nahmen sie Reißaus, aber die Verfolger verlegten ihnen den Weg. Wieder musste man kehrtmachen und zu entkommen suchen. Wie Schwärme schneller Vögel flogen die flüchtenden und hetzenden Reiterscharen über die weite Steppe. Staub lag in der Luft, Stimmen schwirrten, dort stürzte ein Pferd, hier flog ein Reiter über den Kopf seines Tieres, ein anderer versuchte hinkend, sein Pferd einzufangen. Alle hatte die Wettkampfbegeisterung und -leidenschaft gepackt. Im Spiel ist niemand verantwortlich. Gefahr und Kühnheit haben eine Mutter.
Die Sonne lugte nur noch mit einem schmalen Rand über den Horizont, es dämmerte, aber noch immer wälzte sich der Räuberritt durch die blaue Abendkühle und ließ die Erde unter den Hufen erbeben. Niemand schrie mehr, niemand wurde mehr verfolgt, alle jagten wie im Rausch weiter. Weit auseinandergezogen wälzte sich die Lawine als dunkle Welle unter der Macht von Rhythmus und Musik des Laufs von Hügel zu Hügel. Waren nicht davon die Gesichter der Reiter so gesammelt und still, hatte nicht das die Laute der kasachischen Dombra und des kirgisischen Komus hervorgebracht?
Sie näherten sich dem Fluss, der matt zwischen den dunklen Sträuchern schimmerte. Jenseits des Flusses war das Spiel zu Ende, dort war der Ail. Tanabai war immer noch von einem geschlossenen Haufen umgeben, der ihn in die Mitte genommen hatte, wie Geleitboote ein Schiff.
Gülsary war müde, sehr müde. Der Tag war anstrengend gewesen. Er hatte keine Kraft mehr. Zwei Dshigiten hielten ihn am Zaum und stützten ihn von beiden Seiten. Tanabai lag mit der Brust auf dem Bock, den er vor sich über den Sattel geworfen hatte. Ihn schwindelte, er konnte sich kaum noch im Sattel halten. Ohne die Reiter wäre weder er noch der Passgänger über den Fluss gekommen. So war man wohl schon vorzeiten mit der Beute geflohen, so hatte man wohl schon vorzeiten einen Verwundeten vor der Gefangenschaft bewahrt.
Da waren der Fluss, die Wiese und die breite kieselbedeckte Furt. Noch war sie zu sehen in der Dunkelheit.
Die Reiter warfen sich in die Flut. Der Fluss brauste und schäumte. Durch spritzenden Gischt und unter ohrenbetäubendem Hufgeklirr zogen die Dshigiten den Passgänger ans Ufer. Das war der Sieg!
Einer hob den ausgeweideten Bock von Tanabais Sattel und galoppierte in den Ail.
Die Kasachen blieben jenseits des Flusses.
»Wir danken euch für das Spiel!«, riefen die Kirgisen ihnen zu.
»Lebt wohl! Im Herbst treffen wir uns wieder!«, klang es herüber, und die Kasachen wendeten die Pferde.
Es war dunkel. Tanabai war im Ail zu Gast. Der Passgänger stand mit anderen Pferden angebunden im Hof. Noch nie war er so müde gewesen, ausgenommen am ersten Tag des Zureitens. Aber damals war er ein Hänfling im Vergleich zu heute. Drinnen sprach man über ihn.
»Trinken wir auf Gülsary, Tanabai! Ohne ihn hätten wir heute nicht gesiegt.«
»Ja, der Braune war stark wie ein Löwe. Auch der Dshigit war stark. Er wird es weit bringen bei ihnen.«
»Du hast recht. Ich habe immer noch Gülsary vor Augen, wie er den Kasachen entging und sich wie Gras an die Erde schmiegte. Es verschlägt einem den Atem!«
»Ja! In alten Zeiten hätten Recken ihn geritten. Das ist kein gewöhnliches Pferd, das ist ein Märchenross.«
»Wann lässt du ihn zu den Stuten, Tanabai?«
»Er ist schon jetzt hinter ihnen her; aber ich denke, es ist noch zu zeitig. Im nächsten Frühjahr wird es gerade richtig sein. Im Herbst lass ich ihn frei, damit er sich kräftigt.«
Lange noch saßen die angeheiterten Männer beisammen, riefen sich Einzelheiten des Räuberritts ins Gedächtnis und sprachen über die Vorzüge des Passgängers, der draußen völlig erschöpft an der Trense nagte. Eine hungrige Nacht stand ihm bevor. Aber es war nicht der Hunger, der ihn plagte. Die Schultern schmerzten, er spürte die Beine nicht mehr, die Hufe brannten, und im Kopf rumorte immer noch das Geschrei der Alaman-baiga. Immer noch glaubte er die Verfolger hinter sich. Ab und zu schreckte er auf, schnaubte und spitzte die Ohren. Wie gern hätte er sich jetzt im Gras gewälzt, sich geschüttelt und inmitten der Herde geweidet. Aber der Herr kam nicht heraus.
Endlich tauchte er leicht schwankend in der Dunkelheit auf. Ein scharfer, beißender Geruch ging von ihm aus. Das kam selten vor bei ihm. Ein Jahr später sollte der Passgänger es mit einem zu tun haben, von dem dauernd ein solcher Geruch ausging. Und er wird diesen Menschen hassen und den ekelhaften Geruch.
Tanabai ging zum Pferd, klopfte ihm auf den Widerrist und schob die Hand unter die Satteldecke. »Hast dich etwas abgekühlt? Bist müde? Ich bin auch hundemüde. Sieh mich nicht so scheel an, ich habe getrunken, aber auf dein Wohl. Es ist doch Feiertag. Ich kenne mein Maß, merk dir das! Auch an der Front kannte ich es. Also komm, sieh mich nicht so an. Gleich reiten wir zur Herde und ruhen uns aus.« Er zog die Sattelgurte fest, sprach noch mit den anderen, die aus dem Haus gekommen waren, dann saßen alle auf und sprengten davon.
Tanabai ritt durch die schlafenden Straßen des Ails. Alles war still, die Fenster waren dunkel. Kaum hörbar tuckerte ein Trecker auf dem Feld. Über den Bergen stand der Mond, die Apfelblüten in den Gärten schimmerten weiß, eine Nachtigall schluchzte. Sie schien die Einzige zu sein im Ail. Sie sang und lauschte ihrer Stimme. Dann verstummte sie, bis sie wieder schlug.
Tanabai verhielt den Passgänger. »Wie schön!«, sagte er laut. »Und wie ruhig! Nur die Nachtigall schlägt. Verstehst du, Gülsary? Du möchtest zur Herde, aber ich …« Sie ritten an der Schmiede vorüber und hätten hier in die letzte Straße, die zum Fluss führte, einbiegen müssen. Aber den Herrn zog es zur anderen Seite. Er ritt die Hauptstraße entlang und hielt an deren Ende vor dem Haus, in dem jene Frau wohnte. Das Hündchen kam angelaufen, bellte und wedelte mit dem Schwanz. Der Herr schwieg, er schien zu überlegen, dann seufzte er und zog unentschlossen am Zügel.
Der Passgänger ging weiter. Tanabai ritt zum Fluss. Auf dem Weg ließ er das Pferd traben. Gülsary war es recht, er wollte möglichst rasch zur Herde. Sie passierten die Wiese, da war der Fluss, die Hufe klapperten übers Ufergeröll. Das Wasser war kalt und brausend. Plötzlich, mitten in der Furt, riss der Herr hart am Zügel und wendete. Gülsary schüttelte den Kopf und glaubte, der Herr habe sich geirrt. Sie mussten doch nicht zurück! Als Antwort versetzte Tanabai ihm eins mit der Peitsche. Gülsary mochte es nicht, wenn er geschlagen wurde. Gereizt kaute er an der Trense und gehorchte widerwillig. Wieder über die Wiese, den Weg entlang bis zum selben Hof.
Vor dem Haus rutschte der Herr erneut unruhig im Sattel hin und her und zerrte an der Trense, dass man nicht wusste, wo er hinwollte. Sie hielten am Tor, von dem nur ein krummer Pfosten übrig geblieben war. Wieder kam das Hündchen. Im Haus war es still und dunkel.
Tanabai stieg aus dem Sattel und ging über den Hof. Den Passgänger am Zügel führend, näherte er sich dem Fenster und klopfte an die Scheibe.
»Wer ist da?«, rief die Frau.
»Ich bins, Bübüdshan! Mach auf. Hörst du, ich bins!«
Im Haus flammte ein Streichholz auf, und ein matter Lichtschein erleuchtete das Fenster.
»Was willst du? Woher kommst du mitten in der Nacht?«
Bübüdshan erschien in der Tür. Sie trug ein offenes weißes Hemd. Die dunklen Haare fielen auf die Schulter herab. Der Duft des warmen Körpers und der wilde Geruch des unbekannten Krautes umgaben sie.
»Entschuldige bitte«, sagte Tanabai leise. »Wir sind spät von der Alaman-baiga fortgeritten. Ich bin müde. Und das Pferd ist am Ende. Es braucht Ruhe, und bis zur Herde ist es weit, das weißt du selbst.«
Bübüdshan schwieg.
Ihre Augen flammten auf und erloschen wie die Steine auf dem Grund einer mondbeschienenen Tränke. Der Passgänger wartete, dass sie herantreten und ihm den Hals kraulen möge, aber sie tat es nicht.
»Kalt ists«, sagte sie und zog die Schultern ein. »Nun, was stehst du herum? Komm rein, wenns so ist. Ach du, was du dir da wieder ausgedacht hast.« Sie lächelte leise. »Ich hab mir schon alles zusammengereimt, während du dich auf dem Passgänger hier herumgetrieben hast, wie ein kleiner Junge.«
»Gleich. Ich will nur das Pferd unterstellen.«
»Dort in der Ecke am Dubal kannst dus anbinden.«
Noch nie hatten dem Herrn so die Hände gezittert. Hastig zäumte er den Passgänger ab, lange nestelte er an den Sattelgurten. Den einen lockerte er, während er den anderen vergaß.
Dann trat er mit der Frau ins Haus. Bald verlöschte in den Fenstern das Licht.
Für den Passgänger war es ungewohnt, auf einem fremden Hof zu stehen.
Der Vollmond übergoss die aufragenden nächtlichen Berggipfel mit milchblauem Licht. Feinhörig lauschte Gülsary auf die Geräusche der Nacht. Das Wasser im Aryk murmelte. In der Ferne tuckerte der Trecker, und in den Gärten sang die einsame Nachtigall.
Von den Zweigen des benachbarten Apfelbaums fielen lautlos weiße Blütenblätter auf Kopf und Mähne des Pferdes. Die Nacht schimmerte hell. Der Passgänger trat von einem Fuß auf den anderen und wartete geduldig auf seinen Herrn. Er wusste nicht, dass er hier noch oft würde stehen müssen, die Nacht hindurch bis zum Morgen.
Es dämmerte schon, als Tanabai vor die Tür trat und Gülsary mit warmen Händen aufzäumte.
Jetzt rochen seine Hände auch nach jenem wilden Kraut.
Bübüdshan begleitete Tanabai. Sie schmiegte sich an ihn, und er küsste sie lange.
»Dein Bart sticht«, flüsterte sie. »Beeil dich, es wird hell.« Dann wandte sie sich wieder dem Haus zu.
»Bübüdshan«, rief Tanabai, »komm, streichle ihn, und sei zärtlich zu ihm.« Er nickte dem Passgänger zu. »Beleidige uns nicht!«
»Beinahe hätt ichs vergessen«, sagte sie lachend. »Sieh mal, er ist ganz mit Apfelblüten bedeckt.« Sie flüsterte ihm zärtliche Worte ins Ohr und streichelte ihn mit ihren wunderbaren Händen, geschmeidig und feinfühlig, wie die Lippen der kleinen braunen Stute mit der Blesse.
Jenseits des Flusses fing der Herr zu singen an. Es war schön, unter seinem Lied zu traben, und doch wünschte Gülsary, möglichst bald bei der Herde zu sein.
In jenen Mainächten lächelte Tanabai das Glück. Er hatte die Nachtweide übernommen, und für den Passgänger begann nun ein reges Nachtleben. Am Tag weidete er und ruhte sich aus, und nachts trug er seinen Herrn, wenn der die Herde in eine Senke getrieben hatte, zu jener Frau. Beim ersten Morgengrauen jagten sie wie Pferdediebe auf verborgenen Steppenpfaden zur Herde zurück. Tanabai trieb die Herde aus der Senke und zählte die Pferde. Der Passgänger war übel dran. Tanabai ließ ihn in der weglosen Steppe scharf gehen.
Gülsary wäre am liebsten für immer bei der Herde geblieben. In ihm erwachte der Beschäler. Noch vertrug er sich leidlich mit dem Leithengst. Aber mit jedem Tag gerieten sie häufiger aneinander, wenn sie derselben Stute nachstiegen. Immer öfter reckte Gülsary den Hals, hob den Schweif und stellte sich vor der Herde zur Schau. Er wieherte schwärmerisch und biss den Stuten erregt in die Hüften. Die ließen es sich gefallen, schmiegten sich an ihn und machten den Leithengst eifersüchtig. Der Passgänger kam dabei meistens schlecht weg, denn der Hengst war alt und ein grimmiger Raufbold. Aber lieber sich aufregen und vor dem Hengst die Flucht ergreifen, als die ganze Nacht auf dem Hof stehen und sich nach den Stuten sehnen. Oft konnte er sich lange nicht beruhigen, stampfte und schlug mit den Hufen. Wer weiß, wie viele Wochen diese nächtlichen Ritte noch gedauert hätten, wäre nicht jenes Ereignis eingetreten.
Der Passgänger stand wie gewöhnlich im Hof, sehnte sich nach der Herde, wartete auf den Herrn und begann, vor sich hin zu dösen. Die Zügel waren hoch an einem Dachbalken festgebunden. Er konnte sich nicht hinlegen. Immer wenn ihm der Kopf herabsank, schnitt ihm die Trense in die Lefzen. Trotzdem döste er weiter. Eine drückende Schwüle lag in der Luft, schwarze Wolken bedeckten den Himmel.
Im Halbschlaf hörte Gülsary, wie die Bäume zu rauschen begannen, als wäre jemand heimlich herbeigeflogen und schüttele und rüttele sie. Der Wind fuhr über den Hof, rollte klappernd einen leeren Milcheimer vor sich her und riss die Wäsche von der Leine. Das Hündchen winselte und suchte Unterschlupf. Der Passgänger schnaubte wild, erstarrte und spitzte die Ohren. Er hob den Kopf und blickte angespannt in die brodelnde Finsternis. Aus der Steppe nahte grollend etwas Schreckliches. Blitze durchschnitten die Wolken, Donner grollte, und die Nacht krachte wie berstendes Holz. Ein starker Regen prasselte nieder. Der Passgänger zerrte am Zügel wie unter Peitschenhieben und wieherte verzweifelt, in Sorge um seine Herde. In ihm erwachte der Instinkt, die Artgenossen vor Gefahr schützen zu müssen. Wie von Sinnen wütete er gegen Zaum und Trense, gegen die geflochtene Rosshaarleine, gegen alles, was ihn hier festhielt. Er warf sich hin und her, wühlte mit den Hufen die Erde auf und wieherte pausenlos, in der Hoffnung, die Herde würde ihm antworten. Aber nur der Sturm pfiff und heulte. Ach, wenn es ihm damals nur gelungen wäre, sich loszureißen!
Der Herr stürzte im weißen Unterhemd aus dem Haus, hinter ihm die Frau, auch sie im weißen Hemd. Im Regen wurden sie mit einem Schlag dunkel. Über ihre nassen Gesichter und angsterfüllten Augen zuckte der blaue Schein eines Blitzes und riss das Haus mit der im Wind schlagenden Tür aus der Finsternis.
»Halt! Halt!«, brüllte Tanabai und versuchte, Gülsary loszubinden, der aber wollte von ihm nichts wissen, er warf sich wie ein reißendes Tier auf seinen Herrn, riss und zerrte an Zügel und Leine. Sich an die Mauer pressend, schlich Tanabai zu ihm heran; mit den Händen den Kopf schützend, sprang er auf ihn zu und hängte sich an den Zaum.
»Bind ihn los, schnell!«, schrie er der Frau zu.
Die hatte die Leine kaum gelöst, da schleppte der sich aufbäumende Passgänger Tanabai schon über den Hof.
»Den Kantschu, rasch!«
Bübüdshan lief nach der Peitsche.
»Halt, halt, ich schlag dich tot!«, brüllte Tanabai und schlug dem Pferd mit dem Kantschu rasend aufs Maul. Er musste in den Sattel, er musste zur Herde.
Wie sah es dort aus?
Wohin hatte der Orkan die Pferde getrieben?
Aber auch der Passgänger musste zur Herde. Gleich, auf der Stelle!
Es regnete in Strömen. Der Donner rollte und erschütterte die sich unter den grellen Blitzen zusammenkauernde Nacht.
»Halt ihn fest!«, befahl Tanabai Bübüdshan, und als sie am Zaum hing, sprang er in den Sattel. Noch saß er nicht, noch krallte er sich an der Mähne fest, da sprengte Gülsary schon vom Hof, rannte die Frau um und schleifte sie durch eine Pfütze.
Er gehorchte nicht dem Zügel, nicht dem Kantschu, nicht der Stimme. Er jagte durch die regengepeitschte Sturmnacht, allein seinem Spürsinn folgend. Er trug seinen machtlosen Herrn durch den aufgewühlten Fluss, durch wirres Gebüsch, über Gräben und durch Hohlwege, er rannte und rannte. Niemals zuvor, auch nicht bei der Alaman-baiga, war Gülsary so getrabt.
Tanabai wusste nicht, wohin ihn der wild gewordene Passgänger trug. Wie mit Flammen peitschte der Regen Gesicht und Körper. Nur ein Gedanke hämmerte in seinem Hirn: Was ist mit der Herde? Wo sind die Pferde? Gott behüte, dass sie in der Niederung zur Bahnlinie gerannt sind. Eine Katastrophe! Hilf mir, Allah, hilf. Helft mir, Arbak, wo seid ihr? Fall nicht, Gülsary, fall nicht! Trag mich in die Steppe zur Herde!
Über der Steppe flammte weißes Wetterleuchten und machte die Nacht zum blendenden Tag, dann war sie wieder in Finsternis gehüllt, der Donner wütete, der Wind peitschte den Regen.
Hell und dunkel, dunkel und hell.
Der Passgänger bäumte sich, riss das Maul auf und wieherte. Er rief, er suchte, er wartete auf Antwort. Wo seid ihr? Meldet euch! Donnernd antwortete der Himmel, und wieder traben, wieder suchen, immer dem Sturm entgegen.
Hell und dunkel, dunkel und hell.
Der Sturm legte sich erst gegen Morgen. Langsam verzogen sich die Wolken, nur der Donner grollte noch im Osten. Die gequälte Erde dampfte.
Pferdehirten suchten die Gegend nach versprengten Pferden ab.
Tanabais Frau suchte ihren Mann. Sie wartete auf ihn. In der Nacht war sie mit den Nachbarn ausgeritten, um ihm zu helfen. Die Herde fanden sie und hielten sie in der Senke fest. Aber Tanabai war nicht da. Man dachte, er habe sich verirrt. Aber sie wusste, dass er sich nicht verirrt hatte. Als der Nachbarsbursche freudig ausrief: »Da ist er, Dshaidar-apa, da kommt er!«, und ihm entgegenritt, rührte sich Dshaidar nicht von der Stelle. Schweigend beobachtete sie vom Pferd, wie ihr buhlerischer Mann zurückkehrte.
Schweigend und finster ritt Tanabai im nassen Unterhemd, ohne Mütze, auf dem eingefallenen Passgänger. Gülsary lahmte auf der rechten Hinterhand.
»Und wir suchen Sie!«, verkündete ihm der herbeigeeilte Bursche freudig. »Dshaidar-apa hat sich schon geängstigt.«
»Ich habe mich verirrt«, brummte Tanabai.
Beide schwiegen. Aber als der Bursche sich entfernte, um die Herde aus der Senke zu treiben, sagte die Frau leise: »Du hast nicht mal Zeit gehabt, dich anzuziehen. Ein Glück, dass du noch Hose und Stiefel anhast. Schämst du dich nicht? Du bist doch nicht mehr der Jüngste. Deine Kinder sind bald erwachsen!«
Tanabai schwieg. Was hätte er sagen sollen?
Der Bursche trieb inzwischen die Herde zusammen. Pferde und Fohlen waren vollzählig.
»Wir reiten nach Hause, Altyk«, rief Dshaidar dem Burschen zu. »Wir haben heute alle genug zu tun. Der Wind hat die Jurten durcheinandergeworfen. Wir müssen sie zusammensuchen, komm!«
Zu Tanabai sagte sie halblaut: »Du bleibst hier. Ich bringe dir was zu essen und anzuziehen. So kannst du nicht vor die Leute treten!«
»Ich werde nach unten kommen«, sagte Tanabai.
Sie ritten davon. Tanabai trieb die Herde auf die Weide. Er trieb lange. Die Sonne schien, und es wurde warm. Die Steppe dampfte und erholte sich. Es roch nach Regen und jungem Gras.
Die Herde trottete grasend über die Bodenwellen und erreichte eine Anhöhe. Hier schien sich eine andere Welt vor Tanabai zu eröffnen. Der Horizont war weit und mit weißen Wolken überzogen. Der Himmel war groß, hoch und rein. Fern in der Steppe rauchte ein Zug.
Tanabai stieg vom Pferd und ging durchs Gras. Eine Lerche flatterte empor und sang. Tanabai ging weiter, den Kopf gesenkt, und plötzlich warf er sich hin.
Noch nie hatte Gülsary den Herrn so gesehen: das Gesicht der Erde zugewandt und die Schultern vor Schluchzen bebend. Er weinte vor Scham und Schmerz, er wusste, dass er das Glück verloren hatte, das sich ihm zum letzten Mal im Leben hingegeben hatte.