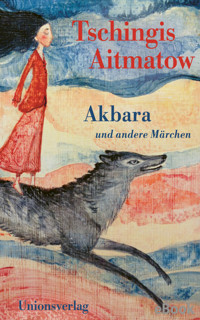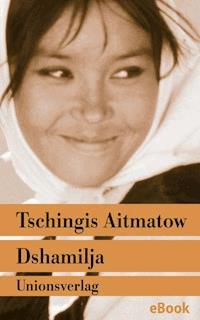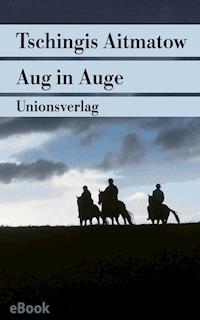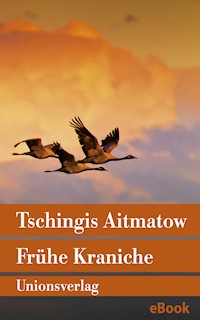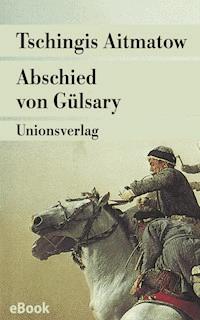Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zeit scheint für beide abgelaufen. Der einst unbezwingbare Schneeleopard Dschaa-Bars fühlt seine Kräfte schwinden und will sich zum Sterben in das kirgisische Hochgebirge zurückziehen. Und Arsen Samantschin, der unabhängige Journalist, wird von der Welle des entfesselten Kommerzes in seiner Heimat überrollt. Die Medien kuschen, Oligarchen und Fanatiker drängen sich vor, und seine große Liebe, die Sopranistin Aidana, feiert als Popstar Triumphe. Das Schicksal führt Arsen und den Schneeleoparden in einer atemberaubenden Wendung zusammen: Arabische Prinzen haben sich zu einer luxuriösen Jagdpartie angekündigt. Arsen soll sie als Dolmetscher begleiten. Aber nicht alle im Dorf wollen hinnehmen, dass es bei diesem Geschäft so wenige Gewinner und so viele Verlierer gibt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Für beide scheint es keinen Platz mehr zu geben in dieser Welt – weder für den alten Schneeleoparden Dschaa-Bars noch für den unabhängigen Journalisten Arsen, der gegen Oligarchen und Fanatiker anschreibt. Dann führt das Schicksal die beiden in einer überraschenden Wendung zusammen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Friedrich Hitzer (1935–2007) war freischaffender Autor, Übersetzer und Redakteur und engagierte sich als Kulturvermittler zwischen Europa, Russland und Mittelasien. 2006 wurde er mit der Puschkin-Medaille für sein Lebenswerk als Brückenbauer geehrt.
Zur Webseite von Friedrich Hitzer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Der Schneeleopard
Roman
Aus dem Russischen von Friedrich Hitzer
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Diese Übersetzung folgt dem russischen Manuskript des Autors vom Februar 2006.
Eine russische Buchausgabe erschien 2006 unter dem Titel Kogda padajut gori. Wetschnaja Newesta (»Wenn Berge einstürzen. Die Ewige Braut«) im Verlag Asbuka-Klassika, St. Petersburg.
Originaltitel: Kodga padajut gori. Wetschnaja Newesta (2006)
© by Tschingis Aitmatow 2006
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Konstantin Yudintsev
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30749-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 00:27h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER SCHNEELEOPARD
Jeder Kreatur bleibt das eigene Schicksal verschlossen …1 – Die Stunde der Jagd bricht für Dschaa-Bars zumeist …2 – Manchmal sieht sich das undurchschaubare Schicksal genötigt …3 – Wem ist was auf dieser Welt bestimmt …4 – Noch vor ein paar Tagen hatte er an …5 – Wie hätte Arsen Samantschin wissen können, dass das …6 – Am Morgen weckte ihn ein Telefonanruf. Als er …7 – Ein paar Tage später war Arsen Samantschin bereits …8 – Arsen Samantschin war bereits seit dem frühen Morgen …9 – So schritten die zwei zu dieser Mittagsstunde über …10 – Der Ail brummte vor Erwartung, Zufriedenheit und Geschäftigkeit …11 – Für Arsen Samantschin war der Moment gekommen …12 – Wirklich tauchte jetzt Struwwelkopf aus der Gruppe von …Epilog — Töten – NichttötenWorterklärungenMehr über dieses Buch
Tschingis Aitmatow: Interview zu Der Schneeleopard
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Friedrich Hitzer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Tier
Zum Thema Asien
Zum Thema Berge
Jeder Kreatur bleibt das eigene Schicksal verschlossen. Niemand weiß, was ihm bevorsteht. Erst der Gang des Lebens zeigt an, was uns von Geburt an vorbestimmt ist, sonst gäbe es das Schicksal nicht. Dennoch lebt in uns die Sehnsucht, die Rätsel zu entschlüsseln, die uns umhüllen. So ist es seit Anbeginn der Schöpfung, seit der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Seit dem ersten Menschenpaar ist es so gefügt. Von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde …
Auch dieses Mal vollzog sich das Unausweichliche jenseits menschlicher Vorstellungskraft und, einmal vollzogen, vielleicht auch jenseits göttlicher Absichten.
Wer es dennoch begreifen wollte, hätte versuchen können, ein Horoskop der betroffenen Wesen zu erstellen, vielleicht waren sie ja kosmische Verwandte, die unter einem verbindenden Sternzeichen das Licht der Welt erblickt hatten. Vielleicht gingen sie darum diesen Schicksalsweg, so und nicht anders, aber wer weiß das schon …
Freilich wussten die beiden nichts voneinander und erst recht nicht, wie sie auf Erden zusammenhingen. Der eine lebte in einer modernen Stadt, einem dicht bevölkerten Flecken Erde, wo sich Märkte ausbreiten und Schaschlikrauch durch die Straßen weht; der andere aber hauste hoch in den Bergen, in wilden, felsigen Schluchten, unter dicht verwachsenen Büschen des Sade-Wacholders, wo Schnee die Schattenhänge das halbe Jahr über bedeckt. Deshalb hieß er auch Schneeleopard, und in der Wissenschaft übers Hochgebirge nannte man ihn Tienschan-Schnee-Bars von der Gattung der Leoparden und der Familie der Großkatzen, zu denen auch die Tiger gehören. Das Volk in der Gegend nannte ihn Dschaa-Bars – Pfeil-Bars –, was treffend seiner Natur im Moment des Sprungs entspricht. Besonders vertraut klang es, wenn man vom Kar-Ketschken-Ilbirs sprach, was der Bis-zur-Brust-im-Schnee-Gehende bedeutete. Auch das entspricht der vollen Wahrheit. Andere Kreaturen suchen die Bergpfade, wo ihnen keine Schneewehen drohen, aber der Kar-Ketschken-Ilbirs pflügt querfeldein … Er ist reine Kraft und Stärke!
1
Die Stunde der Jagd bricht für Dschaa-Bars zumeist um Mittag an. Zu der Zeit machen sich die Pflanzenfresser, die Grauziege und der Steinbock – Etschki und Archar –, von überall her auf den Weg zu den Bächen und Flüssen im Gebirge, um ihren Durst zu stillen, was mitunter über die Nacht bis zum nächsten Tag dauert. Zur Tränke ziehen sie alle wohlgeordnet. Mit flinkem, federndem Tritt scheinen sie den Boden der Pfade kaum zu berühren, bewegen sich wie hüpfende Ketten in kleinen Gruppen, scharf um sich spähend und mit feinem Gehör für alles ringsum, um bei Gefahr wie eine Sprungfeder augenblicklich über den Erdboden davonzuschnellen.
Großartig ist aber auch die Jagdkunst, die Dschaa-Bars beherrscht. Er erwartet seine Beute, geschickt getarnt und verborgen hinter einem Felsen, von wo er in zwei Takten den Überraschungssprung von oben herab vollzieht – seine Meisterleistung. Oder aber er stürzt sich seitwärts aus einem Busch jählings auf das Opfer, reißt es nieder, beißt im gleichen Augenblick die Kehle durch, beginnt noch im heiß strömenden Blut seine Happen zu verschlingen und vollendet das, wozu er bestimmt ist …
Am besten jagt es sich, wenn die Herde gehörig Wasser getrunken hat. Dazu muss sich Dschaa-Bars in der Nähe der Tränke in den Hinterhalt legen und jedes Geräusch vermeiden, geduldig ausharren und sich beherrschen. Die Beute ist so nah – nur einen Sprung entfernt, aber er muss sich zügeln und warten, bis Böcke und Grauziegen sich vollsaugen, alle Kraft verwendet er darauf, ruhig zu bleiben, bis Etschki fertig ist. Immer wieder hebt sie ihren zarten, feinen Schädel, spitzt dabei die Ohren und strahlt aus schimmernden Augen, schluckt und schluckt in unhörbaren Zügen, während die Vorderläufe bis über die Knöchel im Wasser stehen. Und je mehr Wasser Etschki in sich hineinzieht, desto größer wird seine Aussicht auf Erfolg. Denn oft genug misslingt es Dschaa-Bars, sich Etschki und Archar an die Fersen zu heften. Wenn er ihnen direkt nachsetzt, sind sie so schnellfüßig, ja geschwind wie der Schall, dass er sie nicht einholen kann und sie sich vor ihm retten. Sie brüllen und winseln nicht, beschmutzen sich auch nicht aus Angst beim Davonrennen wie manche Geschöpfe, die Wildschweine etwa, die sich bei Dürre hier ins Gebüsch verirren. Aber wenn Etschki und Archar sich satt getrunken haben, verlieren sie an Behändigkeit, und da muss man, setzen sie sich von der Tränke in Bewegung, sofort zupacken.
Auch dieses Mal zieht es Dschaa-Bars gegen Mittag zur Jagd in die Nähe einer Tränke. Er trottet gemächlich durchs Dickicht, entlang dem vertraut lärmenden Fluss, und sieht sich dabei um, kann doch einer seiner gefleckten Mitbrüder urplötzlich von hinten her auftauchen. Es kam ja vor, dass ein anderer Schneeleopard auf der Jagd war oder gar ein ganzes Rudel. Auf diese zusätzlichen Mühen und das gegenseitige bedrohliche Anfauchen verzichtet Dschaa-Bars gern! Lieber ist er allein … Und so zieht er weiter.
An diesem frühherbstlichen Tag strahlt der Tienschan, das Himmelsgebirge, in all seiner Fülle. Die Schneestürme werden erst später hereinbrechen, noch sind die Pässe seit dem Sommer frei zum Herumstreunen. Das Wild genießt die hohe Zeit des Äsens und hat bereits eine verlockende Körperfülle angesetzt, auch die Vögel lärmen, trällern und zwitschern noch ganz ausgelassen, die Nestkleinen sind schon recht kräftig. Die Vogelbrut kann ja nicht bis zum Winter bleiben, den sie hier nicht aushält, eines Tages wird alles, was Flügel hat, bis zum nächsten Sommer verschwinden.
Dschaa-Bars hält Ausschau nach Beute und späht nach einem Platz für die Jagd. Ziehen da nicht durstige Grauziegen zum Wasser? Jetzt ist es Zeit, sich zwischen Büschen und Felsen niederzukauern, wo sie den Gesprenkelten nicht bemerken können. Von hohem Wuchs ist Dschaa-Bars, elastisch, lang und stark, sein Nacken makellos und geschmeidig, sein Hals mächtig und rund, der Schädel groß und wuchtig, mit katzenhaften Ohren, und seine durchdringenden Augen leuchten und strahlen im Schatten. Die der Umgebung so gut angepassten, markant farbigen Flecken auf dichtem, wollig seidenem Fell besingt man seit alters in Liedern über Schamanen und Hakane, die sein Fell auf ihrem Körper tragen … Weiß er denn von seinem afrikanischen Bruder, der einen gleichermaßen langen und stattlichen Schweif trägt, aber wie eine Katze von Baum zu Baum springen muss, um sich von oben herab auf die Beute zu stürzen, während ihm, dem Schneeleoparden, gegönnt ist, stolz dahinzuschreiten, über Felsen und durch Schluchten zu klettern? Denn hier, in vier- bis fünftausend Metern Höhe, gibt es keine mächtigen Stämme und Baumkronen wie in Afrika, in seinem Reich liegt der Wald weit drunten im Tal, wo sich im Geäst der Bäume die Luchse tummeln. Wenn sich ein Bars wie er in die waldigen Gefilde verläuft, fauchen ihn die Luchse an und zischen, als wollten sie den entfernten Verwandten nicht anerkennen. Für die Schneeleoparden gibt es eine eigene Welt hoch oben – die großen Berge gleich unterm Himmel. Hier sind ihre Jagdgründe im Wettlauf mit Archar und Etschki, den Bergziegen und Steinböcken.
Dschaa-Bars platziert sich geschickt zwischen Steinbrocken im Gebüsch am Ufer des kleinen Flusses. Gut verborgen, spreizt er seine scharfen Krallen. Die Etschki werden bald eintreffen und sich am Wasser volltrinken, an die sieben sind es, die in einer Kette am Berghang stolz daherstelzen und zugleich ängstlich die Ohren spitzen. Aus seiner Felsspalte hat er sie schon lange erspäht. Und erstarrt jetzt voller Erwartung.
Die Sonne strahlt von hoch oben am klaren Himmel, nur vereinzelte Wolken berühren im Vorüberziehen die Gletschergipfel. Wetter und Sonne könnten nicht besser passen zu dem, was dieses einzigartige Raubtier vorhat. Innerlich und äußerlich bereitet es sich vor auf den Sprung. Der entscheidende Moment der Jagd rückt näher. Nur eins beunruhigt Dschaa-Bars – wie er da zwischen den Felsbrocken liegt und aufmerksam alles beobachtet, hört er plötzlich sich selbst, als würde er tief Atem holen. So etwas geschieht natürlich in vollem Lauf und bei jähen Sätzen und Sprüngen, auch dann, wenn in erbitterten Raufereien ums Weibchen geröchelt, gebrüllt und wütend gekeucht wird, wenn die Fetzen fliegen und man bereit ist, allen Tieren ringsum an die Kehle zu gehen. Aber in dieser reglosen Stellung, wo er mit dem Ort des Hinterhalts völlig verschmilzt und nur noch gespannte Aufmerksamkeit ist – da darf er doch nicht so schnaufen … Er hört jetzt deutlich sein Einatmen und Ausatmen. Das widerfährt ihm zum ersten Mal. Auch das Herz schlägt heute stärker als sonst und hallt nach in den Ohren.
Im Leben des Dschaa-Bars hat sich in der letzten Zeit einiges verändert. Schon seit dem vergangenen Winter ist er ein Einzelgänger, ein grimmiger Paria, den das Rudel verstoßen hat. So kommt es, wenn das Alter, zunächst unmerklich, über einen hereinbricht. Plötzlich brauchte ihn niemand mehr. Ein jüngerer Bars hatte sich seiner Barsin genähert und sie umworben. Die Rauferei war furchtbar. Er konnte ihn nicht besiegen. Ein zweites Mal gingen sie aufeinander los, verbissen sich ineinander, es ging um Leben und Tod, aber es misslang ihm erneut, den eingedrungenen Rivalen ein für alle Mal zu verjagen. Das Krummohr war äußerst bösartig – man hatte dem wohl bei früheren Balgereien das eine Ohr zerfetzt –, ein zähes, hartnäckiges Raubtier, das der Barsin zu Leibe rückte, sich zu ihr legte und sich an ihr rieb, scharwenzelte und drohte. All das trieb der Eindringling schamlos vor Dschaa-Bars’ Blicken. So kam es, dass die Barsin, mit der Dschaa-Bars nach seiner ersten Leopardin, die beim Erdbeben im Gebirge ums Leben gekommen war, lange zusammengelebt hatte, mit der er zweimal Nachkommen bekommen hatte, dass sie mit dem Rivalen, dem Krummohr, fortging. Sie stellte sich dabei zur Schau, schlenkerte mit dem Schweif mal nach links, mal nach rechts, richtete ihn hoch und krümmte ihn zu einem Bogen, rieb und rüttelte Seiten und Schultern mit dem anderen, ihrem neuen Partner. Sie lief einfach davon. Ungerührt. So mir nichts, dir nichts …
Dschaa-Bars setzte nach, holte sie ein, was nicht schwer war. Die beiden zogen hintereinander her durch die Talsenke, wo es wie zuvor zu einer wilden Balgerei kam. Bei diesem erneuten Versuch, seinen Platz als Stammvater und Erzeuger im Rudel zu erhalten, ereilte Dschaa-Bars die endgültige Katastrophe. Denn dieses Mal stürzte sich die Barsin an der Seite ihres neuen Gefährten auf Dschaa-Bars, biss ihn und zerrte an seinem Fell, was seine Niederlage besiegelte. Aber noch in dieser Lage riskierte er es, als er wieder etwas zu sich gekommen war, ins benachbarte Rudel einzudringen und sich ein jüngeres Weibchen zu schnappen. Das Geraufe war erbarmungslos, gleich drei Männchen fielen über ihn her, und so wurde wieder nichts daraus. Das Rudel mit dem Muttertier und den jungen Anwärtern rannte davon in die nächstbeste Bergschlucht, während er verlassen und verstoßen zurückblieb, abgeschnitten von seiner Bestimmung – denn im Kampf um den Erhalt des Geschlechts steht die Natur stets auf der Seite der frischen, jungen Kräfte.
Dschaa-Bars schweifte danach eine Zeit lang durch die Umgebung, mal erstarrte er mitten im Lauf, mal rannte er ziellos dahin oder legte sich auf den Boden, um sich darauf wieder zu erheben und verzweifelt die Berge anzubrüllen. Wenn er es doch nur gekonnt hätte – er wollte heulen wie der Wolf. Erschüttert und verwirrt wusste er nicht mehr aus und ein, verlor sogar die Jagdlust, die Beute reizte ihn nicht mehr. Die Herde konnte gemächlich in einer Linie an ihm vorüberziehen, als wüssten die Steinböcke, dass er, der erfahrene Dschaa-Bars, der ja noch lange nicht alt, sondern ein durchaus kräftiger und erfolgreicher Jäger war, jegliche Lust verloren hatte.
Zu jener Zeit, als sich sein Wesen schon veränderte, trieb ein Erlebnis sein Leid auf die Spitze. Er stand am Kamm einer Felserhebung, lehnte sich an den Stamm eines knorrigen Wacholderbaums, blickte ziellos um sich her und erspähte unerwartet, wie unten in der Talsenke ein Paar junger Schneeleoparden gemeinsam dahingaloppierte. Sie hatten einander erstmals gefunden, Männchen und Weibchen, übervoll an Kraft und Leidenschaft, sie rannten tänzelnd und beleckten sich spielerisch und kochenden Blutes, bis sie sich schließlich, wie aufgelöst, vereinigten und ineinander flogen … Sogar auf solche Entfernung war zu sehen, wie die Augen fordernd loderten.
Unwillkürlich legte sich Dschaa-Bars hin und rutschte auf dem Bauch über den Boden, er stöhnte, als wollte er vor sich selbst wegkriechen, aber wohin nur? Einstmals war auch ihm ein solcher Triumph beschieden gewesen – die vollzogene Paarung mit seiner Barsin, die damals so süß winselte, biegsam wie eine Schlange war sie ihm unter die Läufe gefallen … Oh, solches hatte er auch mit dem blutjungen, jungfräulichen Weibchen erlebt, das er sich im Nachbarrudel geholt hatte. Zu zweit waren sie damals im Paarungsgalopp den Blicken ihrer Barsgefährten davongeeilt, um sich nicht vor den Brüdern und Schwestern wie Hunde verklammert zum Geschlechtsakt zu vereinen, den die Natur nur dem Paar selbst vorbestimmt – ihr und ihm allein, in völliger Abgeschiedenheit von anderen …
Genau so hatten sie damals vor Sehnsucht nach Begattung gebrannt, das Fleisch loderte, und sie erwarteten die magische Vereinigung. Der Himmel über ihnen brannte mit und bebte und wogte mit aufblitzenden Gipfeln, o ja, die ganze Welt ringsum klirrte und leuchtete … Er und sie, das neue Paar, waren seinerzeit genauso Seite an Seite dahingejagt, hatten sich gegenseitig mit berauschender Energie aufgeladen wie die beiden da unten, an solch einem Tag im Frühherbst, damit im folgenden Frühling das Geschlecht der Schneeleoparden im Gebirge neuen Zuwachs und Fortbestand erhalte.
Eng aneinandergepresst wie ein Wesen mit doppeltem Rumpf preschten sie dahin, gleich einem großen Fischpaar schnellte ihr Schweif pfeilschnell im Wind. Um eine knappe Schädellänge sie leicht vor ihm, wie sich das ziemt fürs Weibchen, sie hat den Vorrang vor ihm, der um einen halben Kopf zurückbleibt, ja, nicht mehr und nicht weniger, ist er doch trunken vom Aroma ihres Körpers, schlürft sich satt an den Gerüchen ihres heißen Atems und hört beim Rennen das Schlagen ihres Herzens, und in diesem Augenblick durchrieselt und überkommt Dschaa-Bars ein Geheimnis. Er vernimmt im vollen Lauf bis dahin nie gehörte Klänge, lang gezogene und dröhnende Schreie, ein vielfaches Echo im Wind und gar in den Strahlen des Lichts, all das schwillt an, fließt vorüber und lärmt über dem Schädel, schwebt in federnden Luftströmen und im Glanz der aufblitzenden Sonne hoch oben, erschallt in den wogenden Bergen und Wäldern ringsum. Oh, wenn es ihm, dem Schneeleoparden, nur vergönnt wäre zu wissen und zu fassen, was er da erlebt, die Musik des pulsierenden Universums, die grandiose Ouvertüre vor dem Akt der Paarung …
Aber es zeigte sich wie so oft nur ein wonnevolles Trugbild, was folgte, war grausame Wirklichkeit. Die Fata Morgana verging, Tage und Jahreszeiten lösten sich ab und kehrten wieder …
Die Launen des Schicksals sind nicht vorhersehbar, und niemand kann es ändern. An dem Tag, da seine Barsin sich vor aller Augen mit dem Krummohr davonmachte, sich dem Sieger hingab, nachdem die beiden Männchen sich einen ganzen Tag lang zerfetzt hatten, da wurde Dschaa-Bars zum einsamen Streuner, zum Paria und tauchte unter. Er lungerte herum und suchte den Ingrimm übers Geschehene zu dämpfen, aber die Wut hielt an, und so zog er ziellos umher, verzichtete darauf zu jagen, und zu all dem widerfuhr ihm noch diese letzte Demütigung. War es ein Zufall? Ausgerechnet in der völlig abgelegenen Talsenke seines Gebirges, wohin er sich jetzt zurückzieht, stößt er unmittelbar auf die beiden, die Barsin und das Krummohr, den siegreichen Rivalen. Genau in dem Moment, wo sie wie ein Hundepaar verklammert kopulieren, dem Höhepunkt nahe, Hintern an Hintern, wie aneinandergeklebt, reglos und still vor sich hin winseln. Als sie Dschaa-Bars erblicken, erstarren sie. Alles vollzieht sich in Sekundenschnelle. Dschaa-Bars brüllt in dumpfer Wut, nähert sich den beiden, senkt den Schädel und schickt sich an zum Sprung. Er will sich endlich rächen, in zwei Sätzen die beiden wie siamesische Zwillinge aneinander Gefesselten ein für alle Mal erledigen, ihr und ihm die Kehle zerfetzen. Nur noch einen Schritt … Aber im letzten Bruchteil einer Sekunde erstirbt er plötzlich, bleibt unbeweglich stehen, ohne den schrecklichen blutrünstigen Blick abzuwenden, den er auf das verhasste, ineinandersteckende Paar richtet; da ist eine Kraft, die ihn bändigt. Als gäbe ihm eine innere Stimme zu verstehen, ja befehle ihm ein anderer Wille, das zur Befruchtung vereinigte Paar nicht anzurühren und zu vernichten – er macht kehrt, stolpert und zieht ab, während er brüllt und stöhnt, heult und schluchzt …
Die Tage vergingen. Dschaa-Bars entfernte sich immer mehr von seinen angestammten Leopardenrudeln und verwandelte sich vollends in einen Einzelgänger, den erbarmungslosen und grimmigen Raubtier-Eremiten, der aus beliebigem Anlass bereit war, bis aufs Blut zu kämpfen. Er hauste in Höhlen, streifte in hohen Schneelagen und jagte die Tiere, die ihm entkommen wollten. Nicht selten erlegte er mehr Beute, als er brauchte. Dann machten sich all diese kleinen Parasiten über den Rest her – Schakale, Füchse und Dachse fraßen sich am Kadaver fest, und die widerwärtige Brut der Aasgeier stürzte vom Himmel, kreischte heiser und unzufrieden und schlug mit Flügeln und Krallen um sich. Auf all das Gezerre und Gezeter blickte Dschaa-Bars verachtungsvoll herab, manchmal stürzte er auf die Meute, um sie zu verjagen, brüllte, fauchte und knurrte sie an, als seien sie an etwas schuld. So ließ er an ihnen seine Wut aus, den Schmerz und die Sehnsucht nach dem, was einmal war.
Die Berge leuchteten wie immer von den Gipfeln her, schienen in ewigem Schnee und Eis erstarrt. Winter und Sommer lösten sich ab mit ihren gewohnten Wettern. Selbst die Einsamkeit des gefleckten Tigerzaren im Hochgebirge schien unveränderlich. Doch die Zeit hielt nicht an, unmerklich holten die Tage den äußerlich unveränderten Dschaa-Bars ein. Er begann in sich die Atemnot zu spüren … Anfänglich litt er nur von Fall zu Fall, hauptsächlich bei jähen, heftigen Bewegungen, aber dass ein dumpfer Schmerz auf die Brust drückte, wenn er in ruhiger Lage atmete, das hatte es noch nicht gegeben.
Während er die Bergziege an der Wassertränke abwartet, fühlt er erstmals, wie ihn der Atem noch vor Beginn der Jagd im Stich lässt.
Wie immer lauert er im Hinterhalt, bis Etschki und Archar sich vollgetrunken haben, und genau dann muss er angreifen. So ist zumindest der Plan. Es kommt nämlich auch vor, dass die Böcke den Hinterhalt wittern und blitzschnell abdrehen und verschwinden. Dann müsste er ihnen nachjagen – mit ungewissem Ausgang.
Dieses Mal kann sich Dschaa-Bars nicht beim Schicksal beklagen. Es ist eine ganze Herde dieser kühn gehörnten Steinböcke, wahre Springer und Felsenflitzer, die sich von Kräutern und Beeren in den unerreichbaren Höhen des Gebirges ernähren. Das reißende Raubtier, Dschaa-Bars, erwartet sie in seinem Versteck. Aus der Ferne bemerken sie ihn nicht, in der Nähe wittern sie nichts und begeben sich jetzt seelenruhig zur Tränke, wo sie sich am Ufer in einer Reihe aufstellen.
Dschaa-Bars bleibt regungslos, sein rechtes Auge folgt ihnen unverwandt – alles geht den gewohnten Gang: Die Tiere trinken ihr Wasser mit Genuss, sie halten inne und schlürfen weiter, er muss nur noch genau abpassen, wann sie fertig sind. Nur eines ist anders geworden: Dschaa-Bars schnauft, aus seiner Brust pfeift es dumpf. Noch wundert er sich nur über das Pfeifen, noch beunruhigt es ihn nicht.
Doch dann stört die Atemnot wirklich: Als er in zwei blitzartigen Sätzen das am Rand stehende Leittier des Rudels, einen großen gehörnten Steinbock, anspringt und mit einem schrecklichen Prankenschlag übers Rückgrat niederreißen will, sieht Dschaa-Bars schon im Anflug, wie die Herde erbebt, die Schädel jählings hochreißt. Er muss nur noch mit seiner Pranke und den ausgestreckten Krallen vernichtend zuschlagen, ja er fliegt schon ganz nah ans Ziel heran, doch er landet auf der Erde, dicht neben dem Archar. Der war kurz zuvor zur Seite gesprungen. Das hätte nicht sein dürfen. Noch ist nichts verloren … In wilder Wut stürzt sich Dschaa-Bars nochmals auf den Steinbock, aber der hat schon kehrtgemacht und ist dem schrecklichen Raubtier entkommen, die Herde hinter ihm drein.
Dschaa-Bars ist hinter der Herde her und will den erstbesten Archar niederreißen, er holt alles aus sich heraus, fast ist es so weit, nur noch ein wenig, aber wieder umsonst. Er war doch so nah und hat keinen erlegt. So nahe war der Triumph … Die Steinböcke entfernen sich mehr und mehr. Er keucht schwer und erstickt beinahe, dann rafft er sich nochmals auf und setzt der Herde nach, aber zu spät …
Solch ein Fehlschlag ist Dschaa-Bars noch nie widerfahren. Am schwersten trifft ihn, dass der Anführer der davonrennenden Herde, der schroff gehörnte Steinbock, auf den er einem Pfeil gleich zugeschossen war, im Lauf sich umdrehte, ihm, dem Großräuber, mit dem Geweih drohte, es herausfordernd schüttelte, mit den Hufen auf die Erde stampfte und dann weiterrannte. Das konnte nur heißen: Dschaa-Bars hat ausgedient, die Zeit der Erfolge ist vorbei. Von nun an muss er betteln gehen und die Beutereste anderer abnagen.
Natürlich hatte Dschaa-Bars schon früher kleine Schlappen beim Jagen eingesteckt, aber solch eine Niederlage noch nie.
Er konnte sich nicht mehr beruhigen, verstört blickte er um sich, versuchte wieder zu Atem zu kommen und trottete ziellos von dannen.
Um ihn war nur noch Leere. Wie gerne hätte Dschaa-Bars zum Abschied die Zauberklänge der Sonne und der Berge gehört, die Wasserfälle und Wälder wie damals bei seinem Paarungslauf – die Musik des pulsierenden Universums. Er wollte mit fordernder Stimme das Verlangen aus sich herausbrüllen, aber alles blieb still. Die Welt schwieg.
Der einsame keuchende ehemalige Zar des Hochgebirges, Dschaa-Bars, entschwand über die Berge und wusste nicht, wohin. Er musste einen Unterschlupf finden, eine Höhle für seine letzte Zeit der Einsamkeit, und das Lebensende abwarten – die allerletzten Tage eines langsamen unabwendbaren Todes.
Das Raubtier konnte nicht vorhersehen, dass ein Mensch die letzten Tage mit ihm und seinem Schicksal teilen würde. Diese Wesen kannte es nur aus weitester Ferne, vom Echo jener seltenen Klangsalven, den Gewehrschüssen im Gebirge. Unwillkürlich war das Tier jeweils zusammengezuckt und erstarrt, lief dann ohne Richtung und Ziel möglichst weit weg. Noch nie aber hatte es den Menschen aus der Nähe gesehen.
Aber diese Begegnung war ihm bestimmt. Wieder nach des Schicksals Fügung …
2
Manchmal sieht sich das undurchschaubare Schicksal genötigt, in Ort und Zeit des Geschehens einzugreifen, ja die Motive der handelnden Figuren zu lenken. Dann geschieht Unerwartetes – und so war es auch diesmal. Auch für Arsen kam es überraschend, obwohl er fest daran glaubte, die Wahrheit werde am Ende siegen – sie kann nicht untergehen, die Wahrheit. Das ist schließlich deine Aufgabe! Immer wieder den Finger auf sie legen, das ist doch der Sinn unseres Lebens, und am Ende fügt sich alles, wie es sein soll. Na schön, aber was ist Wahrheit? Ja, das ist die große Frage …
Am Freitag begann das Nachtleben merklich früher als an den Werktagen. Schon am frühen Abend war Arsen Samantschin an seinem Stammplatz und bestellte sich etwas zu trinken. Er wollte nicht rauchen. Wie oft hatte er sich geschworen, damit aufzuhören. Dann kämpfte er dauernd mit sich, bis ihn das Verlangen und die innere Ungeduld überwältigten. Verstohlen zog er am Glimmstängel, mal sehen, was passierte. Bald würden in der Dämmerung, draußen vor dem Fenster, die Straßenlaternen aufleuchten, da konnte man die Signale der Ampeln sehen und die blinkenden Scheinwerfer der über den Prospekt fahrenden Autos.
Noch war das Restaurant halb leer, aber nach einer Weile würde es hier so voll sein, dass keine Stecknadel zu Boden fiel. Nicht verwunderlich, denn hierher, ins teuerste Restaurant am Ende des Eichenparks, strömte die Prominenz und Elite. Das ehemalige Haus der Offiziere, im Eurostil hergerichtet und mit internationalem Flair grell und laut als ›Eurasia‹ wieder auferstanden, war zum In-Lokal der Neunzigerjahre geworden.
In diesem ›Eurasia‹ wartete er seine Stunde ab. Es schien seltsam, dass es einen Außenseiter wie ihn – nicht das erste Mal und immer solo – ausgerechnet hierherzog. Dass diese Geschäftemacher, die tagaus, tagein Vabanque spielen und immer am Rand der Pleite stehen, gern über den Durst trinken, begreift man ja. Zu denen gehörte er aber nicht, und die Gründe, weswegen es ihn immer wieder voller Erwartung ins ›Eurasia‹ und sogleich hinter eine Flasche Wein zog, als sei er mit Freunden verabredet, war ihm selbst nicht ganz klar. Er tat sogar, als habe er zu tun, holte aus seinem unverzichtbaren Aktenkoffer allerlei Papiere, blätterte sie durch, korrigierte und redigierte sie scheinbar, goss sich dabei Wein nach und lauschte der Musikkonserve im Hintergrund. Wieder wurde ihm bewusst, wie viel für ihn auf dem Spiel stand. Aber seine Sehnsucht ließ ihm keinen anderen Ausweg, und zugleich ahnte er, dieses Mal könnten sich die Dinge so entwickeln, dass er an die Grenze all seiner Hoffnungen und Erwartungen stoßen würde. Aber er musste den letzten Zug machen. Er musste es einfach schaffen, zu ihr durchdringen, er musste handeln. Nur so konnte das Gespräch beginnen. Aber wie würde sie darauf reagieren? Manche Leute nannten sie schon eine Primadonna, aber er weiß es besser, und sie weiß es auch … Die Hauptsache war, sie nicht zu verpassen! Noch ein Versuch! Um der Wahrheit willen! Wieder kommt er mit seiner Wahrheit daher. Wie oft noch! Aber was soll daraus werden? Wie geht es weiter? Schwer zu sagen, wie sie reagieren wird. Alles, was er erlebt hatte, stand deutlich vor ihm, und an seinen Überzeugungen hatte er nicht die geringsten Zweifel, sie waren ihm teuer, und nie wäre er davon abgerückt, lieber wäre er in der Wüste verdurstet. Aber würde er damit auf Verständnis stoßen? Die Dinge liefen derzeit in eine andere Richtung. Nichts war mehr wie früher. In dieser Welt haben romantische Träume keinen Platz mehr. Aber auf beides will er nicht verzichten, er klammert sich an sie, auch wenn er sich vorkommt wie in einem Fangeisen … Es sieht danach aus, als sausten alle an ihm vorbei auf der Autobahn der modernen Zeiten, und er steht mit erhobener Hand daneben und winkt, wie ein Sonderling, den niemand beachtet … Aber nein, noch ein Versuch! Deshalb war er so früh wie möglich gekommen und hatte sich den besten Platz ergattert, von dem er direkt auf die Bühne unter der Kuppel blickte für die Show am Abend. Diese Position war dafür unerlässlich …
Unterdessen tauchten die Orchesterleute auf und verteilten sich nach und nach auf ihren Plätzen, wie sich das für ein Restaurant gehört, das eine Liveshow mit lokalen Stars und internationalen Gästen im Programm hat.
Den einen oder anderen Musiker, der zuvor im Opernorchester gespielt hatte, kannte er vom Sehen, mit einigen von ihnen hatte er persönlich verkehrt, das war allerdings schon lange her. Wie viel Zeit war seither vergangen! Damals waren sie auf ihn angewiesen …
Die Musik setzte ein – und sie bringt in jedem eine großartige Regung in Gang, zieht den unsichtbaren Vorhang vor einer anderen, lange ersehnten Welt hoch und entführt in einen neuen Raum des Daseins … Nur die Musik kann ihn dem Menschen erschließen – die Alltagshektik entschwindet, zurück bleibt nur der singende Geist. Die Musik – das unerklärliche, unbändige Element – war die tiefsitzende Leidenschaft, mit der er geschlagen war, weit mehr als ein Hobby, vielmehr etwas Hohes und Unfassliches. Nicht selten dachte er an einen Vorfall, der ihn insgeheim über sich selbst lachen ließ, wie ein Idiot war er mit seiner Empörung dagestanden und auf blankes Unverständnis gestoßen. In den frühen Perestroika-Jahren wohnte er in London einer Konferenz als Journalist bei, und das schicke Hotel hatte eine Gästetoilette im Untergeschoss – mit allen Finessen für die Bedürfnisse unter der Gürtellinie ausgestattet. Wie von Zauberhand kamen die Klänge von der Decke über die Klosettschüsseln herab. Die Musik, der Ehrfurcht und Wahrhaftigkeit gebührte, musste rund um die Uhr herhalten für alle Passanten, die es an den Ort zog, wohin auch der Kaiser zu Fuß geht. Ebenda verrichtete er seinerzeit sein kleines Geschäft. Andere kamen und gingen, erledigten ihre Notdurft in den Kabinen, wo sie ihr Wasser abschlugen oder den Hintern wischten, räusperten, rotzten und spuckten, um als abruptes Finale das Abspülwasser aufschäumend in die Klosettschüssel zischen zu lassen, während zu ihrer Ehre Wagner, Chopin oder ein anderes Jahrhundertgenie von oben herab gespielt wurde. Was für eine Musik stürzte hier direkt in die Kanalisation! Er konnte diese urbane Zivilisation mit ihrem ungeheuren Service überhaupt nicht fassen. Wie war das nur möglich! Für ihn war die Musik ein Weg zu Gott! Die Milchstraße des Geistes, wo die Menschenseele in kosmische Dimensionen transzendiert! Sie ist die universale Sprache, sie begleitet alle Gebete und heiligen Gesänge und verleiht ihnen Flügel, wenn unser sehnsüchtiger Glauben über den Wolken in der Ewigkeit aufgehen will. In der Musik wächst der Mensch über sich hinaus, sodass er für einen Moment der Macht des stets lauernden Teufels entgleitet und ein freies und klarsichtiges Wesen wird.
Aber sieh mal einer an, was die sich hier erlauben! Ach, dachte er, durch und durch ein Kind des Sowjetzeitalters: Wo liegt hier in dem Hotel nur das »Buch für Beschwerden und Vorschläge« aus, wo er den Fünfsterne-Administratoren gehörig die Meinung sagen könnte! Aber als er ins Foyer hochstieg und loslegen wollte, fing er an zu stottern und hielt den Mund – richtig komisch fand er sich später; aber dann war es ihm doch gelungen, in seinem durchaus passablen Englisch, das er sich in den Moskauer Studienjahren bei Fortgeschrittenenkursen des Komsomol zur Führung des Kampfes gegen den imperialistischen Westen erworben hatte, sich über die Erniedrigung der Musik im Klosett zu beschweren, worauf man ihm schlicht antwortete: Wenn Ihnen diese Toilette missfällt, gehen Sie in eine andere …
Er war versessen auf Musik und erklärte das eine oder andere Mal halb scherzend: Hätte ich als Kind Musikstunden genossen und nicht den Pferden des Ails in den Bergen nachgejagt, wäre aus mir bestimmt ein Komponist geworden – so wahr mir Gott helfe! Denn, so behauptete er, in seinem Inneren erschaffe er ständig Musik, ganz intuitiv, aber das gelinge ihm nur für sich selbst. Sonst nicht …
Was er allerdings ausgesprochen gerne tat: Mit dem einen oder anderen Artikel in der Zeitung betätigte er sich als musikalischer Anreger oder als Theaterkritiker. Da war es allerdings auch passiert, dass er einmal eine heftige Ladung abbekommen hatte.
Eigentlich war die Sache nicht der Rede wert. Jetzt aber, im Restaurant, kam alles wieder hoch, vielleicht auch weil er sich immer wieder Wein nachgoss und sich ein wenig erhitzte, zumal der französische Wein im ›Eurasia‹ exquisit war. Der Besuch in diesem Etablissement würde ihn, der jede Kopeke als Freischaffender verdienen musste, wieder teuer zu stehen kommen, aber das musste jetzt sein, meinetwegen, sagte er sich und verachtete sich dabei für seine ständigen Hintergedanken ans schnöde Geld … Er blätterte durch die Papiere, erinnerte sich gereizt und verärgert an diesen Typen, solche wie er schießen heutzutage aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen, dieser miese Kerl, ein banaler Schreiberling, ein lokaler Showman und Populist … Ausgerechnet der war in einer Diskussion zum Thema Musik und musikalische Kultur über ihn hergezogen: Hört, wie er kreischt und schreit, unser Kranich, verirrt am Himmel der Perestroika, unser Melomane Arsen Samantschin. Damals, als Samantschin im Schwarm mit Gorbatschow flog, hat er alle um sich gesammelt, in seiner Zeitung Ruchanjat, ha, ha, das »Geistesleben«, so nannte er das Blättchen, das aber auf dem Markt einen schweren Stand hatte, es wollte den Sozialismus erneuern, sozusagen geistig, kulturell. Und jetzt ist es aus mit Gorbatschow und all denen, die ihn umschwärmt haben, aber er, der verirrte Kranich, schreit weiterhin von hoch oben herab, singt seine Loblieder auf seine universale, erhabenste, höchste und allerschönste Musik. Wir bräuchten davon nur eine, das reiche – bravo, bravo! Jawohl, es gibt nichts Erhabeneres, nichts Freieres und Großzügigeres als die Musik auf dieser Welt. Drum darf auch jeder verfahren mit ihr, wie er will – mal hoch zu Ross im Galopp, mal mit Donnerhall, lasst es krachen und einschlagen, wie und wo es mag, wir knallen mit der Peitsche, scharen alle um uns, und los gehts – he, he, Dschingis Khan, heißa, heißa, ha, ha, ha! Dreht euch im Kreis, prustet, quiekt und schreit, hüpft und tanzt, stoßt euch blutig, blast und fickt euch in besinnungslose Trance … Genau das brauchen wir und holen das Letzte aus der Musik, bis euch Hören und Sehen vergeht. Mixt Gott und Sex und alles, was euch Spaß macht, lasst es schäumen und spritzen, und schlürft es runter. Uns solls recht sein, wir vermarkten die Platten, Kassetten, CDs und DVDs. Da stapeln sich die Rubel, Dollars, Som und Sum auf unsren Konten. Man beschimpft uns als Liberale und Neureiche, kein Problem, sollen sie schimpfen. Lieber neureich und liberal als arm und humanistisch. Uns hält nichts auf. Die Show zählt, aufs Bisnes kommt es an. Wir pfeifen auf eure Prinzipien, von wegen erhaben und heilig, klassisch und sakral, und dann noch die Folklore! Ihr könnt flüstern, was ihr wollt, was heute zieht, ist die Ekstase. Total digital! Das ist der neue Humanismus-Schamanismus. Gelebte Freiheit! Es muss krachen und knallen. Wir ändern auch das Klima, wenn ihr möchtet. Das ist unsere Weltrevolution!
Da hast du es, dieses Scheusal!
Warum musste er nur an diese zynische Tirade denken. Zornig schüttete er den Wein in sich hinein und wollte gleich nachgießen, doch da trat ein Angestellter des Restaurants an seinen Tisch. An Aussehen und Auftreten merkte man sofort, dass es kein Kellner war, sondern ein äußerst robuster Herr, der, wie es sich für internationalen Service-Standard gehörte, eine graue Fliege um den dicken Hals und eine große Brille auf der Nase trug. Es musste der Direktor höchstpersönlich sein.
»Verzeihung – Arsen Samantschin?« Dabei legte er seine Visitenkarte mit dem Emblem des ›Eurasia‹ auf den Tisch.
Dieser reagierte in seiner lebhaften Art. »Der bin ich, ja, Arsen Samantschin. Sie haben sich nicht geirrt. Und Sie sind der Eurasia-Chef, der Herr Direktor?« Er erhob sich, streckte ihm die Hand zum Gruß entgegen und fügte mit scherzhafter Feierlichkeit hinzu: »Also der Chef des ganzen Kontinents Eurasien?«
»Oschondoi!« Der Direktor verbeugte sich leicht und bestätigte mit diesem kirgisischen Wort: Genau so ist es. Und in diesem Moment verpasste ihm Arsen Samantschin insgeheim den Spitznamen »Herr Oschondoi«. Doch erst später konnte er sich davon überzeugen, wie zutreffend das war. Der Scherz sollte ein böses Ende nehmen.
Oschondoi zog nach dem Handschlag selbstsicher einen Stuhl zu sich her und setzte sich an die Tischecke, offenbar wollte er über etwas ernsthaft reden, denn er fing damit an, seine schwere Brille zu putzen.
Arsen Samantschin war etwas verwundert über den unerwarteten Besuch des Direktors höchstpersönlich, erzählte aber freundlich weiter. »Verehrter Chefdirektor, gestatten Sie, mein Köfferchen wegzuräumen, damit es Ihnen nicht im Weg ist. Übrigens haben Sie das ›Eurasia‹ exquisit eingerichtet, einfach bemerkenswert, ja, da sitze ich und amüsiere mich, dann und wann komme ich hierher, zwar selten, aber …«
»Ich weiß, ich weiß …«, unterbrach Oschondoi, aber er konnte nicht weiterreden.
»… da sitze ich und amüsiere mich«, wiederholte Arsen Samantschin aufgekratzt und blickte in die Runde. »Sehen Sie nur, wie viele Gäste und was für Schönheiten!« Er kam ins Plaudern, der Wein tat seine Wirkung. »Ohne Frauen, aber wem sag ich das, ist ein Restaurant kein Restaurant!« Samantschin näselte das Wort auf französische Art, aber der andere kapierte das nicht. »Ja, ohne sie ist das Restaurant kein Restaurant, das Theater kein Theater und der Basar kein Basar. Sieh da, da kommen wieder welche. Oho, wahre Schönheiten! Auf dem Balkon oben hat es auch noch Plätze, wer will, darf etwas höher sitzen. Wie schön, das Orchester stimmt sich ein! Oh, wie ich darauf warte, ich warte auf die Musik! Deshalb bin ich gekommen. Was für Kronleuchter! Sehen so italienisch aus!«
Der Direktor nickte. »Oschondoi! Genau getroffen, so ist es, italienisch.« Entschlossen hob er den Arm etwas an, wie um nicht unterbrochen zu werden: Ein Moment, der Herr, ich habe auch etwas zu sagen.
»Ich bin zu Ihnen an den Tisch gekommen, weil Sie … weil nämlich …« Er stockte mitten im Satz.
»Sie sind willkommen!« Arsen Samantschin blühte auf, offensichtlich hatte man ihn erkannt, er ist also nicht völlig vergessen, man kennt ihn in der Öffentlichkeit, sogar so ein Manager, ein Chef. »Na, dann trinken wir einen zusammen!«, schlug er liebenswürdig vor und blickte aufrichtig in das fleischige Gesicht seines Gegenübers. »Ich muss schon sagen, Sie haben einen erlesenen Wein, wirklich ausgezeichnet! Darf ich Ihnen etwas einschenken, und dann bestelle ich noch einen.«
»Nein, nein!« Oschondoi hielt die Hand mit der Flasche fest. »Deshalb bin ich nicht gekommen. Ich bin dienstlich hier. Ja, viele kennen Sie, Sie sind ein bekannter Mann, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Ich komme wegen einer anderen Sache. Da ist ein Problem. Die Lage ist Folgende: Wir haben heute etwas sehr Großes vor, also, das Dinner für die ausländischen Sponsoren – die Kanadier, der Konzern fürs Gold in Aksuisk, ein Global Player, Sie verstehen, und die Unsrigen, unsere Gold-Partner, laden dazu ein. So ist das eben, alles sehr wichtige Leute, selbstverständlich mit ihren Frauen und Leibwächtern. Und das Konzert! Darum geht es eigentlich nicht, es geht um etwas anderes. Ich will nicht um den heißen Brei herum reden, man hat soeben angerufen und uns angewiesen, dass Arsen Samantschin heute nicht im Saal sitzen darf. So lautet der Auftrag, das wird verlangt.«
»Halt! Das ist doch nicht möglich! Wer ist es denn, der sich so sehr um mich kümmert?«, platzte es aus Arsen Samantschin heraus. »Wer verlangt das und mit welchem Recht …«
»Ich sage nur, was man mir aufgetragen hat!« Oschondoi fühlte sich angegriffen und bekam einen roten Kopf. »Wer sich um wen kümmert, geht mich nichts an«, sagte er knapp. »Anweisung von oben!« Der Kopf zeigte in Richtung Decke, wo die Kronleuchter brannten. »Ich tue nur meine Pflicht. Ich rate Ihnen, das Restaurant unauffällig zu verlassen und keine weiteren Gespräche zu führen. Je schneller, desto besser. Erheben wir uns also jetzt gleich und bringen es hinter uns. So ist die Anweisung.«
»Anweisung, Anweisung! Was soll das?« Samantschin brachte nur die paar Worte heraus, erbleichte und presste die Lippen hart zusammen. Soll er jetzt einen Skandal vom Zaun brechen, dass diesem Großmaul Hören und Sehen vergeht? Den Tisch zurückstoßen, ihm in die Fresse hauen, laut und vernehmlich gegen diese Beleidigung und Ehrverletzung protestieren und weiß Gott was sonst gegen die Herabwürdigung seiner Persönlichkeit und seiner Menschenrechte unternehmen? Da traf ihn die Vermutung, worum es ging, wie der Blitz, und der Sinn stand ihm nicht mehr danach. Der Ausbruch der Emotionen war mit einem Schlag erstickt, das Feuer in der Brust erloschen. Im Grunde geschah das nicht aus Selbstbeherrschung, sondern im Gefühl des Absturzes, wie nach einem Knockout, wie ein gefällter Baum, der auf einmal wegknickt. Die Erde unter seinen Füßen erbebte und krachte, der gesamte Raum schien ihm plötzlich kahl und leer, weil ja all das, was er in seinem Innersten verspürte, sich einbildete und begreiflich machen wollte, was in ihm unterschwellig lebte und strömte und wovon er auch träumte, es endlich herauszufinden, was die stille Musik in ihm erklingen ließ – all das brach schlagartig zusammen wie der Baum unter der Axt und beraubte ihn seines Wesens, seiner Würde und seines Selbstvertrauens. Das war so niederschmetternd, dass ihm nur noch eine Frage einfiel: Ob sie dahintersteckte? Ist sie jetzt wirklich so weit gegangen? Ohne daran zu glauben, was sich ihm aufdrängte, blickte er auf die Bühne – sie war noch nicht da, aber die Band stimmte sich auf ihren Auftritt ein, indem sie dem Publikum ein buntes Potpourri an Melodien vorspielte. Dann holte er das ständig griffbereite Handy – seinen ganzen Stolz – aus der Tasche und fing an zu wählen. Die Finger zitterten. Er fürchtete sich davor, dass ihm die Stimme versagen könnte. Oschondoi durfte das auf keinen Fall bemerken. Aber er konnte nicht anders. Und ahnte, er würde sie an ihrem Apparat nicht erreichen, was sie selbst nach einigen Klingelzeichen mit einer völlig verfremdeten Stimme bestätigte: »Hier ist Aidana Samarowa. Ich bin vorübergehend nicht erreichbar«, worauf sofort leere Amtszeichen folgten.
»Keine Antwort?« Oschondoi erkundigte sich teilnahmsvoll mit hochgezogenen Augenbrauen.
Samantschin schwieg. Was hatte Oschondoi wohl mit seiner Frage gemeint? Er fragte ja nicht, wer es sei, der nicht antworte, ließ auch nicht durchblicken, wen er vermutete oder ob er sogar wisse, um wen es sich handelte. Aber Arsen wollte ihm jetzt nicht auf den Zahn fühlen, nein, das wäre erniedrigend. Was geht das den überhaupt an! Jetzt muss ich sofort entscheiden, wie es weitergehen soll. Aufstehen, mich unauffällig entfernen und einen Schlusspunkt setzen – oder ultimativ eine Erklärung verlangen, wer diese Anweisung gegeben hat und weshalb er, der Chef des Restaurants, sich dermaßen ereifert und selbst den Rausschmeißer spielt.
»Nun, wie stehts?« Oschondoi erhob erwartungsvoll seine Stimme. »Stehen wir auf? Ich begleite Sie gerne bis zum Ausgang.«
»Nein, kommt nicht infrage, ist völlig unnötig«, wandte Arsen Samantschin ein, »seien Sie unbesorgt, ich kenne den Weg.« Verärgert ließ er den Deckel seines Aktenkoffers zuknallen.
»Ganz wie Sie wünschen! Ist vernünftig. Fürs Essen und den Rest brauchen Sie nichts zu bezahlen. Das geht aufs Haus, nicht der Rede wert«, meinte Oschondoi großspurig.
Da explodierte Arsen Samantschin, als habe er auf die Gelegenheit gewartet, seiner Wut freien Lauf zu lassen. »Was erlaubst du dir!«, schleuderte er Oschondoi ins Gesicht und wechselte dabei betont vom Sie zum Du. »Für wen hältst du mich eigentlich? Ich bin doch kein dahergelaufener Bettler! Scher dich zum Teufel! Ich pfeif auf den Laden hier, und du kannst mir gestohlen bleiben. Hol den Kellner her, und ich rechne bis auf die Kopeke ab, bevor ich von hier verschwinde. Verpiss dich! Das wars!«
»Bitte schön! Ganz wie du willst. Der Kellner kommt sofort. Und dann aber raus hier!«, verwarnte ihn Oschondoi, erhob sich, hochrot und stiernackig, langsam von seinem Platz und ging, ohne sich umzusehen.
Da erlaubte sich Arsen Samantschin einen unverzeihlichen Fehler, in dieser Lage war das einfach eine Dummheit: Er spielte den Unbeugsamen und trieb den Skandal auf die Spitze.
»Ach, so einer bist du!«, schleuderte er Oschondoi hinterher, und als sich dieser umdrehte, herrschte er ihn direkt an. »Glaub nur nicht, du kannst mich einfach so rauswerfen! Das wird Folgen haben. Ich bin nicht irgendwer. Ich bin Journalist, unabhängiger Journalist! Denk daran!«
Das brachte Oschondoi so richtig auf die Palme, er feuerte eine volle Ladung zurück: »Woran soll ich denken? Ein Journalist, dass ich nicht lache. Ein Hampelmann bist du. Euch muss man nur was zu fressen geben, und schon kriegt man alles von euch. Du kannst mich kreuzweise, du aufgeblasener Angeber. Um dich machen ja sogar die Weiber einen Bogen, wenn sie dich sehen.«
»Das geht dich einen feuchten Dreck an.«
»Hast sie wohl nicht alle! Wenn du in fünf Minuten nicht weg bist, dann blüht dir was, Wichser. Ich kann auch anders. Schluss! Und jetzt halt dein Maul!« Oschondoi riss sich die Brille von seinem vor Wut entstellten Gesicht und stürzte davon, ohne diesen »unabhängigen Journalisten«, um den ja sogar die Weiber einen Bogen machten, noch eines Blickes zu würdigen.
Wenn Arsen Samantschin bloß geahnt hätte, was ihm diese Geschichte noch alles einbrocken würde.
In dem Moment tauchte der Kellner auf. »Verzeihung bitte, hier ist die Rechnung!«
Aber das passte ihm jetzt auch nicht. Noch immer außer sich und einem weiteren Wutanfall nahe, schob Arsen Samantschin den kleinen Teller mit der Rechnung von sich.
»Bring mir erst noch einen Wodka.«
»Wodka?«
»Ja, Wodka! Wenn du kein Russisch kannst, dann eben Arrak!«
»Wie Sie wünschen. Wie viel darf es sein?«
»Was du herschleppen kannst! Los, los, beeil dich!«
»Jawohl!« Der Kellner eilte flink zum Tresen. Arsen blickte aufgebracht um sich. Niemand sah her zu ihm. Alles ging seinen gewohnten Gang, wie jeden Abend. Das Restaurant war brechend voll, auch die Balkonplätze füllten sich. Raunende Gespräche, Lachen flirrte durch den Raum, Gläser klirrten beim Anstoßen, und die Musik war eingestimmt auf die Atmosphäre im Saal. Rundum flitzten Lichtstrahlen die Wände entlang, und all das belebte und erfrischte die Gemüter. Er war der Paria in dieser Runde. Ihm war schwindlig, beklommenen Herzens begriff er, jetzt dürfte sich nicht mehr erfüllen, womit er heute rechnete. Er versuchte sich auszumalen, wie verhasst er einigen Personen war, dass sie ihn regelrecht deportieren wollten. Wer waren sie denn? Er musste genau wissen, woher der Wind wehte! Attackierten ihn Aidana oder ihre neuen Gönner? Wie konnte sie ihn nur so verraten und den Feinden ausliefern? Woher wussten diese Leute überhaupt von ihren persönlichen Problemen, das ging die doch nichts an. Und wenn sie hinter dem Rausschmiss steckte? Welch eine Niedertracht! Aber warum eigentlich? Was war da passiert, dass sie ihn hochkant vor die Tür setzten!
Ja, mit Aidana gab es ein Problem. In ihrer Beziehung war auf einmal eine Pause eingetreten, die länger und länger dauerte, sie wollte sich mit ihm nicht mehr treffen.
Deshalb hatte er sich bei seinem letzten Besuch im ›Eurasia‹ einfach neben die Bühne gestellt, sein Köfferchen umklammernd. Den ganzen Abend stand er wie angewurzelt und ließ sie nicht mehr aus dem Blick. Er wollte ihr zurufen: He, du unerreichbare Göttliche, komm endlich zu dir, hast du etwa die Ewige Braut schon beerdigt, bevor du sie ein einziges Mal auf die Bühne gebracht und ihre Arien gesungen hast? Verkauft und verraten hast du sie? Treibst dich in Spelunken herum! Die Schmähungen, die in ihm aufwallten, würgten ihn, aber es kam kein einziges Wort über seine Lippen. Er stand einfach stur da und starrte auf die Bühne, und in seinem Köfferchen lag das große Werk wie eine stumme Geisel, er hielt es für das Größte, oh, davon war er überzeugt, für sein Manuskript würde die Stunde noch kommen … Aber wann sollte sie anbrechen? Für wen ist das Werk denn bestimmt? Doch nur für sie … Währenddessen dröhnte die Musik auf der Bühne, das Schlagzeug heizte gehörig ein, die Sängerin verströmte sich in ihrem Gesang, ihr Körper bog sich in erotischen Windungen und Rhythmen. Niemand nahm Notiz, wie er ihretwegen litt, weil sie da Stimme und Körper verausgabte, eine Tagelöhnerin dieser Bulldozermusik, die alle Gedanken hinwegfegt, die Menschen in hämmerndem Takt vor sich hertreibt. Aber ihr Gesang entzündete die Leidenschaften, sodass alle außer Rand und Band gerieten, sie mit unersättlichen Blicken verschlangen und ihr ekstatisch applaudierten. Nur er war reglos dagestanden, mit dem Köfferchen in der Hand, und einige Male begegneten sich ihre Blicke wie Blitze im Ansturm des Wahnsinns. Sie hatte also begriffen … Und nun lag auch wieder diese Spannung zwischen ihnen, auf einer höheren Ebene. Wie ein Neubeginn …
Nur eins ist diesmal anders: Gleich wird man mich aus dem Saal werfen und vor die Tür setzen. Soll ich mich fügen und mit dem Köfferchen und dem darin liegenden großen Werk verschwinden?
Der Kellner kehrt zurück mit der Flasche Wodka auf dem Tablett. »Bitteschön, darf ich eingießen? Ins Weinglas oder ins Wasserglas?«
»Ins Wasserglas!«
»Wie viel?«
»Randvoll!«
Er schüttet das volle Glas Wodka in sich hinein wie in einen heißen Schlund, als wolle er den Brand löschen. Er dreht fast durch und holt tief Luft.
»Was bin ich schuldig?«, fragt er barsch und mustert die auf der Rechnung stehenden Ziffern, zählt gestreng bis auf die letzte Kopeke das Geld nach, was den Kellner verwundert. Dann geht er schweigend davon, mit steifen Schultern und gerecktem Hals, sichtlich bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, dass er sich nach dem Glas Wodka kaum noch gerade halten kann. In der Garderobe nimmt er den Hut und setzt ihn mechanisch auf den Kopf. Er trägt immer einen Hut, im Sommer und im Winter. Nicht von ungefähr nennt ihn Aidana den Hut-Mann. Und schon am Ausgang, hört er ihre Stimme von der Bühne her, die Stimme von Aidana Samarowa, hört, wie alle im Restaurant ihr enthusiastisch applaudieren, die Show beginnt. Die Diva ist da! Die Musik setzt ein, Lichtreflexe blitzen auf, erste begeisterte Ausrufe sind zu hören: Ai-da-na! Ai-da-na! Doch Arsen Samantschin blickt nicht zurück, angespannt hält er sein Köfferchen hoch, verlangsamt seine Schritte, kämpft gegen den in ihm hochkriechenden Rausch und steigert sich in seine Wut hinein – was für ein Riesenspaß: Alles zum Anfassen! Hereinspaziert!, schreien Mode und Reklame, alles ist auf Effekt getrimmt, einer überholt den andern, süchtig nach Beliebtheit, Ruhm, und letzten Endes geht es nur um Scheine, sie sollen fallen wie die Blätter von den Bäumen; und er brummelt und flüstert und spöttelt: Geld ist der beste Freund auf der Welt, o la, la, o la, la, heißa, heißa, ha, ha, ha. Er möchte auftrumpfen, wenn er es noch schaffen würde, und mit den Füßen stampfen und aus vollem Hals lachen, o la la, o la la, heißa, heißa, ha ha ha. Hör auf zu denken, jetzt musst du hüpfen, Arsa-Arsa! Aber er reißt sich zusammen. Und auf einmal möchte er losheulen. Aufjaulen, dass ihn der Himmel erhört und erstickt. Es ist alles zu viel geworden. Wo ist nur der Ausweg, er muss fort, damit er nichts Schlimmes anstellt. Auf der Stelle weg, bevor es zu spät ist, für immer verschwinden.
»Lieben und töten! Wie ist das nur möglich? Du bist ja besoffen! – Nein, das ist nicht der Suff«, antwortet er sich selbst, und es fröstelt ihn beim bloßen Gedanken daran. »Lieben und töten …«
Er ging weg und dachte bei sich: Noch auf dem Totenbett werde ich das nicht vergessen und verzeihen.
3
Wem ist was auf dieser Welt bestimmt? Genau darum geht es: Wem ist was bestimmt? Das war schon immer die Frage, und wird es bleiben. Niemand kann ihr entrinnen. In Erwartung des Schicksals kommen und gehen die Tage. Und die Erwartung bleibt bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde … So wird es stets sein.
Der Wind weht, wie er will – so kann sich auch das vorausschauende Schicksal jederzeit eines anderen besinnen, wenn es seinen alles durchdringenden Blick schweifen lässt und alles ausspäht, was sich in der Welt, in den Gefühlen, Gedanken und Handlungen der Menschen abspielt. Es legt seinen Klammergriff um alles, verknüpft weitgespannte Vorsätze mit den unterschwellig heranreifenden Umständen. Auf wen das Los fällt, der muss seinem unzähmbaren Willen folgen und bekommt seine Macht zu spüren. Wachenden Auges sieht er auf seinem Weg das Verhängnis auf sich zukommen, wendet sich zum Himmel und ruft ihn an: Warum musste das sein? Woher kommt das nur? Wo ist der Ausweg? Was soll ich tun?
Aber der Himmel schenkt ihm kein Gehör, nicht für Geflüster noch Schreie …
Sogar das wilde Tier in den Bergen flehte den Himmel um Hilfe an, es röchelte und brüllte zum Mond empor, aber der Mond verbarg sich, mal hinter den Wolken, mal hinter den verschneiten Gipfeln. Denn das allgegenwärtige Schicksal hatte den Bergleoparden in den Blick gefasst und hielt ihm etwas bereit.
Abgeschlagen im Gerangel der Männchen, im Rudel ausgeschieden und somit des Rechts auf Vermehrung und Fortpflanzung beraubt, kamen über Dschaa-Bars, den von niemand begehrten und gebrauchten Paria, schwere Tage. Sie waren umso bedrückender, als er sich vorerst noch instinktiv wehrte und sich mit seinem Zustand nicht abfand, noch immer ersehnte er sich die Rückkehr der ehemaligen Energie und geriet er mitunter regelrecht in Wallung. Wie früher wollte er sich einem Weibchen im Rudel nähern, doch sie waren alle schon vergeben, und sein Werben wurde nicht erwidert. Es kam vor, dass er losstürzte, um sich in Stellung zu bringen und einem Rivalen an die Kehle zu gehen, aber die Rauferei endete wie schon gewohnt unentschieden. Alles vergeblich, und bald nahm man ihn im Rudel nicht mehr ernst, als sei er schon gar nicht mehr auf der Welt. So musste er sich von allen Plätzen, wo die Schneeleoparden nach großer Beute zusammenliefen, abseits halten. Das kostete ihn unglaubliche Geduld, er kauerte in angespannt zitternder Ruhestellung und wartete ab, bis er sich über die von den anderen übrig gelassene Beute hermachen konnte. Der letzte Rest war sein Anteil. Äußerlich war er so eindrucksvoll wie früher, mit gewaltigem Kopf und ermüdeten, aber immer noch leuchtenden Augen unter der Stirn, dem wellig knochigen Nacken und einem zumeist ruhigen und weich gebogenen Schweif, was davon zeugte, dass Dschaa-Bars sich zu beherrschen wusste, wenn es nötig war.
Doch das Rudel kümmerte das überhaupt nicht. Besonders die Raubtierpaare, die mit ihren Jungen lebten, schauten grimmig drein und mieden Dschaa-Bars, als sei er an etwas schuld. Auch das ehemalige Weibchen, seine Barsin, hatte für ihn überhaupt nichts übrig, zeigte es ihm mit herausfordernder Frechheit und zog an ihm, als sei er ein Schatten, vorüber, Seite an Seite mit dem ebenso frechen, neu gefundenen Verehrer. Solche Erniedrigung musste Dschaa-Bars hinnehmen, der doch vor Kurzem noch alle Schneeleoparden in diesen Bergen und Schluchten des von ewigem Schnee bedeckten Tienschan erfolgreich angeführt hatte. Aus dem Rudel ausgeschlossen, hauste er abseits und schlug sich durch, indem er allerlei Kleinwild jagte, Dachse und Zieselmäuse, manchmal kamen ihm auch Hasen zwischen die Pranken. Hunger musste Dschaa-Bars zwar nicht leiden, aber er konnte sich nicht wie einst am festen Fleisch der wilden Paarhufer satt fressen, die er fast jeden Tag tollkühn, aber vergeblich anfiel. Auch hier blieb ihm der Erfolg versagt.
Trotz alledem war sein Widerstandswille nicht erschöpft, sonst hätte er sich dem Schicksal völlig ergeben, sich in sein Los als Paria fügen und gedemütigt weiterleben können. In ihm rumorte es, er rebellierte gegen die Wirklichkeit, in der Tiefe seines Raubtierwesens wuchsen Trotz und Widerwille. Eine wilde Kraft von innen her trieb ihn zum Aufbruch aus den vertrauten Bergen und Schluchten, die ihm so viel Unheil brachten, um für immer und unwiderruflich zu verschwinden. Die Auflehnung schwoll an und ließ das Blut in ihm kochen, das war wie der Ruf einer anderen Welt. Dorthin konnte man nicht in einem Satz springen, diese Welt lag jenseits des großen, hohen Passes, dicht unter dem Himmel am Schneekamm. Dorthin musste er sich auf den Weg machen, an die Grenze der bewohnten Welt, wo keinerlei Kreatur ständig leben konnte, wo nur zur Sommerszeit für wenige Tage ein Pfad offen war, aufs höchste Plateau zwischen den Gebirgskämmen des Usengilesch-Bügels, wohin nur die größten Flugmeister unter den Vögeln gelangen konnten. Unstillbare Sehnsucht zog ihn dorthin, denn an jenem Ort hatte er sich früher jeweils während der wenigen Sommertage eingerichtet. Ja, darauf lief jetzt seine Tragödie hinaus. In die Unerreichbarkeit des zuvor Erreichbaren …
Der Weg zum Pass war steil und felsig, er führte durch tiefe Schneefelder, die nie tauten, und zog sich dahin dicht unter den Wolken, deren Körper über den Pass krochen, sich dann auflösten oder über die Hänge abglitten, von Winden über die Berge getrieben, als wären es Herden. All das dicht neben ihm, wie mit der Hand zu greifen.
Dschaa-Bars ließ seine Blicke wandern, machte nach kurzer Strecke immer wieder halt, trat dabei von einem Bein aufs andere und zierte sich jedes Mal verlegen – durch wie viele Schneewehen musste er noch? Und wieder ging er los, stapfte durch die Schneewächten, ertrank bis zum Hals, bis er es wieder schaffte, sich mit allen vier Pfoten freizukraulen, weiterzukriechen und mit dem ganzen Körper zum eisigen Schoß der Felsen hoch zu robben. Doch schon hier schnaufte er so schwer wie bei einem rasanten Lauf nach Beute, das Herz klopfte und pochte in den Ohren, am schlimmsten war der Erstickungsanfall, der in Blitzen alles um ihn herum fortzuschleudern und zu zerstören schien. Die Kräfte versagten, er konnte nicht weiter und höher. Die verfluchte Atemnot warf ihn nieder und würgte ihn. Er röchelte und brüllte vor Ersticken und konnte keinen Schritt mehr vor den andern setzen. Dschaa-Bars brach zusammen. Die Strecke, die ihm zu gehen verblieb, war überschaubar, mit den Kräften von einst hätte er sie binnen einer Stunde zurückgelegt und den Pass bezwungen, er wäre schließlich in der anderen Welt angekommen. Für ein kurzes Glück in den Himmeln. Aber wenn er es geschafft hätte, wäre es eine Ankunft ohne Rückkehr geworden – für immer, bis zum letzten Atemzug und Augenblick des Lebens …