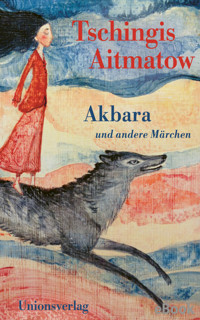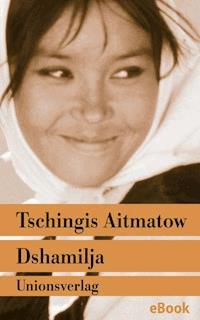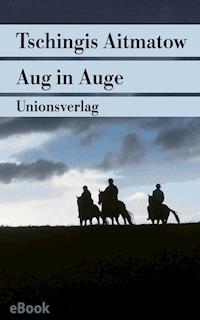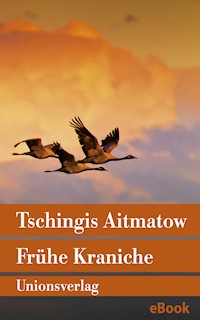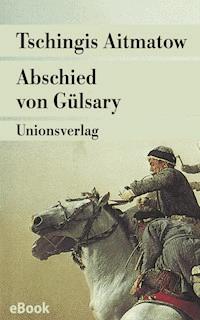12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die Wölfin Akbara und ihr Wolf Taschtschajnar ein letztes Mal vor dem schlimmsten Feind - dem Menschen - ausreißen, ahnen sie nicht, dass ihr Ende unausweichlich ist. Denn wo immer der Mensch in das seit Urzeiten herrschende Gleichgewicht der Natur eingreift, wächst die Verwüstung des Lebens. Awdji Kallistratow, der ausgestoßene Priesterzögling und Gottsucher, kann sich mit der gleichgültig und selbstsüchtig gewordenen Welt nicht abfinden. Auf der Suche nach den Wurzeln der Kriminalität reist er in die Steppe Mujun-Kum, wo der berauschende Hanf wächst. Eine Reise, die ihm zum Kreuzweg wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Wo immer der Mensch in das seit Urzeiten herrschende Gleichgewicht der Natur eingreift, wächst die Verwüstung des Lebens. Awdji Kallistratow, der ausgestoßene Priesterzögling und Gottsucher, kann sich mit der gleichgültig und selbstsüchtig gewordenen Welt nicht abfinden. Auf der Suche nach den Wurzeln der Kriminalität reist er in die Steppe Mujun-Kum.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Friedrich Hitzer (1935–2007) war freischaffender Autor, Übersetzer und Redakteur und engagierte sich als Kulturvermittler zwischen Europa, Russland und Mittelasien. 2006 wurde er mit der Puschkin-Medaille für sein Lebenswerk als Brückenbauer geehrt.
Zur Webseite von Friedrich Hitzer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Der Richtplatz
Roman
Aus dem Russischen von Friedrich Hitzer
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die russische Originalausgabe erschien unter dem Titel Placha in der Zeitschrit Nowyj Mir, Heft 6, 8 und 9, Moskau 1986.
Originaltitel: Placha (1986)
© by Tschingis Aitmatow 1986
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Romy und Hilmar Pabel (entnommen dem Bildband Auf Marco Polos Spuren, erschienen im Süddeutschen Verlag, München)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30748-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.06.2024, 23:46h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER RICHTPLATZ
Erster Teil1 – Nach der kurzen und wie vom Atem eines …2 – Vor Tagesanbruch kühlt die Luft über der Savanne …3 – Der Winter war bereits in die Mujun-Kum eingezogen …4 – In all der Zeit hatte Awdij Kallistratow einige …5 – Ein halber Tag war vergangen, der Zug fuhr …6 – Im Morgengrauen des vierten Tages tauchten die buckligen …Zweiter Teil1 – Einen Gruß dem Verletzten«, sagte Awdij so locker …2 – Jener Morgen in Jerusalem war heiß, und er …3 – Der Sommerregen in der Steppe bereitete sich über …4 – Im Stationskrankenhaus von Shalpak-Saz, wohin man Awdij Kallistratow …5 – Ober-Kandalow entdeckte Awdij Kallistratow am Bahnhof, als er …Dritter Teil1 – Menschen suchen das Schicksal, und das Schicksal sucht …2 – Mit großer Mühe, Überredungskünsten und Zärtlichkeiten war es …3 – Am Morgen des anderen Tages, etwa gegen zehn …4 – An dem Tag brachen die Wölfe auf …5 – Bis zu jenem tragischen Ereignis hatte er drei …6 – Die Frühlingstage hielten an, man konnte sogar sagen …WorterklärungenNachweisMehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Friedrich Hitzer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Asien
Zum Thema Tier
Erster Teil
1
Nach der kurzen und wie vom Atem eines Kindes hingehauchten Erwärmung des Tages auf den zur Sonne geneigten Gebirgshängen schlug unfassbar rasch das Wetter um. Von den Gletschern her setzte der Wind ein, durch Spalten und Schluchten drang buckelig und spitz die Dämmerung vor und trug unmerklich das kalte Graublau der bevorstehenden Schneenacht mit sich.
Schnee gab es in Massen ringsum. Über den gesamten Höhenzug um den Issyk-Kul waren die Berge von Schneewehen zugedeckt; über diese Gegend war vor ein paar Tagen ein Sturm hinweggefegt wie Feuer, nach Laune dieses eigenwilligen Elements plötzlich auflodernd. Unheimlich, was sich da so heftig abspielte – die Berge verschwanden in der undurchdringlichen Finsternis des Schneesturms, und es verschwand der Himmel, als hätte sich die eben noch sichtbare Welt in ein Nichts verwandelt. Dann kam alles zur Ruhe, und das Wetter klarte rundum auf. Seit der Befriedung des Schneesturms standen die Berge gefesselt von riesigen Verwehungen in der erstarrten und allem auf der Welt entrückten, erkalteten Stille.
Und nur dieses beharrlich anwachsende und zunehmende, sich nähernde dumpfe Rattern eines Großraumhubschraubers, der sich zu jener vorabendlichen Stunde durch den Cañon Usum-Tschat hindurcharbeitete, hin zum Gletscherpass Ala-Möngkü, der in windiger Höhe von Wolkengespinsten eingenebelt war, es steigerte sich mehr und mehr, kam heran, anhaltend von Minute zu Minute stärker werdend, es gewann schließlich die Oberhand, es ergriff die Herrschaft über den ganzen Raum und schickte sich an, mit einem alles erdrückenden, dröhnenden Getöse über die nur für Laute und Licht erreichbaren Grate, Gipfel und Wolkengletscher zu schwimmen. Um das zwischen Felsen und Schluchten vielfach widerhallende Echo vermehrt, rückte das bedrohliche Gedröhn hoch oben mit einer derart unabwendbaren und furchterregenden Kraft voran, dass es schließlich schien, als fehlte nur wenig, und das Schreckliche geschähe, wie damals – beim Erdbeben …
In einem kritischen Moment geschah es dann auch: Von einem steilen, durch die Winde nackt gefegten Berghang, der unter der Flugbahn lag, löste sich unter dem Schlag des Schalls etwas Geröll und kam sofort wieder zum Halt, wie geronnenes Blut. Dieser Stoß genügte indessen, dass sich vom bebenden Boden einige wuchtige Gesteinsbrocken aus dem Steilhang losrissen und weit in die Tiefe hinabrollten, immer schneller und heftiger, Staub und Schotter hinter sich aufwirbelnd, durch Stauden von Rotweide und Berberitze hindurch, eine Schneewehe völlig zersprengten, bis sie am Fuß des Steilhangs wie eine Kanonenkugel einschlugen und die Höhle erreichten, die hier von Grauwölfen in der Nähe eines halb zugefrorenen warmen Baches gebaut war, unter einem ausladenden Felsen, an einer von Gestrüpp verdeckten tiefen Spalte.
Die Wölfin Akbara sprang vor den herabstürzenden Steinbrocken und dem niedersprühenden Schnee zurück und wich rückwärts in die Dunkelheit der Spalte, gespannt wie eine Feder, mit gesträubter Nackenmähne und mit wild glühenden, im Halbdunkel phosphoreszierenden Augen, bereit, sofort und augenblicklich zu kämpfen. Aber ihre Ängste waren dieses Mal unnötig. In offener Steppe ist das schrecklich, wenn du, auf der Flucht vor einem dich verfolgenden Hubschrauber, nirgendwohin springen kannst, während er unablässig deiner Fährte nachjagt, dich einholt, dich mit dem Sausen der Rotoren betäubt und von oben herab mit Feuerstößen aus Maschinenpistolen angreift, wenn es also in der Welt überhaupt keine Rettung mehr vor einem Hubschrauber gibt und die Erde sich auch nicht auftut, um den Gejagten Zuflucht zu gewähren, wenn es keine solche Spalte gibt, wo du dein ewig verwegenes Wolfshaupt vergraben könntest …
In den Bergen ist es ganz und gar anders – hier kannst du immer davonspringen, immer etwas finden, wo du dich verbergen und die Gefahr abwarten kannst. Aber die Urangst ist nie vernünftig, und erst recht nicht die vor Kurzem erkannte und erlebte. Mit dem Herannahen des Hubschraubers begann die Wölfin, laut zu winseln, krümmte sich, den Kopf verbergend, zusammen, und trotzdem hielten es die Nerven nicht aus, mit einem Ruck riss sich Akbara los und heulte auf, erfasst von ohnmächtiger, blinder Furcht, und kroch auf dem Bauch krampfhaft zum Ausgang vor, böse und verzweifelt die Zähne fletschend, bereit, auf der Stelle zu kämpfen, als könne sie es damit in die Flucht schlagen, dieses über dem Spalt dröhnende eiserne Ungeheuer, bei dessen Erscheinen sogar die Steinbrocken von oben herabzuprasseln begannen wie beim Erdbeben.
Auf das panische Geheul Akbaras hin zwängte sich ihr Wolf in die Höhle – Taschtschajnar, der sich seit der Zeit, da die Wölfin schwer trug am Leib, meistens außerhalb der Höhle befand, in der Abgeschiedenheit des dichten Gestrüpps. Taschtschajnar, er hatte seiner zerschmetternden Kiefer wegen von den Hirten der Gegend seinen Namen – Steinbrecher – bekommen, kroch zu Akbaras Ruhelager, um sie knurrend zu beruhigen, als wollte er sie mit seinem Körper vor Unglück schützen. Sie presste sich an seine Seite, und immer fester an ihn gedrückt, winselte die Wölfin weiter, als flehte sie klagend den ungerechten Himmel oder irgendjemand an, vielleicht ihr unglückliches Schicksal, und sie konnte sich, am ganzen Körper zitternd, noch lange nicht beherrschen, sogar als der Hubschrauber schon jenseits des mächtigen Gletschers Ala-Möngkü verschwunden und hinter den Wolken gar nichts mehr von ihm zu hören war.
Und in dieser allumfassenden Bergstille, die alles verschlang, als sei die Lautlosigkeit des Weltalls eingebrochen, verspürte die Wölfin plötzlich in ihrem reifenden Leib lebendige Stöße und Regungen. So war es auch gewesen, als einmal Akbara, noch in den ersten Zeiten ihres Jagdlebens, im Sprung eine große Häsin erstickt hatte: Im Bauch der Häsin waren damals auch solche Regungen unsichtbarer Wesen aufgekommen, und dieser seltsame Umstand hatte die junge, neugierige Wölfin gar sehr verwundert und gebannt, argwöhnisch hatte sie auf ihr ersticktes Opfer geschaut und erstaunt die Ohren gespitzt. Das war so wundervoll und unbegreiflich gewesen, dass sie sogar versucht hatte, ein Spiel mit den unsichtbaren Körpern anzufangen, genauso wie es die Katze mit den halb toten Mäusen zu treiben pflegt. Und nun nahm sie selbst in ihrem Inneren eine solche lebende Last wahr, da gaben welche Zeichen von sich, die unter günstigen Umständen binnen anderthalb bis zwei Wochen das Licht der Welt erblicken würden. Doch vorerst waren die Tierjungen vom Schoß der Mutter noch untrennbar, ein Teil ihres eigenen Wesens, und deshalb erlebten sie auch bis zu einem gewissen Maß im entstehenden, noch unklaren, nebelhaften embryonalen Vorbewusstsein denselben Schrecken, dieselbe Verzweiflung wie zu dieser Stunde die Wölfin selbst. Das war ihre erste Fernberührung mit der Außenwelt, mit der sie erwartenden feindseligen Wirklichkeit. Das brachte sie auch dazu, sich im Leib zu bewegen und damit auf das Leiden der Mutter zu reagieren. Auch für sie war es schrecklich, die Angst hatte ihnen das Blut der Mutter übertragen.
Aufmerksam dem lauschend, was ohne ihren Willen ablief, lauschend der in ihrem Schoß auflebenden Last, geriet Akbara in Erregung. Das Herz der Wölfin begann wiederholt zu stechen und füllte sich mit Kühnheit und Entschlossenheit, unbedingt die zu verteidigen und vor jedweder Bedrohung zu schützen, die sie in sich austrug. Jetzt hätte sie es bedenkenlos mit jedem und allem aufgenommen. In ihr war der große natürliche Instinkt erwacht, die Nachkommen zu erhalten. Zugleich spürte Akbara das Bedürfnis wie eine heiße Welle heranströmen, zu liebkosen, zu erwärmen und lange, lange Zeit den Säugern Milch zu geben, als wären sie bereits an ihrer Seite. Das war ein Vorgefühl des Glücks. Und sie stöhnte vor Zärtlichkeit, vor Erwartung, dass Milch in die rot und prall geschwollenen, riesigen, in zwei Reihen am Wanst herausragenden Zitzen trat, ein Gefühl der Wonne durchzog langsam den ganzen Körper, und so rückte sie erneut zu ihrem graumähnigen Taschtschajnar hin, um sich endgültig zu beruhigen. Er war gewaltig, sein Fell war warm, kräftig und geschmeidig. Und sogar er, der mürrische Taschtschajnar, erfühlte, was die Wolfsmutter, die sich immer enger an ihn schmiegte, verspürte, und er witterte, was in ihrem Schoß vor sich ging, und war also auch davon berührt. Ein Ohr aufrecht gestellt, hob Taschtschajnar den kantigen, schweren Schädel mit dem düsteren Blick aus den tief sitzenden dunklen Augen; in den kalten Pupillen leuchtete schattenhaft ein dumpfes, wohliges Vorgefühl auf; er knurrte dabei verhalten, etwas schnaubend und hustend, und brachte damit wie immer seine gute Laune und die Bereitschaft zum Ausdruck, widerspruchslos der blauäugigen Wölfin zu gehorchen und sie zu beschützen, und er schickte sich an, Akbaras Kopf, ihre leuchtenden blauen Augen und die Schnauze mit seiner breiten, warmen und feuchten Zunge sorgsam rein zu lecken. Akbara liebte Taschtschajnars Zunge, wenn sie, vom heftigen Blutstrom heiß geworden, biegsam wurde, schnell und energisch wie eine Schlange, wenn er damit zu spielen begann und sich ihr sehnsüchtig und zitternd vor Ungeduld ergab, sie aber tat anfänglich so, als wäre ihr dies zumindest gleichgültig, sogar dann noch, wenn die Zunge ihres Taschtschajnar weich und feucht war, in den Minuten der Ruhe und Glückseligkeit nach sättigendem Mahl.
Bei diesem Paar reißender Tiere war Akbara der Kopf, sie war der Verstand und verfügte über das Recht, die Jagd zu beginnen, während er die treue, zuverlässige, unermüdliche und ihren Willen unbedingt erfüllende Kraft war. Diese Beziehungen wurden niemals verletzt. Nur einmal hatte es diesen merkwürdigen und unerwarteten Vorfall gegeben, als ihr Wolf bis zum Morgengrauen verschwunden war und mit dem ihr fremden Geruch eines anderen Weibchens zurückkehrte – mit der Ausdünstung schamloser Brunst, die Rüden über Dutzende von Werst scharfmachte und herbeilockte; das hatte in ihr unbändige Wut und Zorn hervorgerufen, und sie wies ihn auch sogleich ab, und unerwartet hatte sie ihm mit ihrem Reißzahn eine tiefe Wunde in der Schulter versetzt und ihn gezwungen, viele Tage lang ununterbrochen hinter ihr herzuhumpeln. Sie hielt diesen Dummerjan in gehöriger Entfernung, von hinten war nur sein Geheul zu hören, und nicht ein einziges Mal antwortete sie darauf, sie wartete nicht auf ihn, als wäre Taschtschajnar nicht ihr Wolf, als gäbe es ihn überhaupt nicht, und wehe, er würde von Neuem versuchen, sich ihr zu nähern, sich zu unterwerfen und sie zu verwöhnen, dann würde Akbara ernsthaft ihre Kräfte mit ihm messen – nicht von ungefähr hatte bei diesem von weit her zugewanderten graublauen Paar sie den Kopf und er die Beine.
Jetzt war Akbara, nachdem sie sich etwas beruhigt und an der breiten Seite Taschtschajnars angewärmt hatte, ihrem Wolf dankbar dafür, dass er ihre Angst teilte und ihr damit das Selbstvertrauen zurückgab, und deshalb widersetzte sie sich auch nicht seinen eifrigen Liebkosungen, erwiderte sie und leckte seine Lefzen an die zwei Mal; ihre Lähmung, die sie zuvor, in den Minuten panischen Schreckens, überfallen hatte und die immer noch in unerwarteten Krämpfen zu spüren war, richtete ihre volle Aufmerksamkeit auf sich selbst, und sie vernahm dabei, wie sich in ihrem Leib die noch ungeborenen Welpen unverständig und unruhig aufführten; und so war sie mit allem versöhnt, mit der Höhle, mit dem großen Winter in den Bergen, mit der allmählich hereinbrechenden Frostnacht.
So endete für die Wölfin der Tag einer schrecklichen Erschütterung. Vom unausrottbaren Mutterinstinkt beherrscht, fürchtete sie nicht nur um sich, sondern auch um jene, die alsbald in dieser Höhle zu erwarten waren und für die sie das alles gemeinsam mit dem Wolf ausgesucht und hergerichtet hatte, in der tiefen Spalte unter dem Felsvorsprung, durch allerlei Gestrüpp verborgen, hinter verstreutem Bruchholz und Steinschlag – dieses Wolfsnest war dafür bestimmt, dass die Nachkommenschaft eine Bleibe hatte, ihren Zufluchtsort auf Erden.
Umso mehr, als Akbara und Taschtschajnar in dieser Gegend Zugewanderte waren. Für das erfahrene Auge unterschieden sie sich sogar äußerlich von ihren hier heimischen Artgenossen. Das Erste, was die Neuankömmlinge unterschied, waren die für Steppenwölfe charakteristischen hellen Töne der Fellstulpen am Hals, die die Schultern fest umrahmten wie ein prachtvoller silbergrauer Umhang von der Unterbrust bis zum Widerrist. Von Wuchs wie die »Akdshaly«, aber graublaumähnig, überragten sie die gewöhnlichen Wölfe der Hochebene um den Issyk-Kul. Und hätte jemand sie aus der Nähe gesehen, so wäre er sehr erstaunt gewesen – diese Wölfin hatte durchsichtige blaue Augen, ein äußerst seltener, möglicherweise einzigartiger Fall. Die Wölfin hatte unter den hiesigen Hirten den Beinamen Akdaly, die Weißwiderristige, aber schon bald veränderte sie sich nach den Gesetzen der Sprachumwandlung zu Akbary, sodann zu Akbara – die Große –, und dabei wäre es keinem in den Sinn gekommen, dass in alldem ein besonderes Vorzeichen lag …
Noch ein Jahr zuvor hätte hier niemand solche Graumähnigen erwartet. Als sie dann einmal aufgekreuzt waren, hielten sie sich indes abseits. Anfänglich streunten die Neulinge, um Zusammenstößen mit den einheimischen Hausherren auszuweichen, zumeist in neutralen Zonen der hiesigen Wolfsreviere umher, schlugen sich mit Mühe und Not durch, preschten sogar, auf der Suche nach Beute, in die Felder hinaus, in die von Menschen bewohnten Niederungen, doch den örtlichen Rudeln schlossen sie sich nicht an – die blauäugige Wölfin Akbara hatte einen viel zu unabhängigen Charakter, um sich Fremden zuzugesellen und ihnen untergeordnet zu sein.
Richter aller Dinge ist die Zeit. Allmählich konnten sich die graumähnigen Zuwanderer selbst durchsetzen; in etlichen grausamen Kämpfen besetzten sie ihr Stück Erde im Hochland um den Issyk-Kul, und nun waren bereits sie, die Eingewanderten, Hausherren, und die einheimischen Wölfe trauten es sich schon nicht mehr, in ihre Reviere einzufallen. Man konnte also sagen, dass sich das Leben der zugezogenen graumähnigen Wölfin am Issyk-Kul ziemlich erfolgreich gestaltete, doch alldem war ihre eigene Geschichte vorausgegangen, und wären Tiere imstande, sich an die Vergangenheit zu erinnern, so hätte Akbara, die sich durch große Aufgewecktheit und feine Wahrnehmung auszeichnete, all das von Neuem durchleben müssen, was in ihr, wer weiß, vielleicht Erinnerungen, manchmal gar Tränen und schweres Stöhnen weckte.
In der untergegangenen Welt der fernen Savanne Mujun-Kum hatte das Leben des großen Jagens seinen Lauf genommen, das endlose Verfolgen in den endlosen Weiten der Mujun-Kum, auf den Fährten der endlosen Herden der Saigas. Seit Urzeiten hausten die Saiga-Antilopen in diesen Savannensteppen des ewig dürrholzigen Saxaul, die ältesten aller Paarhufer, so alt wie die Zeit selbst, diese im Lauf ausdauernden Herdentiere mit der aufgeworfenen Schnauze, den breiten rohrförmigen Nüstern, die Luft durch die Lungen mit solcher Kraft ausblasen, wie der Wal durch seine borstigen Spritzlöcher ganze Ozeanströme bläst, und deshalb mit der Fähigkeit ausgestattet sind, ohne Atempause vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne zu rennen, und wann immer sie sich in Bewegung setzten, wurden sie verfolgt von ihren uralten und unzertrennlichen Wölfen; die eine aufgescheuchte Herde versetzte die benachbarte in Panik und jene wiederum die nächste und die weitere, und dann stürzten sich in dieses gemeinsame Rennen die großen und kleinen Herden aus entgegengesetzten Richtungen, die Saigas rasten durch die Mujun-Kum dahin – durchs Gebirge, durch die Täler, über den Sand, wie die Wasser der Sintflut –, da lief die Erde rückwärts davon und dröhnte unter den Hufen wie unterm Hagelgewitter zur Sommerzeit; und die Luft wirbelte von der Bewegung, vom Staub und vom Brandgeruch des unter den Hufen geschlagenen Feuersteins, durchdrungen vom Geruch des Herdenschweißes, dem Geruch des wahnsinnigen Wettlaufs um Leben und Tod, während die Wölfe, getrennt voneinander laufend, hinterher- und nebenherrannten und versuchten, die Saigaherde in ihren Wolfshinterhalt zu lenken, wo dann inmitten der blattlosen Salzsträucher des Saxaul die Schneidesicheln warteten – reißende Tiere sprangen urplötzlich aus dem Hinterhalt auf den Nacken des ungestüm dahinrennenden Opfers und stürzten, wie ein Kreisel mit der Antilope verknäuelt, hin und schafften es dabei, die Kehle zu durchbeißen, aus der ein Strom von Blut schoss, und stürzten sich daraufhin von Neuem in die Verfolgung; doch die Saigas erkannten irgendwie und oftmals frühzeitig, wo sie der Wolfshinterhalt erwartete, und schafften es, zur Seite auszuweichen, und dann wurde die Treibjagd von Neuem aufgenommen, in einem neuen Kreis, mit noch größerer Wucht und Geschwindigkeit, und alle zusammen – die Gejagten und die Verfolgenden – verknäuelten sich in eine einzige Kette des grausamen Daseins, gingen ganz auf im Lauf, sie verbrannten ihr Blut wie im Todeskampf, um zu überleben und zu leben, und vielleicht konnte sie nur Gott selbst anhalten, die einen wie die anderen, die Gejagten und Jagenden, denn es ging um Leben und Tod von lebenstrotzenden Kreaturen, die Wölfe nämlich hielten ein derart besessenes Tempo nicht aus, waren nicht geboren, in einer solchen Form des Daseinskampfes zu bestehen, sie brachen im Kampfrennen zusammen und blieben im Staubsturm der dahinbrausenden Verfolgung zurück und verendeten; oder aber, falls sie am Leben blieben, verzogen sie sich danach in andere Gebiete, wo sie in harmlose Schafsherden einfielen, für die es kein Davonrennen gab; dafür gab es jedoch dort eine andere Gefahr, die schrecklichste aller denkbaren Gefahren – dort bei den Herden befanden sich Menschen, die Schafsgötter oder auch Schafssklaven, jene also, die selbst leben, aber andere nicht überleben lassen, schon gar nicht, wenn diese von ihnen unabhängig sind und so frei, um frei zu sein …
Menschen, Menschen sind Gottmenschen! Die Menschen machen Jagd auf die Saigas der Savanne Mujun-Kum. Früher waren sie auf Pferden erschienen, in Fell gekleidet, mit Pfeilen bewaffnet, sodann kamen sie mit knallenden Gewehren, sprengten Hurra brüllend hierhin und dorthin, und die Saigaherde stürzte lärmend in die eine oder die andere Richtung, und finde sie dann einer im Saxaulgestrüpp! Es war dann aber die Zeit gekommen, da die Gottmenschen die Treibjagd mit Autos veranstalteten und die Saigas, fast so wie die Wölfe, bis zur Zermürbung jagten, die Antilopen zusammentrieben und sie aus dem fahrenden Wagen niederschossen; und sodann fingen die Gottmenschen an, in Hubschraubern heranzufliegen, orteten die Saigaherden aus der Luft und umzingelten die Tiere nach vorgegebenen Koordinaten; dabei rasten Scharfschützen über die Ebene mit einer Geschwindigkeit bis zu hundert Stundenkilometern und noch mehr, damit die Steppenantilopen nicht entkommen konnten, während die Hubschrauber von oben Ziel und Kurs korrigierten. Autos, Hubschrauber und Schnellfeuergewehre – und das Leben in der Savanne Mujun-Kum kippte um …
Die blauäugige Wölfin Akbara war noch von halb heller Färbung gewesen und ihr künftiger Wolfsgemahl Taschtschajnar knapp über ihrem Alter, als für sie die Zeit gekommen war, sich an die Mühen des Wolfslebens zu gewöhnen – an die großen Treibjagden. Anfangs schafften sie gerade das Nachsetzen, zerfleischten niedergeworfene Antilopen, töteten nicht ganz Getötete, doch mit der Zeit übertrafen sie viele ihrer erfahrenen Artgenossen an Kraft und Ausdauer, vor allem die alternden. Und wäre alles verlaufen wie von der Natur vorgesehen, dann wäre ihnen bald die Aufgabe von Leittieren des Rudels zugefallen. Aber es war alles anders gekommen …
Kein Jahr ist dem andern gleich, im Frühjahr jenes Jahres aber war der Nachwuchs unter den Saigaherden besonders reichhaltig, viele Muttertiere warfen zweimal, war doch im vergangenen Herbst während des Treibens die dürre Grasdecke der Savanne zweimal aufgegrünt, nach einigen ausgiebigen Regenfällen bei heißem Wetter. Die Nahrung war kräftig, daher auch die Zahl der Würfe. Zum Werfen zogen sich die Saigas zu Frühjahrsbeginn in den schneefreien großen Sand zurück, weit in die Tiefe der Mujun-Kum, wohin die Wölfe kaum je gelangten und wo die Jagd auf die Saigas über Wanderdünen ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Auf Wüstensand ist die Antilope nicht einzuholen. Doch dafür erhielten die Wolfsrudel das Ihrige im Überfluss zum Herbst und Winter, als die jährlich wiederkehrende Wanderung einen Riesenbestand Antilopen in die Weiten der Halbwüste und der Steppe hinaustrieb. Nun verfügte Gott höchstpersönlich, dass die Wölfe ihren Anteil erhielten. Sogar im Sommer, besonders bei großer Hitze, ziehen es die Wölfe vor, die Saigas nicht anzurühren, andere, leichtere Beute ist genug vorhanden – über die ganze Steppe flitzen zahllose Murmeltiere, sie holen im Winterschlaf Versäumtes nach und müssen während ihres kurzen Sommerlebens all das schaffen, wozu Raubtiere und andere Kreaturen ein ganzes Jahr haben. Der Stamm der Murmeltiere legt also ringsum geschäftige Hast an den Tag und missachtet die überall lauernden Gefahren. Warum sie nicht fangen, da ja allem seine Stunde schlägt, im Winter kriegt man aber kein Murmeltier – es gibt sie nicht. Auch andere kleine Tiere und Vögel, insbesondere Rebhühner, dienen den Wölfen während der Sommermonate als zusätzliche Nahrung, aber die Hauptbeute bringt die große Herbstjagd auf die Saiga – vom Herbst bis zum Ende des Winters. Wiederum galt hier das Gesetz: alles zu seiner Zeit. Und darin bestand die naturgegebene Zweckmäßigkeit des Lebenskreislaufs in der Savanne. Lediglich Naturkatastrophen und nur der Mensch konnten diesen ursprünglichen Gang der Dinge in der Mujun-Kum zerstören …
2
Vor Tagesanbruch kühlt die Luft über der Savanne etwas ab, und erst jetzt verschafft die Nacht Erleichterung, den Lebewesen wird freier zumute, es kommt die Glücksstunde zwischen dem heraufziehenden Tag, trächtig schon mit seiner Sonnenglut, die bis zum Weißglühen die salzige Steppe täglich und unerbittlich durchbäckt, und der scheidenden, schwülheißen Nacht, die das Ihre vollendet hat. Der Mond glüht nun über der Mujun-Kum wie eine gelbe Kugel und taucht die Erde in ein beständiges bläuliches Licht. Nirgendwo, an keinem Horizont ein Anfang oder ein Ende dieser Erde, überall fließen ihre dunklen, unermesslichen Weiten mit dem Sternenhimmel zusammen. Die Stille lebt, denn alles, was die Savanne bevölkert, alles – die Schlangen ausgenommen – beeilt sich, die kühle Stunde, das Leben zu genießen. Im Tamariskengesträuch piepsen und rascheln die frühen Vögel, geschäftig flitzen die Igel hin und her, die Zikaden, die, ohne je zu verstummen, die ganze Nacht hindurch sangen, zirpen nun mit ganzer Kraft und strecken sich bereits aus ihren Höhlen, nach allen Richtungen äugen die gerade erwachten Murmeltiere und lassen sich noch Zeit bis zum Einsammeln ihres Futters, die abgefallenen Samen des Saxaul. Eine flachköpfige graue Zwergohreule und fünf flachköpfige Eulchen, halbwüchsig und schon völlig befiedert, fähig, die Flügel zu schlagen, flattern mal hierhin, mal dorthin, und sie fliegen – die ganze Familie –, wie sich das gehört, rufen sich ständig fürsorglich zu, ohne sich aus den Augen zu verlieren. Andere Geschöpfe und unterschiedliche wilde Tiere der Savanne tun es ihnen in der vormorgendlichen Dämmerung gleich, jedes auf seine Weise …
Und der Sommer hielt an, der erste gemeinsame Sommer der blauäugigen Akbara und Taschtschajnars, die sich bereits als unermüdliche Treiber bei den Zermürbungsjagden auf die Saiga hervorgetan hatten und schon zu den stärksten Wolfspaaren der Mujun-Kum gehörten. Zu ihrem Glück – auch in der Welt der Wildtiere mag es wohl glückliche und unglückliche Wesen geben – waren sie beide, Akbara und Taschtschajnar, mit natürlichen Eigenschaften ausgestattet, die für Steppenräuber der Halbwüstensavanne so lebenswichtig sind: blitzschnelle Reaktion, das Vorausfühlen beim Jagen, eine Art »strategischer« Auffassungsgabe und selbstverständlich außergewöhnliche Körperstärke, Schnelligkeit und Sprungkraft im Lauf. Alles sprach dafür, dass diesem Jägerpaar eine große Zukunft bevorstand, ein Leben, erfüllt von den Beschwernissen der täglichen Nahrungssuche, aber gleichermaßen auch voll der Schönheit ihres Raubtierdaseins. Vorläufig stand ihrer uneingeschränkten Herrschaft über die Steppen der Mujun-Kum nichts im Wege, da ja nur hin und wieder zufällig Menschen in diese Gebiete eindrangen; im Übrigen waren sie noch kein einziges Mal einem Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnet. Dies würde ihnen wenig später bevorstehen. Und da war noch ein Merkmal des Lebens, genauer gesagt, eine Gunst, wenn nicht gar ein Privileg der Schöpfung: Die Raubtiere, wie auch die gesamte Tierwelt, konnten von Tag zu Tag leben, ohne Sorgen und ohne Angst vor dem Morgen. Der Plan der Natur hatte es so eingerichtet, dass die Tiere von dieser verfluchten Daseinslast von Grund auf frei waren. In dieser Gnade der Natur lag aber auch die Tragödie beschlossen, die den Bewohnern der Mujun-Kum auflauerte. Keinem von ihnen war es gegeben, davon etwas zu ahnen. Keinem von ihnen war die Vorstellung eingegeben, dass letztendlich der scheinbar grenzenlose Lebensraum – die Savanne Mujun-Kum, so ausgedehnt und gewaltig, diese Insel im asiatischen Subkontinent –, dass dieser fingernagelgroße gelbbraune Fleck auf der Landkarte Jahr um Jahr von den Rändern her durch umgepflügtes Neuland eingekreist wurde, vom Andrang der zahllosen vor sich hinträumenden Viehherden, die, der Kette artesischer Brunnenlöcher folgend, neue Futterplätze suchten; auch durch die Kanäle und Straßen der Randgebiete und durch die unmittelbar an die Savanne gelegten Erdgasleitungen, die riesigsten ihrer Art; immer hartnäckiger, langfristiger und mit mehr und mehr Technik ausgerüstet, brachen die Menschen auf Rädern mit Motoren und Funkausrüstungen zu den Wasservorräten in die Tiefe aller Wüsten und Halbwüsten ein, darunter auch der Mujun-Kum, und dass dieses Einbrechen schon nicht mehr die geografischen Entdeckungen selbstloser Gelehrter waren, derer sich die Nachfahren stolz rühmen, sondern eine ganz und gar gewöhnliche Sache von ganz und gar gewöhnlichen Menschen, zu der beinahe jeder fähig ist. Den Bewohnern der einzigartigen Savanne Mujun-Kum war noch weniger das Wissen eingegeben, dass alles, was in der menschlichen Gesellschaft gewöhnlich geworden ist, in sich die Quelle des Guten wie des Bösen auf der Welt verbirgt. Und dass es ganz von den Menschen selbst abhängt, wohin sie diese Kraft des Gewöhnlichen lenken – zum Guten oder zum Schlimmen, zum Erschaffen oder zum Verwüsten. Und erst recht nicht ahnen konnten die Geschöpfe der Savanne Mujun-Kum jene fein gesponnenen Qualen, die den Menschen, seit sie denkende Wesen geworden waren, bis aufs Äußerste zusetzen, wenn sie versuchen, sich selbst zu erkennen, und dennoch das Wesen jenes uralten Rätsels nicht durchschauen: weshalb das Böse fast immer das Gute besiegt.
All diese Menschheitsfragen konnten, nach Logik der Dinge, die Raubtiere und die anderen Geschöpfe der Mujun-Kum nicht berühren, denn sie lagen außerhalb ihrer Natur, außerhalb ihrer Instinkte und Erfahrung. Und im Großen und Ganzen hatte vorläufig noch nichts die Lebensweise dieser gewaltigen Steppe verletzt, über die heißen Ebenen und Wellen erstreckt sich die Halbwüste, und nur hier wachsen und gedeihen die dürrebeständigen Arten der Tamariske, eine Pflanze, halb Strauch, halb Baum, hart wie Stein und verdrillt wie Schiffstau, hier gedeiht der sandige Saxaul und allerlei hartes Weidegewächs, vor allem der spitzbogige, schilfige Tschij, diese flimmernde Pracht der Halbwüste, das Steppenrohrgras, das in Mond und Sonne schimmert wie goldener durchsichtiger Wald aus Gesträuch und Gestrüpp, in dem jeder wenigstens von der Größe eines Hundes bei erhobenem Kopf alles – wie in seichtem Wasser – um sich herum sieht, so wie er selbst gesehen werden kann.
In dieser Gegend erfüllte sich auch das Schicksal des neuen Wolfspaares Akbara und Taschtschajnar, und sie hatten zu dieser Zeit – das Wichtigste im Leben der Tiere – schon ihre Erstlinge, die drei Welpen aus der ersten Brut, die Akbara in jenem denkwürdigen Frühling in der Mujun-Kum zur Welt gebracht hatte, in der denkwürdigen Höhle, die sie in der Talsenke, unter der ausgewaschenen Wurzel des Saxaul, ausgewählt hatten, nahe beim halb dürren Tamariskenhain, wohin man bequem die Wolfsjungen zum Aufziehen hinausführen konnte. Die Wolfsjungen hielten bereits die Ohren aufrecht, entwickelten ihre Eigenheiten, obgleich ihre Ohren beim gemeinsamen Spielen auf Welpenart zur Seite knickten; auch auf den Beinen fühlten sie sich bereits ziemlich sicher, und immer häufiger hefteten sie sich zu kleinen und größeren Ausflügen an die Fährte der Eltern.
Unlängst hatte ein solcher Ausflug, der sie einen ganzen Tag und die Nacht von der Höhle wegführte, mit einem unerwarteten Unheil geendet.
An jenem frühen Morgen führte Akbara ihre Brut an den fernen Rand der Savanne von Mujun-Kum, wo in den Weiten der Steppe, besonders in den dumpfen, tiefen Schluchten und Mulden, halmige Gräser wachsen, die einen schweren, nichts ähnelnden bestrickenden Duft von sich geben. Schlendert man lange durch diese hohen Gräser, so spürt man zunächst eine ungewöhnliche Leichtigkeit in den Bewegungen, wie ein angenehmes Gleiten über der Erde, sodann kommt es zu Schlaffheit in den Beinen und zu Schläfrigkeit. Akbara erinnerte sich an diese Plätze noch von der Kindheit her, sie stattete diesem Ort einmal im Jahr, wenn die betäubenden Gräser blühten, einen Besuch ab. Unterwegs jagte sie kleines Steppenfederwild und liebte es dann, sich in dem hohen Gras leicht zu berauschen und sich in den heißen Schwaden des gräsernen Duftes herumzuwälzen, im Lauf dieses Schweben zu verspüren und dann einzuschlummern.
Dieses Mal waren Taschtschajnar und sie schon nicht mehr allein – ihnen folgten die Wolfsjungen, drei plumpe, langbeinige Welpen. Für den Nachwuchs gehörte es sich, bei den Ausflügen möglichst viel vom umliegenden Land kennenzulernen, sich von Kindheit an seine künftigen Wolfsreviere anzueignen. Die Stellen der stark duftenden Gräser, wohin sie die Wölfin führte, um sie damit vertraut zu machen, markierten die Reviergrenzen, dahinter erstreckte sich eine fremde, unüberschaubare Welt, dort könnten Menschen sein, von dort trug es bisweilen lang gezogene, heulende, herbstliche Winde, die Dampfpfeifen von Lokomotiven, das war die den Wölfen feindliche Welt. Dorthin, an diese Grenze der Savanne, zogen sie, von Akbara geführt.
Hinter Akbara folgte, gemächlich trabend, Taschtschajnar, während die Wolfsjungen, ausgelassen vor lauter überschüssiger Energie, herumtollten, immerzu darauf erpicht, vorauszuspringen, doch die Wolfsmutter erlaubte ihnen eine derartige Eigenmächtigkeit nicht, sie achtete streng darauf, dass es niemand wagte, den Pfad vor ihr zu betreten …
Zunächst kamen sie durch sandigen Boden zwischen dem Saxaulgehölz – und dem Wüstenwermut, die Sonne stieg immer höher und kündigte damit, wie gewohnt, klares, heißes Savannenwetter an. Gegen Abend schon hatte die Wolfsfamilie die Savannengrenze erreicht. Just vor Anbruch der Dunkelheit. Die Gräser standen in diesem Jahr hoch und reichten den ausgewachsenen Wölfen fast bis zum Widerrist. Erhitzt von der heißen Sonne des Tages, strömten die unansehnlichen Blüten an den flauschigen Halmen einen starken Duft aus, und besonders an den Stellen, wo das Gewächs eng gedrängt stand, verdichtete sich der Duft jenes Grases. Hier richteten sich die Wölfe nach der langen Wegstrecke in einer kleinen Schlucht einen Rastplatz ein. Die unermüdlichen Wolfsjungen wollten sich indessen nicht ausruhen, ja, sie rannten immerfort umher, berochen und beäugten alles, was an dem unbekannten Ort ihre Neugierde weckte. Die Wolfsfamilie hätte da wohl die ganze Nacht verbringen können, umso mehr, als die Raubtiere sich ausgezeichnet gesättigt und ausgiebig den Durst gestillt hatten – unterwegs hatten sie es geschafft, einige fette Murmeltiere und Hasen zu reißen, allerlei Nester zu plündern, den Durst hatten sie an der Quelle in einer Schlucht, die am Weg lag, gestillt, aber ein außergewöhnliches Ereignis veranlasste sie, diesen Ort vorzeitig zu verlassen und nach Hause umzukehren, zur Höhle in der Tiefe der Savanne. Die ganze Nacht über liefen sie.
Was war geschehen? Die Sonne war schon im Untergehen, als Akbara und Taschtschajnar, von den Düften des betäubenden Grases leicht berauscht, sich im Schatten von Sträuchern zum Schlaf ausstreckten und plötzlich nicht weit entfernt eine menschliche Stimme vernahmen. Als Erste hatten den Menschen die Wolfsjungen gesehen, die miteinander über der kleinen Schlucht spielten. Die Raubtierjungen konnten nicht ahnen, dass dieses plötzlich aufgetauchte Wesen ein Mensch war. Ein Menschenwesen – völlig nackt bis auf eine Badehose am Leib und an bloßen Füßen Turnschuhe, mit einem einst weißen, inzwischen gehörig abgenutzten, schmutzigen Panama auf dem Kopf – rannte so splitternackt durch ebendiese Gräser. Es rannte seltsam, suchte das Gewächs und lief dort unentwegt zwischen den Halmen vor und zurück, als bereite es ihm Vergnügen.
Die Wolfsjungen hielten sich zunächst versteckt, sie waren verwundert und fürchteten sich ein bisschen – so etwas war ihnen noch nie begegnet. Und der Mensch rannte und rannte immerzu durch die Gräser wie ein Verrückter. Die Wolfsjungen fassten nun etwas Mut, die Neugierde siegte, sie wollten mit ihm ein Spiel anfangen, mit diesem merkwürdigen Läufer, diesem überdrehten, nie gesehenen, nackthäutigen zweibeinigen Raubtier. Und da hatte auch der Mensch die Wolfsjungen entdeckt. Und das Erstaunlichste war: Statt sich in Acht zu nehmen und darüber nachzudenken, wieso hierher auf einmal Wölfe kamen, ging dieser Kauz zu den Wolfsjungen hin und streckte ihnen zärtlich die Hände entgegen.
»Oho, schau mal einer, was ist denn das?«, rief er aus, schwer schnaufend und sich den Schweiß aus dem Gesicht wischend. »Doch nicht etwa ein Wölflein? Oder kommt mir das nur so vor, weil mir schwindelt? Ja, nein, drei sind es, so hübsche und so große Kerlchen! Ach, ihr meine süßen, wilden Dingerchen! Woher kommt ihr denn, und wohin wollt ihr? Was macht ihr denn da? Mich hat wohl der Teufel hierhergeführt, aber was tut ihr da in diesen Steppen unter dem verfluchten Gras? Nun kommt schon, kommt doch her zu mir, habt keine Angst! Ach, ihr Dummerchen, ihr meine lieben wilden Tierlein!«
Die unverständigen Wolfsjungen folgten tatsächlich seinen Koseworten. Schwanzwedelnd drückten sie sich verspielt zur Erde, krochen zum Menschen hin, in der Hoffnung auf einen Wettlauf, als auf einmal Akbara aus der Schlucht heraussprang. Die Wölfin hatte die Gefährlichkeit der Lage augenblicklich erkannt. Dumpf knurrend stürzte sie sich auf den nackten Menschen, den die Strahlen der untergehenden Steppensonne rosafarben anleuchteten. Es hätte sie keinerlei Mühe gekostet, ihm mit den Eckzähnen kräftig die Kehle oder den Bauch zu zerfetzen. Aber der Mensch, beim Anblick der wütend anfallenden Wölfin völlig verstört, hockte sich nieder und fasste sich dabei aus Angst an den Kopf. Das war es auch, was ihn rettete. Schon im Anlauf hatte Akbara ihre Absicht geändert. Sie sprang über den Menschen hinweg, den nackten und schutzlosen, den sie mit einem Schlag hätte vernichten können, sie sprang über ihn hinweg, erspähte die Züge seines Gesichts und die vor unheimlicher Angst erstarrten Augen, sie witterte in jener Sekunde die körperliche Ausdünstung des Menschen, wandte sich erneut um, nachdem sie ihn übersprungen hatte, um ein zweites Mal in der anderen Richtung über ihn hinwegzusetzen. Ohne zu verharren, stürzte sich Akbara zu den Wolfsjungen, trieb sie weg und drängte sie ab zur Schlucht, stieß dort mit Taschtschajnar zusammen, biss den Wolf, packte rechtzeitig auch ihn, der beim Anblick des Menschen seine Nackenmähne schrecklich gesträubt hatte, und sie alle vertrollten sich im Haufen hinab in die Schlucht und waren augenblicklich verschwunden …
Und erst jetzt kam es diesem nackten und unbeholfenen Typen in den Sinn, vor den Wölfen davonzurennen. Er rannte lange durch die Steppe, ohne sich umzusehen und zu verschnaufen …
Das war die erste zufällige Begegnung Akbaras und ihrer Familie mit dem Menschen gewesen. Aber wer konnte wissen, was diese Begegnung ankündigte …
Der Tag neigte sich dem Ende zu, er klang aus mit einer langen, überschüssigen Glut von der untergehenden Sonne, von der tagsüber aufgeheizten Erde. Sonne und Steppe bestehen seit Ewigkeiten: Nach der Sonne bemisst man die Steppe, die Größe des von der Sonne beleuchteten Raumes. Und der Himmel über der Steppe bemisst sich nach der Höhe, die der Milan im Flug erreicht hat. Zu jener Stunde vor Sonnenuntergang kreiste über der Savanne Mujun-Kum in schwindelnder Höhe ein ganzer Schwarm weiß geschwänzter Milane. Sie flogen, als wären sie entrückt, schwammen ziellos, selbstvergessen und schwebend den Flug um des Fluges willen vollendend, in ihrer immerfort kühlen, von einem Dunstschleier verhüllten, wolkenlosen Höhe. Einer hielt sich am andern, alle kreisten in einer Richtung, als wollten sie damit die Ewigkeit und die Unerschütterlichkeit dieser Erde und dieses Himmels versinnbildlichen. Die Milane gaben keinerlei Laut von sich, sondern beobachteten nur schweigend, was sich da tief unter den Flügeln abspielte. Dank ihrer außerordentlichen, alles erfassenden Spähkraft, dank ihres Sehvermögens (das Gehör steht bei ihnen an zweiter Stelle) hatten diese aristokratischen Greifvögel die Oberhoheit über die Savanne, auf die sündhafte Erde ließen sie sich lediglich zur Nahrungsaufnahme und fürs Nachtlager herab.
Sie beobachteten wohl zu jener Stunde aus unermesslicher Höhe, wie auf einer Handfläche, den Wolf, die Wölfin und die drei Wolfsjungen, die sich auf einem kleinen Hügel unter verstreuten Tamariskenbüschen und dem goldfarbenen Gesträuch des Tschij niedergelassen hatten. Wegen der Hitze hechelten sie gleichzeitig mit hängender Zunge, sie rasteten auf der kleinen Anhöhe und dachten dabei nicht im Geringsten daran, dass sie aus dem Himmel der Greifvögel beobachtet wurden. Taschtschajnar verharrte mit schräg gelagertem Oberkörper in seiner Lieblingspose: Er hatte die Pfoten vor sich gekreuzt, den Kopf gehoben, er zeichnete sich durch einen mächtigen Nacken, starke Knochen und einen massigen Körperbau aus. Daneben saß die junge Wölfin Akbara, den kurzen Schwanz sorgsam unter sich zurechtgelegt, wie ein zur Statue erstarrter Körper. Die Wölfin stützte sich auf die gerade vor sich gestellten, sehnigen Beine. Ihre weiß schimmernde Brust und der feine Bauch mit den nach wie vor abstehenden, wenn auch schon nicht mehr so hervorschwellenden Zitzen in zwei Reihen unterstrichen die festen, kräftigen Lenden der Wölfin. Und die Wolfsjungen, die Drillinge, tummelten sich daneben. Ihre rastlose Aufsässigkeit und Verspieltheit ärgerten die Eltern nicht im Geringsten. Der Wolf und die Wölfin schauten auf sie mit offensichtlicher Nachsicht – sollen sie sich halt austoben …
Und die Milane kreisten unentwegt in jener entrückten Höhe und beobachteten noch immer ungerührt, was sich unten bei Sonnenuntergang in der Mujun-Kum tat. Nicht weit von den Wölfen und Wolfsjungen, etwas abseits von ihnen in den Tamariskenhainen, weideten Saigas. Gar nicht wenige waren es. Eine ziemlich große Herde hielt sich hier in den Tamarisken auf und in einer gewissen Entfernung noch eine andere, noch zahlreichere Herde. Würden sich die Milane für diese Steppenantilopen interessieren, so hätten sie sich beim Rundblick über die Savanne, über Dutzende von Kilometern, davon überzeugen können, dass die Zahl der Saigas riesig war – Hunderte, Tausende waren es, sie waren der Urtyp der Tiere in dieser gesegneten, ihnen seit Urzeiten vertrauten Halbwüste. Die Saigas warteten das Ende der Abendhitze ab und brachen des Nachts zu den Wassertränken auf, zu den in der Savanne so seltenen und fernab gelegenen Nassquellen. Einzelne Gruppen zog es bereits in jene Richtung, und sie beschleunigten dabei rasch ihren Lauf. Sie hatten große Entfernungen zurückzulegen.
Eine der Herden zog so nah an dem Hügel vorüber, wo sich die Wölfe befanden, dass ihre rasch dahingleitenden Flanken und Rücken, die leicht gesenkten Köpfe und die kleinen Hörner der Böcke in der geisterhaft beleuchteten Grasdecke des Tschij deutlich zu sehen waren. Sie bewegten sich immer mit gesenktem Kopf, dadurch können sie jeden Augenblick zum Rennen losbrechen, ohne den geringsten Luftwiderstand zu verspüren. So hat sie die Natur im Lauf der Evolution ausgestattet, und darin liegt der Hauptvorteil der Saigas: Vor beliebiger Gefahr können sie sich durch Flucht retten. Sogar wenn sie nicht alarmiert sind, bewegen sich die Saigas gewöhnlich in mäßigem Galopp, unermüdlich und unerschütterlich, und sie geben dabei niemandem den Weg frei, außer den Wölfen, denn sie, die Antilope, ist die Vielzahl, und schon darauf beruht ihre Stärke …
Jetzt zogen sie an Akbaras Familie vorüber, die von Sträuchern verdeckt wurde – eine galoppierende Masse, und diese Bewegung zog einen lebenden Wind mit sich, aus Herdengeruch und dem Staub der Hufe. Die Wolfsjungen auf dem Hügel überkam eine Erregung, instinktiv erwitterten sie etwas. Alle drei schnupperten angestrengt in die Luft und wollten, ohne noch zu begreifen, worum es ging, in jene Richtung laufen, von wo es diesen so aufwühlenden Herdengeruch hertrug, so sehr drängte es sie in das stänglige Unterholz des Tschij, in dem eine große Bewegung zu erahnen war: das Flimmern vieler flitzender Körper. Dennoch rührten sich die Wolfseltern nicht einmal, weder Akbara noch Taschtschajnar veränderten ihre Positur, sie blieben äußerlich gelassen, obgleich es ihnen keine Mühe gemacht hätte, in buchstäblich zwei Sprüngen, urplötzlich, an der Seite der vorüberziehenden Herde aufzutauchen und sie zu jagen, sie heftig und unbändig zu verfolgen, zu zermürben in jenem gemeinsamen Wettlauf bis zur Schwelle des Todes, wo man aufgibt, wo Erde und Himmel die Plätze vertauschen, in einer jähen Wende so flink und geschickt zu sein und im Flug ein paar Antilopen niederzureißen. Möglich wäre das durchaus gewesen, aber es hätte auch so kommen können, dass sie die Beute nicht erjagt hätten, das war bisweilen auch geschehen. So oder so – Akbara und Taschtschajnar dachten nicht daran, eine Verfolgungsjagd zu beginnen, auch wenn sich das fast aufdrängte, auch wenn sich die Beute geradezu anbot, aber sie rührten sich nicht vom Fleck. Dafür gab es Gründe – sie waren an dem Tag satt, und bei solch unglaublicher Hitze und schwerem Magen eine Hetzjagd zu veranstalten und die kaum einzuholenden Saigas zu verfolgen, das hätte fast so viel wie den Tod bedeutet. Die Hauptsache war aber, dass eine derartige Jagd für den Nachwuchs noch verfrüht gewesen wäre. Die Wolfsjungen hätten in Stücke zerfetzt werden können, ein für alle Mal, sie wären im Lauf außer Atem geraten, hinter dem unerreichbaren Ziel zurückgeblieben, sie hätten daraufhin den Mut verloren. Im Winter, wenn die Jahreszeit der großen Treibjagden kam, dann konnten die Jungwölfe, bereits mit gewachsenen Kräften und beinahe ein Jahr alt, ihre Kraft versuchen, dann konnten sie sich der Sache anschließen, doch vorerst lohnte es sich nicht, ihnen das Spiel zu verderben. Aber bald würde die Stunde ihres Ruhmes schlagen!
Akbara sprang von den Wolfsjungen, die sie in der Ungeduld des Jagdfiebers belästigten, etwas zurück, setzte sich an einem anderen Fleck nieder und verfolgte dabei unverwandten Blickes den Zug der Antilopen auf der Suche nach einer Tränke, Flanke an Flanke im silbrigen Tschij, wie Fische zur Laichzeit zu den Oberläufen der Flüsse schwimmen, alle in ein und derselben Richtung strömend und keine von der anderen zu unterscheiden. Im Blick Akbaras schimmerte ein Wissen durch – lass die Saigas jetzt nur davonziehen, es kommt der festgesetzte Tag, alles, was in der Savanne war, wird in der Savanne bleiben. Die Wolfsjungen hatten sich inzwischen darangemacht, den Vater zu belästigen, sie versuchten, den mürrischen Taschtschajnar aufzuscheuchen.
Akbara aber stellte sich plötzlich den Anfang des Winters vor, sah die große Halbwüste ganz in Weiß vor sich, jenen schönen Tag, da zur Morgendämmerung Neuschnee auf der Erde liegt, einen Tag oder einen halben Tag lang liegen bleibt, jene Stunde aber wird den Wölfen das Signal geben für die große Jagd. Und von dem Tag an wird die Jagd auf die Saigas die Hauptsache in ihrem Leben sein. Und dieser Tag wird anbrechen! Nebelschwaden in den Niederungen, frostiger Raureif auf dem traurigen weißen Tschij, auf den umgeknickten, buschigen Tamarisken und diesige Sonne über der Savanne – die Wölfin stellte sich den Tag so deutlich vor, dass sie unwillkürlich erbebte, als wäre das alles bereits so, als hätte sie unverhofft die frostige Luft eingeatmet und würde bereits auf den federnden Pfotenpolstern, geschlossen zu Blütensternbildern, dahintappen, auf verharschtem Schnee, und vollkommen deutlich konnte sie ihre stattlich ausgewachsenen Mutterspuren lesen und alle Spuren der Wolfsjungen. Bereits erwachsen wären sie dann, stünden fest auf den Beinen und zeigten schon ihre Neigungen, ihre Spuren würde sie selbst lesen und darin wiederum all das erkennen, gleich daneben den Abdruck der stärksten Pfoten – mächtige Blütenstände mit Krallen wie Schnäbeln, die aus Nestern herausragten, das wären die Pfoten Taschtschajnars, tiefer und kräftiger in den Schnee eingedrückt als all die anderen, weil er gesund ist und schwergewichtig an der Wamme, er ist die Kraft und das blitzschnelle Messer an den Kehlen der Antilopen, und jede eingeholte Saiga wird den weißen Schnee der Savanne schlagartig mit purpurrotem Blut tränken, wie ein Vogel – im Schwingen der heißen roten Flügel, um des einen Zweckes willen, damit anderes Blut lebe, verborgen in ihren grauen Fellen, denn ihr Blut lebte auf Kosten eines anderen Blutes; so war es vom Ursprung aller Anfänge vorgegeben, ein anderes Mittel gab es nicht, und da war niemand Richter, wie es auch weder Schuldlose noch Schuldige gab, Schuld hatte nur der, der das eine Blut schuf für das andere. (Lediglich dem Menschen ist ein anderes Los bestimmt, er beschafft sich sein Brot durch Arbeit, und durch Arbeit züchtet er sich Fleisch – er erschafft die Natur für sich selbst.)
Und die Spuren im Neuschnee der Mujun-Kum, die größeren und etwas kleineren Wolfsdolden, würden sich nebeneinander durch den Nebel der Niederungen ziehen und in den windgeschützten Talsenken, inmitten der Sträucher, enden – da warten dann die Wölfe, blicken um sich und lassen die zurück, die im Hinterhalt bleiben …
Nun naht die heiß ersehnte Stunde, Akbara schleicht sich heran, so nah man herankriechen kann, und presst sich dabei im Schnee eng an die vereisten Gräser, ohne zu atmen, nähert sich den weidenden Saigas, so nah, dass sie in ihre Augen sieht, die noch durch nichts beunruhigt sind, und dann stürzt sie sich auf sie wie ein Schatten – und dies ist die Sternstunde des Wolfes! So lebhaft stellte sich Akbara jene erste Treibjagd, die Lehre der Jungwölfe, vor, dass sie unwillkürlich aufwinselte und sich kaum auf der Stelle hielt.
Ach, was wird das für ein Verfolgen sein durch die Savanne des Winteranfangs! Die Saigaherden werden Hals über Kopf dahinjagen, wie vom Feuer getrieben, und der weiße Schnee wird sich augenblicklich in eine schwarze Erdnarbe verwandeln, und sie, Akbara, wird ihnen auf der Fährte sein, führend und allen voran, und hinter ihr, beinahe gleichauf, ihre Wolfsjungen, alle drei Erstlinge, ihre Nachkommenschaft, die auf die Welt gekommen und vom Ursprung an bestimmt waren zu solcher Jagd, und nebenher ihr Taschtschajnar, der gewaltige Vater, im Lauf unbändig und nur ein einziges Ziel verfolgend – die Saigas so zu treiben, dass sie in den Hinterhalt gelenkt werden, um damit für seine Sprösslinge die Jagdaufgabe vorbildlich zu erfüllen. Ja, das wird ein unbändiger Lauf werden. Und in Akbara lebte zu jener Stunde nicht nur die künftige Beute als Ziel und heißer Wunsch, sondern auch das Verlangen, möglichst bald möge das Jagen beginnen, wenn sie in der Verfolgung wie grau geflügelte Vögel dahingetragen werden … Darin erfüllte sich der Sinn ihres Wolfslebens …
Das waren die Träume der Wölfin, die Triebe ihrer Natur; wer weiß, vielleicht waren ihr die Träume von oben eingegeben, bitter wird sie sich später an sie erinnern müssen, im Herzen wird es sie stechen, und sie wird davon oft und ausweglos träumen … Und sie wird wehklagen, wie zur Strafe für ihre Träume. Denn alle Träume sind so – anfänglich entstehen sie in der Einbildung, dann aber zerbrechen sie, weil sie es darauf ankommen ließen, wie so manche Blumen und Bäume, ohne Wurzeln zu wachsen … So sind doch alle Träume – und ihre Tragödie ist: Man braucht sie bei der Erkenntnis von Gut und Böse …
3
Der Winter war bereits in die Mujun-Kum eingezogen. Einmal hatte es schon recht ordentlich geschneit, doch der Schnee bedeckte die Savanne nicht lange, die an jenem Morgen wie ein weißer Ozean erschien, uferlos für den Blick, mit im Dahinrollen erstarrten Wogen, mit grenzenlosem Raum für den Wind und das rispenblütige Gipskraut, und wo dann schließlich in der Mujun-Kum eine Stille einkehrte wie im unendlichen Weltraum, der Sand war endlich mit Nässe vollgesogen, und die feuchten Lehmsenken waren durchweicht, nachdem sie ihre raue Härte verloren hatten … Doch zuvor waren die schnatternden Herbstgänse in Schwärmen über die Savanne in Richtung Himalaja gezogen, von wer weiß welchen Meeren und Flüssen her, wohl zum Ursprung neuer Wasser, sodass die Bewohner der Savanne, verfügten sie über Flügel, sich dem Ruf hätten ergeben und mitziehen müssen. Doch jeder Kreatur ist ihr Paradies vorbestimmt … Sogar die Steppenmilane waren, in ihrer Höhe schwebend, ein klein wenig zur Seite gewichen …
Akbaras Wolfsjungen waren zum Winter hin merklich gewachsen und hatten ihre kindliche Gleichheit abgelegt, alle drei Erstlinge waren in linkische, das Maß ihres Alters übersteigende Jungwölfe verwandelt, doch ein jeder hatte bereits seine ausgeprägte Eigenart. Die Wölfin konnte ihnen freilich keine Namen geben: Von Gott gefügte Grenzen lassen sich nicht überschreiten, dafür konnte sie leicht nach dem Geruch, was Menschen nicht gegeben ist, und nach anderen Lebensmerkmalen unterscheiden und einen jeden ihrer Nachkommenschaft einzeln zu sich rufen. So verfügte das größte der Wolfsjungen über eine breite Stirn wie Taschtschajnar und wurde wahrgenommen als der Großschädel, während das mittlere, auch ein Brocken, mit den lang gezogenen hebelförmigen Läufen als der Schnellfuß galt, den niemand daran hindern würde, mit der Zeit ein Traberwolf zu werden; unter ihnen war aber noch, haarscharf wie Akbara selbst, die Blauäugige mit dem weißen Flecken um die Leisten, wie ihn Akbara hatte, ihr verspieltes Nesthäkchen, und Akbara hatte sie sich in ihrem wortlosen Bewusstsein als Nesthäkchen eingeprägt. Sie wuchs heran zum Gegenstand von Zwist und tödlichen Kämpfen unter den Rüden, dann, wenn ihre Zeit zum Ranzen käme …
In der Nacht war unmerklich der erste Schnee gefallen, und der frühe Morgen brachte einen unverhofften Festtag für alle. Anfangs hatten die hochgeschossenen Wolfsjungen vor dem Geruch und dem Aussehen des unbekannten Stoffes, der das ganze Gelände um die Höhle verwandelt hatte, etwas Scheu, doch darauf gefiel ihnen die kühle Freude, sie rannten und tollten umher – wer ist der Schnellere –, zappelten im Schnee, schnaubten und wufften vor Lust. So hatte der Winter für die Erstlinge begonnen, und sein Ende würde die Trennung bringen, von der Wolfsmutter und dem Wolfsvater, den Abschied voneinander, und dann würde jedes für sich ein neues Leben beginnen.
Bis zum Abend fiel noch einmal Schnee, und am nächsten Morgen war die Steppe schon vor Sonnenaufgang klar und taghell. Ruhe und Stille breiteten sich überallhin aus, und der beißende Winterhunger kündigte sich an. Das Wolfsrudel lauschte gespannt in die Umgebung, es war höchste Zeit für den Fang und das Erbeuten von Nahrung. Für die Treibjagd auf die Saigas erwartete Akbara die Mitwirkenden aus anderen Rudeln. Vorerst kündigte sich noch niemand an. Alle lauschten und warteten auf solche Signale. Da sitzt Großschädel in ungeduldiger Spannung, ahnt noch nicht, welche Mühen ihm bei der Jagd bevorstehen, auch Schnellfuß hält sich bereit, und dort Nesthäkchen – sie blickt der Wölfin in die blauen Augen, hingebungsvoll und kühn, während nebenan der Vater der Familie, Taschtschajnar, auf und ab geht. Und alle warteten darauf, wie Akbara befiehlt. Doch über ihnen waltete ein höherer Gebieter – Zar Hunger, der Herr über die Befriedigung der Leiber.
Akbara erhob sich und setzte sich trabend in Bewegung, längeres Warten war sinnlos. Und alle folgten ihr nach.
Alles begann etwa so, wie es der Wölfin geträumt hatte, als die Wolfsjungen noch klein waren. Und nun war die Zeit angebrochen, die eigentliche Zeit für die Steppentreibjagd in Rudeln. Noch würde es ein wenig dauern, bis sich mit den Frösten auch die Einzelgänger an die Wolfsgemeinschaften anschlössen und bis Winterende gemeinsam auf Beute gingen.
Unterdessen führten Akbara und Taschtschajnar ihre Erstgeborenen schon zur Bewährung zu ihrer ersten großen Jagd auf die Saigas.
Die Wölfe gingen, sich der Steppe anpassend, mal im Schritt, mal im Trab und pressten dabei in den jungfräulichen Schnee die Blumen von Raubtierspuren, Zeichen der Kraft und des geballten Willens, da schlichen sie unter den Sträuchern, mal geduckt, mal schlüpfend wie Schatten. Und alles hing nun von ihnen selbst ab und vom Glück …
Geschwind lief Akbara auf einen Hügel hinauf, Umschau zu halten, und erstarrte, die blauen Augen in die Ferne gerichtet und die Gerüche der Winde mit ihrem Spürsinn auslesend. Die große Savanne erwachte, so weit die Wahrnehmung im leichten Nebel reichte, die Saigaherden ließen sich nach dem Wind an verschiedenen Orten erwittern – riesige Ansammlungen von Jährlingen, die sich schon in neue Herden aufgeteilt hatten. Das Jahr war für die Saigas fruchtbar gewesen, das kam also auch den Wölfen zugute.
Die Wölfin verweilte auf der von Tschij bewachsenen Anhöhe etwas länger, sie hatte wohl auszuwählen und nach dem Wind zu bestimmen, wohin und in welche Richtung der Steppe sich begeben, um ohne Fehl die Jagd zu beginnen.
Und just zu dem Zeitpunkt war auf einmal von irgendwoher, seitwärts und von oben her, ein seltsames dumpfes Grollen zu hören, über die Steppe zog ein Heulen, das aber keineswegs dem Donnern des Gewitters ähnelte. Dieser Ton war völlig unbekannt und wurde derart laut, dass es auch Taschtschajnar nicht mehr hielt, er sprang zur Wölfin hoch, und sie beide wichen vor Angst zurück – am Himmel ereignete sich etwas, dort tauchte ein noch nie gesehener Vogel auf, ungeheuerlich krachend flog er über der Savanne, etwas schief liegend und mit dem Schnabel nach unten geneigt, dahinter, in einiger Entfernung, schien noch so ein Ungetüm zu fliegen. Sodann entfernten sie sich, und der Lärm verstummte allmählich.
Und so hatten zwei Hubschrauber den Himmel der Mujun-Kum durchschnitten wie Fische, die im Wasser keine Spuren ihrer Bewegung hinterlassen. Damit aber hatte sich weder oben noch unten etwas verändert, abgesehen davon, dass es um Luftaufklärung ging, dass darüber zu jener Stunde die Funksprüche der Piloten in unverschlüsseltem Text über den Äther gingen, was sie gesehen hatten, wo und in welchem Planquadrat sich Zugänge zur Mujun-Kum befanden, für Geländewagen und Laster mit Anhängern …
Aber die Wölfe – was hätten sie, da die urplötzliche Verwirrung einmal überstanden war, noch damit anfangen können – hatten alsbald die Hubschrauber vergessen und trabten über die Steppe zu den Revieren der Saigas hin, ohne auch nur im Traum zu ahnen, dass sie alle, alle Bewohner der Savanne, schon entdeckt, auf Karten in nummerierten Quadraten vermerkt und zum Massenabschuss verurteilt waren, dass ihr Untergang bereits eingeplant und koordiniert war, dass man schon auf zahllosen Motoren und Rädern heranrollte …
Woher sollten sie, die Steppenwölfe, auch wissen, dass ihre Urbeute – die Saigas – jetzt für die Erfüllung des Fleischplans gebraucht wurde, dass die Lage für das Gebiet außerordentlich angespannt war – der »Fünfjahresplan« wird platzen – und irgend so ein Forschling aus der Leitung des Gebietskomitees plötzlich die Strategie vorschlug: ran an die Fleischvorräte der Mujun-Kum. Die Idee lief darauf hinaus, es gehe nicht nur um die Produktion, sondern auch um den tatsächlich vorhandenen Fleischbestand, und nur dies sei der einzige Ausweg, das Gesicht dieses Gebiets in der Volksmeinung und bei den übergeordneten Aufsichtsorganen zu wahren. Woher hätten sie, die Steppenwölfe, wissen sollen, dass aus den Zentralen in das Gebiet Anrufe kamen, unverzüglich und augenblicklich die Forderung zu erfüllen. Buddelt es aus dem Boden, aber bringt das Fleisch her, Schluss mit dem Verschleppen, im Jahr, da der Fünfjahresplan abgeschlossen wird, was sollen wir dem Volk sagen, wo bleibt der Plan, wo bleibt das Fleisch, wo bleibt die Erfüllung der Verpflichtungen?
»Plan wird bestimmt erfüllt«, antwortete die Gebietsverwaltung, »in der nächsten Dekade. Zusätzlich Reserven an Außenstellen vorhanden, wir werden Druck machen, werden es einfordern …«
Und die Steppenwölfe schlichen sich zu der Stunde nichts ahnend und eifrig auf Umwegen zum verborgenen Ziel, immer noch von der Wölfin Akbara angeführt, geräuschlos auf den weichen Schnee tretend, sie näherten sich der letzten Grenze vor dem Angriff, den hohen Stängeln des Tschij, zwängten sich dazwischen und ähnelten dabei den bräunlichen Erdhügeln. Von hier konnten Akbaras Wölfe alles sehen wie auf einer Handfläche. Die unzählbare Herde der Steppenantilopen, alle wie ausgesucht, absolut einheitlich geschaffen, mit weißem Fell an den Flanken und kastanienfarbenem Rücken, weidete in dem breiten Tamariskental, ohne die Gefahr zu ahnen, und sie fraßen gierig das Steppengras mit dem feuchten Schnee. Akbara wartete vorerst noch ab, das war nötig, um vor dem Sprung Atem zu schöpfen und in einem Satz aus der Deckung hervorzupreschen und sich in vollem Lauf in die Verfolgung zu stürzen, und dann würde die Treibjagd schon selbst anzeigen, wohin und wie das Manöver zu lenken war. Die Jungwölfe hielten vor Ungeduld die Schwänze krampfhaft angelegt und stellten die Ohren wie fliegende Vögel, auch der beherrschte Taschtschajnar war bereit, die Stoßzähne in das erjagte Opfer zu hauen, ihm kochte das Blut; Akbara jedoch hielt die Flammen in den Augen verborgen und gab noch kein Zeichen zum jähen Absprung, sie wartete auf den günstigsten Zeitpunkt, nur dann konnte man mit einem Erfolg rechnen – die Saiga erreicht im Handumdrehen ein Tempo, dem kein anderes Tier folgen kann. Den günstigsten Zeitpunkt musste man erwischen.