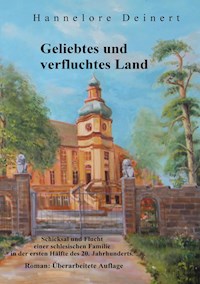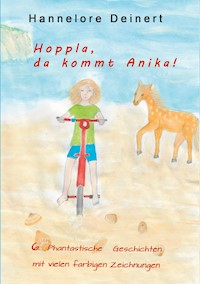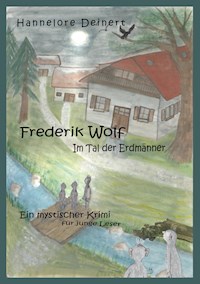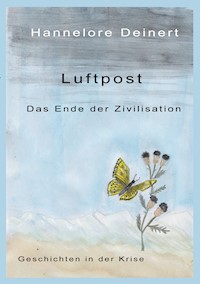5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In den Wirren des zweiten Weltkrieges bringt Karin ihre Tochter Fanny zur Welt. Der Tochter, die in einem schwachen Moment mit einem fremden Soldaten gezeugt wird, kann Karin keine Liebe geben. Als ihr Mann Fritz im Krieg fällt, droht Karin in eine Depression zu fallen. Sie lebt mit der Gewissheit, dass sie und alle am Krieg scheitern werden. Ohne die Liebe der Mutter, aber mit einem starken Überlebenswillen und der Gabe, Tiere zu verstehen, wächst die kleine Fanny zu einem aufgeweckten Mädchen heran. Dieser Roman ist eine Hommage an das Schicksal unzähliger Frauen der Kriegs- und Nachkriegszeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Nur ein kleiner Fehltritt
Das unerwünschte Kind
Der Tod wohnt nebenan
Meinen herzlichsten Dank an
alle, die zum Gelingen des Werks
beigetragen haben.
Impression:
Ein Menschenkind verirrt sich schutzlos in einer bedrohlichen, ihm feindlich gesinnten Welt. Es ist ein ungebetener Eindringling, den man wie eine junge, lästige Katze beseitigen will, weil man glaubt, es stände dem Glück im Wege.
Aber es hat einen Fürsprecher, einen guten Stern, nur wenn er erlischt, dann wird es allzu dunkel und kalt.
Aus Feuer und Asche erblüht neues Leben, irgendwann und unaufhaltsam. Das ist die Hoffnung.
Diese Geschichte beruht auf wahre Begebenheiten, die sich während des zweiten Weltkriegs zugetragen haben.
Die Namen der Protagonisten wurden geändert.
Nur ein kleiner Fehltritt
Maikäfer flieg’!
Dein Vater ist im Krieg.
Deine Mutter ist in Pommerland,
Pommerland ist abgebrannt.
Maikäfer flieg’.“
(Wiegenlied aus den Kriegsjahren)
Eigentlich war dieser herrliche Maimorgen im Jahre 1941 wie geschaffen für Glücksgefühle, aber Karin Gruber wurde, als mit dem etwas schwergängigen Herrenfahrrad, das sie sich von ihren Wirtsleuten ausgeliehen hatte, den langgezogenen Hügel hinauf strampelte, von Angst und Ratlosigkeit getrieben. Endlich oben, stieg sie vom Rad, zog das selbstgehäkelte Jäckchen aus und legte es hinter sich in den Fahrradkorb. Es war ihr trotz der Morgenkühle warm geworden und es lag noch ein weiter Weg vor ihr.
Sie hatte die Eltern schon lange nicht mehr besucht, denn es machte keinen besonderen Spaß, das schwarze Schaf der Familie zu sein. Sie war das siebte von den acht Kindern der Bauersleute Alois und Eva Niederhammer, die in der Niederbayrischen Gemarkung Train einen Hopfenbauernhof bewirtschafteten.
Zwei Militärsjeeps kamen Karin entgegen. Die Soldaten darin winkten der hübschen, jungen Frau übermütig zu, Karin winkte zurück. So ein fescher Soldat auf Krankenurlaub war es gewesen, der für das Dilemma, in dem sie sich jetzt befand, verantwortlich war.
Während Karin einen Hügel hinunter raste, wobei ihr dunkelbraunes, langes Haar wie eine Fahne hinter ihr her wehte und ihr Rock heftig im Fahrwind flatterte, tauchten schon die ersten Hopfengärten auf, der junge Hopfen rankte sich bereits an den dicken Drähte zu dem Gerüst hinauf, welches von dicken Balken getragen wurde.
Karins Gedanken aber schweiften zu jenem Abend zurück, an dem sie mit ihrer Freundin Hilde im Cafe Amman gesessen hatte:
Es war das beliebteste Tanzkaffee in Kelheim und an den Wochenenden immer gut besucht. Abends tanzten die jungen Leute gern nach den besinnlichen oder flotten Klängen eines elektrischen Klaviers.
Auch an jenem Abend saßen Karin und Hilde an ihrem Lieblingstisch, ganz hinten am Fenster, wo man weitgehendst ungestört war und das Lokal gut überschauen konnte. Während sie Lale Andersons gefühlvolles Lili Marlene lauschten, wurde Karin auf die jungen Männer am Nebentisch aufmerksam. Sie waren in Zivil, rauchten und unterhielten sich leise miteinander, wobei sie, wie Karin belustigt bemerkte, verstohlene Blicke zu ihr und Hilde herüberwarfen. Als einer von ihnen, ein fast nobel aussehender junger Mann mit rotblondem Haar, herüberkam und sie mit einer leichten Verbeugung um einen Tanz bat, sah sie keine Veranlassung, dies abzulehnen. Sie stand lächelnd auf und ging ihm voran zur Tanzfläche. Weitere Paare folgten, auch Hilde mit einem jungen Mann mit einer Augenbinde. Die kleine Tanzfläche füllte sich.
Sie wiegten sich im Takt und Karin lauschte der leisen, angenehmen Stimme ihres Tanzpartners dicht an ihrem Ohr. Er sprach von einem verirrten Granatsplitter, der ihm eine Woche Fronturlaub beschert hatte, aber schon morgen früh müsse er zurück zu seiner Einheit. Ob er jemals wiederkehren würde, das weiß nicht einmal der liebe Gott. Während er Karin sanft an sich zog und sie von Fritz, ihrem Mann, erzählte, von dem sie seit Monaten nichts mehr gehört, geschweige denn gesehen hatte und den sie so sehr vermisste, überkam beide eine große Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Nähe. Karin blickte in zwei sehnsüchtige Augen, sie ließ es zu, dass er den Arm um sie legte und hinausführte. Sie schlenderten Arm in Arm durch eine stille Gasse, am „Alten Markt“ bogen sie hinter dem Brauhaus in den schmalen Weg zum Kanal ein. Dort küssten sie sich, an der Uferböschung breitete er seine Jacke aus und einen seligen Moment lang gaben sie sich ihrem Hunger nach Nähe hin, sie vergaßen den Krieg und die Sorgen, sie vergaßen die Welt um sich.
Danach brachte der Fremde Karin, zärtlich einen Arm um sie gelegt, nach Hause. Sie wohnte am ‚Alten Markt’, in einem kleinen Haus, in dem sich ein Milchlädchen befand, einige abgetretene, in das Haus gebaute Steinstufen führten zu ihm hinauf. Ein hoher Lattenzaun verband das Haus mit dem zweistöckigen Nachbargebäude und grenzte einen Innenhof zur Straße hin ab.
Karin und der Soldat blieben vor der Lattentür stehen, er nahm ihr Gesicht in die Hände und flüsterte: „Wenn es mir dreckig geht, schöne Unbekannte, dann denk ich an dich, dann werde ich alles überstehen können.“
Dann schritt er schnell Richtung Donaustraße davon. Karin sah seiner aufrechten, von den Straßenlaternen schwach beschienenen Gestalt nach, bis sie, sich noch einmal umwendend und zurückwinkend, an der Hausecke des Cafés Amman verschwand.
Karin ging durch den Innenhof zum Abort, er befand sich am Ende des Hofs, in einem niedrigen Gebäude, das plan an die kahle Wand des zweistöckigen Nachbargebäudes grenzte. Unter dem zum Hof hin leicht abfallendem Dach befanden außer dem Abort noch ein Schuppen und eine Waschküche. Die Bretterwand an der Straßenseite gegenüber schloss den Hof hermetisch von der Außenwelt ab.
Obwohl Obermüllers, die Vermieter, hier regelmäßig für Sauberkeit sorgten, die Sitzfläche mit dem runden, abnehmbaren Holzdeckel und der Bretterboden wurden jeden Tag geschruppt, legte Karin die Sitzfläche sorgfältig mit Zeitungspapier aus, davon lag reichlich bereit, denn Herr Obermüller war ein fleißiger Zeitungsleser. Aus der Setzgrube roch es streng, Karin war froh, als sie wieder draußen war und tief die frische Nachtluft einatmen konnte. Sie betrachtete kurz den klaren Sternenhimmel, dann betrat sie das Haus durch die seitlich gelegene Haustür und stieg die schmale Holzstiege zum Taubenschlag hinauf. So hatten Fritz und sie die kleine Mansarde, in die sie schon vor ihrer Heirat eingezogen waren, getauft.
Die Kammer, die sie betrat, wurde vom übrigen Dachboden durch eine Bretterwand abgetrennt, sie war geräumig und niedrig. Unter die Dachschräge hatte Fritz ein offenes, grobes Regal eingebaut, in dem Küchenutensilien und Lebensmittel untergebracht waren. Die zwei kleinen Fenster gingen zu den Gärten der Häuser hinaus, davor stand ein noch recht ansehnliches, bequemes Kanapee, das Hilde, Karins Freundin, irgendwo organisiert hatte. In der Raummitte stand ein schlichter Holztisch mit einer hübschen Tischdecke darauf, er war von vier Stühlen umgeben. Von der Decke hing ein Kabel mit einer nackten Glühbirne herab, einen Schirm konnte Karin noch nicht auftreiben. Links neben der Tür befand sich der Herd mit den drei Ofenplatten und rechts eine Bretterwand mit einer Tür, die in einen schmalen Raum, kaum größer als eine Abstellkammer, führte. Zwei Betten standen darin und unter der Dachschräge ein schäbiges, viertüriges Seitboard und ein Bretterregal, in denen die Wäsche der kleinen Familie Platz fand. Fritz‘ geliebte Gitarre lag in einem Leinenbeutel auf dem Seitboard.
Unter dem winzigen Fensterchen stand ein Bett, indem Karins vierjähriges Söhnchen Andi friedlich schlief. Karin hatte die bloße Glühbirne, die von der Decke hing, brennen lassen und mit einem Tuch abgedeckt, sodass ein sanftes Schlummerlicht den Raum schwach erhellte, die Obermüllers hatte sie gebeten, ein Auge und ein Ohr auf das schlafende Kind zu haben. Obermüllers taten es gern, sie hatten Verständnis für die junge Frau, wenn sie gelegentlich ausgehen wollte.
Nun galt Karins erster Blick ihrem schlummernden Söhnchen. Sein kurzes Blondhaar war verwuselt und sein freches Sommersprossengesichtchen gerötet und gelöst im Schlaf. Wieder stellte Karin gerührt fest, wie unwahrscheinlich er seinem Vater ähnelte.
Müde ging sie in den Wohnraum zurück, schöpfte aus dem Warmwasserbehälter des Herds warmes Wasser in eine Schüssel und wusch sich sorgfältig, wobei sie darauf achtete, sparsam mit der nach Veilchen duftenden Seife umzugehen. Sie und das ebenfalls nach Veilchen duftende Badesalz waren Hochzeitsgeschenke von Horst und Arnold, ihren Trauzeugen, sie waren Raritäten, denn in der Seifenfabrik, in der sie arbeitete, wurde nur gewöhnliche Kernseife hergestellt.
Danach legte sich Karin in das zweite Bett in der Schlafkammer und dachte an Fritz, ihrem Mann.
„Mein Gott“, dachte sie, „wie konnte mir das nur passieren? Welcher Teufel hat mich nur geritten?“ Sie schämte sich, aber sie hatte nicht wirklich das Gefühl etwas Schlechtes getan zu haben. Sie sah nicht wirklich einen Grund, dieses Erlebnis zu vergessen oder zu verdrängen, denn es war Fritz gewesen, den sie geliebt hatte. Aber Fritz durfte trotzdem nie etwas davon erfahren. Nie und nimmer.
Natürlich war sie nie ein Kind von Traurigkeit gewesen, und als sie Fritz Gruber vor fünf Jahren begegnete, da hatte sie nicht lange nach seinem Woher und Wohin gefragt. Er war von Anfang an ihre große Liebe gewesen, bis heute, daran konnte auch die Ablehnung der Eltern und der Geschwister nichts ändern. Erst recht nicht die verfluchte Schwangerschaft.
Wieder fühlte Karin eine ohnmächtige Wut in sich aufsteigen. „Der Fremde ist weg“, dachte sie bitter, „und spielt irgendwo in Frankreich oder sonst wo den Helden. Sie durfte nun allein diesen winzigen Moment der Schwäche ausbaden. War das gerecht?
Nun war sie nach all den Jahren auf dem Weg zu den Eltern. Es würde ein Canossagang werden, das wusste Karin, aber sie würde nicht reumütig und demütig zurückkommen, sie brauchte keine Vergebung für dass, was sie getan hatte, sie brauchte nur ein wenig Zuwendung, brauchte Verständnis und Rat, vielleicht auch ein wenig Hilfe. Sie fühlte sich so allein.
Währenddessen war es Mittag geworden und Karin hatte einen Großteil ihres Weges, von Kelheim nach Train waren es etwa zwanzig Kilometer, zurückgelegt. Gelegentlich kam ihr ein Militärfahrzeug oder ein Pferde- oder Ochsengespann entgegen, die hauptsächlich von Frauen oder Burschen oder älteren Männern, die für den Wehrdienst zu jung oder zu alt waren, gelenkt wurden. Karin hoffte, dass ihr Vater noch nicht eingezogen worden war.
Auf den Äckern arbeiteten junge Frauen, die ihren Arbeitsdienst bei den Bauern ableisten mussten. Natürlich auch polnische Zwangsarbeiterinnen, die froh waren, nicht in einer Rüstungsfabrik arbeiten zu müssen, die überall wie Pilze aus dem Boden wuchsen. Sie winkten Karin zu, die schon mühsamer in die Pedale ihres schweren Fahrrades treten musste, Karin winkte zurück.
Sie hatte nie viel mit Stall- und Feldarbeit am Hut gehabt, wusste sich immer erfolgreich davor zu drücken, was bei den Geschwistern natürlich nicht gut ankam.
Karin hatte es geliebt, beim Vater zu sitzen, wenn er abends mit den anderen Bauern der kleinen Gemarkung beim Ochsenwirt saß, einen zünftigen Schafskopf drosch, dabei seinen Schoppen Bier trank und sich gerne eine Prise Schnupftabak reinzog. Schon mit neun Jahren war sie ein ernstzunehmender Gegner für die alte Schafskopfriege gewesen, worauf Bauer Niederhammer natürlich immer mächtig stolz war. Ihr gelang es zur Freude der Mutter auch, den Vater meist beizeiten, wenn auch schon mit leichter Schlagseite nach Hause zu manövrieren.
Sie war gerade vierzehn Jahre alt und hatte eben die Volksschule hinter sich, als sie schon beim Ochsenwirt beim Bedienen mithelfen durfte und sich bei ihm zunehmend unentbehrlich machte. Natürlich kam sie nicht ganz davor herum, auf den Feldern und Wiesen beim Ernten mitzuhelfen oder der Mutter im Haus zur Hand zu gehen, aber sie brauchte zum Beispiel nicht wie die Geschwister morgens um fünf im Stall zu stehen, auszumisten und die Kühe zu melken, denn sie hatte ja bis spät in die Nacht hinein bedient und nebenbei reichlich Trinkgelder kassiert.
Bislang hatten die Geschwister, zuerst Eva, die ältere, dann Lenz und dann Sepp im Ochsenwirt geheiratet und waren danach weggezogen. Als Karins Lieblingsbruder Georg seine Elisabeth heiratete, platzte der Ochsenwirt aus allen Nähten. Ein Schlagzeuger, ein Saxophonist und ein Gitarrist, der auch sang, sorgten für Stimmung und brachten die Hochzeitsgesellschaft ordentlich in Schwung, sie wurden von der anwesenden Weiblichkeit kräftig angehimmelt.
Karin half beim Bedienen und hatte alle Hände voll zu tun. Den Gitarristen allerdings konnte sie trotzdem weder überhören, schon gar nicht übersehen. Er spielte und sang wie ein junger Gott und sah auch so aus. Er hatte eine sportliche Figur, ein freches, hübsches Gesicht und blondes Haar, das ihm bei jeder seiner rhythmischen Bewegungen in die breite Stirn fiel.
Bald bemerkte Karin geschmeichelt, dass er ihr mit seinen blauen Augen überallhin folgte und sie schenkte ihm dafür, wann immer sich ihre Blicke begegneten, ihr allerliebstes Lächeln.
Fritz Gruber aber sang und spielte nur für das Mädchen im engen, schwarzen Kleid mit dem weißen Kragen und dem weißen Schürzchen. Traumhaft sicher und mit katzenhafter Geschmeidigkeit balancierte sie die Tabletts mit den überschäumenden Bierkrügen durch die Tanzenden, von Tisch zu Tisch, unglaublich bei der knabenhaft zarten Figur. Er bewunderte ihr dunkles, seidiges Haar, welches zu einem Pferdeschwanz gebunden, bei jeder ihrer Bewegungen lustig wippte, und die dunklen Löckchen, die aufs lieblichste ihr ovales, hübsches Gesicht und ihren Nacken umspielten. Wenn sie ihm und seinen Kameraden einen Schoppen Bier brachte, verliebte er sich in ihre sanften, rehbraunen Augen und in ihr bezauberndes Lächeln, das offensichtlich nur ihm galt.
Nun, es kam wie es kommen musste, nicht die Braut wurde in dieser Hochzeitsnacht entführt, sondern Karin vom Gitarristen.
Das war schlimm genug, dachte Karin und quälte sich wieder einen Buckel hinauf, aber was dann kam, konnten ihr die Eltern nicht verzeihen.
Drei Tage war sie bei Fritz, in seiner winzigen Junggesellenbude gewesen. Sie feierten ihre Liebe, sie scherzten, lachten und Fritz kochte Rührei und Bratkartoffeln.
Dann war sie mit Fritz nach Hause gegangen, sie wollte ihn in ihrer Naivität den Eltern vorstellen und Fritz wollte um ihre Hand anhalten. Aber die Eingangstür war verschlossen gewesen, Karin wusste bis dato gar nicht, dass es einen Schlüssel dafür gab, ein kleiner Koffer stand davor.
Sie trommelte mit beiden Fäusten an die Tür und rief nach den Eltern, da war der Vater mit verkniffenem Gesicht herausgekommen. Sie wollte ihm erklären, ihm von ihrer Liebe erzählen, vielleicht sich auch entschuldigen, aber er hatte nur mit starrem Blick an ihr vorbeigeschaut und gesagt: „Nein, Karin, es ist vorbei. Du hast einen Schlussstrich gezogen, du hast uns das Herz gebrochen. Erwarte nichts mehr von uns.“
Dann hatte er die Tür zugemacht, ohne Fritz überhaupt wahrgenommen zu haben.
Karin stand da, als wäre sie vom Blitz getroffen worden, ungläubig hatte sie die verschlossene Haustür angestarrt. Fritz nahm sie tröstend in die Arme und drückte ihren Kopf an seine Brust. Sie hatte sich unwillig freigemacht und war mit steifen Knien zu Hector, dem Hofhund, gegangen, hatte ihn gestreichelt, ein letztes Mal. Dann hatte sie wie um Abschied zu nehmen über den Hof geschaut, alles war so still und traulich gewesen, so als wäre nichts passiert. Die Geranien vor den kleinen Fenstern im Erdgeschoss blühten, sie waren Mutters Stolz, die angebauten Stallungen mit der Tenne darüber lagen völlig friedlich da. Auf der Anhöhe dahinter wusste Karin den Apfelhain, den sie so mochte, ein stabiler Holzsteg, über den die Ernten eingefahren werden, verbindet ihn mit der Tenne.
Sie schaute in den überdachten Durchgang hinein, der zum Abort und dem Kräutergärtchen der Mutter führt, er war wie immer reinlich gefegt. Er verbindet die Stallungen mit dem längst stehenden Geräteschuppen mit dem großen, zweiflügligen Tor. Das angebaute Gewölbe, ehemals ein Schweinestall, grenzt an die Dorfstraße und dient jetzt als Schlafplätze für die Saisonarbeiter. Gegenüber schließt die fensterlose Fassade des Ochsenwirts den Hof wie ein Atrium ab. Zwei Zufahrten von der Dorfstraße herkommend, dazwischen ein ummauerter, im Boden eingelassener Misthaufen, erlauben ein problemloses Ein- und Ausfahren der Fuhrwerke, ohne dass gewendet werden muss.
Fritz hatte Karin ein wenig Zeit gelassen, dann hatte er seinen Arm um ihre Schultern gelegt, ihren Koffer aufgenommen und sie sachte aus dem Hof geführt. Karins Herz war so schwer wie ein Stein gewesen, willenlos ließ sie sich leiten. Beim Ochsenwirt wollte sie in die Gaststube laufen, um sich zu verabschieden, aber Fritz hatte sie weitergezogen, zur Bushaltestelle, einige Bauersleute hatten ihnen verwundert nachgeschaut. Als der Bus kam, waren sie eingestiegen und durch einige Dörfer gefahren, bis zu dem Ort, in dem Fritz und seine Freunde wohnten. Dort, in einer Dorfkneipe, in der die jungen Männer oft einkehrten und zu Mittag aßen, hatten sie auf Fritz‘ Freunde, Horst und Arnold, gewartet.
Karin hatte wie ein aus dem Nest geschubster, kleiner Vogel ausgesehen. Fritz hatte versuchte, ihre Tränen und ihren Kummer einfach wegzuküssen. Dann waren Horst und Arnold gekommen und es wurden eifrig Zukunftspläne geschmiedet. Dabei hatten Karins Bauernstolz und ihr frecher Egoismus endlich wieder Oberhand gewonnen
Zuerst wollten sie es in Kelheim versuchen, dort, in der Kreisstadt, rechneten sie sich die besten Chancen aus, um sich in den zahlreichen Lokalen und Tanzkaffees bekannt zu machen.
„Kannst du singen, Karin?“, hatte Arnold gefragt.
„Wie eine Krähe“, hatte Karin lachend geantwortet, „aber ich mag Musik.“
Fritz‘ Sachen hatten in einem kleinen Koffer gepasst. Er bezahlte seine Zimmermiete, dann fuhren sie noch am gleichen Tag voller Zuversicht mit einem Bus nach Kelheim.
Das Städtchen Kelheim liegt am Ende eines Jura-Berglandes, zwischen dem Fluss Donau und dem kleineren Flüsschen Altmühl, sie hatten sich in Jahrmillionen ihre Betten durch die felsigen Hügel des Jura-Berglands gegraben. Einige Kilometer nach Kelheim mündet die Altmühl in die Donau, davor erstreckt sich ein nur wenig von Menschen besiedeltes Sumpfgebiet, in dem sich Reiher, Störche, Wildgänse, Enten und zahllose Amphibien, wie Frösche, Kriechtiere, Echsen heimisch fühlen.
Kelheim ist eine lebendige Kleinstadt, deren Hauptstraße von schönen Bürgerhäusern gesäumt und von einer gut erhaltenen Stadtmauer mit drei Stadttoren und einigen Wehrtürmen umgrenzt wird. Ihren Reichtum verdankt die Stadt den drei großen Brauereien und den Zellstoff- und Zellwollfabriken.
Vom Mittelalter her stammen die Kanäle, die man aus Abwehrgründen um Kelheim verlegt hatte. Der kleine Hafen hinter der westlichen Stadtmauer bildet den Abschluss des Rhein-Main-Donaukanals, den König Ludwig schon im 19. Jahrhundert anlegen ließ. Auch den monumentalen Rundbau der Befreiungshalle ließ er zum Gedenken an die Befreiungskämpfe der deutschen Fürsten gegen Napoleon erbauen, er steht allzu wuchtig und dominant auf dem Michelsberg, welcher das Jura-Bergland abschließt. Dem Wanderer, der durch die Flussauen der Donau und der Altmühl streift, grüßen viele Burgen und Schlösser von den bewaldeten, felsigen Hügeln herab.
Im kleinen Haus am ‚Alten Markt‘ fanden Karin und Fritz schnell eine billige Bleibe. Sie nannten die Mansardenkammer unter dem Dach liebevoll ihren Taubenschlag. Über der Kammer, unter dem Ziegeldach, ergab sich ein niederes, offenes Räumchen, das sie als Abstellraum benutzen durften.
Horst und Arnold hatten gegenüber dem ‚Alten Markt’, in einem ebenerdigen, ehemaligen Spital und Armenhaus, in dem derzeit militärische Amtsstuben untergebracht waren, ein Domizil gefunden. Sogar einen Raum zum Proben für ihre Auftritte stellte man dem Trio großzügig und kostenlos zur Verfügung.
Die Band nahm so ziemlich alles an, was sich ihr bot. Sie spielte in jeder Kneipe und bei privaten Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Jubiläen und Geburtstagen. Und weil sie gut war und ihr Repertoire vielseitig, sie spielte was immer gewünscht wurde, Swing, Foxtrott, Tango, Charleston, arbeitete sie sich allmählich in die besseren Veranstaltungen hoch und verdiente dadurch auch mehr Geld. Anfangs stand Karin, mit einem Charleston-Kleid und hohen Pomps angetan dabei und versuchte ein Tamburin schwingend und mit den Hüften wackelnd die Band zu unterstützen, aber beim besten Willen, sie brachte die Band dadurch nur aus dem Takt und so verzichtete man schnell auf sie. Karin war es recht, denn sie bediente lieber und kassieren dabei tüchtig die Trinkgelder der gutgelaunten Herren.
Als sie sich aber im kleinen Friseursalon nebenan die Haare schulterlang abschneiden und zu einer Innenrolle brennen ließ, so wie die mondänen Filmstars in den Zeitschriften und auf den Filmplakaten, und sie sich wie diese die Lippen groß und rot anmalte, war Fritz nicht gerade begeistert davon. Er strich ihr die starren Locken aus der Stirn und küsst ihren Haaransatz, dabei meint er missbilligend und tadelnd: „Das steht dir nicht, Karin. Mir wär es lieber, du bleibst du selbst, so gefällst du mir am besten.“
Karin war verärgert und streckte ihm die Zunge raus. Sollte sie immer wie ein Landei herumlaufen?
Als sich Andi ankündigte, löste das bei Karin und Fritz eine Riesenfreude aus, auch Horst und Arnold waren begeistert über den Bandnachwuchs, wie sie es nannten. Ausgelassen feierten sie die gute Nachricht und Karin wurde von Stund an wie ein rohes Ei behandelt.
Sie legten im Standesamt einen Hochzeitstermin fest, Horst und Arnold sollten die Trauzeugen sein. Natürlich, sie waren die Besten, die man sich hätte wünschen können. Sie organisierten in einem Lokal einen separaten Raum und dekorierten ihn mit Luftballons und Glücks-Transparenten. Irgendwoher trieben sie eine alte Pferdekutsche mitsamt Pferd auf und putzten beides liebevoll heraus.
Karin war einundzwanzig Jahre alt, Fritz ein wenig älter, als sie im September des Jahres 1936 mit der geschmückten Pferdekutsche, auf dessen Bock Horst und Arnold saßen, zum Standesamt fuhren.
Sie war glücklich und sah in ihrem hübschen, blauen Kostüm, das den kleinen Schwangerschaftsbauch gut kaschierte, der weißen, dezent bestickten Bauernbluse, den modernen Nahtstrümpfen und den hohen Pumps, die sie noch von ihren missglückten Auftritten her hatte, bezaubernd aus. Fritz trug zu seiner schwarzen Kniebundhose ein schlichtes, weißes Leinenhemd, graue Kniestümpfe mit Zopfmustern, schwarze Trachtenschuhe und eine graue Trachtenjoppe.
An eine christliche Hochzeit war allerdings nicht zu denken, denn Fritz war, wie Karin erst jetzt wirklich registrierte, ein Evangelischer. Für einen Geistlichen wäre es undenkbar gewesen, dieser Verbindung, in der die Braut obendrein unübersehbar schwanger war, den christlichen Segen zu erteilen.
Sie feierten allein, das heißt, jeder der wollte konnte mittanzten und mitsingen, es wurde ein ausgelassenes Fest, das bis in die frühen Morgenstunden hinein andauerte. Als sie endlich nur noch zu viert zusammensaßen, wurde Fritz plötzlich, vielleicht durch den ungewohnten Weingenuss, von einer tiefen Wehmut heimgesucht. Er beklagte sich bitter, dass weder Karins noch seine Familie an diesem für sie so wichtigen Tag teilgenommen hatten und ihnen sogar die Kirche den Segen für ihren Lebensbund verweigerte.
„Wisst ihr“, fing er zu erzählen an und lächelte dabei verlegen, „ich würde mich lieber heute als morgen mit meiner Familie versöhnen, aber ich weiß nicht wie. Es war ein so peinlicher, so ärgerlicher Anlass, warum ich gegangen bin, oder besser gesagt, gehen musste. Ihr werdet es nicht glauben, es war eine dumme Weibergeschichte. Das Blödeste daran ist, ich habe keine Schuld daran, außer vielleicht, dass ich mich reichlich dämlich angestellt habe.“
„Komm zur Sache, Fritz“, drängte Horst, der sich langsam nach seinem Bett sehnte. „Was ist denn passiert?“
„Das ist schnell erzählt“, meinte Fritz. „Wisst ihr, mein älterer Bruder arbeitet als Juniorchef im Sägewerk unseres Vaters. Er bewohnt mit seiner Frau den ersten Stock unseres Elternhauses, ich selbst hatte es mir unterm Dach gemütlich gemacht. Und einmal, es war schon spät, ich war gerade von einer Probe nach Hause gekommen und wollte mich hinlegen, da klopfte es an meine Tür. Ich wunderte mich und öffnete, die Frau meines Bruders stand davor, mit nichts an als einen Bademantel. Ich dachte schon, es wäre was passiert.
Sie aber schlüpfte herein und kam gleich zur Sache. Ihr wisst, ich bin absolut nicht spröde, das kann man nicht behaupten, aber gewisse Grundsätze, wie die Frau des Bruders ist Tabu, die kenne ich schon. Außerdem liegt meine Schwägerin nun wirklich gar nicht auf meiner Wellenlänge. Als sie mich umarmen wollte, nun, da schmiss ich sie kurzerhand raus. Kann schon sein, dass ich dabei etwas grob war und sie ein paar blaue Flecke abgekriegt hat, jedenfalls zog sie, wüste Beschimpfungen und Drohungen ausstoßend, ab.
Am nächsten Morgen, als ich arglos in die Küche kam, ich hatte den peinlichen Vorfall in der Nacht halbwegs verdrängt, da traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein gut platzierter Faustschlag am Kinn und warf mich zu Boden. Ich schaute, mein verrenktes Kinn haltend, überrascht auf, mein Bruder stand mit zornigem Gesicht und drohend kreisenden Fäusten über mir. „Steh auf, du feige Sau!“, schnaubte er, „und verteidige dich!“
Seine Frau lehnte am Büfett und schaute mich mit unverhohlener Schadenfreude und Boshaftigkeit an. Meine Mutter kam erschrocken herein und wollte wissen was los ist.
„Das Schwein hat letzte Nacht versucht, Leoni zu vergewaltigen“, schnaubte mein Bruder, jederzeit bereit, mich zu zermalmen und dann zu zerschmettern. Meine Unschuldsbeteuerungen tat er als feige Ausreden ab, im Gegenteil, sie steigerten nur noch seine Wut. Für ihn gab es nur eine akzeptable Lösung: Den Kampf.
Der Austragungsort sollte die Wiese hinter dem Haus sein, dort hatten wir immer unsere freundschaftlichen Machtkämpfe ausgetragen. Sollte ich den Kampf verlieren, müsste ich mich formell bei meiner Schwägerin entschuldigen und ihr ein beachtliches Schmerzensgeld bezahlen. Wie der Kampf auch ausgehen würde, ich müsste danach meinen Koffer packen und gehen, und zwar auf der Stelle und auf Nimmerwiedersehen.
Da begriff ich erst den Ernst der Lage und dass ich gegen die bösartigen Unterstellungen meiner Schwägerin keine Chance hatte. Mochten sie von mir denken was sie wollten, ich ging hinauf in meine kleine Wohnung und packte meinen Koffer. Ehe ich das Haus verließ, ging ich in die Wohnstube, um meinen Eltern den wahren Sachverhalt zu schildern und mich zu verabschieden, denn ich hatte keine Lust weiterhin mit dieser Frau unter einem Dach zu leben. Meine Mutter, Vater war schon im Betrieb, stand mit versteinertem Gesicht am Fenster und starrte hinaus.
„Spar die die Worte, Fritz“, sagte sie mit rauer Stimme, ohne mich anzusehen, „es ist einfach zu beschämend.
Also ging ich. Mein Bruder sah mich weggehen und rief mir nach: „Du feige Sau, nicht einmal Manns genug für einen fairen Kampf bist du!“
Fritz schwieg. Karin sah es ihm an, wie sehr er unter dieser Sache litt. Er war also auch ein Heimatloser, ein Verjagter, so wie sie. Es war sogar noch schlimmer bei ihm, denn er wurde verleumdet und mit Schimpf und Schande von Zuhause weggejagt, was er sich hatte nie anmerken lassen, immer war positiv und unternehmungslustig. Karin nahm sich vor, ihm eine liebende, gute Frau zu sein.
Andi kam im folgenden Februar im Kreiskrankenhaus von Kelheim auf die Welt. Er hatte drei Väter, die völlig vernarrt in den Wonnepfropfen waren. Er war ein wohlgenährtes, zufriedenes Kind, das, von Karin gestillt und von den Bandmitgliedern grenzenlos verwöhnt, von Anfang an zu allen Veranstaltungen und Unternehmungen mitgenommen wurde. Oft musste Karin die Bandmitglieder ermahnen, es nicht zu übertreiben mit dem kleinen Kerl, wo sollte das denn hinführen,
Es war eine unwiederbringlich schöne Zeit.
Als Andi zwei Jahre alt war, wurden Fritz und seine Freunde zum Wehrdienst einberufen. Man müsse, wie es im lockeren Slogan der jungen Leute hieß, die vorwitzigen Polen ein für allemal in ihre Schranken verweisen. Wie alle Einberufenen hatten sie keinen Zweifel daran, dass es eine schnelle, relativ schmerzlose Angelegenheit werden würde, den Polen gute Manieren beizubringen.
Im August des Jahres 1939, am Abend bevor sie am nächsten Morgen mit dem Zug nach Regensburg zu ihrer zugewiesenen Einheit abfahren mussten, feierten die zukünftigen Helden und Befreier im Weißen Brauhaus übermütig ihren Abschied.
Erst an Weihnachten, Karin hatte die Mansarde mit Tannenzweigen geschmückt, kam Fritz in seiner grauen Uniform, erschöpft, still und abgemagert die Stiege zum Taubenschlag herauf. „Polen ist besiegt“, sagte er später nur.
„Dann kannst du jetzt also zu Hause bleiben?“, fragte Karin hoffnungsvoll, aber Fritz meinte nur: „Sieht so aus, als würden wir demnächst in Finnland einmarschieren. Außerdem befürchtet man, dass sich die Engländer und Franzosen einmischen und sich gegen uns mobilisieren werden.“
Erst später erzählte er, dass Arnold zu einer anderen Division abkommandiert worden war und Horst vor seinen Augen im Granatenregen gefallen sei.
Eine kurze Woche war Fritz da. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute entglitt unwiderruflich wie Sand zwischen den Fingern. „Bleib doch“, bettelte Karin am Vorabend seiner Abreise, „versteck’ dich irgendwo, aber geh’ nicht mehr zurück in diesen verdammten Krieg!“
Aber sie wusste es so gut wie Fritz, dass dies nicht möglich war. Sie spürten beide, es gab kein Entrinnen aus dem verhängnisvollen Sog, in den sie und alle anderen geraten waren.
Karin hatte in der Seifenfabrik Arbeit bekommen, dort lernte sie Hilde Wagner, eine Arbeitskollegin, kennen. Sie arbeiten beide in der Verpackungs- und Etikettier-Halle, in der es vergleichsweise ruhig und sauber zuging im Vergleich zur Produktionshalle. Dort verursachten die malmenden Knochen in den Mühlen einen ungeheuren, unangenehm knirschenden Lärm und der siedende Knochenbrei verströmte einen widerlich süßen Geruch, der den Arbeiterinnen auch nach der Arbeit noch anhaftete und sie mit nach Hause trugen.
Bald glaubte Karin zu wissen, warum sie und Hilde und andere mehr oder weniger hübsche Frauen in der Packerei arbeiten durften. Sie wettete mit Hilde, wann der Vorarbeiter, der sich wie ein Gockel im Hühnerhof aufführte, anfangen würde, sie mit dummen Sprüchen und Handgreiflichkeiten zu belästigen.
Andi wurde während ihrer Arbeitszeit von den Hausleuten, den Obermüllers, betreut, sie hatten den kleinen, aufgeweckten Kerl in ihr Herz geschlossen. Für seine Betreuung zahlte Karin ein wenig mehr Miete und brachte gelegentlich Kern- und Schmierseife von der Fabrik für sie mit. Die Aufseher wussten, dass die Arbeiterinnen ungefragt die Ausschussware mit nach Hause nahmen und tolerierten es stillschweigend, wohl auch deshalb, weil sie sich selbst reichlich davon bedienten. Seife gab es schließlich im Überfluss in der Seifenfabrik.
Erst im Sommer kam Fritz für ein paar Tage nach Hause, aber von seinem einstigen Frohsinn und seiner Zuversicht war nicht mehr viel zu bemerken. Er war in sich gekehrt und schweigsam, und wenn Karin ihn verwöhnte und liebte, ließ er es ohne große Ambitionen zu.
Bei seiner Abreise sagte er: „Sieht so aus, als würden wir demnächst in Flandern einmarschieren, Karin. Gott steh’ uns bei.“
„Aber wozu?“, fragte Karin erbost.
Fritz umarmte sie so lang und innig, als wäre es ein Abschied für immer.
Der Krieg war fern, an die deutschen Bomber, die gelegentlich am Himmel vorbeibrummten, hatte man sich gewöhnt. Andi wurde ein richtiges Bengelchen und war kaum noch zu kontrollieren. Oft verschwand er für Stunden und keiner hatte Zeit, nach ihm zu suchen. Wenn er Hunger hatte, tauchte er von selbst wieder auf, also gewöhnte man sich daran.
Als Fritz Ende des Jahres kam, ging er auf Krücken, er hatte oberhalb des Knies einen Durchschuss abbekommen, der ihm womöglich ein steifes Knie bescheren würde. Er kam direkt aus einem Frontlazarett und durfte bis zu seiner Genesung zu Hause bleiben.
„Hauptsache, du bist wieder da“, meinte Karin tapfer. „Du wirst sehen, Andi und ich kriegen dich schon wieder auf die Beine.“
Fritz erholte sich schnell und beschäftigte sich viel mit Andi. Wenn Karin arbeiten musste, begleitete er seinen Sohn zum Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen und schaute ihm stolz dabei zu. Und seit Andi, unter größter Geheimhaltung natürlich, seinem Vater das Versteck seiner Freunde und sich, eine Höhle nah der Donau, gezeigt hatte und Fritz dabei die Bekanntschaft von Andis Freunden hatte machen dürfen, waren Vater und Sohn eine eingeschworene Gemeinschaft. Fast immer schlossen sie ihre Ausflüge mit einem Besuch im Café Angerer ab, wobei sie, ein Stück Kuchen verzehrend, ernste Männergespräche führten. Speziell ging es dabei um Andis Verantwortung für Mutti, wenn Vati nicht da sein konnte.
„Habt ihr den Krieg nicht bald gewonnen, Vati?“, fragte Andi einmal bei einer solchen Gelegenheit.
„Hm“, meinte sein Vater ernst, „so schnell geht das leider nicht, Andi. Aber wenn die Franzosen besiegt sein werden, dann wird der Krieg auch vorbei sein.“
„Müssen wir die Franzosen denn besiegen, Vati?“, fragte Andi und runzelte die Stirn.
„Aber ja, Andi, sonst werden sie uns besiegen, so wie es vor hundert Jahren schon ihr Napoleon Bonaparte getan hatte!“
Als sie nach vier Woche an einem eisigen Januarmorgen auf dem Kelheimer Bahnhof voneinander Abschied nehmen mussten, brach Karins Beherrschung wie ein Kartenhaus zusammen, sie klammerte sich, jeden Stolz vergessend, an Fritz und heulte wie ein Kind. Er hielt sie fest im Arm, bis der Zug dampfend und lärmend einfuhr und am Bahnsteig anhielt.
Dann machte er sich sanft von ihr los, gab Andi einen Kuss und ging ohne Krücken, den rechten Fuß etwas nachschleifend, mit seinen Militärsack über der Schulter rasch zum Zug, wo er in einen der Waggons verschwand.
Noch einmal zeigte sich sein Gesicht an einem der Fenster, dann fuhr der Zug dampfend und stampfend an, Karin schaute ihm immer noch nach, als er schon lange verschwunden war. Es schien ihr, als wäre er für immer weggefahren, weit weg, unaufhaltsam und endgültig.
Hilde Wagner war ein Schatz, sie war mittelgroß und hatte eine schöne, frauliche Figur. Ihre dicken, blonden Zöpfe trug sie um den schmalen Kopf gewunden, sie waren ihr Stolz und betonten die Zartheit ihrer ebenmäßigen Züge. Ihre dunklen Augen jedoch und ihr stolzer Gesichtsausdruck verrieten eine nicht zu unterschätzende Willensstärke, welche ihre Eltern besonders zu spüren bekamen. Zum Beispiel, als sie gegen deren Willen in einem Regensburger Schneideratelier eine Lehre anfing, um Modedesignerin zu erlernen. Hildes Vater war Standesbeamter und Bürgermeister der Stadt, er hätte seine Tochter gern im Rathaus, in einer der Amtsstuben untergebracht.
Der Krieg jedoch durchkreuzte Hildes Pläne, denn auch ihr Vater konnte es nicht verhindern, dass seine Tochter für das Deutsche Vaterland entweder ein sogenanntes freiwilliges Jahr in der Landwirtschaft absolvieren oder eben in einer Fabrik arbeiten musste. Sie zog die Seifenfabrik vor, in der sie später Karin kennenlernte und sich mit ihr anfreundete.
Jedenfalls richtete sich Hilde im Parterre ihres Elternhauses ein Schneideratelier ein, wo sie nach Herzenslust entwerfen, schneidern und mit der Nähmaschine ihrer Mutter nähen konnte. Es machte Ihr Freude mit Hilfe von unzähligen Modejournalen aus unscheinbaren Kleidern moderne Designerstücke zu entwerfen und mit immer neuen Accessoires, wie Boleros, Krägen oder Puffärmeln zu experimentieren. Hilde war immer schick gekleidet und kümmerte sich bald auch ein wenig um Karins Garderobe.
Aber auch Hilde haderte mit dem Schicksal, denn ihr Verlobter war vor einiger Zeit mit seiner Familie von der Gestapo abgeholt und mit anderen Juden in ein Arbeitslager nach Dachau deportiert worden. Dennoch hatte sie für Karin immer ein offenes Ohr und brachte sie mit ihrem Frohsinn und Optimismus immer wieder dazu, hoffnungsfroher in die Zukunft zu schauen.
Manchmal gingen sie ins Café Amman zum Tanztee, oder ins Kino.
Als im neuen Lichtspielhaus, es lag außerhalb Kelheim hinter der Altmühlbrücke, der Film „Kleider machen Leute“, eine Komödie mit Heinz Rühmann und Herta Feiler, aufgeführt wurde, leisteten sich die Freundinnen diesen Spaß. Die Vorführung kostete 50 Pfennige.
Karin und Hilde waren das erste Mal hier und betraten ehrfürchtig den Vorführraum, in dem die Besucher mit gedämpfter Schlagermusik empfangen wurden. Sie setzten sich in eine der hinteren Reihen auf die gepolsterten Klappstühle und betrachteten beeindruckt die rotbespannten Seitenwände mit der rötlich schimmernden, elektrischen Wandbeleuchtung. Viele Leute kamen in den Vorführraum und nahmen auf den Klappstühlen Platz, dann schauten sie gespannt zum roten Samtvorhang, der die gesamte Vorderfront des Lichtspielsaals geheimnisvoll verhüllte. Als er endlich mit leisem Surren auseinanderglitt, wurde es dunkel, das verhaltene Stimmengewirr verstummte und eine weiße Leinwand wurde sichtbar. An der Rückfront war ein Surren zu hören, ein kräftiger, gebündelter Lichtstrahl durchstrahlte den ganzen Saal und fiel auf die Leinwand. Laute Musik erklang und die Vorführung begann.