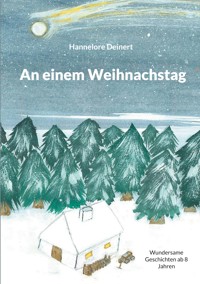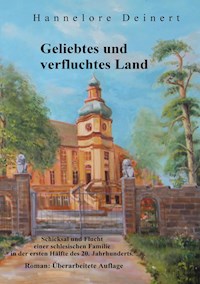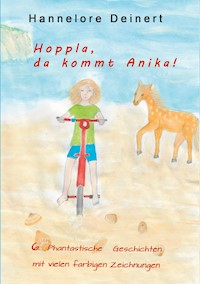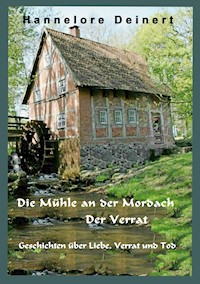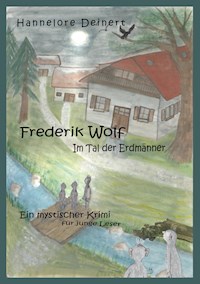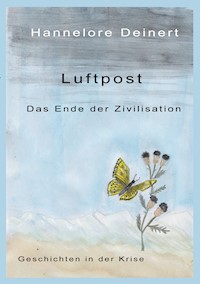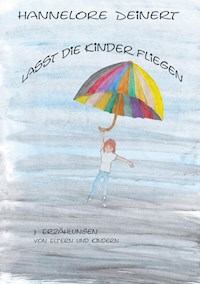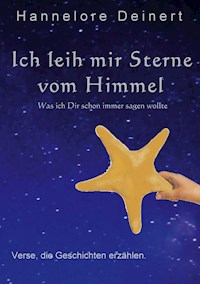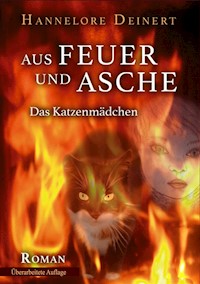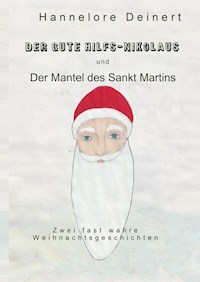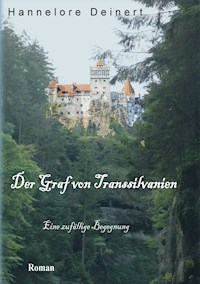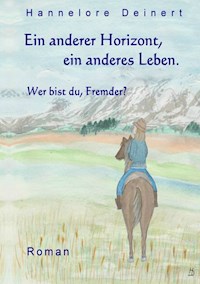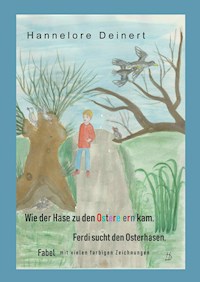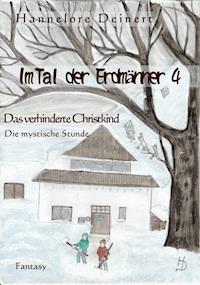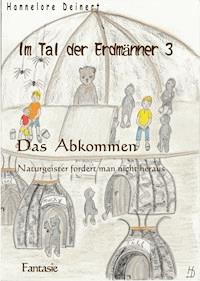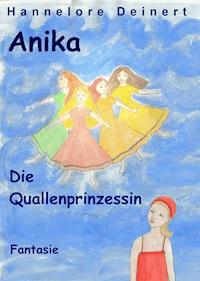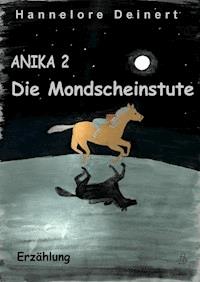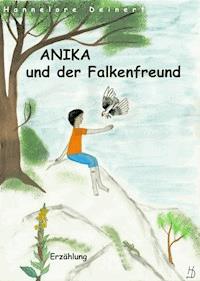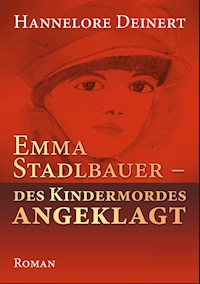
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als jüngstes von vier Geschwistern wächst das Mädchen Emma in Niederbayern auf. Den jähzornigen Ausbrüchen des kriegstraumatisierten Vaters wissen die Kinder zu begegnen, jedoch in der Schule muss Emma begreifen, dass Anpassung wichtiger scheint als eigenständiges Denken. Sie fliegt ohne Schulabschluss von der Schule und beginnt auf einem Bauernhof zu arbeiten. Als sich der Sohn des Bauern in Emma verliebt, wird sie vom Hof geschickt. Nun wird aus Emma kurzentschlossen Emil, somit kann sie im geliebten Wald eine Forstlehre beginnen. Allzu spät merkt Emma, dass sie schwanger ist. Ganz allein entbindet sie das Kind und bringt es dann im Bach zur Ruhe. Den Tod der kleinen Tochter begreift die 16-jährige nicht, sie wird als Kindsmörderin angeklagt. Gibt es einen Neuanfang für Emma? Psychologisch unterfüttert und mitreißend geschildert ist die dramatische Geschichte der Emma Stadlbauer, die sich in der Welt aus bitterer Armut und gesellschaftlichen Konventionen behaupten muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Die Schulzeit
Auf dem Steingräberhof
Der Forstgehilfe
In den Fängen der Justiz
Schuld, Sühne, Frieden
Meinen herzlichsten Dank an
alle, die zum Gelingen des Werks
beigetragen haben.
Vorwort
Niederbayern der 40er- bis 50er-Jahre.
Die Handlung könnte sich in jeder beliebigen Kleinstadt in Bayern ereignet haben. Die Namen der Personen sind erfunden.
Emma, die mit Ihren Eltern und Geschwistern in einer einsam gelegenen Kate am Waldrand wohnt, zerbricht fast am wohlmeinenden Unverständnis ihrer katholischen Lehrschwestern und den Geistlichen. Von zu Hause aus an ein freies, selbstständiges Denken gewöhnt, entwickelt sie sich unter der strengen Rute der Schule zu einer angepassten Persönlichkeit, die es versteht, sich mit Betrügereien durchzumogeln.
Später wird sie in einer äußerst schwierigen, sie völlig überfordernden Situation zur Mörderin.
Ihre Richter finden kein Verständnis für sie und verurteilen sie zu einer mehrjährigen Haftstrafe.
Letztendlich aber kann sich Emma nur selbst richten. Während ihrer Haft in einer Jugendstrafanstalt versucht sie, sich mit ihrer Schuld zu arrangieren.
Ist ihr danach ein Neubeginn möglich?
Die Schulzeit
Zwischen Neufurt an der Donau, einer idyllisch gelegenen Kreisstadt am Rande der Fränkischen Alb, und dem Weiler Bruch im Donaumoos, stand jahrzehntelang eine von der Außenwelt unbeachtete, unscheinbare Kate. Das graue Ziegeldach überspannte auf einer Seite einen angebauten Stall, der einer Ziege, einigen Hühnern und einem Hahn Schutz vor den Unbilden des Wetters bot. Einige Meter hinter der Kate befand sich ein Klohaus mit einer Setzgrube. Nicht weit entfernt bahnte sich ein glasklarer Bach, von den nahen, bewaldeten Buckeln herkommend, seinen Weg zur Donau hin. Diese kleine Kate erlangte in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch ein aufsehenerregendes Vorkommnis eine traurige Berühmtheit.
Der Waldarbeiter Richard Stadlbauer hatte damals, im Jahre 1938, das schlichte Häuschen für seine Lisbeth und für seine zu erwartende Familie gebaut, Stein um Stein, wo immer er einen ergattern konnte, ohne je an eine Baugenehmigung und dergleichen zu denken. Als Lisbeth schwanger wurde, heirateten sie in aller Stille standesamtlich und zogen in die Kate ein.
Richard hatte, ohne es zu wissen, in einem Schutzgebiet gebaut, sein Glück war, dass keinem Neufurter Gemeindevorstandsmitglied oder einem anderen auf der nahen, wenig befahrenen Landstraße vorbeifahrenden Bürger die wie ein Hexenhäuschen anmutende Kate auffiel.
Bis zu ihrer Niederkunft arbeitete Lisbeth auf einem Bauernhof in Bruch, einem drei Kilometer entfernten Weiler, und Richard brachte als Waldarbeiter gutes Geld mit in die Kate. Der kleine Wilhelm konnte also seinen ersten, kräftigen Schrei in einer warmen Stube mit einem Eisenherd, einem Schwenkarmbrunnen und von Richard gezimmerten Möbeln machen. Das Gackern einiger Hühner und das kräftige Krähen eines Hahns im kleinen Stall nebenan waren ihm eine vertraute Schlummermusik.
Richard war im besten Alter und so war es nur natürlich, dass er im Herbst 1939 seine Einberufung in den Wehrdienst in Händen hielt. Er wurde aufgefordert, sich unverzüglich in der Kaserne von Neufurt einzufinden, um sich dort für den Dienst am deutschen Vaterland zu melden.
Das erweckte in Richard ein patriotisches Gefühl. Obgleich seine Frau erneut schwanger war, machte er sich, beseelt von einer vaterländischen Pflicht, auf den Weg nach Neufurt in die dortige Kaserne.
Erst Weihnachten kam er für einige Wochen nach Hause. Er sorgte für Brennholz, welches er hinter der Kate an die Wand schichtete, schoss einen Rehbock, den er zerlegte und in der Räucherkammer hinter dem Stall räucherte. Er besorgte eine Ziege, damit Frau und Kinder es gut haben sollten, wenn er nicht da sein würde.
Denn es war Krieg, was das bedeutete, das hatte er inzwischen kapiert. Richards Patriotismus war verflogen, er wäre gern zu Hause bei seiner Familie geblieben.
Im Februar brachte Lisbeth in der Kate ihren zweiten Sohn, den kleinen Johannes auf die Welt. Da es nun im Bett mit zwei Kindern zu unruhig wurde, holte sie eine Futterkrippe aus dem Wald, polsterte sie ordentlich mit Stroh aus und legte das Kindchen, warm in eine Decke gehüllt, hinein.
Der Krieg nahm kein Ende, allmählich machte er aus den Soldaten gefühllose, wütende Kampfroboter, die nicht wussten, weshalb und wofür sie mordeten und brandschatzten, nur dass sie es mussten, um selbst am Leben zu bleiben.
Auch Richard hatte sich verändert. Als er im späten Frühjahr für einen kurzen Fronturlaub in die Kate kam, beachtete er die Kinder kaum, sprach nicht viel und fragte nichts. Wortkarg fertigte er ein weiteres Bett an, in dem die Kinder schlafen konnten, und baute durch den Wohnraum eine Holzwand mit einer Tür darin, so dass eine kleine Schlafkammer entstand.
Eines Morgens schnürte er seinen Militärsack und ging, ohne sich groß von seiner besorgten, ratlosen Frau und den Kindern zu verabschieden.
Lisbeth war nicht glücklich, als sie bald darauf merkte, dass sie erneut schwanger war. Sie hatte begriffen, dass es nie mehr so sein konnte, wie es einmal war.
Vom Grauen des Krieges bekam sie in ihrer Abgeschiedenheit wenig mit, nur dass es immer mehr Witwen und Halbwaisen gab und auf den Äckern viele polnische Kriegsgefangene arbeiteten.
Wieder wurde es Winter. Lisbeth lebte mehr schlecht als recht vom Sold ihres Mannes, den sie einmal im Monat im Neufurter Rathaus abholen musste. Die Ziege gab Milch und die Hühner legten Eier, sodass sie mit den Kindern nicht darben musste. Sie konnte sogar einiges davon in Neufurt gegen andere Lebensmittel, Kleidung, Schuhe oder Wolle eintauschen. Von der Wolle strickte sie für die Kinder warme Wollsachen und für ihren Mann Socken, die sie beim Roten Kreuz abgab.
Als er Weihnachten zur Tür hereinkam, seine Joppe abnahm, wortlos an den Türhacken hängte und sich erschöpft am Tisch niederließ, war sie glücklich. Sie half ihm aus den Stiefeln, schlug Eier in die Pfanne, schnitt Brot auf. Als er aß, bemerkte sie, dass er nervös wurde, wenn das Baby weinte, sie ging dann mit dem Kind nach nebenan, um es zu beruhigen. Der kleine Wilhelm folgte ihr, er wollte mit dem schweigsamen, finsteren Mann nicht alleine sein.
Richard blieb zwei Wochen. Er wanderte stundenlang im Wald umher und kam immer mit einem Bündel Brennholz zurück, das er hinter der Kate an die Wand schichtete. Einmal brachte er ein Reh mit, er zerlegte und räucherte es.
Die Abende verbrachte er still und versunken auf seinem Stuhl, ohne über das Notwendige hinaus mit seiner hochschwangeren Frau oder den Kindern zu reden. Lisbeth umsorgte ihn und hoffte, eines Tages den Mann zurückzubekommen, der vor drei Jahren in den Krieg gezogen war.
Dann musste Richard wieder zurück an die Front.
Eines Nachts im Januar brachte Lisbeth unbemerkt von der Außenwelt ihr drittes Kind, ein gesundes Mädchen zur Welt. Sie nannte es nach ihrer verstorbenen Mutter, Susanne.
Gelegentlich dachte sie daran, dass ihre Kinder keine Geburtsurkunden hatten oder getauft waren, aber die drei kleinen Schreihälse ließen ihr wenig Zeit darüber nachzudenken.
Als im Frühsommer Richard von der Front nach Hause kam, erschrak Lisbeth bei seinem Anblick, er war hager geworden, abgezehrt, erschöpft. Dieses Mal aber war er nicht nur wortkarg, sondern auch reizbar. Wenn die Kinder lärmten oder weinten ertrug er es nicht und flüchtete in den Wald.
Mehr und mehr kamen ihm Zweifel, ob diese Kinder die seinen waren. Er unterstellte Lisbeth, dass sie es mit anderen Männern treibe, während er in den Schützengräben mit den Kameraden draufgehe. Lisbeth war entsetzt und froh, als er seinen Beutel packte und ging. Ihr Mann war ihr fremd geworden.
Nur noch selten kam Richard nach Hause und es war jedes Mal eine schlimme Zeit für Lisbeth und die Kinder. Die Kinder fürchteten sich vor dem mürrischen, leicht aufbrausenden Vater, der zum Glück meist schon am frühen Morgen in den Wald ging und erst in den Abendstunden, immer mit einem Bündel Holz, manchmal auch mit einem erlegten Wild, zurückkam.
Als er wieder zur Front musste, bedauerte es keiner, im Gegenteil.
Im Herbst 1943 wurde Lisbeth durch ein amtliches Schreiben unterrichtet, dass ihr Mann zum großen Bedauern der Befehlshaber in Stalingrad in russische Gefangenschaft geraten sei.
Obwohl Lisbeth nicht wusste, wie es nun weitergehen soll, war sie in ihrem Inneren froh. Sie würde ihr Schicksal besser ohne jenen finsteren Mann, welcher ihr Mann im Krieg geworden war, meistern. Aber sie war wieder schwanger, zum ersten Mal haderte Lisbeth mit ihrem Schicksal.
Dieses Mal umgaben sie ihre Kinder, als sie im Mai 1944 in der kleinen Kate ihr viertes Kind gebar. Der fünfjährige Wilhelm war der Gebärenden schon eine Hilfe, ernsthaft befolgte er ihre Anweisungen. Als das kleine Mädchen geboren war, freuten sich die Geschwister mehr wie die Mutter.
Sie nannten es Emma.
Lisbeth lebte mit ihren Kindern bescheiden und unbehelligt vom Kriegsgeschehen und den Mitmenschen in der unscheinbaren Kate am Waldrand. Einmal im Monat musste sie mit den Kindern zur drei Kilometer entfernten Stadt, um dort im Rathaus den Sold ihres Mannes und Essensmarken abzuholen, dabei brauchte sie lediglich die standesamtlich beglaubigte Heiratsurkunde und Richards Einberufung vorzulegen. Wenn Lisbeth anschließend in der Stadt die notwendigen Einkäufe tätigte, nahm kaum jemand Notiz von ihr und ihren Kindern. Man kannte sie.
Eines Tages fuhren amerikanische Jeeps durch die Stadt. Soldaten, auch dunkelhäutige, warfen Schokoladentäfelchen und Kaugummis in die Kinderschar, die ihnen lärmend folgte und nach den Süßigkeiten haschte, sodass kaum eins davon das Straßenpflaster berührte. Auch Lisbeths Kinder vergaßen ihre Scheu und beteiligten sich an der Jagd nach den unbekannten Leckereien.
Die Frauen am Straßenrand waren irritiert. Hatten nicht dieselben Soldaten, die jetzt so menschenfreundlich taten, Bomben auf die deutsche Städte geworfen und ihre Männer und Söhne erschossen? Noch immer trugen sie ihre Gewehre auf den Rücken, aber nun riefen sie triumphierend: „Der Krieg ist vorbei! Deutschland hat kapituliert! Hitler ist tot!“
Langsam begriffen die Frauen und Mütter und hofften, dass ihre Männer und Söhne nun heimkommen würden. Bis auf jene, die Trauer trugen.
Lisbeth aber dachte nicht daran und hoffte auch nicht, dass ihr Mann wiederkommen würde. Sie richtete für ihre Buben unter dem niedrigen Dach der Kate ein Strohlager her, wo sie ihr eigenes Reich hatten und in der frostfreien Zeit schlafen konnten. In den klirrendkalten Wintermonaten rückten sie in der warmen Stube zusammen und wärmten sich gegenseitig. Brennholz fanden sie genug im Wald.
Anfang jeden Monats, sommers wie winters und bei jedem Wetter, machte sich Lisbeth mit den Kindern auf den Weg zur Stadt, um im Rathaus die Essensmarken zu holen und Eier und Ziegenmilch gegen Wolle, notwendige Kleidungsstücke einzutauschen und um Nahrungsmittel zu besorgen. Dies war beschwerlich, besonders solange die kleine Emma noch getragen werden musste.
Trotz aller Mühen war es eine gute Zeit, aus der sie jäh gerissen wurde, die wohlmeinenden Takelarme der Zivilisation griffen gierigen nach den bis dahin unbehelligt zurückgezogen lebenden Bewohnern der Kate am Rande des Donaumooses.
Als Lisbeth wieder einmal den Sold ihres Mannes im Rathaus von Neufurt abholen wollte, fragte sie der Beamte, ob ihr großer Bub nicht dieses Jahr eingeschult werden würde. „Er muss doch schon soweit sein“, meinte er, Wilhelm abschätzend musternd. Wilhelm war ein gutgeratener, aufgeweckter Junge. „Wie alt ist er denn, Frau Stadlbauer?“
„Er ist gerade sieben Jahre geworden“, antwortete Lisbeth und schaute den Beamten beunruhigt an.
„Dann melden Sie ihn in der katholischen Knabenschule für das nächste Schuljahr an“, meinte der Beamte förmlich. „Vergessen Sie seine Geburts- und Taufurkunden nicht.“
Zwar erschien Lisbeth mit ihren Kindern bei ihrem nächsten Stadtbesuch in der katholischen Knabenschule und stellte dort ihren großen Sohn Wilhelm vor, aber die verlangten Papiere konnte sie nicht vorlegen. Der junge Priester, zu dem Lisbeth geschickt wurde, stellte erschüttert fest, dass diese Kinder bisher ohne den Beistand der Mutter Kirche, quasi wie wilde Tiere geboren wurden und aufgewachsen sind.
Der rührige Priester nahm seine Aufgabe, diese Kinder in den Schoß der Kirche aufzunehmen, sehr ernst.
So wurden die kleinen Heiden in aller Stille in der Pfarrkirche getauft und ihrer Mutter auferlegt, von jetzt ab an jedem Sonntag den Gottesdienst zu besuchen und an der anschließenden Katechismus-Stunde teilzunehmen.
Dies machte das Leben für Lisbeth nicht gerade leichter. Jeden Sonntag marschierte sie nun mit ihren Kindern in aller Herrgottsfrühe los, um pünktlich um zehn Uhr das Hochamt in der Pfarrkirche besuchen zu können. Dort saß sie mit ihnen eine Stunde lang auf der Kirchenbank, umgeben von Weihrauchduft, von dem ihr übel wurde, und umbraust von mächtiger Orgelmusik. Nach dem Hochamt begaben sie sich in das benachbarte Gemeindehaus, in dem der junge Priester sie und andere Unwissende in einem kahlen Raum erwartete und in die Grundlagen des Katechismus einführte.
Am Nachmittag, nachdem sie sich mit der mitgebrachten Brotzeit gestärkt hatten, durften sie den langen, mühsamen Heimweg antreten, die kleine Emma war nach langem Jammern eingeschlafen und lag schwer wie ein Mehlsack in den Armen ihrer Mutter. Bei der Kate angelangt waren sie hungrig und erschöpft. Es war eine wahre Tortur, Sonntag für Sonntag.
Bis zu Wilhelms Einschulung hielt Lisbeth durch, dann ließ sie mehr und mehr, anfangs mit schlechtem Gewissen, die sonntäglichen Gottesdienstbesuche ausfallen. Die Kinder waren froh darüber, außer Wilhelm, den man in der Schule deswegen rügte.
Auch für Emma, die Jüngste der Stadlbauer-Kinder, waren diese Gottesdienstbesuche qualvoll. Das unendlich lange Stillsitzen und die ernsten, dunkel gekleideten Menschen mit ihren tadelnden Blicken blieben ihr in unangenehmer, ja schrecklicher Erinnerung.
Obwohl sie wenig von der Mutter oder den Geschwistern liebkost wurde, dies war in diesem rauen Familiengefüge nicht üblich, lernte sie doch sich zu behaupten und stark zu werden. Rücksicht nahmen die großen Geschwister kaum auf sie, aber Emma durfte nach Herzenslust ihre Kräfte erproben, wobei blaue Flecke und Beulen am Köpfchen zu ihrer schmerzhaften Grunderfahrung gehörten. Sie durfte mit allem, was ihr in die Fingerchen kam, experimentieren, es sei denn, es wäre lebensgefährlich gewesen. Aus Fehlern lernt man, war die Devise bei den Stadlbauers und Emma lernte fleißig. Sie lernte sich bei den Geschwistern und der Mutter verständlich zu machen, lernte ihre Ziele geduldig zu verfolgen und Rückschläge wegzustecken, so wie es die Geschwister vor ihr taten und es immer noch machten. Die Kate, später der Wald mit den Pflanzen und den Tieren und die duftenden, saftigen Blumenwiesen im Donaumoos waren ihr unermessliches Lehr- und Spielzimmer.
Als auch für Johannes, dann für Susanne der Ernst des Lebens begann und sie jeden Morgen den langen Weg nach Neufurt zur Volksschule antreten mussten, kam eines Herbsttages der Vater von der langen Gefangenschaft heim.
Fünf Jahre war er fort gewesen, nun kam ein Fremder zur Kate herein, hager, ausgemergelt mit tiefliegenden, dunkel umschatteten, unruhigen Augen und tiefen Furchen auf der bleichen Stirn und den Mundwinkeln.
Auch ihm waren die Kinder und deren Mutter fremd geworden.
Als er wieder seine Arbeit als Holzfäller aufnehmen konnte, schien alles gut zu werden.
Emma war sieben Jahre alt, als im September des Jahres 1951 auch ihre Schulzeit begann.
Erwartungsfroh und mit vor Aufregung roten Wangen lief sie am Morgen ihres ersten Schultages an der Hand der Mutter, die ein zügiges Tempo vorlegte, den weiten Weg zur Schule. Ihr lichtbraunes, dichtes Haar hatte Lisbeth in Kinnlänge abgeschnitten und die längeren Haare am Scheitel mit einem Kamm ordentliche aufgerollt. Emma trug das Strickkleid, das vor ihr schon Johanna getragen hatte, und auf dem Rücken den abgewetzten Ranzen von Wilhelm, er hatte einen neuen, schon gebrauchten bekommen. Im Ranzen befanden sich ein in ein Butterbrotpapier gewickeltes Pausenbrot, eine Griffelschachtel mit zwei Griffeln und eine Schiefertafel mit einem Schwamm, der an einer Kordel an der Seite des Ranzens herabbaumelte. Natürlich stammten auch sie von Susanne, ihrer großen Schwester, die sie nun nicht mehr brauchte.
Emma war stolz darauf und freute sich auf die Schule, denn nun würde sie auch lesen und schreiben lernen, so wie die großen Geschwister.
Die waren schon im Morgengrauen losmarschiert, denn ihr Unterricht hatte schon vor einer Stunde begonnen, also um acht Uhr.
Lisbeth beabsichtigte, während die Erstklässler ihre erste Unterrichtsstunde absolvierten, in der Stadt einige Besorgungen zu machen. Am Mittag könne man die Kinder wieder abholen, wurde den Müttern erklärt. Die höheren Klassen allerdings mussten länger in ihren Klassenräumen ausharren, manchmal auch, nach einer zweistündigen Mittagspause, bis um vier Uhr nachmittags.
Die Mädchenschule war ein langes, einstöckiges Gebäude mit vielen Fenstern. Die Erstklässler wurden von einer Lehrnonne und einer Novizin in einem im Erdgeschoss befindlichen Klassenraum begrüßt und in drei lange Bankreihen aufgeteilt. Emma, die zu den Kleineren gehörte, wurde in die vorderste Bank der mittleren Bankreihe dirigiert. Die Novizin, eine angehende Nonne, zeigte den Mädchen wo sie ihre Ranzen aufzuhängen hatten, nämlich an den seitlich der Bänke befindlichen Haken. Die Lehrschwester, sie war an ihrer großen, schwarzen Haube zu erkennen, stand unterdessen neben einem Pult, vor einer großen Tafel, und wartete, bis alle Schülerinnen ihre Plätze eingenommen hatten und Ruhe eingekehrt war. Dann begrüßte sie die Kinder, nannte ihren Namen, sie hieß Schwester Angelika, und rief jedes Kind namentlich auf. Die genannten Kinder mussten sich erheben und wurden in ein Anwesenheitsheft eingetragen. Einundvierzig Erstklässler konnte die Schwester verzeichnen, dieses Mal durch die Flüchtlingskinder mehr als in den Jahren zuvor.
Die Novizin legte inzwischen vor jedes Kind eine Lesefibel, Emma betrachte den Einband des leicht fleckigen, abgegriffenen Büchleins vor ihr auf der Schulbank, es zeigte eine bunte Moorwiese, auf der ein Kind mit einem Lämmchen spielte. Noch nie hatte sie ein Buch besessen, die Schulbücher der Geschwister waren natürlich tabu für sie. Hatten die anderen Kinder auch ein solches Buch bekommen? Emma schaute sich um. Da geschah etwas so Entsetzliches, so Unerwartetes, das bei Emma alle anderen Erinnerungen an diesen Tag auslöschte. Denn als sie sich davon überzeugt hatte, dass die anderen Kinder auch so ein Buch bekommen hatten und sie sich wieder nach vorne wandte, traf sie ein Schlag ins Gesicht, der ihr fast die Besinnung raubte. Ein heftiger Schmerz durchfuhr sie, so als wäre sie kopfüber auf eine Betonwand gestürzt.
Als die Mütter ihre Kinder abholten, sah Lisbeth sehr wohl die roten Fingerabdrücke auf der Wange ihrer kleinen Tochter, sah ihre glanzlosen Augen und konfusen Bewegungen, die erwartungsvolle Vorfreude schien bei ihr völlig verflogen zu sein, sie wagte jedoch nicht die Lehrschwester zu fragen, was vorgefallen sei. Dazu fühlte sie sich nicht berechtigt.
Nachdem die Mütter ermahnt wurden, ihre Kinder nun jeden Werktag mit ordentlichem Schulmaterial pünktlich und sauber zum Unterricht zu schicken und mit ihnen am Sonntag die Heilige Messe zu besuchen, wurden sie mit ihren Kindern entlassen.
Emma war wie betäubt, ihre Wange brannte wie Feuer, aber mehr noch brannte die Scham in ihr. Sie war vor allen Kindern geschlagen worden, nie mehr würde sie an diesen Ort der Demütigung zurückgehen können.
Lisbeth betrachtete das bockige Gesicht ihrer still neben ihr einhergehenden Tochter. „Was auch passiert ist“, dachte sie, „Emma muss damit klarkommen.“ Und so fragte sie nicht weiter nach.
Die Schmach aber, die Emma an diesem ersten Schultag erlitten hatte, würde sie durch ihre ganze Schulzeit begleiten.
Lisbeth jedoch hatte andere Sorgen als die Schulprobleme ihrer Kinder, denn ihr Mann wurde immer unzugänglicher. Nur wenn er Bier getrunken hatte, zwei, drei, manchmal auch vier Flaschen jeden Abend, wurde er ruhiger. Und so sorgte Lisbeth dafür, dass immer ausreichend Bier im Hause war, auch wenn sich die Familie ansonsten in allen Dingen einschränken musste.
Emma aber beschloss, nicht in die Schule zu gehen, sie brauchte das Lesen und Schreiben nicht unbedingt, entschied sie. Nur war zu befürchten, dass Mutter es nicht akzeptieren würde, die Geschwister mussten ja auch jeden frühen Morgen zur Schule aufbrechen. Emma aber wusste sich zu helfen. Wenn die Mutter sie eine Stunde nach den Geschwistern losschickte, kam sie bald von der Landstraße ab, sie wanderte in den Wald, pflückte Beeren oder kletterte auf Bäume. Oder sie lief auf die taufeuchten Wiesen des Donaumooses, pflückte Blumen und schaute den Tieren zu, den Fröschen zum Beispiel oder den Vögeln, wenn sie in hellen Scharen über die Wiese flogen und sich darauf niederließen. Meistens wurde Emma dabei müde und schlummerte im weichen Gras ein.
Wenn sie nach Stunden heimkam, fiel es vorerst nicht auf, dass sie die Schule geschwänzt hatte.
Aber das dicke Ende ließ nicht lange auf sich warten. Es kam, als Susanne von Schwester Angelika einen Brief mitbrachte.
„Geehrte Frau, geehrter Herr Stadlbauer!“, buchstabierte Lisbeth die mit zierlicher Schrift verfassten Zeilen. „In Bayern, sowie auch in den anderen Bundesländern haben wir die Schulpflicht und so ist es in ihrer Verantwortung, ihre Tochter Emma an jedem Werktag in die Schule zu schicken. Da ihre anderen Kinder die Schule regelmäßig besuchen, sehen wir vorerst davon ab, ihre Tochter Emma vom Ordnungsamt abholen zu lassen, was unweigerlich veranlasst werden muss, wenn sie weiterhin dem Unterricht fernbleibt.
Mit freundlichem Gruß, Schwester Angelika, Lehrschwester der ersten Mädchenklasse der Volksschule von Neufurt an der Donau.“
Nun gab es keine Rettung mehr, Emma musste nun sogar noch früher, nämlich schon in der Morgendämmerung mit den Geschwistern aufbrechen, um mit ihnen nach Neufurt in die Schule zu wandern. Auf den Stufen der Mädchenschule musste sie dann warten, bis später ihre Schulkameradinnen kamen und das Klassenzimmer aufgeschlossen wurde.
Sie war nun bei Schwester Angelika als Schulschwänzerin eingestuft, auf die man ein besonderes Augenmerk haben musste. Nicht selten machte das Kind während des Unterrichts einen abwesenden, verträumten Eindruck oder schlief sogar ein.
Die bleierne Müdigkeit während der Schulstunden machte Emma sehr zu schaffen. Das frühe Aufstehen, der lange Schulweg mit den Geschwistern im zügigen Schritt, dann das Warten vor der Schule saßen ihr gehörig ihn den Knochen.
Aber als die junge Novizin, die sie am ersten Schultag so schmerzlich zurechtgewiesen hatte, nicht mehr auftauchte, fand Emma sogar Freude am Unterricht. Nur der lange Heimweg danach zog sich allzu quälend hin. Keine ihrer Klassenkameradinnen hatte den gleichen Weg.
Aber dann kam ein Flüchtlingskind in die Klasse, die ein Stückweit den gleichen Schulweg hatte, sie hieß Agathe Winter und hatte lange, blonde Zöpfe. Agathe wohnte mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern außerhalb von Neufurt, auf halbem Weg zur Kate, und so war Emma auf ihrem Heimweg nicht mehr allein. Das war sehr schön.
Emma und ihre neue Freundin wanderten nach dem Unterricht zusammen aus der Stadt, dann auf der Landstraße bis zum rechts abgehenden, festen Weg mit dem Wegweiser „Zum Unterfeld“. Dort musste sich Agathe von Emma verabschieden, denn, nach einigen Apfelhainen und moorigen Wiesen, standen an den ersten bewaldeten Buckeln die drei Baracken der Flüchtlingsfamilien. In einer davon wohnte Agathe mit ihrer Mutter und ihren beiden älteren Schwestern.
Nachdem Agathe in den Weg „Zum Unterfeld“ abgebogen war, hatte Emma immer noch eine schier unendliche Wegstrecke allein zu bewältigen. Bald kannte sie jede Kurve und jede Steigung der Landstraße und jeden Baum und Strauch am Straßenrand. Natürlich kannte sie auch das Marterl am Ende einer langgezogenen Steigung, die ausladende Weide dahinter konnte man schon von Weitem sehen.
Emma blieb immer davor stehen und betrachtete seltsam berührt das leidende Gesicht des sterbenden Jesus am hölzernen Kreuz. Er war nackt, den Blicken der Vorbeigehenden preisgegeben, nur ein Tuch verhüllte seine Lenden. Die Dornen des Kranzes auf seinem Kopf verletzten ihn, Blutstropfen rannen über seine Stirn, so wie über seine Hände und Füße, die mit Nägel ans Holz geschlagen waren. In seiner Brust klaffte eine breite Wunde, was für unsägliche Qualen musste er haben. „Warum“, dachte Emma voller Mitleid und Verwunderung. „Warum hat man ihm das abgetan? Was hat er gemacht?“
Im Frühling dann, an einem wunderbar milden Tag, gab Emma endlich der Bitte ihrer Freundin nach und begleitete sie zu den Baracken der Flüchtlinge, wie sie von den Einheimischen etwas abfällig genannt wurden.
„Es ist nicht weit“, drängte Agathe, „und heute, am Sonnabend, können wir noch ein wenig zusammen spielen.“
In der Kate war es eng, aber das empfand Emma inmitten der Geschwister und der Mutter als wohltuenden Schutz, die Enge in der Baracke aber, in die sie Agathe brachte, war erdrückend. Sie war nicht viel größer als ihre Schlafkammer zu Hause.
Agathe grüßte die zwei größeren Mädchen, die im Hintergrund mit angezogenen Beinen auf einer Matratze hockten und in Schulbüchern lasen. Zwischen der Matratze und dem winzigen Essbereich am Eingang stapelten sich Kisten, in denen sich wohl die Habseligkeiten der Barackenbewohner befinden mochten.
Emma schaute zu, wie Agathe von einem Laib Brot zwei dicke Scheiben abschnitt und dick mit Zwiebelschmalz beschmierte. „Mama ist noch putzen“, erklärte sie. „Wir können jetzt zum Spielen gehen.“
Sie gab Emma ein Brot. Ehe sie die Baracke verlassen konnten, musste Agathe noch einige Fragen ihrer größeren Schwestern nach dem Wohin beantworten. Endlich draußen atmete Emma befreit auf. Sie setzte sich neben Agathe auf die schmale Holztreppe und sie aßen zusammen ihre Schmalzbrote.
„Komm“, meinte Agathe dann, „ich zeig dir meinen Lieblingsplatz.“
Sie liefen durch eine Schlüsselblumenwiese einen Hang hinauf und blickten auf einen mit dichtem Schilf umwucherten Weiher hinab. Er lag still und dunkel zu ihren Füßen, Froschquaken war zu hören.
„Den Weiher kennt kein Mensch“, flüsterte Agathe, so als würde sie ein großes Geheimnis verraten. „Nur ich und jetzt auch du. Komm, ich zeig’ dir mein Versteck.“
Sie liefen zum Weiher hinunter und Emma folgte Agathe in das dichte Schilf hinein. Dann standen sie in einem kleinen Rundell, in dem das Schilf total niedergetreten war. Emma war beeindruckt, zumal ihr Agathe erklärte, dass man hier Tiere und alles andere beobachten konnte, ohne selbst bemerkt zu werden.
Als sie gegen Abend nach Hause kam, stritten sich die Eltern wieder, auf dem Tisch standen die üblichen Bierflaschen. Sie schlich die Leiter zu den Geschwistern hinauf, die eng zusammengerückt unter dem Dach saßen.
„Ich hab’ Hunger“, beklagte sich Emma.
„Setz dich zu uns“, flüsterte Wilhelm. „Vater wird bald schlafen, dann können wir essen.“
Wenn Richard Stadlbauer am Abend missmutig nach Hause kam, verlangte er nach seinem Bier, welches ihm Lisbeth bereitwillig mit einem Eintopfgericht auf den Tisch stellte. Sie setzte sich dann still zu ihm und hoffte, dass es dieses Mal nicht so schlimm werden würde mit ihm. Falls die Kinder noch nicht gegessen hatten, mussten sie warten, bis Vater eingeschlafen war und sie ihn zusammen ins Bett bringen konnten. „Vater muss hart arbeiten“, versuchte Lisbeth dann den Vater zu entschuldigen. „Er ist sehr erschöpft.“
An diesem Abend aber wurde der Vater lange nicht müde. Die Kinder hörten, wie er schimpfte und begann, Gegenstände durch die Stube zu werfen, die irgendwo krachend aufschlugen. „Du elende Schlampe!“, hörten sie ihn brüllen, „mit wem hast du es getrieben, während ich in den Kohlegruben fast verreckt wäre? Hab’ endlich den Anstand und sag’, von wem die Kinder sind!“
„Wenn er Mutter schlägt“, meinte Wilhelm, „dann bring ich ihn um.“
„Er ist furchtbar stark“, gab Johannes flüsterte zu bedenken. Er erzitterte, weil es unten wieder furchtbar krachte. „Wie willst du das machen?“
„Wenn er schläft, dann ramm’ ich ihm das Küchenmesser rein“, erklärte Wilhelm entschlossen. „Direkt ins Herz.“
„Mutter sagt, es wird bestimmt besser mit ihm werden“, meinte Susanne mit tränenerstickter Stimme und schmiegte sich fester in ihre Decke, „Vater hat im Krieg Schreckliches erlebt, das hat er noch nicht verwunden.“
„Wenn er Mutter schlägt, bring ich ihn um“, wiederholte Wilhelm verzweifelt entschlossen seinen Vorsatz.
Emma fühlte sich zwischen den großen, starken Brüdern und der großen Schwester beschützt, aber sie dachte an die arme Mutter, die unten in der Küche dem tobenden Vater standhalten musste. Die Kinder hörten gelegentlich ihre besänftigende, beschwörende oder auflehnende Stimme.
Als es ruhig wurde, kam die Mutter halb die Leiter herauf, die Kinder registrierten besorgt ihr bedrücktes Gesicht. „Er schläft, wir können ihn jetzt ins Bett bringen“, flüsterte sie.
Unten roch es nach Bier. Vater saß schnarchend und zusammengesackt auf seinem Küchenstuhl, sein Kopf lag auf dem Tisch, leere Bierflaschen umgaben ihn. Auch auf dem Boden lagen Flaschen, in einer Ecke der Küche lag ein Stuhl mit einem abgebrochenen Bein.
Lisbeth und die Kinder schleppten Richard keuchend ins Bett und zogen ihm die Stiefel, den Pullover und die Arbeitshose aus. Dann gab Lisbeth den Kindern einen Teller Suppe und fing an, aufzuräumen.
Ohne mit dem Essen aufzuhören, versicherte Wilhelm mit Nachdruck, so als wolle er es sich selbst versprechen: „Wenn er dich noch einmal schlägt, dann bringe ich ihn um.“ Er hatte die blutverklebten Haare am Hinterkopf seiner Mutter gesehen. „Er war nicht immer so, Wilhelm“, meinte Lisbeth besänftigend und sammelte die Bierflaschen ein. „Früher war er lieb. Wir müssen geduldig mit ihm sein, dann kann alles gut werden.“
Am nächsten Tag leimte Richard Stadlbauer still und missmutig das abgebrochene Stuhlbein wieder an. Er schämte sich für das, was er angerichtet hatte, denn er liebte seine Frau verzweifelt. Er konnte es ihr nicht zeigen, im Gegenteil, er verbarg es hinter seiner rauen und unwirschen Art. Außerdem nagte das Misstrauen hartnäckig an ihn, dass sie ihn während der langen Kriegsjahre betrogen haben könnte.
Im neuen Schuljahr warteten auf die Mädchen der zweiten Klasse einige Veränderungen. Zuerst wurde von Schwester Angelika eine vorläufige Sitzordnung festgelegt, die strebsamen und ordentlichen Schülerinnen sollten in der Fensterbankreihe sitzen, die weniger fleißigen in der mittleren Bankreihe und die unaufmerksamen, nachlässigen Schülerinnen in der Wandbankreihe. Obwohl die Kinder dieses System nicht ganz durchschauten, war Emma froh, mit Agathe in der ersten Bank der Fensterreihe Platz nehmen zu dürfen. Den Platz fand sie gut, denn dort hatte sie freie Sicht auf das Pult von Schwester Angelika und auf die Tafel, vor allem saß Agathe neben ihr. Sie hängte den Ranzen an den seitlichen Haken, holte die Griffelschachtel und die Schiefertafel heraus und legte alles ordentlich auf ihre Schreibfläche. Auch Agathe war ganz offensichtlich zufrieden mit ihrem Platz.
Als alle Kinder ihre neuen Plätze eingenommen hatten, klopfte Schwester Angelika mit einem dünnen Rohrstock auf ihr Pult. Die Kinder verstummten augenblicklich und schauten sie erwartungsvoll an.
„Erhebt euch, Kinder!“, meinte sie. Die Schülerinnen standen auf.
„Wir wollen um ein gutes Schuljahr beten und die Jungfrau Maria um ihre Fürsprache und Hilfe bitten!“
Während die Klasse das gewohnte Morgengebet sprach, betrachtete Emma verstohlen Schwester Angelika, die in ihrer schwarzen Tracht schön, rein und klar aussah. Ob sie selbst auch einmal so werden könnte wie sie?
Schwester Angelika war noch jung, keine dreißig Jahre alt. Sie war sehr gottesfürchtig und stets bestrebt, ihre Schülerinnen auf ein christliches, verantwortungsvolles Leben vorzubereiten. Dazu musste sie streng sein, auch wenn dies, weiß der Himmel, nicht immer leicht war, denn sie liebte ihr Lehramt und sie liebte natürlich auch die ihr anvertrauten Kinder.
Nach dem Gebet durften sich die Mädchen setzen.
„Wir kennen nun schon alle Buchstaben und beherrschen die Zahlen bis zu der Zwanzig, Kinder“, begann sie den Unterricht. „Wir können schon lesen, schreiben und rechnen, deshalb ist es an der Zeit, nun mit Tinte in richtige Hefte zu schreiben. Zuerst werden wir in das Schreibheft schreiben, das die Weingärtner jetzt austeilen wird. Weingärtner hol’ bitte die roten Hefte aus dem Regal und verteile sie. Schlierhammer, hilf’ ihr bitte dabei. Habt ihr alle einen Federhalter mitgebracht, am letzten Schultag des vergangenen Schuljahrs habt ihr ihn auf eure Tafel geschrieben, damit ihr ihn nicht vergessen sollt?“
Einige Kinder hatten keinen mitgebracht, auch Emma nicht.
„Es ist außerordentlich wichtig“, erklärte Schwester Angelika tadelnd, „dass ihr immer eure Schulsachen mitbringt, sonst behindert ihr das Lernen. Die also, die einen Federhalter dabei haben, dürfen nun mit Tinte in das Heft schreiben, die anderen nehmen noch einmal die Schiefertafel und den Kreidestift.“
Agathe hatte einen Federhalter dabei, den sie nun, wie die Kinder, die einen hatten, vorsichtig in das im oberen Rand der Schulbank eingelassene Tintenfass tauchte und dann damit die gleichmäßigen, schönen Wellen von der Schultafel sorgsam in ihr rotes Heft abmalte.
„So bekommt ihr ein Gefühl für euer neues Schreibgerät“, erklärte Schwester Angelika und schritt prüfend durch die Bankreihen. „Die Kinder, die keinen Federhalter mitgebracht haben, schreiben auf ihre Schiefertafel das ABC in großen und kleinen Buchstaben. Wenn ihr nicht fertig werdet, dann schreibt es zu Hause zu Ende. In die letzte Zeile der Tafel schreibt das Wort „Federhalter“, damit ihr ihn morgen auch ganz sicher dabeihabt!“
Emma ärgerte sich. Warum musste sie den Federhalter vergessen, schließlich hatte ihr Wilhelm seinen alten gegeben, sogar mit zwei unterschiedlich starken Federn. Unwillig malte sie die Buchstaben des Alphabets mit dem Griffel auf ihre Tafel. Agathe half ihr etwas gönnerhaft dabei. „Schreib ein bisschen kleiner, Emma“, meinte sie mit einem abschätzenden Blick auf Emmas Schiefertafel, „sonst passen nicht alle Buchstaben drauf.“
Zwar wurde Emma nicht ganz fertig, weil die Rechenstunde begann, aber das war nicht schlimm. Nur als sie auch die Rechenaufgaben, zehnerüberschreitende Plus- und Minusaufgaben, nicht ganz schaffte, hatte sie zu Hause noch einiges fertig zu machen.
Gottlob war in der nächsten Stunde Kunst, Kunst war Emmas Lieblingsfach. Ihre Zeichnungen, wenn sie an der Wand neben den anderen geheftet waren, fielen auf und wurden bewundert.
Wenn es merklich kühler wurde und am Morgen die Wiesen mit dünnem, in der aufgehenden Sonne glitzernden Reif überzogen waren, holten die Stadlbauer Kinder ihre Winterstiefel aus einer Truhe, bis dahin waren sie, wie viele andere Kinder auch, barfuß gelaufen, und die Mutter legte die selbstgestrickten Wollsachen bereit. Dieses Jahr hatte Susanne zu ihrer Freude ein richtiges Kleid aus Wollstoff bekommen und überließ ihr ungeliebtes Wollkleid der kleinen Schwester, die es erfahrungsgemäß noch bequem zwei Winter tragen konnte.
Dieser Umstand würde Emma noch einigen Kummer bereiten.
Schuld war der leicht muffige Geruch, der den von der Mutter gestrickten Wollsachen anhaftete. Die Strümpfe, Röcke, Pullover, Mützen, Schals und Handschuhe verursachten nicht nur körperliches Unbehagen, sie kratzten erbärmlich auf der Haut, Emma wurde wegen ihnen auch gehänselt.
Die Wollsachen trockneten nur langsam und wurden deshalb von Lisbeth nur gelüftet, was den muffigen Geruch allerdings nicht völlig vertreiben konnte. Nur selten wurden sie in der Zinkwanne, die am Wochenende auch als Badewanne genutzt wurde, mit Seifenlauge gewaschen und gespült.
Während einer Schulstunde nun beugte sich Schwester Angelika über Emmas Heft, um ihre Aufgaben in Augenschein zu nehmen. Sich wieder aufrichtend meinte sie tadelnd und deutlich im Klassenraum vernehmbar: „Stadlbauer, richte deiner Mutter aus, sie soll darauf achten, dass du dich jeden Tag gründlich wäschst. Du riechst ja wie ein Wollbär.“
Während Emma vor Scham am liebsten im Boden versunken wäre, brach die Klasse in ein heiteres Gelächter aus.
Seitdem wurde sie, wenn man sie ärgern wollte, „Wollbärli“ genannt, was ihr schier unerträglich war.
Natürlich richtete Emma der Mutter Schwester Angelikas abfällige Bemerkung nicht aus, sie schämte sich auch für sie, die Mutter, und wollte sie nicht kränken. Aber der Mutter und den Geschwistern fiel auf, wie sorgsam sich Emma nun jeden Abend am Brunnen wusch und wie oft sie ihren Mund spülte.
Weniger betroffen war Emma von den seit dem neuen Schuljahr allmorgendlich vollzogenen Züchtigungen der säumigen Schülerinnen, die ihre Hausaufgaben oder sonstiges vergessen hatten. Sie bekamen den bis dahin harmlosen Bambusstab zu spüren, der von Schwester Angelika hauptsächlich als Zeigestock benutzt wurde. Die Übeltäter mussten sich vor der Tafel aufstellen und ihre Hände, mit der Innenseite nach oben, ausstrecken. Schwester Angelika ging dann die Reihe ab und schlug kurz und beherzt auf jedes Händchen. Wenn ein Kind reflexartig die Hand zurückzog, dann bekam es einen Stockhieb mehr. Manche Kinder weinten leise, andere erstarrten und gingen nach der Züchtigung mit steifen Beinen zu ihren Plätzen zurück.
Das war nicht erfreulich anzusehen, aber Emma spürte die ganze Tragweite dieser Züchtigung erst, als es sie selbst betraf.
Es war nicht das erste Mal gewesen, dass sie aus irgendeinem Grund die Hausaufgaben nicht fertig gemacht hatte, aber dieses Mal hatte sie versäumt, sie vor dem Unterricht noch fertig zu schreiben.
Der Vater war am Abend müde und missmutig zur Küche hereingekommen und hatte gleich nach seinem Essen und seinem Bier verlangt. Die Kinder hatten sich wie immer mit ihren Schulsachen still unter das Dach verzogen, sie wussten, Vater brauchte jetzt seine Ruhe. Weil es in der Kate kein elektrisches Licht gab und Mutter brennende Kerzen unterm Dach nicht zuließ, konnten sie sich nur noch gegenseitig abfragen oder sich Geschichten erzählen, so es der Lärm unten in der Küche, der recht lange andauern konnte, zuließ.
An diesem Tag hatte Emma nicht viele Hausaufgaben auf, das meiste davon hatte sie schon mit Agathe in der großen Pause erledigt, nämlich fünf Hauptwörter mit dem Anfangsbuchstaben „F“ auf die Schiefertafel zu schreiben. Nun brauchte sie nur noch das Zweiereinmaleins auf die Rückseite der Tafel zu schreiben und auswendig zu lernen. Schwester Angelika würde es wie immer morgen abfragen.
Aber dann vergaß es Emma. Als sie am nächsten Morgen ihre Schiefertafel auf die Schreibfläche der Schulbank legte, war deren Rückseite unübersehbar leer. Schwester Angelikas prüfendem Blick, als sie durch die Bankreihen schritt, entging es nicht. „Aufstehen, Stadlbauer“, ordnete sie an. Emma wusste, was das bedeutete, oft genug hatte sie es gesehen. Sechs weitere Schülerinnen, die meisten von der Wandbankreihe, mussten sich erheben.
„Mitkommen“, dirigierte Schwester Angelika kurz und bündig und ging den Mädchen voran zur Tafel. Die folgten ihr mit hängenden Köpfen und trockenen Kehlen und stellten sich vor der Tafel auf.
„Ich hoffe, es wird euch eine Lehre sein und euch helfen, gewissenhafter eure Aufgaben zu erledigen“, meinte Schwester Angelika streng. „Streckt nun eure Hände mit der Innenfläche nach oben vor.“
Die Mädchen taten es zaghaft und schauten zu, wie Schwester Angelika den Rohrstock vom Katheter nahm und sich ihnen wieder zuwandte.
Emma stand neben Sieglinde Straubinger, einem stillen Mädchen von der Wandbankreihe. Sie war die erste, Emma hörte ihren weinerlichen Atem und schaute in die teils schadenfrohen, teils neugierigen oder anteilslosen Gesichter ihrer Schulkameradinnen. Sie hörte neben sich das Zischen des Rohrstocks, den leisen Ton, als er die Handfläche ihrer Nachbarin traf und Sieglindes Aufstöhnen. Emmas Zunge klebte am Gaumen, ihre Hand wollte zurückzucken, aber das ging nicht, das würde einen Schlag mehr bedeuten. Emma biss die Zähne zusammen und verkrampfte sich, sie schaute starr in Schwester Angelikas gütige, bedauernde Augen. Dann das Zischen des Rohrstocks und ein messerscharfer Schmerz auf der Handfläche und Emma zog ihre Hand zurück.
Die weiteren Maßregelungen an den Mitschülerinnen bekam sie kaum mit, und auch nicht den weiteren Verlauf des Unterrichts. Auf ihrer Handfläche verlief eine rote Spur und schmerzte wie ein Brandmal. Sie schämte sich und fühlte sich gedemütigt, schuldig und wehrlos.
„Weißt du, Emma“, meinte Agathe in der großen Pause großzügig, „wenn du was nicht verstehst, dann sag’ es nur, dann helf’ ich dir.“
Agathe hatte noch nie ihre Hausaufgaben vergessen und natürlich noch nie Tatzen bekommen.
Zweimal in der Woche kam nun der junge Priester Sebastian in die Klasse, um die Mädchen auf ihre erste heilige Kommunion im nächsten Jahr vorzubereiten.
Emma war aufgeregt, denn die erste heilige Kommunion von Johanna, ihrer Schwester, war ihr noch gut in Erinnerung, sie übertraf alles, was sie bisher erlebt hatte. Johanna war so schön gewesen in ihrem weißen Kleid, wie sie mit den anderen Kommunionkindern auf den Mittelgang der Pfarrkirche zum Altar geschritten war, wie eine kleine Braut. Natürlich war das Kleid geliehen gewesen, aber Emma würde dann auch so ein Kleid tragen dürfen und auch so schön sein und gefeiert werden, wie die Kommunionkinder im vorherigen Jahr.
Priester Sebastian, der wie Schwester Angelika ein langes, schwarzes Gewand trug, verteilte in seiner ersten Unterrichtsstunde ein dünnes Büchlein, auf dem das Wort „Katechismus“ stand. Emma versuchte sogleich dieses schwierige Wort zu buchstabieren.
„Aus dem Katechismus lernen wir unseren Glauben zu verstehen“, erklärte der Priester. „Er lehrt uns die „Zehn Gebote“, nach denen wir ein gottgefälliges Leben führen können.“
Die Kinder hingen an seinen Lippen, ein gottgefälliges Leben wollten sie alle führen, das war etwas Großartiges, Erstrebenswertes und Notwendiges, um in den Himmel zu kommen, wie Schwester Angelika schon erklärt hatte. Der Priester versprach, dass er nun viele Geschichten von Jesus, Gottes Sohn, und von seiner Mutter, der Jungfrau Maria, erzählen würde, das fanden die Kinder spannend. Zum Abschluss erinnerte er die Mädchen, dass es nun unbedingt erforderlich sei, damit sie im nächsten Jahr die Erste heilige Kommunion empfangen können jeden Sonntag um zehn Uhr das Hochamt zu besuchen. Es wäre für zukünftige Kommunionkinder auch wichtig, den Schultag mit der Morgenandacht, die jeden Morgen um sieben Uhr in der Kirche stattfand, zu beginnen.
Dazu waren alle Kinder bereit.