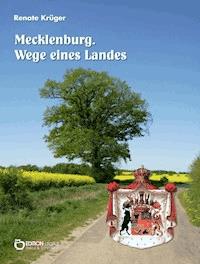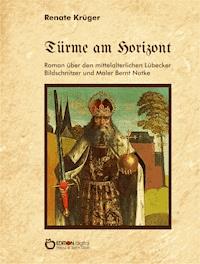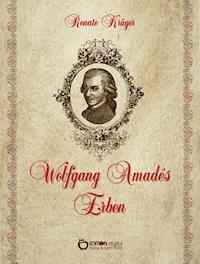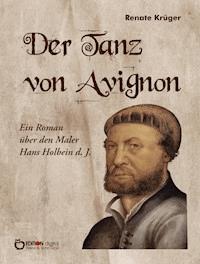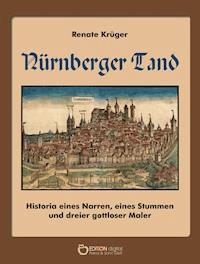8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Autorin hat fünf Gemälde des nicht einmal vierzig Bilder umfassenden Lebenswerkes dieses neben Caspar David Friedrich bedeutendsten Malers der deutschen Frühromantik zum Anlass einer weitreichend angelegten epischen Darstellung genommen. Der so gleichsam von den Werkaussagen ausgehende Text versucht in farbiger und lebendiger Schilderung das Leben des 1777 in Wolgast geborenen, 1810 in Hamburg gestorbenen Künstlers zu erfassen und dem Leser eine Vorstellung von den persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Bedingungen zu geben, die hier durch einen tragisch frühen Tod auf das an seiner Vollendung gehinderte Schaffen einwirkten. Unter Bezug auf das 1806 entstandene Doppelporträt der Eltern gibt die Autorin im ersten Bild Auskunft darüber, wie Napoleons Machtausbreitung und der wirtschaftliche Ruin des Bruders Daniel die finanziell ungesicherte Lage des jungen Künstlers und seiner Familie bedrängten; zugleich enthält dieses Kapitel die einfühlsame Darstellung der Kinderjahre Ph. O. Runges, spiegelt es in Reflexion und Analyse die von Krankheit und Sensibilisierung geprägte Kindheit. Die Autorin hat dieses Prinzip auch in den folgenden Abschnitten beibehalten: Das 1805 gemalte Gruppenporträt „Wir drei“ wird zum Motiv einer Würdigung und Wertung der besonderen Rolle, die Runges älterer Bruder im Leben des Künstlers spielte. In „Die Lehrstunde der Nachtigall“ und „Bildnis der kleinen Louise Perthes“ sind es Runges Frau Pauline und der ihm freundschaftlich verbundene Verleger Friedrich Perthes, die sich episodisch seines Lebens und seiner Person erinnern. Der zeitliche Abstand der beiden gealterten Menschen vom erlebten Geschehen und die subjektive Sicht ihrer Erinnerungen brechen dabei das Bild des von ihnen geliebten oder geschätzten Menschen auf verschiedenartige Weise. Im abschließenden fünften Bild „Der Morgen“ endlich wird in einer großen Rückschau und wechselnden Perspektiven und Zeitebenen die Ideenwelt des Romantikers Runge aus sozialer Herkunft, Naturerlebnis, Weltanschauung, Freundschaften, politischen Haltungen, künstlerischen Zielsetzungen und Lebenserfahrungen heraus erfasst und in Beziehung gesetzt zu Zeitgenossen und den Erfahrungen des beginnenden Industriezeitalters. Es ist das besondere Verdienst der Autorin, Wesen und historische Rolle der deutschen Romantik am Schicksal des lange Verkannten und Missverstandenen sichtbar gemacht zu haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Aus Morgen und Abend der Tag
Philipp Otto Runge – Sein Leben in fünf Bildern
ISBN 978-3-86394-305-9 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Selbstporträts von 1802.
Das Buch erschien erstmals 1977 im Union Verlag, Berlin.
© 2013 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Ich will mein Leben in einer Reihe Kunstwerke darstellen; wenn die Sonne sinkt und wenn der Mond die Wolken vergoldet, will ich die fliehenden Geister festhalten.
Philipp Otto Runge in einem Brief an Daniel Runge vom Februar 1802
Erstes Bild: Die Eltern
1. Kapitel
Philipp Otto Runge: Die Eltern, 1806
Zum zweiten Mal in diesem harten Jahr 1806 fährt Philipp Otto Runge die Straßen, die er in sehnsüchtigen Gedanken so oft zurückgelegt hat: die Wege zwischen Hamburg und Wolgast, zwischen der Weltstadt und dem kleinen pommerschen Hafen, zwischen der Elbemündung und der Mündung der Peene. Doch die Wirklichkeit ist anders als die Sehnsucht, das Land ist unruhig, unsicher, geängstigt. Wird auch uns der Krieg heimsuchen? Werden die Franzosen uns quälen? Die Last dieser Wirklichkeit wird für Runge nicht dadurch leichter, dass er sie nicht allein tragen muss. Frau und Kind sind bei ihm. Er verpflanzt seine ganze Familie von Hamburg nach Wolgast. Zum Mitleid mit dem Land kommen die Sorge und die Verantwortung. Er ist für zwei Menschen verantwortlich: für Pauline und den Sohn.
Sie fahren durch kleine Städte und große Dörfer, bald kann der Blick ungehindert über ausgedehnte Weideflächen schweifen, bald auf tiefgrünen Büschen am Waldesrand ausruhen, die Schwalben fliegen tief, Kirchturmuhren tönen durch die Stille; was hat die Stunde geschlagen?
Alt ist das Land, und alt ist irgendwie die Zeit. Runge scheut sich fast, mit der Last von so viel Jugend und Jungsein hindurchzufahren: er selbst neunundzwanzigjährig, Pauline ist einundzwanzig Jahre alt und der kleine Otto eine Menschenknospe von einem Jahr.
Im März war Runge mit dem Bruder Daniel diesen Weg schon einmal gezogen. Ihr Hamburger Handelshaus war zusammengebrochen. Sie wussten nicht mehr, wovon sie in der nächsten Zeit leben sollten. Sie wollten nach Wolgast, um die traurigen geschäftlichen Angelegenheiten mit den Eltern und den Geschwistern zu besprechen und zu ordnen, denn der Konkurs des Hauses Hülsenbeck, Runge & Co traf sie leider alle. Damals wirkte das Land hier ringsum friedlich und tröstend. Jetzt nicht. Nur schnell hindurch, nur schnell nach Pommern.
Es besteht kein großer Unterschied zwischen Mecklenburg und Schwedisch-Pommern. Die Landschaft wirkt ähnlich. Die Menschen sind ähnlich. Nur die Obrigkeit ist anders, und Pommern darf froh sein, dass es zu Schweden gehört. Das Joch des Nordens scheint in diesen Zeiten leichter. Runge wird mit diesem Land, mit diesen Menschen leben müssen - wie lange? Doch alles wird anders sein, als er es sich erträumt und ersehnt hat.
Was hat er erträumt?
Das Ereignis der Heimkehr der Söhne ... Dieses Bild war während der Kopenhagener Zeit in ihm gewachsen, und seither hat es ihn nicht verlassen. Die Söhne waren ausgezogen in die nahe und in die weite Welt, um ihr Glück und nicht weniger sich selbst zu finden. Nun kehren alle zurück ins Elternhaus, erfolgreich, glücklich, dankbar. Alles und sich selbst legen sie den Eltern zu Füßen: Seht, das ist aus uns geworden, das habt ihr aus uns gemacht. Eure Mühen und Sorgen und schlaflosen Nächte sollen als übergroßer Segen auf euch zurückkehren. Alle die zarten Pflanzen, die ihr unter Schmerzen und Sorgen in den Weltengarten gesetzt habt, haben tiefe Wurzeln geschlagen, sind zu kräftigen Büschen und Bäumen geworden, geben Schutz und Schatten für andere, auch für euch selbst.
Damals hat er seinen Traum gezeichnet: Jeder begrüßt und umfängt jeden vor der geöffneten Tür des Elternhauses. Traumhaft leicht und zart sind alle Bewegungen. Nur im Traum könnte es so sein. Damals hat er sogar geplant, den kleinen Saal im Wolgaster Haus seines Bruders Jakob mit diesem Traum zu schmücken, doch es wird nicht geschehen, dieser Traum ist ausgeträumt.
Fort mit den trüben Gedanken! Es bleiben genug andere Bilder, die gemalt werden wollen. Die Lerchen jubilieren, und es duftet nach warmem Waldboden. Es warten noch andere Träume. Und es bleibt so viel gute Wirklichkeit, dass er sich schämen sollte, dem bisschen Traum, das nicht in Erfüllung ging, nachzutrauern. Die Söhne dürfen ja heimkehren. Warum nur die Söhne? Das Kopenhagener Bild war nicht vollständig. Sind die Töchter weniger? Zugegeben, Töchter bleiben immer viel mehr zu Hause als Söhne. Töchter nehmen die Heimat viel stärker überallhin mit, wohin auch immer sie gehen. Sie haben die Gabe, die Heimat dort auszubreiten und wachsen zu lassen, ein neues Zuhause aus sich hervorgehen zu lassen und über ihre Familien zu breiten.
Vier Töchter sind aus dem Runge-Haus hervorgegangen. Erst nach drei Töchtern wurde der erste Sohn geboren, Johann Daniel. Die älteste Tochter, Maria Elisabeth, lebt im Elternhaus. Sie hat keine neue Heimat begründen können. Sie kränkelt seit Kindertagen, ähnlich wie Otto. In ihrer Kränklichkeit und Schwachheit fühlen sich Otto und Maria am meisten verbunden. Otto liebt die um vierzehn Jahre ältere Schwester wie eine zweite Mutter, und die Schwester hört ihre plattdeutsche Namensform Mrieken am liebsten aus dem Munde Ottos.
Die zweite Tochter, Ilsabe Dorothea, ist schon Witwe. Durch ihre Ehe mit dem Gutspächter Helwig wurde die Familie Runge auch im Mecklenburgischen heimisch. Ilschen, auch Helwigsch genannt, verstand es ganz besonders gut, die alte Heimat auszubreiten, auch auf ihre Pachtungen Großen-Helle und Lüdersdorf nördlich von Penzlin, zwischen Waren und Neubrandenburg. Das Rungesche Leben spielt sich fortan zwischen Hamburg, Lüdersdorf und Wolgast ab. Ilschen hat wenig Gelegenheit, über ihre frühe Witwenschaft zu trauern. Um sie braust so viel Rungesches Leben, dass sie sich nie einsam fühlt.
Die Schwester Regina Charlotte hat es nur achtzehn Jahre in Wolgast und überhaupt auf der Welt ausgehalten. Sie liebte alles Stille, den Garten und den Friedhof, die Blumen und die Schmetterlinge, und sie fühlte sich jetzt gewiss wohl in der ewigen Stille.
Durch Daniel breitete sich die Familie Runge nach Hamburg aus, auch wenn er keine eigene Familie begründete. Die auf Daniel folgende Schwester Anna Christine, Stienchen genannt, blieb gleichfalls unvermählt, lebt im Wolgaster Elternhaus, kränkelt und ist oft schwer zu ertragen.
In Wolgast lebt auch Jakob Friedrich, Kaufmann und Reeder wie der Vater, tüchtig, verheiratet mit Friederike Peters, die er bei seiner Schwester Helwig in der mecklenburgischen Runge-Heimat kennengelernt hat. Anlässlich seiner Hochzeit vor vier Jahren waren alle Runge-Kinder in Wolgast vereint. Ihm, Jakob, hatte Otto das Bild von der Heimkehr der Söhne schenken wollen.
Der nächste Sohn, David Runge, ist Landmann durch und durch, verwaltet die Ländereien der Schwester und seine eigenen an der Müritz. Er fühlt sich als Mecklenburger, hat eine Neubrandenburgerin zur Frau, ist ungemein fleißig und tüchtig, voller Humor, Schwung und Gesundheit. Der folgende Bruder Karl Gustav starb schon mit drei Jahren. Den leeren Platz nahm bald Philipp Otto ein.
Auch Ottos jüngerer Bruder, Karl Hermann, verspricht ein tüchtiger Landwirt zu werden. Er ist Ottos Lieblingsbruder, ein wenig heimlich zwar, denn Daniel neigt zur Eifersucht. Aber Otto ertappt sich dann und wann doch bei dem Gedanken, dass er auch bei Karl Hermann leben könnte, wenn der erst einmal richtig Fuß gefasst hätte mit sich und seiner zukünftigen Familie. Er hat im vergangenen Jahr geheiratet. Und er wird sich des jüngsten Runge-Sohnes Gustav annehmen müssen, der lange mit Otto im Hamburger Hause Daniels lebte, um den Beruf eines Buchhändlers zu erlernen, den es aber doch nicht bei Daniel und den Büchern hielt. Er sehnte sich nach frischer Luft und wollte auch lieber Landmann werden. Mit seiner Gesundheit ist es nicht weit her. Sein tägliches Nasenbluten ist noch immer beunruhigend. Jetzt lebt er beim Bruder David.
Otto wird sie auf seiner Heimfahrt alle miteinander besuchen. Statt der Heimkehr der Söhne die Heimkehr der Geschwister, die Heimkehr zu den Geschwistern.
2. Kapitel
Die erste Heimkehr mit Daniel im März dieses Jahres 1806 war schmerzlich gewesen. Sie kamen einen Tag früher als erwartet, unverhofft also, denn im Hause des Reeders Runge verlief das Leben nach einem festen Plan, und es gelang sogar der Mutter erst nach einigen Seufzern, die beiden hungrigen und müden Söhne in diesen Plan einzufügen. Bald aber dampfte die Suppe vor ihnen auf dem Tisch, für den Tee fanden sich sogar noch ansehnliche Zuckerstückchen, Zucker wurde knapp in diesen Monaten, auch in Schwedisch-Pommern. Die Mutter hüllte Otto in seine alte Wolljacke und legte für Daniel eine braune Zigarre auf den Tisch.
»Wir haben es nicht zu Konsuln und Bürgermeistern gebracht. Wir sind bankrott«, sagte Daniel.
Der Vater verabscheute Zigarrenrauch, aber er runzelte nicht einmal die Stirn. Nach einer kurzen Pause holte er zu einer tröstenden Rede aus.
»Ist nun auch euch diese Erfahrung nicht erspart geblieben! Nicht der Franzose ist unser größter Widersacher. Nicht er allein hat euch zu Fall gebracht, sondern auch die Habgier derer, denen ihr vertrautet ... Sie muss man verdammen, nicht die Franzosen, die schließlich nach ihren eigenen Gesetzen leben müssen. Wir wollen darüber nachdenken, wie wir etwas retten können: euren und unseren Lebensunterhalt und euer und unser Vertrauen in die Menschen.«
Der Vater strich sich über das blank rasierte Gesicht, hinter dem jeder Gedanke offen zutage lag. Er trank einen Schluck Wasser, denn selbst das Bier war rar in jenen Tagen. Er fasste die Hand der Mutter und streichelte sie. Das hatte Otto noch nie gesehen.
»Kommt also zu uns, Otto, du und deine Frau und dein Kind. Dein Elternhaus ist noch kräftig genug, Brot und Vertrauen zu spenden.«
»Ja, Vater, wir werden kommen.«
Die Eltern sind Garantie des Beständigen, des Bleibenden, des unwandelbar Guten, der alten biederen Wahrheitsliebe. Das Elternhaus ist ein Bollwerk, in dessen Schutz sich Runge auch jetzt noch frei, froh und sicher entfalten kann. Nicht alles ist ins Wanken geraten.
3. Kapitel
Und nun kommen sie. Die Trennung von Hamburg war Otto schwergefallen. Er muss nicht nur die Freunde zurücklassen, Hülsenbeck, Perthes, Claudius, sondern auch die Bilder, die er im vergangenen Jahr fertiggemalt hat und die in ihm doch noch nicht abgeschlossen sind, denen er noch nicht als Fremder gegenübertreten kann, wie es ein Maler doch können muss. Die Nabelschnur ist noch nicht durchschnitten, vielleicht wird sie es nie sein. Vielleicht wird er deshalb niemals ein richtiger Maler ... Er kann sich von keinem Bild trennen. Er könnte kein Bild verkaufen, anonym, vielleicht dorthin, wo er es nie wiedersehen wird.
Fruchtbar war das vergangene Jahr 1805 für ihn gewesen. Wie sollte er sich von den vorjährigen Bildern trennen, von den prallfrischen Kindern seines Freundes Hülsenbeck, von dem Bild Daniels, Paulines und seiner selbst, das sich von allein den Namen WIR DREI gab, von seinem Selbstbildnis im blauen Rock und vom Bildnis seines Söhnchens im Klappstuhl? In alle diese Bilder war das Glück geflossen, das er an der Seite Paulines empfand. Und von all dem soll er sich nun trennen wegen dieser Betrüger, dieser Schmarotzer, der Scheeläugigen, Langfingrigen, die das Runge-Haus zu Fall gebracht haben? Und auch wegen der Franzosen, denen Hamburg so wichtig ist. Von Hamburg aus können sie England schlagen. Hamburg hat seine Neutralität erklärt, doch wird ihm das nützen?
Sie fahren durch eine weite Wiesen- und Hügellandschaft. Die Birkenstämme werden des Leuchtens nicht müde. Über den weichen beweglichen Zweigen liegt ein grüner Schleier, ein zarter Firnis. In unmerklichen Pinselstrichen wird die Schicht dichter und dichter. Man müsste innehalten, um dem Maler bei dieser Arbeit zuzuschauen. Die Natur hat keine Schwierigkeiten damit, eine ihr und anderen unerwartete Pause einzulegen. Sie ist nicht von störender Unruhe gequält und gedrängt. Sie ist fähig, sich Zeit zu lassen.
Runge hingegen ist unruhig. Früher hat er davon geträumt, ganz langsam durch die norddeutsche Landschaft zu wandern, mit Aquarellfarben, mit Kreiden, mit vielen weißen, leeren, rechteckigen Blättern, hier und da innezuhalten, alles zu erfassen, das Beste und Schönste auszuwählen, festzuhalten, festzuhalten, festzuhalten ... Es muss doch etwas geben, was wirklich bleibt, was nicht zwischen den Fingern zerrinnt wie das Hamburger Vermögen und das Vertrauen zu den Menschen, die sich Freunde nannten. Die treue, einfache, karge Landschaft ... Doch jetzt, da er sie durchfährt, ist er nicht fähig, sie an irgendeinem Punkt zu packen. Sie schlüpft ihm zwischen den Fingern hindurch, glatt, unfassbar. Er hat Papier und Stifte bei sich, natürlich, doch er lässt sie in der Reisetasche. Er beneidet Pauline und das Kind. Sie sind beide ganz bei sich, ruhen ineinander, unabhängig von der Umgebung.
Runge lässt den Wagen an einer Lichtung halten. Dort laden gefällte Baumstämme zum Sitzen in der Sonne ein. Pauline ist auch dort gleich ganz zu Hause, und sie vermag auch den Kleinen sogleich in diese neue grüngoldene Häuslichkeit aufzunehmen. Es bedarf fast keiner Vorbereitungen. Sie lässt sich nieder, knöpft das Kleid auf, legt Otto Sigismund an ihre Brust und gibt ihm alles, was er braucht: Nahrung, Wärme, Geborgenheit, Weltfreundlichkeit. Pauline lächelt, das Kind lacht sogar unter lautem Schmatzen. Runge versucht sein Gesicht zu glätten, doch er friert und fühlt sich allein. Das Bild vor ihm ist so altgewohnt, und er ist in diesem Augenblick nicht in der Lage, es neu zu sehen, diese Ruhe auf der Flucht.
Ob der Zimmermann Joseph sich damals auch so fremd neben Maria und dem Kind gefühlt hat, neben den Menschen, für die er allein verantwortlich war?
Der Fuhrmann hat sich irgendwo ins weiche Gras geworfen. Man wird ihn wecken müssen, es ist jetzt keine Zeit zum Schlafen. Ein Gedicht aus dem Hause Claudius schießt Otto in den Sinn, ein hartes, unbequemes, das beweist, dass Matthias Claudius kein geruhsamer Träumer und Genießer der kleinen Freuden des Lebens ist, denn was wird aus den kleinen Freuden in dieser harten Zeit?
’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, Und rede du darein! ’s ist leider Krieg - und ich begehre Nicht schuld daran zu sein!
Was sollt’ ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen Und blutig, bleich und blass, Die Geister der Erschlagnen zu mir kämen, Und vor mir weinten, was?
Was hülf ’ mir Krön’ und Land und Gold und Ehre? Die könnten mich nicht freun! ’s ist leider Krieg - und ich begehre Nicht schuld daran zu sein!
Runge möchte diese Verse aus sich herausschreien, aber er beißt sich auf die Lippen. Um Paulines willen darf es nicht sein. Sie lässt sich so leicht beeinflussen. Er darf ihre friedliche Stimmung nicht stören. Weint er, dann weint sie auch. Lächelt er, dann freut sie sich auch.
So holt er ein anderes Gedicht von Vater Claudius aus sich heraus, eins, das auch ihn stärken und festigen wird.
War einst ein Riese Goliath Gar ein gefährlich Mann! Er hatte Tressen auf dem Hut Mit einem Klunker dran, Und einen Rock von Drap d’argent Und alles so nach advenant.
Da kam in seinem Schäferrock Ein Jüngling zart und fein; Er hatte nichts als seinen Stock Als Schleuder und den Stein, Und sprach: »Du hast viel Stolz und Wehr, Ich komm im Namen Gottes her.«
Trau nicht auf deinen Tressenhut, Noch auf den Klunker dran! Ein großes Maul es auch nicht tut: Das lern vom langen Mann; Und von dem kleinen lerne wohl: Wie man mit Ehren fechten soll.
»Was murmelst du da vor dich hin?«
»Sie werden nicht siegen!«
»Wer?«
»Die Kriegsschreier! Die Betrüger! Die Verprasser fremden Gutes! Die Großmäuler!«
Pauline schüttelt missbilligend den Kopf. So schön ist es hier, und Otto ...
Auf der Waldlichtung steht eine hohe Lärche, davor rekelt sich eine kleine Tanne.
Ich bin noch klein, habe viel weniger Stockwerke als du, aber ich wachse dir nach - wenn man mich lässt, scheint die kleine Tanne zur Lärche zu sagen.
Auf der Oberseite schimmern die Zweige weißlich grün, unten erscheinen sie dunkel. Sie sind kräftig, füllen Raum aus. Die Lärche ist durchsichtig. Zwischen die Bäume sind gelbe Butterblumen hingesprenkelt, nicht gerade üppig. Dahinter recken sich Lupinenkerzen in die Höhe. Seitlich davon haben sich gelbe Schwertlilien angesiedelt, gesellig sind sie, stehen nie allein. Die Sonne ist von eiligen Wolken ertränkt worden. Aber sie braucht keine Wiederbelebungsversuche, die Wolken ziehen weiter.
Nun gleitet der kleine Otto von der Mutter herab und rutscht am Baumstamm entlang, betastet neugierig und befriedigt die raue rissige Rinde. Auch das gehört noch zu seiner mütterlichen Welt, und es ist seiner Geborgenheit kein Ende. Runge steht vor seiner Frau, sie sieht ihn an, und er fühlt, dass es ein neuer, auf eine neue Art glücklicher Blick ist. Es schmerzt ihn, dass er ihn so neu, so glücklich nicht erwidern kann. Doch dann lässt er sich niederziehen zu Pauline, ihre Arme umfangen ihn, er lässt sich küssen und liebkosen, und als er seine Augen wieder erhebt aus der bergenden Wärme Paulines, sieht er alles neu: die zarten, hellgrünen Triebe an den Tannenspitzen, die Gänseblümchen, zwischen ihnen das Kind, dann die Pferde, die ungeduldig zum Aufbruch scharren.
Nun wäre es an der Zeit, Stifte und Papier herauszuholen, aber er ist eben doch kein Landschaftsmaler. Nicht diese tatsächliche Landschaft wird er festhalten, sondern den Traum, der ihm aus ihr zuwuchs.
»Wir müssen weiter.«
Er nimmt das Kind auf den rechten Arm, umfängt Pauline mit der linken, bald rollt der Wagen.
Kurz vor Schwerin zeigen sich Schäden an der Deichsel. Der Kutscher rümpft die Nase über Runges Hilfsbereitschaft. Dieser Stubenhocker will mit einem so schweren dicken Balken hantieren? Doch er wundert sich. Runge hat in seiner Knabenzeit viel gebastelt und ausprobiert. Der Kutscher kommt trotz großer körperlicher Kraft und langjähriger Deichselerfahrung langsamer zum Ziel als Runge mit seinen tastenden Händen, die dem scharf arbeitenden Vorstellungsvermögen folgen. Fast ohne Anstrengung kann man sich die Deichsel wieder nutzbar machen.
Schwerin ist eine stille vernachlässigte Stadt. Der Herzog residiert in Ludwigslust. Die Reisenden erfreuen sich am Anblick der Seen und fahren weiter.
Auf dem Weg nach Güstrow steht ein Landstreicher mit finsterem Gesicht an einer Waldlichtung. Weit und breit ist kein anderer Mensch zu sehen. Der Mann schimpft auf die Reisenden ein, ohne sie dabei anzublicken. Otto sucht ihn zu begütigen. Der Kutscher schüttelt den Kopf. Mit solchem Gelichter wird er schneller fertig. Die Waffe unterwürfiger Freundlichkeit braucht man hier noch lange nicht einzusetzen. Sie sind ja in der Überzahl, wenn der Kerl handgreiflich werden sollte. Runge aber gibt dem Mann einen Zehrpfennig und einen Becher Wein. Das Drohen auf dem Gesicht des Landstreichers geht in Grinsen und schließlich in Erstaunen über. Er trottet den Weg zurück, den die Runges gekommen sind.
In Güstrow will man ihnen kein Quartier geben. Es sei alles besetzt. Runge bittet beharrlich, während der Kutscher flucht.
»Wir sind doch pommersche Landsleute!«
Das hilft. Der Wirt schließt ein Zimmer auf. Pommern stehen hoch im Kurs. Sie sind gute Landwirte, und wirtschaftliche Tüchtigkeit ist in Güstrow einer der Maßstäbe, an denen man Menschen misst. Wenn der Wirt wüsste! So gut wie nichts ist geblieben vom Hamburger Ergebnis der pommerschen Tüchtigkeit.
Am nächsten Tag reisen sie weiter. Fruchtbar dehnen sich die Äcker, gehegt, gepflegt, mit banger Sorge beobachtet. Wird die Saat heranreifen? Wird man eine gute Ernte im Frieden einbringen können?
Als sie an die Peene kommen, lässt Runge halten. Er möchte nun doch noch zeichnen. Pauline lächelt, das Kind kreischt, die Pferde scharren, der Kutscher knurrt, das Blatt bleibt leer, Runge seufzt. Die Landschaft ringsum ist schön, doch Runge entdeckt plötzlich, dass er mit einem anderen, mit einem übermächtigen Bild ausgefüllt ist. Ein Glücksgefühl durchströmt ihn. Er sieht die Umgebung, in die er vergeblich hineingelauscht hat, nur als Rahmen für dieses innere Bild, das Bild der Eltern, zu denen man nun zurückkehren muss, weil nichts anderes geblieben ist. Muss? Zurückkehren darf ... Nicht das Bild von der Rückkehr der erfolgreichen Söhne ist geblieben, sondern das Bild der Eltern, die auf ihre Kinder warten, ganz gleich, wie sie kommen, in Samt und Seide oder zerlumpt.
Runge sieht auf das leere Papier und sieht die alten Eltern darüber hinwachsen, streng, liebevoll, bieder, offen, einladend. Ja, das muss bleiben, dieses Bild soll bleiben. Pauline schaut auf ihren Mann und sieht, dass er lächelt. Sie nickt ihm zu, er schlägt seinen Skizzenblock zusammen, nickt zurück.
»Wir wollen weiter, zu Vater und Mutter!«
Je mehr sie sich Wolgast nähern, um so fröhlicher wird Philipp Otto Runge. Vielleicht ist es gut, dass nicht alle Träume in Erfüllung gehen. Auch aus unerfüllten Träumen entstehen Wirklichkeiten. Die Wirklichkeit der Erinnerung ... Runge wird wieder in seine Kinderkleider schlüpfen, wird fünfzehn Jahre, zehn Jahre, fünf Jahre alt werden.
4. Kapitel
Wenn man fünf Jahre alt ist, ist es selbstverständlich, dass man nach der Welt greifen darf, und nicht nur das, man muss auch das Ergriffene festhalten. Denn auf Besitz und auf den Erwerb von noch mehr Besitz ist nun einmal die Wolgaster Weltordnung gegründet. Der Vater besitzt eine Reederei und eine Schiffswerft mit allem, was dazu gehört, als da sind Äxte, Beile, Sägen, Bretter, an denen sich der Fünfjährige nicht satt riechen kann, weiterhin Zollstöcke, Winkelmaße, Segeltuch, dünne Seile, dicke Taue, Anker, Ketten, Pech, Leim, Hämmer, Nägel, Hobel.
Der kleine Otto greift nach allem, streicht über alles, nicht hastig oder gierig, denn er ist ein sanftes Kind, oft krank, er streichelt eher prüfend, abwägend, dann aber greift er doch danach. Die Kraft, mit der er so manche Holzplättchen, Segeltuchfetzen oder Anstreichpinsel festhält, möchte man seinem schmächtigen Körper gar nicht zutrauen. Soll er lieber beim feinen zarten Streicheln, Tasten und Fühlen mit geschlossenen Augen bleiben. Was hat er jetzt unter seinen Fingern? Glänzend kaltes, glattes Metall, raues, aufgefasertes Holz, einen runden Stein, der sich so freundlich der Hand einschmiegt, fein gefächerte Muscheln, die er am Meer gefunden hat? Alles, was er mit seinen Händen begreifen kann, wird ihm zum Eigentum.
Otto denkt nicht darüber nach, ob auch alle die kräftigen breitschultrigen Männer, die zwischen den Taurollen, den Holzstapeln und den Schiffsgerippen, Eigentum des Vaters sind. Übrigens denkt niemand in Wolgast darüber nach. Es ist eine Gunst des Himmels, zur Schiffswerft des Reeders Runge zu gehören, ob als ständiges Eigentum des Besitzers oder nur als Arbeitskraft für die Stunden des Tages. Eigentum wäre fast besser. Mit seinem Eigentum geht der Patron vorsichtig um, er lässt es sich etwas kosten.
Otto liebt die Schiffszimmerleute und die Fahrensmänner, die Matrosen und die Arbeiter. Er lässt sich gern von ihnen an der Hand fassen, und es ist immer wieder ein Erlebnis für ihn, in diese Hände einzudringen, deren Oberfläche sich nicht viel anders anfühlt als die von Holz oder Tau, hart, rau, rissig. Nur das ist anders, dass sich diese Greifwerkzeuge von selbst bewegen - und wie! Ach sie halten fest, was sie ergriffen haben. Meist ist es nicht viel. Das Patschhändchen des kleinen Otto ist ihnen Kredit, das müssen sie besonders fest halten. Dem Kleinen ist es nicht unlieb, festgehalten zu werden. Er fühlt sich sicher in diesen Händen.
Am sichersten an der Hand von Johann Castorp, dem Meister, dem Baas, der das Sagen auf der Werft hat, den alle fürchten und ehren - Otto aber liebt und ehrt ihn.
Fünf Jahre ist er alt. Sein sechstes Lebensjahr fällt in das Weltjahr 1782. Die Welt in Wolgast ist klein. Die große Welt ist weit entfernt. Man weiß wenig von Paris, von Wien. Eigentlich ist die Wolgaster Welt nur nach Norden offen. Das Meer ist nicht Grenze, sondern Verbindung. In der Nähe liegt Rügen. Man kann die Insel sehen, wenn man die Peene bis zum Meer entlanggewandert ist. In der Ferne liegt Schweden. Man kann es nicht sehen, aber es ist wirklich vorhanden. Vorpommern ist seit den Tagen von Münster und Osnabrück schwedisch, und man ist für Schweden.
Fünf Jahre ist er alt, und er sitzt in des Baas Castorp Bretterbude auf dem Holzplatz der Werft. Der Baas hat dort auf einem Holzkohlenfeuerchen Tee gekocht. Sie trinken davon. Der Baas hat in seine Tasse einen handlichen Schuss Branntwein gekippt. Es ist zwar nicht kalt, aber Branntwein ist immer gut. Otto bekommt in seinen Tee zwei Stückchen Kandiszucker, die der Baas schon den ganzen Tag in seiner finsteren Hosentasche herumgetragen hat. Sie haben sich in die Bretterbude zurückgezogen, weil draußen ein Gewitter tobt. Natürlich fürchtet sich Otto vor Gewittern, auch hier noch, in des Baas Castorp Bretterbude. Doch er weiß, dass er ruhig sein kann, obgleich keine Wetterkerze brennt und niemand einen Wettersegen murmelt wie daheim die Großmutter mit ihrem zahnlosen Wackelmund. Der Baas beteuert immer wieder, dass er kein frommer Mann sei. Er sagt es mit so eindringlichen stillen Worten, dass es fast so klingt wie ein Wettersegen. Sie sollen beruhigt sein daheim. Otto ist in Sicherheit. Er wird sich in der abgekühlten Luft auch nicht erkälten, er bekommt ja heißen süßen Tee. Und der Baas lenkt ihn ab.
»Willst du auch Reeder werden, kleiner Patron?«
Otto nickt; natürlich möchte er das. Was kann es Schöneres geben, als Schiffe zu bauen und sie über das Meer segeln zu lassen, nach Stettin, nach Saßnitz, nach Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck, ja sogar nach Hamburg? Und einmal wird auch er auf einem solchen Schiff segeln, mitten in die rote Sonne hinein, die im schwarzblauen Meer versinkt.
Und schon ist er mit seinen Gedanken bei der Sonne. Rot ist sie, auch gelb, manchmal sogar fast weiß. Über dem Meer kann man sie am besten sehen, dort kann sie sich nicht hinter Bäumen und Häusern verstecken.
»Ich möchte auf das Meer hinausfahren, Onkel Baas!«
»Und ich möchte dir dann nachwinken, kleiner Patron. Es fährt sich leichter, wenn einer einem nachwinkt. Mir wollte keiner nachwinken, deshalb bin ich zu Hause geblieben. Du aber hast genug Leute, freu dich! Das wird ein Gewimmel an der Reede geben, wenn der berühmte Handelsherr und Schiffsmeister Philipp Otto Runge fortsegelt. Die Winkehände werden solchen Wind machen, dass die Segel schon davon anschwellen. Und du wirst am Heck des Schiffes stehen und zurückschauen, und der letzte Blick aus deinen großen blauen Augen wird mich treffen. Versprichst du mir das?«
Eine so lange Rede hat Otto noch nie aus dem Munde des Baas gehört. Er muss darüber nachdenken, sonst rollt die Welt für ihn nicht weiter. Er kann nicht gleich antworten, er muss allein sein und nachdenken, hinaus aus der Bretterbude! Es hat keine Gefahr mehr. Das Gewitter ist vorüber. Nur ganz in der Ferne, über Rügen oder sogar über Schweden, grummelt es noch. Über dem Peenestrom kommt die Sonne angeschwommen, schiebt lachend ihre Wärme mitten in die abgekühlte Luft, und es scheint Otto, als befinde sich seine Rechte im Warmen, seine Linke aber im Kalten.
Und die Sonne macht noch mehr. Sie spannt einen farbigen Bogen weit über den Nordhimmel. Otto ist bestürzt. Es ist das erste Mal, dass er ein solches Ereignis bewusst wahrnimmt. Fort ist die Frage des Onkel Baas, über die er hier draußen nachdenken wollte. Jetzt muss er sich diesem Regenbogen zuwenden, sonst rollt die Welt für ihn nicht weiter. Er saugt die Farben in sich hinein, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila, er saugt jede einzeln, dann alle zusammen. Und siehe da! Unter diesem leuchtenden Bogen erblüht ein zweiter, verhalten, als wolle er den Glanz des ersten nicht schmälern, und Otto glaubt darunter schon die Keime eines dritten Regenbogens zu sehen. Oder täuscht er sich?
»Onkel Baas! Onkel Baas!«
Er springt in die Bretterbude zurück. Onkel Baas trinkt den letzten Schluck Tee.
»Onkel, was ist das? Sieh doch nur!«
Der Baas stapft mit steifen Knien nach draußen. Zwei Regenbogen über der See. Der Baas sieht ein Bild in sich. Ein Schiff fährt ab, mitten in die Regenbogen hinein, unter dieser farbenfunkelnden Brücke hindurch. Die Regenbogen wölben sich mit ihrem geheimnisvollen Glanz wie ein Schirm über dem Schiff. Wie zwei Schirme. Ein starker Schutz. Wie eine farbige Wand gegen die graue Welt. Auf dem Heck des Seglers steht der kleine Patron. Die Regenbogen wölben sich auch über ihm. Er darf sich darunter sicher fühlen. Vielleicht sind Regenbogen der einzige wirksame Schutz für diesen kleinen Menschen. Er winkt zurück, er winkt dem Baas.
Das Bild vergeht. Der kleine Otto springt auf den Baas zu, fasst ihn an der Hand, nein, er zerrt an ihr, reißt an ihr.
»Onkel Baas, was ist das? Wohin führt diese Brücke? Woraus ist sie gebaut?«
Der Baas lässt seine Augen von einem Ende des Regenbogens zum anderen wandern und sagt nach längerem Überlegen: »Aus Regentropfen ist die Brücke gemacht. Wohin sie führt? Wir kommen nicht dorthin. Warum nicht? Sie ist ja bei uns.«
»Aber ich möchte sie haben. Ich möchte sie in meiner Hand halten.«
»In deiner Hand halten kannst du den Regenbogen nicht. Höchstens malen. Doch in der Natur sind die Regentropfen viel schöner als auf einem gemalten Bild. Schau sie doch nur an, solange sie da sind. Sie besuchen uns so nämlich nur kurze Zeit. Sieh sie an, dann hast du sie. Berühre sie mit den Augen, halte sie mit den Augen fest. Und denke daran, wenn du einschläfst oder aufwachst. Anders kann man sie nicht haben.«
»Ja, Onkel Baas, anders kann man sie nicht haben.«
Er wiederholt diesen Satz mehrere Male, fasst nach der Hand des Baas, Onkel Castorp muss es ja wissen. Otto schaut unverwandt auf die Regenbogen, sieht sie schwächer und schwächer werden. Es zuckt ihm in der Hand, er möchte nach den bunten Brücken greifen, doch er macht die Finger steif, er möchte den Baas nicht enttäuschen. Die Wolkenwände schieben sich nach Osten. Der Himmel über der See wird blau, und die Regenbogen verschwinden in den blauen Himmel hinein. Der kleine Philipp Otto Runge schaut ihnen nach. Der Baas neben ihm verzieht keine Miene. Er denkt an seine Frau, die schon in jungen Jahren verstorben ist, verschwunden, weggewelkt. Endlich sagt er: »Wir müssen jetzt weiterarbeiten, kleiner Patron. Und du musst nach Hause gehen und sagen, dass du das Gewitter und die Regenbogen gut überstanden hast.«
Am Abend bringt der fünfzehnjährige Bruder Daniel den kleinen Otto ins Bett. Dieses lang geübte Amt will er sich nicht nehmen lassen, doch bald wird es zu Ende sein, denn Otto möchte nicht mehr zu Bett gebracht werden. Und Daniel darf nicht mehr lange im Hause bleiben. Er ist fast erwachsen, er muss nun selbst sein Brot verdienen.
»Wo warst du, als das schlimme Gewitter auf uns niederging?«, fragte Daniel. »Ich war ja in der Schule, ich konnte mich nicht um dich kümmern. Aber bei jedem Blitzeszucken habe ich an dich gedacht. Hast du dich gefürchtet?«
»Ein bisschen. Aber der Baas hat mir Tee mit Kandiszucker gegeben. Und er hat gesagt, ich soll ihm winken, wenn ich fortsegle. Kleiner Patron nennt er mich.«
»Soso, ihm sollst du winken! An mich denkst du wohl überhaupt nicht? Bald werde ich nämlich absegeln, kleiner Patron!«
»Weißt du, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich schaue dich jetzt an, und dann habe ich dich auch später immer. So wie die Beile, die Sägen, die Bretter und den Baas und die anderen Werkleute. Und dann gibt es noch den Regenbogen. Er ist wie eine Brücke, und er ist noch breiter als die Peene. Du sollst das eine Ende anfassen, und ich nehme das andere. Dann geht es hoch hinauf, und ganz oben treffen wir uns. Sooft wir einen Regenbogen sehen. Auf Wiedersehen, lieber Daniel! Schön ist dein Schiff. Und es fährt mitten unter der farbigen Brücke hindurch. Gute Nacht, lieber Daniel!«
Und schon ist Otto eingeschlafen.
5. Kapitel
Zögernd kehrt Philipp Otto Runge aus seinen Kindheitserinnerungen in die Gegenwart zurück. Warum wollte Daniel damals nur um jeden Preis fort aus der Wolgaster Behaglichkeit und Geborgenheit, fort vom Elternhaus, von der Peene, vom Holzhof des Vaters? Aus Wolgast war doch etwas geworden, eine der größten und noch immer blühenden Städte in Schwedisch-Pommern. Auch aus Daniel hätte in Wolgast etwas werden können, das Beispiel seines Bruders Jakob beweist es ja. Unter der Schwedenfahne ist in Wolgast gut wohnen. Hamburg ist gefährdet. In Wolgast werden Schreibfedern gezückt, um das Lob der kleinen Behaglichkeit aufzuzeichnen. In einem dieser Berichte heißt es:
»Wenn die unregelmäßigen und gebogenen Straßen auch nicht ansprechen, so trifft das Auge doch auf mehrere schöne Häuser, die nach und nach entstanden sind und im Äußeren durch ihren gelungenen Bau und durch ihre mit feinem und hellem Glas versehenen Fenster viel Freundliches haben. Und sprechen die Häuser nicht an, so tun es doch unsere Schiffe im Hafen; dies sind unsere schönsten und kostbarsten Gebäude, welche in Sonderheit einen reizenden Anblick gewähren, wenn sie mit geschwellten Segeln ankommen oder abgehen und bei Feierlichkeiten ihre Flaggen wehen lassen. Doch haben wir auch große und massive Häuser, die mit Ehren in einer großen Stadt ihren Platz einnehmen würden und deren Bau namhafte Summen kostete; und ist die Mehrzahl der Häuser auch beschränkt, so sind diese doch hin und wieder bequem und gut eingerichtet. Dabei ist das Ameublement der Zimmer und das Speise- und Trinkgerät so geschmackvoll und kostbar, wie man es nur immer in einer Stadt von ähnlichem Range finden kann. Auch wir haben Möbel von Mahagoniholz, Fortepianos mit einem Flötenzug, Trumeaux, Teppiche, Sineumbra-Lampen, Lüster, Ampeln, geschmackvoll gemalte Drahtgitter vor den Fenstern und mehrere Sachen des Luxus und der Mode ...«
Stolz sind die Wolgaster, denkt Runge. Auf einiges werden auch sie verzichten müssen. Aber nur vorübergehend, davon ist jeder Wolgaster fest überzeugt.
»Der Handel ist nicht zu jeder Zeit gleichbleibend, indem sowohl Zeitumstände als auch der schwächere oder stärkere Unternehmungsgeist diesen Wechsel herbeiführen. Wolgast hat glückliche Zeiten gehabt, besonders brachte der amerikanische Krieg große Wohlhabenheit in diese Stadt, so wie überhaupt ganz Pommern durch ihn gewann, indem seine Schiffe unter neutraler Flagge fuhren. Auch in den Jahren seit 1790 war der Handel in dieser Stadt äußerst bedeutend, und die großen Seeschiffe, deren Wolgast über siebzig hatte, verdienten außerordentlich durch hohe Frachten ...«
Selbstverständlich verzichtet man auch nicht auf den Lobpreis der Wolgaster selbst.
»Es fehlt auch nicht an unternehmenden Männern hieselbst, welche teils den Schiffbau betreiben und dadurch Nahrung und Leben im Orte verbreiten, teils auch die auswärtigen Konjunkturen im Handel glücklich benutzen und durch Getreidehandel sich selbst und einen großen Teil ihrer Miteinwohner in Wohlstand versetzten. Unter jenen zeichneten sich mehrere aus, besonders Canzler und Runge; unter diesen die Kaufleute Sonnenschmidt und Homeyer ...«
Doch wie steht es in dieser schlechten Zeit mit den lieben Wolgastern? Haben sie auch noch anderes als geschwellte Segel und Mahagoni? Was bedeutet ihnen Ehre, Treue, Vaterland? Runge wird es prüfen.
6. Kapitel
Otto war ein schwächliches Kind. Krankheiten richteten sich gern häuslich bei ihm ein und verließen ihn höchst ungern. Ein offenes Fenster ließ gleich eine Erkältung herein, und durch den Türspalt huschte das Ohrensausen. Mutter und Muhme waren oftmals voller Unwillen gegen den Bruder Daniel, der den Kleinen auch bei größter Kälte zu Spielen im Freien aufforderte.
Otto ist zu weich, rechtfertigte sich Daniel, er muss eine harte Haut kriegen.
Den Tod wirst du ihm unter die Haut jagen, empörte sich die Muhme.
Der sitzt schon darunter, bei jedem Menschen sitzt er darunter, widersprach es in Daniel, doch er dachte es nur. Gnade ist es von Gott, ein hohes Alter zu erlangen. Gnade ist es vom Himmel, den Tod immer wieder abzuwehren, zu verhindern, dass er sich unter der Haut ausbreitet. Otto brauchte einen Schutz. Man musste den Tod in ihm erschrecken, man durfte ihm nicht Furcht und Schwäche zeigen. Otto musste also auch bei Kälte hinaus.
Der Vater hat seit dem ausgehenden Winter krank gelegen. Nun kann er endlich wieder aufstehen. Er darf die besondere Herzlichkeit der Familie zu diesem Tag erwarten. Er ist ja wie der liebe Gott, zu dem jeder freudigen Herzens aufbricht, um ihm Gaben zu bringen, selbst verfasste oder wenigstens auswendig gelernte Gedichte voll Liebe und Ergebenheit.
Der Vater hat uns das Leben geschenkt. Der Vater erhält unser Leben, und darüber hinaus liebt er uns auch. Der Vater gibt uns nicht nur das Notwendige für den Tag, sondern darüber hinaus Überfluss. Er gibt uns mehr Brot, als zur Sättigung erforderlich ist. Es gibt Milch in Fülle und sonntags sogar einen Schluck Bier für die Großen. Der Vater belohnt das Bravsein und straft den Verstockten. Der Vater ist wie der liebe Gott, der Herr über Wolgast und die Welt. Wie man dem lieben Gott zur Überwindung seiner Leiden gratuliert und dafür ein schönes Osterfest zum Geschenk erhält, so muss man auch dem Vater zur Genesung gratulieren, ihm und sich selbst einen angenehmen Tag bereiten. Fühlt der Vater sich gesund, wohl, anerkannt, geehrt, wird sich sein Wohlbefinden auf die ganze Familie ausdehnen.
Kurz nach dem Mittagessen gehen die Kinder Runge hinaus auf die Peenewiesen, um dem Vater Blumensträuße zu pflücken. Sie bewegen sich langsam, denn die Mahlzeit war ungewöhnlich reichlich. Die Kinder Runge sind eine stattliche Heerschar. Sie werden eine ganze Wagenladung Blumen bringen. Der Zug wird von der siebzehnjährigen Charlotte angeführt. Daniel geht mit Stienchen, Jakob mit David, zwischen ihnen der kleine Karl. Nur Otto muss daheimbleiben, denn er ist wieder einmal krank, hustet, lächelt aus glanzlosen Augen, gestikuliert mit matten Bewegungen, er möchte mit, er braucht doch auch einen Blumenstrauß. Doch alle sind unerbittlich, sogar Daniel und erst recht die Mutter. Die aber hat wenigstens Verständnis für die Notwendigkeit kindlicher Ehrerbietung. So kramt sie aus ihren Schätzen schwarzes Papier hervor, dazu eine Schere, eigentlich zu scharf für Kinderhände. Sie legt alles auf Ottos Bettdecke und sagt: »Spaziere mit der Schere über das Papier. Du musst es als deine Wiese ansehen. Wenn du fleißig suchst, findest du Blumen, selbst geschnittene.«
»Aber das ist schwarzes Papier und keine schöne grüne Wiese. Wie sollen sich bunte Blumen in schwarzem Papier verstecken?«
»Such sie, Otto, such sie!«
Sie lässt den Kleinen im Zimmer der Kinder allein, sie muss nach Gustav, dem ganz Kleinen, schauen. Die große Standuhr tickt genau und schwerfällig. Ihr Zifferblatt trägt ein ganzes Haus mit einem Garten. Durch das offene Fenster sind Eintagsfliegen in Ottos Zimmer hereingeschwärmt und durchtanzen ihr kurzes Leben. Fern in der Küche klappern die dicken Kupferkessel. Otto fängt erst einmal an zu weinen. Doch dann vergisst er die Tränen über dem Gedanken, wie das wohl zugehen könnte: Dass sich Blumen im schwarzen Papier verstecken, Blütenkelche, kleine und große Blätter?
Er nimmt das Papier in die Hand. Es ist steif und tot. Doch er stellt sich die Blumen vor, die darin verborgen sein könnten, und er sieht plötzlich ihre Umrisse auf dem Bogen, folgt ihnen mit den Augen. Ja wirklich, die Mutter hat recht, er braucht diesen Linien jetzt nur noch mit den Klingen der Schere zu folgen. Die Tränen hängen noch an seinen Augenwimpern, aber er schneidet schon. Es ficht ihn nicht an, dass das Papier schwarz ist, nicht grün, nicht bunt. So hat er die Blumen auch schon gesehen: als schwarzen scharfen Schatten in einer Vase gegen das offene Fenster, gegen den dunkel leuchtenden Abendhimmel. Das Grün der Blätter war ins Schwarz hineingekrochen, und doch waren die Blätter noch ganz da. Auch jetzt sind sie noch da, in Ottos stets wacher Erinnerung. Er braucht die Formen nur aus seiner Erinnerung zu entlassen, dann kann er sie aus dem schwarzen Papier herausschneiden. Doch die Schere ist nicht wie das Auge, sie lässt sich nicht so mühelos dirigieren. Sie sträubt sich gegen die Finger, gegen die kleine Hand, schneidet am liebsten gerade Linien, keine gezackten Blattränder. Otto kämpft mit der Schere, und Tränen lösen sich wieder von seinen Augen, verschleiern seinen Blick, die Schere zuckt steuerlos in seinen Fingern, doch das Papier gibt sich nun willig zu Zacken her, und ein lebensfreundliches Blatt wächst aus der Schwärze. Otto legt es auf den weißen Bettbezug, und da liegt es gut. Er schnitzelt weiter und lässt einen Grashalm sprießen, spitzig, vom Wind gebogen, sein langes Blatt weht wie eine Fahne von des Vaters Schiffen, wenn sie peeneabwärts fahren. Otto versucht sich an Blütensternen, sie gelingen. Er baut ein ganzes Blumenbeet auf der Bettdecke zusammen, er ordnet alles Ausgeschnittene zu einem Strauß, den er dem Vater schenken wird. Der Vater kann Schiffe, der kleine Sohn aber Blumen wachsen lassen.
Die Geschwister kommen zurück, große Sträuße im Arm, bunte Vielfalt um die Genesung des Vaters. Sie schauen auf Ottos Bettdecke und staunen: Wer hat dem Kleinen die Blumen ausgeschnitten? Er selbst? Otto ist hochrot vor Stolz und Freude und Fieber. Er bringt kaum ein Wort heraus und zeigt nur auf die Schere und das Papier. Sie sollen ihn loben, ihn verstehen, ihn mit aufnehmen in ihre Blumengemeinschaft, er hat doch auch einen Strauß!
Am meisten freut sich die Mutter. Einen Augenblick lang sieht sie glücklich in Ottos Kindheitszukunft. Otto wird sich seine Welten aus Papier schnitzen. Da sind Schlittschuhläufer, die paarweise mit verschränkten Armen über die spiegelglatte Fläche schweben. Rund gebogen sind die Schlittschuhe, elegant und rund sind die Bewegungen der Eistänzer, rechts und links und rechts und links. Er könnte auch die ganze Stadt Wolgast aus dem Papier schnitzen, die kleinen Wind flüchtenden Hütten der Armen, von deren Dächern das Stroh herabhängt wie ungekämmtes Haar, die Hütten mit den winzig-schrägen Fenstern und dem geborstenen Schornstein, aber auch die stattlichen Häuser der Kaufleute und Handwerker, zu deren Eingangstüren kleine Treppen hinaufführen, denn reputierliche bürgerliche Wohnräume liegen auf einer höheren Ebene als die Straße. Man hat sich emporgearbeitet, und andere dürfen zu einem hinaufsteigen, die Treppen sind bequem.
Wo bleibt der Vater? Er müsste sein kurzes Nachmittagsschläfchen jetzt abbrechen. Vorsichtig klinkt die Mutter die Tür zum Wohnzimmer auf. Das Sofa, auf dem der Vater zu ruhen pflegt, ist leer. Die Kissen sind glatt, niemand hat auf ihnen gelegen. Die Mutter erschrickt. Sollte der Vater etwa auf die Werft gegangen sein? Er wäre dazu imstande. Sie kann es ihm nicht verdenken, er muss ja wieder einmal nach dem Rechten sehen, das ist ihm Pflicht, denn er weiß, was recht ist. Doch er hat auch Pflichten gegenüber der Familie. So gesund ist er noch nicht, dass er sich jetzt schon das Joch des Werftalltages auferlegen darf. Wie leicht kann er einen Rückfall erleiden, und dann? Die Mutter gerät außer sich, das geht schnell bei ihr.
»Tochter, sieh nach dem Kleinen, wasche die Kinder! Daniel, bleibe du bei Otto, ich muss mich um Vater kümmern!«
Auch er ist wie ein Kind, fügt sie in Gedanken hinzu, aber ein solches Wort darf die Ohren der Kinder nicht erreichen. Sie zupft ihr Häubchen zurecht, ihrem Mann darf sie nicht unordentlich unter die Augen gehen. Sie legt das große Umschlagetuch um, springt die Haustreppen hinunter auf die Straße, eilt die wenigen Schritte zur Peene.
Daniel lobt jede einzelne Blume, jedes Blättchen, das der kleine Bruder ausgeschnitten hat. Er sucht einen starken weißen Papierbogen, verdünnt den Leim, den sie zum Holzkleben benutzen, und hilft Otto, die ausgeschnittenen schwarzen Blumen zu einem gefälligen Kränzchen anzuordnen, das er dann geschickt auf das Papier klebt.
»Wann kommt denn Vater?«, fragt Otto immer wieder.
»Sei nur geduldig, er wird schon kommen.«
»Darf ich wenigstens aus dem Fenster schauen?«
»Ja, aber zieh dir die Pelzweste an und Wollsocken und binde dir einen dicken Schal um.«
Otto schaut in den Garten. Wie lange schon ist er nicht darin herumgesprungen! Der Gartenzaun steht aufrecht und wachsam mit seinen festen Latten. Wenn sich eine zu lösen droht, ist der Vater sofort da mit Hammer und Nägeln. Jetzt übernimmt Daniel schon dann und wann diese Aufgabe. Auch sein Hammerschlag ist treffsicher und klingt vertrauenerweckend. Dort hinten fließt die Peene. Dieser Name lässt sich so leicht aussprechen, Otto konnte es schon mit zwei Jahren. Auf der Reede liegen zwei kleine Segelschiffe. Dorthin ist also der Vater gegangen, die Schiffe anschauen, nach denen er während seiner langen Krankheit Sehnsucht bekommen hatte. Er liebt auch seine Schiffe, nicht nur seine Kinder. Auch Schiffe sind für ihn lebende Wesen mit Haupt, Leib und Gliedern, vielen Gliedern. Man muss sich um sie bemühen, sie sind etwas Lebiges. Vater ist hingegangen, sich mit seinen Schiffen zu unterhalten. Wachse wohl, fahre wohl, komm zurück!
Charlotte Runge, die große Schwester, hat aus ihren Blumen eine Kette gewunden, einen Kranz aus Butterblumen, Kornblumen und Klatschmohn. Zuerst hat sie dabei an das Grab der Großeltern gedacht. Sie liebt es, Gräber zu schmücken. Ein Jahr später, 1784, mussten die Geschwister dann auch ihr Grab schmücken, denn es hielt sie nicht mehr lange in Runges Reederhaus. Doch das war später, und an diesem Genesungstage des Vaters ging sie nicht mit dem Blumenkranz auf den Friedhof. Wird sie es wagen, dem ernsten, strengen Vater die heiteren Blumen um den Hals zu hängen, aus Dankbarkeit, dass man nicht auch sein Grab zu schmücken braucht? Daniel setzt schon zu einer Rede an, um sie zurückzuhalten. Übrigens hält er nichts von ihren häufigen Friedhofsbesuchen und meint später, sie habe sich den Tod selbst auf dem Friedhof herbeigewünscht.
Als die Mutter sich anschickt, den Vater zu holen, will ihr Wasser, der braungelbe zottige Hund, sogleich folgen. Ihm ist die Mutter die liebste von allen Hausgenossen. Die Schwester Charlotte verscheucht über diesem Anblick ihre Friedhofsgedanken und legt die Blumenkette um Wassers Hals. Der Hund schaut sie verwundert an, nimmt aber den Schmuck ergeben hin. Im Hause Runge schüttelt niemand Kränze ab, das wäre verschmähte, ja in den Staub getretene Liebe. Wasser scheint zu wissen, dass er nun ein Liebesbote sein muss, ein Gegenstand zu liebevoller Verzierung. Auch in norddeutschen Kaufmannshäusern nutzt man jede Gelegenheit, etwas auszuschmücken, zu dekorieren, die Flächen über den Türen, die Kommoden und Spiegeltischchen, das Holz der Tischflächen und den Fußboden.
Endlich kommt der Vater zurück. Die Mutter begleitet ihn, nein, sie hat ihn abgeholt, sie hat ihn im Schlepptau. Der Vater scheint nicht darüber erfreut, im Gespräch mit den Schiffen unterbrochen worden zu sein. Sein Mund ist so fest geschlossen, dass man ihm ansieht, er hat den Weg über nicht gesprochen, er war ungehalten. Auch die Mutter ist ungehalten. Es kommt Otto so vor, als habe sie dasselbe Gesicht übergezogen wie der Vater. Otto hält es für geraten, schnell wieder ins Bett zu schlüpfen, und erst dort streift er die Pelzweste ab und versteckt sie unter der Bettdecke, desgleichen den dicken bunten Schal. Die Strümpfe behält er an. Auch Daniel hat die Mutter kommen sehen und eilt aus Ottos Zimmer, nur schnell zu den ganz Kleinen! Die Mutter kommt als Gewitter. Hoffentlich hat sich Gustav nicht wieder die Strümpfe ausgezogen!
Doch das mütterliche Gewitter zieht vorüber, ohne sich zu entladen. Auf der Diele warten die Kinder mit ihren Blumensträußen. Sie treten aus der kühlen Dunkelheit an den Vater heran, der vor Verwunderung und Überraschung nicht dazu kommt, die Haustür zu schließen, obwohl er immer über offenstehende Türen schilt, wegen des Wärmeverlustes. Sie sagen ihre Gedichte auf. Die Sträuße packt sich der Vater erst einmal unter den Arm. Die Magd muss kommen und sie ihm abnehmen. Für einen Augenblick steht sie, als kämen ihr alle diese Blumen zu. Des Vaters Gestalt ist wieder ungeschmückt. Da durchschießt es Daniel: Jetzt ist Ottos Stunde!
»Der schönste Blumenstrauß wartet noch auf Sie, lieber Vater. Otto hat ihn nicht gepflückt, sondern selbst gemacht.«
Er bietet dem Vater den Arm und geleitet ihn in Ottos Zimmer. Daniel ist eine Brücke, die jeden zu jedem führen kann.
Und Wasser, der Hund? Der ist mit sich und seinem Schmuck sehr zufrieden. Der Herr klopfte da unten an der Peenereede gerade an einem Schiffsrumpf herum. Es klang leise und voll. Das Holz schien sich gegen das Klopfen zu wehren. Wasser hat sich vor den Herrn gestellt, mit dem Schwanz gewedelt und laut gebellt. Der Baas musste über den bekränzten Hund lachen. Der Herr aber verzog keine Miene. Wortlos trottete er mit seiner Frau hinter dem Hund nach Hause. Wasser bewegte sich so vorsichtig, dass das Blumenkränzchen keinerlei Schaden nahm. Geübte Augen sähen freilich, dass manche Blumen schon zum Welken neigten. Otto sieht es nicht, er freut sich unbeschreiblich über den Hund, er muss immer wieder hellauf lachen.
Am Abend schenkt Daniel dem kleinen Bruder das Blumenkränzchen. Man kann dem Hund nicht zumuten, auch am Abend noch wie ein Pfingstochse auf dem Hof herumzulaufen. Der Vater hat sich in sein Kontor zurückgezogen und bedarf keiner Aufheiterung. Daniel und Otto können nicht ahnen, dass der Vater Ottos ausgeschnittene Blumen betrachtet. Otto aber hat nun doch noch lebendige Blumen und kann mit ihnen tun, was er möchte, sie pressen oder trocknen oder in schwarzem Papier nachschneiden. Er tut beides: zuerst die Formen nachschneiden, nachdem er sie lange betrachtet hat. Dann legt er sie zwischen die Seiten von Luthers Großem Katechismus, aus dem er lesen lernte. Er wird die Blumen trocknen und ein schönes Bild daraus kleben.
»Unser Otto ist zwar dauernd krank, aber er ist doch geschickt und kräftig, er macht sich alles selbst«, sagen die Mädchen am Abend bewundernd in der Küche. »Passt nur auf, eines Tages macht er sich auch noch sein Haus selbst, erträumt sich eine Frau und Kinder dazu und erschafft sie auch, vielleicht macht er auch uns alle neu ...«
Und nun mache ich mir meine Eltern selbst, bestätigt sich Philipp Otto Runge in seinen Kindheitsträumen und kehrt aus der Wirklichkeit des Jahres 1783 in die des Jahres 1806 zurück. Ich mache sie so, wie ich sie haben, wie ich sie behalten möchte. Natürlich sind sie da, und wie lange schon, aber damit, dass etwas da ist, habe ich es ja noch nicht. Das gilt nicht nur für die Eltern, das gilt erst recht für die Kinder. Ich habe ein Kind erzeugt, geschaffen, es ist da, und doch gehört es mir nicht ganz. Was tue ich, damit mir etwas ganz gehört? Was haben sie da früher über mich gesagt? Ich würde mir einmal meine ganze Welt selbst machen? Ach, ihr Schwestern, ihr Mägde, ich kann es nicht, niemand kann es. Ich kann nicht alles neu machen, was ich liebe.
Das erste, was Runge in seinem Elternhaus sucht und findet, ist das aufgeklebte Blumensträußchen. In einem fest gefügten, liebevollen Elternhaus geht nichts verloren. Sein kleines Zimmer ist noch da, die alte knarrende Kommode steht noch darin, und in einer Schublade dieses Möbels liegt das weiße, kaum vergilbte Papier mit dem schwarzen Blumenkränzchen.
Blumen, getrocknete und lebendige, gezeichnete und gemalte, haben Otto Zeit seines Lebens begleitet. Blumen sind Gottes liebste Geschöpfe. An ihnen erprobte und entwickelte und stärkte er seine Lust, schließlich auch den Menschen zu erschaffen. Otto hört stets einen anderen Vergleich aus dem biblischen Bericht von der Erschaffung des Menschen, nicht, dass Gott den Menschen nach seinem, Gottes eigenem Bild geschaffen habe, sondern nach dem Bild der Blumen.
Als Otto, dreijährig, einmal eine Tulpe geschenkt bekam, ging er singend mit ihr durch das ganze Haus, unbekümmert um die anderen, sprach auch dann und wann mit ihr, fest davon überzeugt, dass er den lieben Gott selbst in seinen Händen trage. Welkende Blumen verdunkeln ihm die Sonne. Später entdeckt er eine Möglichkeit, wie man Blumen ewiges Leben verleihen kann, man kann sie aufkleben und mit einem Firnis überziehen. Von dieser Möglichkeit ist er so beglückt, dass er es wagt, sogar dem Großen von Weimar damit unter die Augen zu gehen, dem Weisen, der so viele Möglichkeiten und Feinheiten des Lebens in sich vereint. Goethe neigte sein Ohr und nahm auch diese Erfahrung eines feinen Auges und Herzens in seinen eigenen Schatz auf, wie es zu seinen Lebensgesetzen gehört, alles zu seinem Eigentum zu machen.
7. Kapitel
Wasser, der blumenbekränzte Hund, springt und bellt lange durch Runges Erinnerungen und bittet immer wieder um Einlass in das Bild, das Runge sich und den Seinen von den Eltern machen möchte. Er liebt diesen Hund, doch zwischen seine Erinnerungen und die Gegenwart haben sich andere Erlebnisse gedrängt, stärker und beherrschender als die Kindheitsgedanken. Ein anderer Hund sprang in sein Leben und raubte ihm einen Teil seiner Kindheit. So muss er auch den frühen bekränzten Kindheitshund verjagen, obgleich er weiß, wie sehr er ihm damit unrecht tut. Den grässlichen schwarzen Zottelhund aber kann er nicht verjagen, obgleich der es verdient hat. Der Schwarze drängt sich von allen Seiten in Ottos Erinnerungen.
Es war im Jahre 1789, als dieser Hund von ihm Besitz ergriff. Es war das Jahr, in dem sich viele Menschen einem neuen Geist öffneten, den die einen für den Satan, die anderen aber für den Heiligen Geist hielten. Auch nach Wolgast waren die Botschaften von Aufruhr und Unruhe gedrungen. Wolgast lag zwar weit entfernt von Paris, den Braukesseln des Lebens, aber Wolgast lag am Meer, und das Meer verbindet, wenn man seine Weite und Unendlichkeit ertragen kann. Die Runges und Müllers, die Familie der Mutter, haben lange genug am Meer gelebt, um es mit allen ihren Kräften ertragen zu können, und sie spüren im Wellenschlag des Meeres auch den Herzschlag der weit entfernten Welt.
Der Patron, Reeder und Kaufmann Daniel Nicolaus Runge spürt das Herz der Welt so stark, dass er seinen eigenen Herzschlag - und das ist auch immer der seiner Familie - davon bedroht fühlt. Er möchte nach seinem eigenen Rhythmus leben, er kann das Meer ertragen, aber nicht die ganze Welt. Wolgast liegt ihm zu nahe an der ganzen Welt.
Er freut sich, als er eine Einladung zu seiner Tochter erhält, die in der Blüte ihrer Jahre und ihrer Ehe steht. Der Vater möge doch kommen und seine weite Welt des Meeres, der Offenheit und der Erwartung in ihre kleine Welt der Stille, der Abgeschiedenheit und der bisweilen beklemmenden Ruhe hineinfließen lassen. Ilsabe Helwig wohnt mit ihrem Mann und ihren Kindern im Mecklenburg-Schwerinschen. Daniel Nicolaus Runge sehnt sich nach dieser Welt. Er hat es nicht gelernt und auch nicht versucht, seine Sehnsüchte in Worte zu kleiden, ihnen einen hörbaren oder greifbaren Ausdruck zu verleihen, doch er sucht nach diesem Ausdruck und findet ihn darin, dass er Otto, in dem er von allen seinen Kindern die stärkste Liebe und Sehnsucht spürt, mitnimmt auf die Reise ins Schwerinsche Idyll.
Otto ist zwölf Jahre alt und gerade wieder einmal von einer Krankheit genesen. Alle haben aufgeatmet und genickt. Ja, er ist reisefähig und reisebedürftig. Man muss diese kurze Pause zwischen zwei Krankheiten ausnutzen. In diesen Zwischenzeiten ist seine Sehnsucht, sein Lebenshunger übergroß, man muss ihn mit mehr als nur mit der Wolgaster Umgebung sättigen. Im Schwerinschen ist alles anders, das wird ihm guttun. Man ist dort fürstlich-herzoglich und nicht bieder-schwedisch. Man spricht zwar dieselbe Sprache, und doch bedeuten manche Worte etwas anderes. Otto wird es merken, er hat ja ein Ohr für die allerfeinsten Unterschiede.
Am meisten freut sich die Mutter über diese Reise. Sie hat es im Laufe ihres zwölfjährigen Zusammenlebens mit diesem Kinde gelernt, sich in alle seine verborgenen Winkel und offenen Plätze hineinzufinden, ihn überall zu verstehen, seine Blicke und Gebärden zu deuten und in ihrer Weise darauf zu antworten, und sie erklärt den anderen Kindern, dass Otto mehr Liebe und Zärtlichkeit brauche als sie alle zusammen. Die Geschwister verstehen es, zumal sie dabei nicht zu kurz kommen. Mutterliebe ist für alle und für einen zugleich und gleich stark da.
Magdalena Dorothea Runge packt selbst den kleinen Rucksack für ihren Sohn, obgleich er es schon selbst kann, aber er fühlt sich wohl in dieser mütterlichen Obhut und Pflege und schaut der Mutter unverwandt zu. Als Daniel zwölf Jahre alt war, hat er sich gegen solchen mütterlichen Dienst bereits kräftig gewehrt. Die Mutter schmiert die Stiefel mit Fett ein, damit sie weich werden und nicht drücken, damit sie glänzen und anzeigen, dass der kleine Reisende aus einem reputierlichen Hause kommt. Als der Vater verstohlen an sich heruntergeschaut hat, fettet auch er seine Stiefel noch einmal ein.
Otto prüft immer wieder, ob er alle seine kleinen Geschenke für die große Schwester und ihre Familie ordentlich eingepackt hat. Er hat das Elternhaus gezeichnet, nicht nur einmal, sondern bei Sonne, bei Regen und bei trübem Wolkenwetter, die Blumen im Garten und auch das Zimmer, in dem die Schwester ihre Mädchenjahre verbracht hat. Für den Schwager hat er die Stadt Wolgast aus Papier ausgeschnitten und für die Kinder Kränzchen aus Blütenblättern auf Papier geklebt und mit Firnis überstrichen. Auch sie sollen beizeiten lernen, mit Blumen zu leben.
Der Wagen, der sie nach Anklam bringen soll, lässt auf sich warten. Daniel Nicolaus Runge wird unruhig. Ist auch die Wolgaster Welt schon gestört? Es wird Zeit, sich für einige Wochen von ihr zu trennen. Als Runge auf seinen Sohn blickt, beruhigt er sich. Ottos Augen sind verträumt und ruhig und beständig zugleich. Sein Atem geht gleichmäßig. Er freut sich, dass der Aufbruch bevorsteht, er freut sich aber auch, dass er noch bleiben darf. Der Vater geht in den Garten, schneidet einen Stock ab und schnitzt ihn als Wanderstab zurecht. Er schneidet allerlei Bänder und Muster in die Rinde und sogar die Anfangsbuchstaben von Ottos Namen: P O R 1789. Otto wundert sich, dass sich der Vater auf solche Künste versteht und seinen Sohn damit erheitern möchte. Er nimmt den Stab in die Hand und stützt sich darauf, da rasselt endlich der Wagen an das Reederhaus.
Otto steigt auf den Bock. Selbst der Kutscher fühlt sich veranlasst, ihn noch wärmer in Decken und schließlich in eine Pferdedecke einzuwickeln. Otto zieht die Nase kraus; der scharfe Pferdegeruch stört ihn, es riecht so gar nicht nach Blumen. Er beklagt sich aber nicht und beschäftigt seine Augen um so stärker. Der Vater sitzt drinnen im Wagen. Otto vergisst die Abschiedstränen der Mutter und taucht mit allen seinen Sinnen in die Landschaft.
Flach und fett und freundlich ist das Land hier. Blau und grün und rot grüßt es von allen Seiten. Tiefblau breitet sich der Himmel, unendliche Fernen verratend und verheißend. Vielfältig grün sind die Bäume und Sträucher und die weitreichenden Viehweiden, auf denen sich die Kühe wie schwarz-weiße Flecken schwerfällig bewegen. Rot glühen die breitschultrigen Dorfkirchen mit ihren untersetzten, gedrungenen Türmen. Dazwischen blitzen weiß die gekalkten Bauernhäuser mit ihrem regelmäßig-sauberen Fachwerkkleid. In den Bauerngärten prangen Blumen, rot, gelb, weiß, die Linden blühen, die Bienen summen. Jedermann lebt ganz in dieser Welt, genießt sie auch bei der Arbeit des Tages, schaut dann und wann vom Grasmähen, Hacken und Graben auf, um in die Sonne zu blinzeln. Otto fühlt, er ist einer von ihnen, ein winziger Teil dieser Landschaft, aber doch groß und fein genug, um diese Welt in sich hineinzulassen, um nicht von ihr aufgesogen und verschluckt zu werden.
Ein groß geformtes Wesen wächst aus der Landschaft empor, es ist wie ein mütterlicher Körper, breit und voll und doch unendlich fein. Einen Frauennamen trägt dieses Wesen: Sankt Marien von Anklam. Otto atmet tief, dieser Anblick erfüllt ihn mit Vertrauen, das ist wie Wolgast. Auch unter den Gewölben der Wolgaster Petrikirche fühlt er sich geborgen und nicht nur das, von hier möchte er aufbrechen zu neuen Entdeckungen, möchte in die nähere und fernere Umgebung wandern. Und - wie schön! - in der ferneren Umgebung findet er nun eine ähnliche Kirchenhalle. Er möchte sie ganz sehen, sie von allen Seiten, von innen und außen mit seinen Augen berühren. Die Augen sind für Otto nicht nur ein Organ, durch das er die Welt in sich hineinfließen lässt; mit ihnen schmiegt er sich auch der Welt an, grüßt sie, streichelt sie, liebkost sie, küsst sie. Er möchte also mit seinen Augen hinein in die Anklamer Marienkirche, und der Vater gewährt es. Er muss ohnehin eine andere Fahrgelegenheit auskundschaften, mag der Sohn sich unterdessen in der Kirche ergehen!
Und wie der sich ergeht! Hundert Augen wünscht er sich, um all das Licht in sich hineinzusaugen, nicht nur das gegenwärtige, sondern auch das Licht, das in diesen vielhundertjährigen Mauern gespeichert ist, es muss doch noch drinnen sein, die Mauern sind prall davon! Wie wenig sind ein Paar Menschenaugen für diese Lichtwelten! Auch die Grabmäler und Grüfte in der Kirche drängen sich nach diesem Licht, lassen sich umschmeicheln, umspielen, liebkosen. Und sogar die Fledermäuse, die doch der schwarzen Nacht entstammen, schweben auf den Wellen des Lichtes leichter und freier noch als in der gewohnten dunklen Verborgenheit. Otto erwartet, dass sich die Fledermäuse in den warmen Strahlen zu Nachtigallen verwandeln. Darüber muss er mit seinem Lehrer Kosegarten sprechen. Ein Mensch mit einem solchen Namen und einem solchen Herzen muss das verstehen. Otto lässt seine Augen wandern, spielen, nimmt mit ihnen den Raum in Besitz, doch dieses Besitzen scheint zu flüchtig, zu wenig; er möchte heute all das auch einmal mit seinen Händen greifen, auch das ganz Große, nicht nur die Blumen und Tiere und Bälle und Geschwisterhände daheim. Er wagt es nicht gleich. Es ist alles so groß, so gewaltig, so überwältigend ; wie soll das alles Platz haben in seinen kleinen Händen? Wenn doch Daniel hier wäre, der würde ihm Mut machen.
Geh darauf los, Otto, fass es, erfasse es, greife es, begreife es, es ist dein Leben, es sind deine Hände, nutze sie! Es ist gut, wenn du die Welt mit deinen Augen erfasst, aber sie braucht auch deine Hände, und du brauchst die Welt auch in deinen Händen.
Er streift mit seinen Handflächen die achteckigen Riesenpfeiler. Niemand könnte sie mit den Händen umfassen, niemand sie mit den Armen umspannen, sie sind viel zu gewaltig, ein wahres Riesenspielzeug. Und doch kann ein Kind, das sich in Liebe der Welt zuwendet, mit seinen Handflächen Besitz von ihnen ergreifen. Otto fühlt den rauen Mörtel, den Staub auch, die Last und den Schmutz der Jahrhunderte. Aber dahinter, ja darin liegt das andere, das Große, das Wesentliche. Otto streichelt auch die Bänke und die Gitter, die Schnitzereien aus Holz und Stein, er klettert sogar an einem Gesims hoch, um ein niedriges Fenster zu streicheln. Dieses Fenster liebkost er ganz besonders, lässt es doch das herrliche Licht in den Raum.
Da kommt der Vater mit dem Küster in die Kirche, eilig und ungeduldig. Er kann den Wagen nicht länger warten lassen. Doch wie sieht der Sohn aus? Staubig und beschmiert. Nun wischt er auch noch die Hände an den blauen Samthosen ab ...
»Bist du ganz und gar von Gott verlassen? Wie beträgst du dich in seinem Haus? Aus einer Kirche kommt man mit sauberen Gedanken und sauberen Kleidern! Ich kann mich neben dir in Anklam nicht sehen lassen!«
Der Küster sucht einen Ausweg.
»In meinem Hof steht ein Brunnen, das Wasser ist klar und rein. Dort mag sich der junge Herr waschen und reinigen. Der Kirchenstaub lässt sich ganz leicht entfernen, das weiß ich aus Erfahrung.«
Der Kutscher, der schon draußen wartet, lacht über das ganze breite Gesicht, als er den staubigen Sohn des ehrenwerten Wolgaster Kaufmanns sieht, und er drängt nicht zur Eile, wie sollte er auch - er ist ja ein Mecklenburger.
Ottos Augen schwimmen in Tränen, er kämpft mannhaft dagegen, nur gut, dass er sein verschmiertes Gesicht nicht allzu weit tragen und zeigen muss! Da plätschert schon der Brunnen des Küsters, und in wenigen Minuten ist Otto wieder derjenige, der er war und sein soll: ein reputierlicher Kaufmanns- und Reederssohn aus Wolgast, der den Vater auf einer Reise begleiten darf.
Die Peitsche knallt, der Wagen ruckt an. Die Fahrt geht der Sonne nach, man wendet sich gegen Westen. Otto verbirgt seine Hände in den Taschen. Diese Welt war doch zu groß für ihn. Man darf sie nicht berühren, und daher kann man sie nicht begreifen. Und er sehnt sich doch unbeschreiblich nach solcher Berührung der ganzen Welt. Er sehnt sich nach einem Menschen, der ihm Mut macht, der ihm zuruft: Wage es nur! Auch Daniels geheimer Zuspruch hat ihn nicht vor Scheltworten bewahrt. Der Vater hat ja recht. Man macht sich nicht schmutzig! Man bewahrt sich vor Staub und Schmutz. Aber - wenn nun Abenteuer und Entdeckungen und Erfahrungen mit Staub und Schmutz bezahlt werden müssen? Was braucht der Mensch mehr: Sauberkeit oder neues Leben? Und es gab dort neben der Kirche ja einen Brunnen mit klarem und frischem Wasser. Es gibt überall Brunnen.