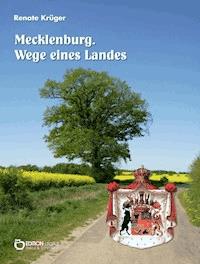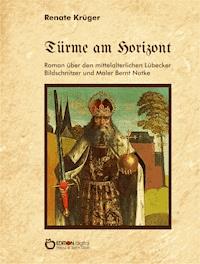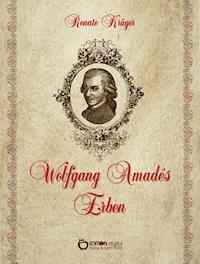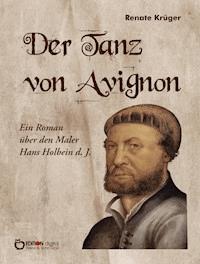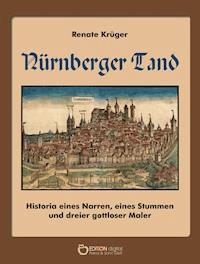8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer kennt nicht die berühmten Bilder Rembrandts, Szenen aus der Bibel und dem Alltag, Porträts und Landschaften, die unverwechselbar das Leben im Goldenen Zeitalter der Niederlande widerspiegeln und deuten? Die Autorin folgt in ihrem Roman nicht der gewohnten Methode, das gesamte Leben Rembrandts zu erzählen, sondern fängt wichtige Abschnitte wie in einem Brennspiegel ein: im Tagebuch von Rembrandts jüdischem Freund, dem Diplomaten, Schriftsteller, Drucker und Verleger Manasse ben Israel (1604-1657) von der Portugiesischen Synagoge in Amsterdam. Diese Abschnitte empfangen Motivation und Deutung aus Rembrandts Bildern, die somit ihren besonderen Platz im Leben erhalten, zumal in der Auseinandersetzung mit dem strengen jüdischen Bilderverbot. Eines Tages steht Manasse be Israel vor der „Nachtwache“ und wird in Zweifel gestürzt, ob die Gesetze des Judentums, in denen es heißt: „Du sollst dir kein Bildnis machen“, zu Recht bestehen. Er beginnt sein Leben und damit seine Wandlung aufzuschreiben. Aus den Aufzeichnungen erleben wir sowohl das Schaffen Rembrandts als auch das Herauswachsen des Weisen der Portugiesischen Synagoge in Amsterdam aus den alten Traditionen, das sie, die Nachbarn Rembrandts, zu treuen, helfenden Freunden werden lässt. Der Titel erschien auch in japanischer Sprache. LESEPROBE: In langer Reihe zogen hochbeladene Fuhrwerke in die Markthalle und zu den städtischen Warenlagern. Pferdegetrappel, Peitschenknallen. In malerischer Kleidung die Fuhrknechte. Hatten ihnen die Landsknechte, die weiter östlich, in Deutschland, nun schon seit vielen Jahren, ihr Unwesen trieben, als Vorbild gedient? Noch malerischer aber wirkten die fremden Kaufleute, die hier und da auftauchten und sich durch ihre lebhaften Reden und Bewegungen auffällig von den schwerfälligen, bedächtigen Holländern unterschieden. Es waren Pelzhändler aus Nowgorod, das am Ende der Welt, kurz vor dem ewigen Eis lag. Sie trugen lange blaue oder rote Gewänder, die mit Pelz verbrämt und mit unzähligen Knöpfen verziert waren. Dort stolzierten türkische Seidenhändler mit gewaltigen Turbanen und Schnurrbärten, krumme Säbel in den Seidenschärpen und krummgebogene Pantoffeln an den Füßen. Ich sah Gewürzhändler aus unseren brasilianischen Kolonien mit ihren schwarzen und braunen Sklaven. Welch ein Bild! Das war Amsterdam! Auch Rembrandt schaute sich angeregt um. „Ein herrliches Bild, nicht wahr? Mir ist es nicht gegeben, solche Bilder zu malen. Leider.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Licht auf dunklem Grund
Ein Rembrandt-Roman
ISBN 978-3-86394-322-6 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Selbstporträts von Rembrandt van Rijn.
Das Buch erschien erstmals 1967 im Verlag Zenner und Gürchott, Leipzig und wurde leicht überarbeitet. Im Jahre 1998 erschien im Verlag edition q eine Übersetzung ins Japanische. Eine weitere Druckausgabe erschien 2001 im Alittera-Verlag München.
Die Vorlagen für die Abbildungen entstammen Wikimedia Commons
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Nachtwache
Die Nachtwache, Öl auf Leinwand , 1642
Amsterdam, 12. Mai 1642
DIES SCHREIBT MANASSE BEN ISRAEL von der Portugiesischen Synagoge zu Amsterdam, der damit von seiner Gewohnheit abweicht, nur über den Ewigen - gelobt sei Er! - und Seine geheimnisvollen Zeichen in der Welt zu schreiben, der bisher noch niemals etwas über sich selbst geschrieben hat und von dieser Gewohnheit auch nicht abzuweichen gedachte.
Warum schreibe ich denn überhaupt und worüber? Heute habe ich eine Erkenntnis gewonnen, die alle meine bisherigen Erkenntnisse übersteigt, die mich einen neuen Weg beginnen lässt, einen Weg, der nicht schweigend gegangen werden darf, sondern in das Wort gezwungen werden muss. Man nennt mich wortgewaltig, und schon vieles habe ich ins Wort gebracht und damit dauerhaft gemacht.
Seit einigen Jahren hat meine Feder geschwiegen, es lag ihr nichts am Tagesgeschwätz, und als ich sie heute hinter meinen Büchern herauszog, war sie stumpf geworden vom Staub der Jahre, aber was tut's! Ich will keine spitzen Reden führen! Leicht liegt die Feder in meiner Hand, und doch wiegt so schwer, was aus ihr fließt, es ist eine neue Welt, die sich mir erschloss, es ist eine Veränderung im Kosmos.
Hier in meinem Zimmer werde ich die neue Welt austragen, festhalten, festschreiben, welcher Raum wäre dafür geeigneter? Hier sind wir nur drei, die Zeit, die Stille und ich. Zeit und Stille sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, und dazwischen klagt mein aufgeregtes Herz - oder ist es Jubel? -, das heute etwas Neues erfuhr. Ist nicht alles neu um mich?
Ich sehe mein Zimmer, wie ich es noch niemals sah, wie ich es niemals sehen wollte. So wie jene merkwürdigen Menschen, die versuchen, die Zeit und den Raum im Bilde festzuhalten und nicht nur das, auch den Menschen ... Ich aber habe mir niemals gemalte Menschen angesehen, andere Bilder aber habe ich schon betrachtet - und verflucht -, denn es widerstrebt dem Willen des Ewigen gelobt - sei Er! -, das Zeitliche zur Ewigkeit zu machen, da es doch bestimmt ist, Staub und Asche zu werden.
Und doch - heute sieht mein Zimmer aus wie eines jener kleinen Bilder, mit denen mein Sohn leider handelt, obgleich ich ihm viele Nächte hindurch erklärt habe, dass er Götzendienst betreibt. Er aber sagte, die Maler malten so aus Liebe zu den Dingen.
Sehe ich mein Zimmer nun auch anders, weil ich diese Dinge hier liebe? Den Tisch, unter den ich meine Beine strecken kann; er steht auf vier starken Balusterfüßen, kräftig genug, um die mächtige Eichenplatte zu tragen. Ein bunter, wollener Tischteppich verbirgt die hebräischen Buchstaben, die ich in erleuchteten Nächten auf die Tischplatte geritzt habe, damit sich meine Blicke an ihnen festsaugen, an den heiligen Zeichen untrüglicher Sicherheit und leuchtender Wahrheit.
Und auf dem Tischteppich meine Bücher, Folianten in den Sprachen der Welt, deren heiligste das Hebräisch ist, Mutter und Wurzel des Griechischen und Lateinischen. Ich kenne jeden Buchstaben dieser Bücher im schweinsledernen Kleid, besser noch als den Anblick der Dinge in meinem Zimmer, die mir heute so neu erscheinen. Ich habe mir nie die Zeit genommen, sie den Weg durch das Auge in mein Herz finden zu lassen, denn dort will ich nur beständige und sichere Werte aufbewahren.
Sind aber Tische und Stühle, Fenstervorhänge und Bücherpulte beständig? Sie sind da, weil sie gebraucht werden, weil sie benutzt werden müssen. Wo sollte ich sonst arbeiten, wenn nicht an einem starken Tisch, wo sollte ich sitzen, wenn nicht auf einem Stuhl, wie sollte ich mich vor neugierigen Blicken schützen, wenn nicht durch Fenstervorhänge, und wo schließlich sollte ich meine Bücher aufbewahren, wenn nicht in Pulten und Regalen?
Alle diese Gedanken sind selbstverständlich, und ich bin sehr verwundert, dass sie sich mir heute aufdrängen wie Fragezeichen und mich von der Betrachtung des Ewigen - gelobt sei Er! - abhalten. Aber dennoch - ich will diesen Fragezeichen nicht aus dem Wege gehen, vielleicht gönnt mir der Ewige - gelobt sei Er! - das Geschenk der Illusion, die Dinge seien dauerhaft und mehr als bloßes Zweckgerät.
So wie auf jenem Bild, das ich früher bei meinem Sohn sah (nicht auf dem Bild, das mir gestern neue Erkenntnisse aufzwang), es drängt mich, sie aufzuschreiben, aber ich muss mit meinen Gedanken etwas zurückgehen - jenes ziemlich kleine Bild also, das nicht mit Farben gemalt, sondern in Kupfer gestochen war wie in meiner Druckerei die Verzierungen. Ich blickte in einen Raum, ähnlich dem, in dem ich hier sitze, etwas altertümlicher wohl, denn der Stich sei immerhin über hundert Jahre alt, sagte mein Sohn, der es wissen muss, wegen der Preise …
Auch dort sitzt jemand an einem Tisch und schreibt in ein Buch, ein Erleuchteter, auf dessen Haupt sich das Licht niedergelassen hat, und was für ein Haupt! Aber darf man so etwas darstellen? Das Bild des Ewigen - gelobt sei Er! - allen Blicken preisgegeben? Man muss es verbergen, wie die heiligen Rollen im dunklen Thora-Schrein, weil die heilige Thora, das Gesetz des Ewigen - gelobt sei Er! - das einzige Unwandelbare und Dauerhafte ist.
Aber ich will den Erleuchteten in seinem Zimmer gelten lassen, weil ich an seine Erleuchtung glaube. Das andere, das da vor ihm in einiger Entfernung auf dem Tisch stand, habe ich freilich nicht beachtet, diesen Gesetzesübertreter am Kreuz, ehemals ein Sohn Israels wie ich, nunmehr Rechtfertigung für den Tod Tausender Glieder am Stamme Judas … Nur nicht daran denken! Ich wollte ja auch über diesen Raum schreiben, der mir jetzt wieder so deutlich vor Augen steht, der meinem Raum hier so eindringlich gleicht - warum nur?
Sollte mein neuer Schüler recht haben, dieser kleine, zierliche Baruch de Spinoza, der nach seinem ersten Besuch bei mir sagte: „Ich werde wiederkommen, Rabbi, wenn es geht, morgen schon!”
Ich sah ihn verwundert an, denn es schien mir selbstverständlich, dass er wiederkäme, sollte ich ihn doch in der heiligen Thora unterrichten. „Natürlich wirst du wiederkommen, Baruch, denn du sollst lernen! Hinter deiner Stirn ist viel Raum! Gut, komm morgen.”
Ich traute meinen Ohren nicht - er widersprach.
„Nein, ich will nicht nur lernen. Ich will auch lernen, Rabbi, aber nicht nur ... Ich will wiederkommen, denn in Eurem Raume lebt das Licht. Ich will mitleben.”
Dabei sah er mich sehr ernsthaft an aus seinen schwarzen, mandelförmigen Augen, herausfordernd, auf eine Entgegnung wartend, aber doch in aller Bescheidenheit. Ich schwieg, denn diese Erfahrung hatte ich noch nicht gemacht, und es ist gut, nach einer neuen Erfahrung einige Zeit zu schweigen, damit sie einen ruhigen Platz im Herzen findet.
Darum habe ich auch die ganze vergangene Nacht geschwiegen, nach der großen Erfahrung von gestern. Ich hatte es oft und oft erlebt, dass mir Schüler Fragen stellten, kluge und weniger kluge, keinem war ich bisher eine Antwort schuldig geblieben, auch wenn ich sie manchmal erst am nächsten Tag nach einer durchwachten Nacht sagen konnte. Niemals aber war es mir begegnet, dass ein Schüler mit einer fertigen Aussage vor mich hintrat und dazu noch bei der ersten Begegnung.
Bei Euch lebt das Licht … Woher kam ihm diese Erkenntnis? Keinesfalls hatte er sie sich erarbeitet, erbetet, sie war einfach da, wie - ja, wie eben das Licht selbst. Heute weiß ich, Baruch de Spinoza, ein Kind von zehn Jahren und noch nicht zum Dienst an der Thora berechtigt, hat recht. Hier lebt das Licht, es lebt so wie auf jenem Blatt mit dem Erleuchteten, es lebt und verleiht Leben den Dingen, auf die es fällt.
Darum werde ich meine Vorhänge aufziehen, damit sich das Licht nicht durch den dicken Stoff mühsam hindurch quälen muss, sondern mit ungebrochener Kraft die Dinge in meinem Zimmer umklammert und sie damit - ewig macht? Unvergänglich und wesentlich? Lauter Fragezeichen? Aber jenes Blatt ist schon über hundert Jahre alt, und das ist schon ein wenig länger, als ein Menschenleben währt.
Auch dort fiel das Licht ungebrochen durch die hohen Fenster und malte dabei das Muster der runden Butzenscheiben an die Fensterleibung, so wie es mittags mitunter bei mir aussieht, wenn ich von einem kurzen Schläfchen erwache, unvollkommener Ersatz für schmerzlich durchschwiegene Nachtstunden. Vorne im Bild waren zwei Schläfer zu sehen. Waren es nicht Tiere? Ja richtig, ein mächtiger Löwe, auch im tiefen Schlaf noch ein Symbol ungebrochener Kraft, ein wahrer Löwe aus dem Stamme Juda - und das besänftigte meinen Unmut über den gekreuzigten Gotteslästerer -, daneben zusammengerollt ein Fuchs, auch er im tiefen Schlaf. Der Mann am Tisch aber war tätig und überzeugt vom Sinn seiner Tätigkeit. Keinen Luxus gab es in diesem Zimmer, nur Licht und Geist.
Eigentlich hat mir das Blatt doch ganz gut gefallen, aber, das werde ich meinem Sohn nicht sagen dürfen, es würde meine Autorität untergraben. Ein gewisser Albrecht Dürer hat das Blatt geschaffen und es „Hieronymus im Gehäuse” genannt.
Genug mit den Abschweifungen. Ich will es festhalten: DAS LICHT VERLEIHT DEN DINGEN LEBEN. Davon will ich jetzt ausgehen. Es werde Licht! So rief der Ewige - gelobt sei Er! - die Welt ins Leben. Nun gut, das ist Sicherheit. Ich will meine gestrigen Erfahrungen niederschreiben. Eine Nacht lang habe ich geschwiegen. Mit dieser Nachtwache habe ich das Recht erworben, meine Erfahrung festzuhalten.
Seit langem habe ich nicht mehr geschrieben, viel Wasser wird fließen, wenn ich die Schleusen öffne, und ich muss achtgeben, dass es nicht nutzlos versickert, sondern eine Mühle treibt, solch eine, wie man sie zu Hunderten sieht, wenn man über Land fährt, über das schöne und reiche Land Holland, in dem man uns nicht nach dem Leben trachtet, uns, den Juden von der Portugiesischen Synagoge.
Hier brauchen wir uns nicht ängstlich zu verbergen, im Gegenteil, von den meisten angesehenen Bürgern werden wir geachtet, manchmal scheinen sie unsere Gesellschaft zu suchen. Etwas Ähnliches vermutete ich gestern, als mein Sohn, Mordechai ben Manasse, zur mir kam und sagte: „Vater, du bist zu wenig unter Menschen. Deine Augen sind gezeichnet von vielen Nachtwachen, es ist nicht gut, wenn die Augen zu viel Schatten durchdringen müssen, besser wäre es, wenn du die Schatten verjagen ließest, und ich weiß wohl, wer das könnte ...”
Ich aber widersprach und sagte: „Falls du einen von deinen Malerfreunden meinst - dann irrst du dich. Sollen sie malen, wenn sie damit ihr Geld verdienen, sollst du mit ihnen umgehen, wenn du an ihnen dein Geld verdienst, ich aber schätze sie nicht und auch nicht, was sie treiben. Sie würden meine Schatten noch schwärzer machen. Und nichts gegen meine Nachtwachen. Sind sie doch Stunden der Erleuchtung.”
Mein Sohn lächelte, und dabei hatte ich befürchtet, er werde ungehalten sein über meine Ablehnung.
„Du hast recht Vater! Allein die Stunden der Erleuchtung machen das Leben lebenswert, und wenn du meinem Rat folgst, soll dir eine Erleuchtung vermittelt werden, die ihresgleichen sucht. Es soll niemand dabei sein als du und ich. Du sollst etwas schauen, was du bislang nicht gesehen hast. Heute Abend, wenn du magst."
Ich wurde neugierig, zeigte aber immer noch Widerstand. „Der Augenschein trügt, Mordechai. Wichtig allein ist das innere Licht."
„Und wenn das innere Licht den Weg des Augenscheines gehen könnte? Wenn du das innere Licht mit deinen Augen wahrnehmen könntest?”
„Wie soll das geschehen?", fragte ich. Mordechai war so seltsam. Das Wort vom inneren Licht hatte ich noch nie aus seinem Munde gehört, und mit welcher Bestimmtheit sprach er es aus! So sprach er sonst nur von hohen Preisen und sicheren Käufern. Er ist ein guter Kaufmann und reicher als ich, der ich nur von meiner Druckerei lebe. Für Buchstaben aber zahlt man weniger als für Bilder.
„Wie soll das geschehen?", fragte ich noch einmal. Mordechai schwieg, und wieder wunderte ich mich. Niemals blieb er eine Antwort schuldig. Er schwieg, nicht, weil er keine Antwort wusste, das merkte ich ihm an, sondern weil seine Antwort nicht mit Worten zu geben war. Da entschloss ich mich, ihm zu folgen, und ich weiß noch nicht, ob ich diesen Gang bereuen oder bejubeln soll.
Mordechai holte mich abends aus diesem meinem Studierzimmer ab. Ich verließ es ungern, denn die Dinge begannen gerade, ihre scharfen Umrisse zu verlieren und sich in unbegrenzte Weiten zu öffnen. Sie verloren ihre Form und setzten meinen Blicken keinerlei Widerstand mehr entgegen. Diese Dämmer - und Nachtstunden sind mir die liebsten.
„Komm, Vater!”, sagte Mordechai leise. Wie ähnlich er mir sieht! dachte ich und war stolz auf meinen Erstgeborenen. Mit spanischer Eleganz und Grandezza stand er in der Tür, sein lose über die Schulter geworfener Mantel flatterte ein wenig im Zugwind, der aus dem Hausflur kam. Ein schwarzer Mantel, ein schwarzer, weicher Schlapphut, ein wohlgeformter schwarzer Bart (um den ihn übrigens viele Männer beneiden!), ein schwarzes Wams, schwarze Kniehose mit schwarzen Schleifen, schwarze Strümpfe, eine schwarze Silhouette im Türrahmen. Nur der Kragen leuchtete weiß, alles andere war schwarz, ernst und streng.
In der Rechten trug er zwei Laternen, in der Linken einen Schlüssel.
„Vertraue mir und komm", sagte er, „du wirst es nicht bereuen.”
Ich nickte, und wir gingen die Treppe hinunter. Erstaunt blickte meine Frau Rebekka aus dem Frauengemach.
„Wo wollt ihr hin? Zu so später Stunde?”
„Nicht fragen, Mutter!", sagte Mordechai. ”Wir werden bald zurückkehren.”
Schwer fiel die Eichentür ins Schloss, und wir standen auf der stillen Straße. Ich nahm eine der Laternen und folgte meinem Sohn Mordechai. An den Haustüren der reichen, breiten Häuser leuchteten Lampen hinter Glas. Manche wurden vom Winde geschaukelt, und dann schien das ganze Haus zu schwanken mit allen seinen weißgestrichenen Fensterrahmen und seinem bunt verzierten Giebel.
Seit langem war ich nicht am späten Abend auf der. Straße gewesen. Der Himmel war sternenklar, doch die enge Straße bot einen zu schmalen Aufblick, als dass ich die Konstellation der Sterne hätte überschauen können. Aber das störte mich nicht, ich hatte sie ohnehin im Kopf, beobachtete ich sie doch jeden Abend von meinem Garten aus.
Mordechai bog in eine Seitenstraße, in der nur verlassene Häuser, Speicher und Schuppen standen. Sprach man nicht davon, dass hier Gesindel sein Unwesen trieb? Wohin wollte Mordechai? Er blieb vor einer schwarzen Häuserfassade stehen, hielt die Laterne dicht ans Schlüsselloch und Schloss auf. Das Geräusch des Schlüssels rief einen Widerhall im Inneren hervor. Mordechai öffnete die Tür, und die Angeln quietschten. Er ging voran, und wir traten in eine mit Steinen gepflasterte, dem Anschein nach ziemlich große Diele, von der aus eine breite Treppe nach oben führte.
Mordechai bot mir seinen Arm, und wir stiegen die Treppe empor. Wir betraten einen Raum, der so groß war, dass der Schein unserer Laternen die Wände nicht erreichen konnte. Mordechai kannte sich hier aus. Er wusste, dass in diesem Saal Laternen standen und hingen, und er entzündete eine nach der anderen, so dass bald eine nahezu festliche Illumination den Raum erhellte, der wirklich außerordentlich groß und völlig leer war.
„Nun?”, fragte ich.
Mordechai wies mit der Hand auf die den Fenstern gegenüberliegende Wand. Ich blickte gespannt hin, konnte aber nichts sehen als eine Leiter und ein Tuch, das über ein großes Gestell gespannt war. Mordechai stellte seine Laterne zu Boden und begann vorsichtig, das Tuch von dem Gestell zu entfernen. Ein Bild kam zum Vorschein. Ich wurde böse auf Mordechai und sagte erregt: „Wegen eines Bildes lockst du mich von meinen Büchern und meinen Nachtgedanken hinweg und sprichst davon, ich müsse einmal in Gesellschaft, gehen? Wäre ich dir doch nicht gefolgt, Mordechai!”
Mordechai antwortete nicht, ich wollte es ihm auch nicht geraten haben! Wie ein Schatzgräber leuchtete er mit seiner Laterne die Fläche des Bildes ab, das an der Wand lehnte und sie fast ausfüllte. Im Lichterschein wurden Menschengestalten sichtbar, ausgerechnet Menschengestalten! Um ich vor ihrer Magie zu schützen, sagte ich mit feierlicher Stimme das uralte Gebot unseres Glaubens: „Du sollst dir kein Bild machen … Auch du nicht, Mordechai!”, fügte ich hart hinzu.
Mordechai aber fuhr fort, mit seiner Laterne die Bildfläche abzutasten. Dann murmelte er: „Dies ist kein Bild eines Menschen, der da ist, dies ist etwas Neues, etwas unerhört Neues …”
Seine Laterne fixierte zwei Gestalten am vorderen unteren Bildrand, deren Füße auf derselben Ebene wie die unseren zu stehen schienen, sie kamen auf Mordechai zu, und der größere von ihnen sah ihn fragend an, ein stattlicher Mann mit Schlapphut, Samtanzug, weißer Halskrause und roter Schärpe.
So sehr ich mich bemühte, meinen Blick von diesem Götzenwerk abzuwenden, ich vermochte es nicht, warum nur nicht? Ich meinte, diesen Mann zu kennen, war aber wiederum unsicher, ob und woher. Meine Gedanken gingen langsam. Dann aber fanden sie einen festen Punkt. War es nicht in einem Wirtshaus gewesen? Da ich außerordentlich selten in ein Wirtshaus ging, fiel es mir nun nicht weiter schwer, meinen Erinnerungen auf die richtige Spur zu helfen.
Ein durchreisender Freund hatte mich um eine Unterredung gebeten. Er war ins Elend geraten und bat mich um Geld. Da er nicht wagte, in mein Haus zu kommen, bat er mich inständig, ihn in seiner Herberge aufzusuchen. Sie befand sich in einem üblen Wirtshaus, und ich zögerte, meinen Fuß über die ausgetretene Schwelle zu setzen. Aus dem Essen- und Tabakdunst kam mir aufreizender Lärm entgegen: Kreischen, anscheinend aus weiblichen Kehlen, Gläserklirren, das unverkennbare Geräusch des Rommelpots, das heisere Keifen der Violinen und das dumpfe Brummen des Basses.
Ich dachte an mein Studierzimmer und seufzte, dann aber hatte sich mein Auge an den Dunst gewöhnt, und ich sah meinen Freund an einem rohen Holztisch in das halb geleerte Bierglas blickend, sorgenvoll den Kopf in die Hand gestützt. Ich trat an seinen Tisch; begrüßte ihn und sagte: „Mach es kurz, oder lass uns in ein anderes Gasthaus gehen."
Er blickte mich traurig an und sagte mit schwerer Zunge: „Ich kann nicht ... Ich habe hier so viele Schulden, dass ich das Haus nicht verlassen darf."
„Wie viel?", fragte ich zurück. Er nannte eine beträchtliche Summe. Ich zog meinen Geldbeutel und zählte ihm diese Summe und noch etwas darüber hinaus auf den Tisch. Ängstlich blickte er sich um, steckte das Geld ein und bat mich, Platz zu nehmen.
„Hier?”, fragte ich. Der Lärm schwoll an. Ein betrunkener Mann hatte Streit mit den Musikanten angefangen.
„Trauermusik spielt ihr und keine Tanzlieder! Wir werden gleich alle einschlafen! Und das für mein Geld! Ich will euch lehren!”
Er riss dem einen den krummen Fiedelbogen aus der Hand und fuchtelte damit wild in der Luft herum, dass es pfiff. Dann zog er ihm den Bogen wie eine Schlinge über den Kopf und begann, ihn zu würgen. Die Umstehenden kreischten vor Vergnügen. Der Musikant zappelte mit den Händen und wurde blau im Gesicht.
„Du lächerlicher Traumspieler du, ich will dir zeigen, wie man richtige Musik macht!", schrie der Betrunkene. Endlich trat ein Beherzter dazwischen und warf ihn zu Boden. Der Musikant zog mit letzter Kraft den zerbrochenen Bogen über seinen Kopf und entfernte sich eilig. Der Trunkene versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Vergeblich. Sein schöner schwarzer Samtanzug wurde staubig und unansehnlich. Angewidert schloss ich die Augen. Wer mochte das sein? Im Wirtshaus erhob sich leises Murren.
„Die reichen Herren", hörte ich, „die dürfen sich alles erlauben!”
Jetzt weiß ich, wer es war: dieser Mann hier, den ich vorne auf dem Bilde sah, der so ernst und weise aussah und so konzentriert und gelassen dastand.
„Wer ist das?", fragte ich Mordechai. „Banning Cocq, Hauptmann der Cloveniersschützen zu Amsterdam.“
„Aha”, sagte ich und musste wieder an das Wirtshaus zurückdenken. Jener betrunkene Mann, der sich auf dem besudelten Fußboden herumgewälzt hatte, war also Banning Cocq, ein angesehener Bürger und Träger eines wichtigen Stadtamtes, Hauptmann einer reichen und ehrbaren Schützenvereinigung. Der Anblick hatte mich so angewidert, dass ich meinen Freund mit aller Überredungskunst zum Mitkommen bewegte und den üblen Ort verlassen konnte.
Ich habe ihm dann noch mehr Geld gegeben und ihn zu einem ehrbaren Leben ermahnt, ohne Bier und Wein, ohne Wirtshäuser und liederliche Gesellschaft. Er hörte mir lächelnd zu, ich aber schwieg nicht zu diesem überlegenen Lächeln, denn Freund ist Freund. Man muss ihm bittere Worte sagen können.
Seltsam aber, dass mich der Anblick dieses Mannes auf dem Bild nicht mit Bitterkeit erfüllte, sondern mit einem rätselhaften Gefühl, gemischt aus Achtung, Vertrauen, ja Freundschaft. Mordechai drehte sich um und leuchtete mir ins Gesicht.
„Du schaust dir ja das Bild an! Warum, Vater?”
Ja, warum? Niemals zuvor hatte ich so lange vor menschlichen Bildern verweilt, sondern schnell die Augen niedergeschlagen. Du sollst dir kein Bild machen! Unsere Religion ist bilderlos. Wichtig allein ist der Buchstabe, der Begriff, die Vorstellung, die Erinnerung. Aber war dies überhaupt noch ein Bild, ein Abbild, die Wiederholung eines wirklichen Menschen? Zweifellos nicht, denn dies war nicht Banning Cocq, wie er in Wirklichkeit war, sondern wie er hätte sein können, wenn er den Weg gegangen wäre, der für ihn erleuchtet worden war.
Wer hatte diese Erleuchtung herausgefunden? Wer hatte gewusst, dass Weisheit und Güte diesem Manne hätte ebenso zu eigen sein können wie die Grausamkeit, die er im Wirtshaus zeigte? Würde Banning Cocq diesem stummen gemalten Vorwurf widerstehen können? Würde er sich nicht schämen müssen? Mordechai schien meine Fragen zu erraten.
„Nun Vater? Ist dies nicht vielmehr ein Vorbild als ein Bild?" Ich nickte.
Draußen lärmte es. Wir erschraken. Wer konnte das sein? Diebe? Einbrecher? Mörder? Mordechai hatte unten die Tür offengelassen. Das war leichtsinnig. Wen sollten wir hier zur Hilfe rufen? Die Häuser nebenan waren ebenso wenig bewohnt wie das, in dem wir uns befanden. Doch unsere Angst war unbegründet. Ein kleiner Mann kam hereingestürzt, ganz außer Atem.
„Ich komme gerade von einer Reise zurück und höre, das Bild soll fertig sein. Ich habe das meiste Geld dafür bezahlt, und nun sehe ich es zuletzt. Ich bin noch gar nicht in meinem Hause gewesen, das ist vielleicht auch gut, denn dort werden sie mir gleich mein ganzes Geld abnehmen, den Gewinn meiner Reise! Ich bin gleich hierher geeilt, und von draußen sah ich Licht im oberen Saal, welch ein Glück, nicht wahr!? Ich dachte, es wäre einer von meinen Schützenbrüdern, und dabei seid Ihr es nur, Mijnheer Mordechai, oder soll ich sagen Senor Mordechai, weil Ihr doch immer so spanisch tut! Wie dem auch sein möge - wo ist das Bild, mein Bild? Ihr müsst nämlich wissen: es ist das erste Mal, dass ich mich porträtieren ließ, früher konnte ich es mir nicht leisten, da war ich noch ein armer Schlucker, erst seitdem ich zum Gewürzhandel überwechselte, bin ich zu Geld gekommen …"
Unversiegbar floss der Redestrom weiter. Als ich mich an sein Plätschern gewöhnt hatte, gewann ich Zeit, mir den Mann genauer anzusehen, der mit klirrenden Sporen die Treppe herauf gepoltert war und nun den Lärm auf andere Art hier oben fortsetzte. Ich wurde unwillig, denn ich konnte es nicht verstehen, dass man diese schöne stille Abendstunde, nach der ich mich sonst den ganzen Tag sehnte, so entweihen konnte.
Klein war der Mann, das hatte ich gleich bemerkt, klein und nervös und fahrig. Obgleich es ziemlich dunkel war, konnte ich erkennen, dass er es nicht vermochte, auch nur einen Augenblick lang stillzustehen, seine Hände und Füße in Ruhe zu halten, sein Auge auf einen Punkt zu richten. Es schweifte bald hierhin, bald dorthin, wie ein kleiner Vogel, dessen Bewegungen uns manchmal ebenso unberechenbar erscheinen. Als der Mann sah, dass ich ihn beobachtete, warf er sich in die Brust, rollte mit den Augen, verbeugte sich dann pathetisch und sagte:
„Gestattet, dass ich mich vorstelle! Ich bin der Leutnant der Cloveniersschützen, mein Name ist Ruytenburch, Ihr werdet von mir gehört haben … Doch wer seid Ihr? Ich kenne Euch nicht.“
Mein Sohn antwortete: „Der Mann ist mein Vater, der Gelehrte Manasse ben Israel; dem die Druckerei gehört, wisst Ihr …”
„Nein, ich weiß nicht, denn ich spekuliere nicht in Büchern, sondern in Gewürzen."
„Seine Bücher sind auch nicht zum Spekulieren da, sondern zum Lesen, wenn ich das noch hinzufügen darf, Mijnheer Leutnant Ruytenburch”, entgegnete mein Sohn.
„Ich lese nur Börsenzahlen, das heißt, ich lasse sie von meinem Diener vorlesen”, sagte der kleine Mann mit zu viel Nachdruck, „aber wo ist das Bild? Ich möchte mein Bild sehen!”
„Hier!”, sagte mein Sohn und leuchtete mit seiner Laterne auf den Mann, der neben dem Hauptmann Banning Cocq stand.
Langsam umgriff der Lichtschein die Gestalt eines kleinen Mannes, der in leuchtendes Gold gekleidet zu sein schien. Aber ach - das Gold war zu gelb, von jenem aufdringlichen Gelb, das die Dirnen zu tragen verdammt sind und in manchen Ländern leider - dem Ewigen sei es geklagt! - auch die Juden. Eine hässliche Farbe, hässlich wie das Goldene Kalb, das unsere Väter - dem Ewigen sei es geklagt! - in der Wüste anbeteten. Ein gelber Anzug, ein gelber Hut, gelbe Stulpenstiefel, gelbe Handschuhe, woher gab es nur so viel Gelb? Auch das Gesicht des Mannes schimmerte gelblich, vor Neid und Geiz?
So stand er da, schien aber soeben erst aus dem Hintergrund an den Hauptmann herangetreten zu sein, so groß war sein Schritt. Und nun begann wieder die kreischende, schrille Stimme des Mannes, der soeben von einer weiten Reise gekommen war, in den stillen Raum hinein zu tönen:
„Eine unerhörte Frechheit ist das! Unerhört! Ich werde sofort zu diesem unverschämten Burschen gehen! Was eigentlich bildet er sich ein? Wofür hält er mich!”
Ich sah mich genötigt einzugreifen.
„Beruhigt Euch, Mijnheer Ruytenburch, wozu dieser Lärm! Diebe und Gesindel werdet Ihr mit Eurem Geschrei herbeilocken, das flatternde Gelichter der Nacht. Weshalb regt Ihr Euch so auf?”
„Soll ich mich da nicht aufregen? Habe ich nicht das Doppelte der vereinbarten Summe gezahlt, damit der Maler mich ein wenig größer malt, als ich leider nur gewachsen bin? Die doppelte Summe, sage ich Euch, und in lauter harten, sauer verdienten Gulden. Ich habe sie auf den Tisch gezählt und geseufzt, denn wer seufzt nicht, wenn er Abschied von dem schönen blanken Geld nehmen muss? Zumal wenn es einen so nutzlosen Weg antritt? Und nun hat der Bursche mich glatt betrogen! Keinen Zoll hat er meiner Körpergröße hinzugefügt, sehe ich neben Banning Cocq nicht wie ein Zwerg aus? Und mein schöner neuer Anzug - er ist ganz anders gelb - und warum sieht man mein Gesicht nicht von vorn wie das des Banning Cocq, bin ich etwa schlechter als er? Habe ich nicht ebenso viel Geld wie er, seit ich in den Gewürzhandel überwechselte? Bin ich nicht deshalb Leutnant bei den Cloveniersschützen geworden? Was aber hat man aus mir gemacht! Den Hofnarren des großen Banning Cocq! Und wie halte ich eigentlich die Hellebarde! Wie eine Schreibfeder! Ich weiß, wie man diese Waffen hält, aufrecht, mit der Spitze nach oben. So habe ich doch auch immer gestanden, wenn der Bursche uns gemalt hat. Das ist Betrug, glatter Betrug! Ich werde mein Geld zurückfordern, jedenfalls die Hälfte, denn wie die Ware, so das Geld. Und diese Ware ist zweifellos schlecht. Weshalb hat er mein Gesicht von der Seite gemalt? Bin ich schlechter als Banning Cocq, der ein Froschgesicht hat? Auf Grund dieses Bildes werden mich meine Schützenbrüder nie zum Hauptmann der Cloveniersschützen wählen. Er weiß ja nicht einmal, wie man eine Hellebarde anfasst, werden sie sagen. Dabei habe ich es mühsam gelernt und viel Geld dafür bezahlt.”
So schimpfte er ohne Unterbrechung weiter. Wütend stand er vor seinem eigenen Bild. Ich aber fand trotz des Lärms zu meiner inneren Stille zurück und dachte wieder über den Satz nach: „Du sollst dir kein Bild machen …"
Plötzlich erschien er mir in einem ganz anderen Licht, in einer anderen Bedeutung. Dieser Mann da hatte sich offensichtlich ein Bild von sich selbst gemacht. Er sah sich groß, stattlich, reich, waffengewandt, verehrungswürdig. Dann aber war ein anderer gekommen und hatte ein Bild von ihm gemacht, und dies Bild sah so ganz anders aus. Das Bild eines schnell reich gewordenen Krämers, eines eitlen Pfaus, der dem Golde nachjagt. Ich glaubte sicher sein zu können, dass nur das zweite Bild der Wirklichkeit entsprach. Welch ein unangenehmer Mensch! Nun war er mir doppelt unangenehm, weil er gegen sich selbst nicht ehrlich sein wollte. Ja, ja, dachte ich, du sollst dir kein Bild machen ...
Dann aber erschrak ich, denn dieses Wort war ja ganz anders gemeint, und an der heiligen Thora soll man nicht deuteln und spekulieren! Sie bezeichnet das Bild an sich als verwerflich und götzendienerisch, und nun finde ich mich, Manasse ben Israel von der Portugiesischen Synagoge, hier vor der großen Leinwand, auf der nur Menschen dargestellt sind.
Schon wollte ich mich zum Gehen wenden. Da fielen mir wieder Mordechais Worte ein: „Dies ist kein Bild eines Menschen, der da ist, dies ist etwas Neues, etwas unerhört Neues …"
Kein Bild, kein Abbild, kein Goldenes Kalb, um das man tanzen könnte, nein, in diesem Bild fand ich etwas von der Stille meines Studierzimmers wieder, in der einem plötzlich bewusst wird, wie man selber ist. Und hier wurde mir bewusst, wie andere sind, wie sie sein könnten, wenn - ja, wenn auch sie vielleicht manchmal in der Stille lebten; Mordechai hatte recht, dies war kein Bild, so wie die anderen, die er durch seine Hände gehen ließ wie Ware.
Ich fand den Mut, mir nun auch die anderen Gestalten anzusehen - der Ewige wird es mir verzeihen - gelobt sei Er! -, und was ich dort sah, war seltsam genug. Aus dem dunklen Hintergrund wogte und brodelte es heran, laut und lärmend und doch unhörbar. Da klirrten die langen Spieße aneinander, da schnappten Gewehrschlösser; da knisterte die seidene Fahne in der Rechten des Fähnrichs, da wurden Gespräche geflüstert und all das untermalt von einem dumpfen Trommelwirbel.
„Sind das die übrigen Cloveniersschützen?”, fragte ich den kleinen Mann, der endlich einmal schwieg.
„Nein, Mijnheer Rabbiner, oder was immer Ihr seid - das sind sie nicht, bei Gott nicht, dies ist ein Haufe von Landsknechten aus den früheren Kriegen, so, wie sie sich jetzt durch Europa wälzen, ich habe davon erzählen hören - niederster Pöbel, der sich für Geld verkauft, mit unserer ehrsamen Schützengilde haben diese Gestalten nicht das Geringste zu tun. Sieht dies nicht aus wie ein Aufbruch aus der Kaiserlichen Feldlager? Dabei sind wir friedliche Leute, wir kommen gern zusammen und trinken miteinander einen Becher Wein, wenn es sein muss, auch mehrere, aber was haben wir mit gewöhnlichem Kriegsvolk zu tun?”
„Aber seid Ihr nicht verpflichtet, die Stadt zu schützen und zu verteidigen, wenn Gefahr vom Feind droht?”, fragte ich.
„So kann nur ein Jude reden, der keine Waffe in die Hand nimmt!", zeterte der kleine Mann. „Wenn der Feind kommt - aber woher soll er schon kommen -, dann werden wir uns natürlich auch Söldner mieten, denn das Geld haben wir dazu, oder meint Ihr, ich werde mit meinem schönen gelben Gewand in den Krieg ziehen?”
Ich musste lächeln, als ich mir diesen Anblick vorstellte.
„Nein, das glaube ich nicht, Ihr würdet eine zu deutliche Zielscheibe für die feindlichen Scharfschützen abgeben, es wäre schade um Euch!"
Ob der Maler die Cloveniersschützen hat so sehen wollen: zum Aufbruch bereit, die Waffen in der Hand? Dann hatte er sich wiederum ein anderes Bild gemacht, als sie es sich von sich selbst machten.
„Was habt Ihr eigentlich mit diesem Bild zu schaffen?”, fragte der kleine Mann misstrauisch. „Ihr habt mit uns doch nichts zu tun - und auch mit diesem Bild nicht. Also was tut Ihr hier und dazu bei Nacht?”
„In der Nacht wandelt die Stille umher. Die Nacht gibt Antwort auf manche Fragen, die der Tag nicht weiß. Ich habe soeben eine solche Antwort bekommen. Sie lautet: Du sollst dir kein Bild machen, nach dem du mit jeder Faser deines Wesens im Recht bist. Du darfst dir aber ein Bild machen lassen von einem, der dich besser kennt, als du dich selbst kennst. Und du sollst dich nach diesem Bilde richten und - anders werden. Seht Ihr, Leutnant Ruytenburch, das wollte ich gerne erfahren. Deshalb bin ich mit meinem Sohn hierhergekommen und - wie Ihr seht - mit Erfolg!"
Erstaunt maß mich der kleine Leutnant von Kopf bis Fuß. Ich sah jetzt, wie er ohne seine Gewürzhändlermaske aussah: ein kleiner, hilfloser Mann, der verlegen den Dingen gegenüberstand, die ihm fremd und unverständlich waren. Aber er hatte leider schon zu viel an den teuren Gewürzen gerochen, und sein Gesicht konnte nicht lange ehrlich bleiben.
Als er merkte, dass ich ein wenig lächelte, versuchte er krampfhaft, überlegen auszusehen.
„Ich gehöre nicht zur Sorte der Philosophen und Büchermenschen", sagte er, „sondern beschäftige mich mit wichtigeren Dingen. Gutes Geld für gute Ware! Ich habe dem Maler soundsoviel Geld bezahlt (die Summe nannte er nicht), und ich habe ein Recht, zu fordern, dass ich gemalt werde, wie es meiner Würde und meinem Reichtum entspricht. Denn die Cloveniersschützen sind die reichste Schützengilde in Amsterdam. Dies Bild ist für den großen Bankettsaal unseres Schützenhauses bestimmt. Dort hängen wertvolle flandrische Teppiche, silberne Leuchter ragen aus den Wänden, in den Vitrinen stehen die wertvollsten Schaupokale. Dort halten wir unsere Konvente, bei denen es die besten Weine, die teuersten Speisen und die ausgesuchtesten Delikatessen gibt. Wir freuen uns des Friedens und unseres Reichtums. Und nun soll dieses Bild im Hintergrund hängen, im Hintergrund unserer Mahlzeiten? Es wird stören und Unruhe bringen. Wir werden uns immer wie vor einem Aufbruch fühlen. Das Essen wird uns nicht mehr schmecken, und der Wein wird uns traurig machen. Wir wollen Ruhe und Sicherheit - hört Ihr? Sicherheit! Hätte er uns bei der Mahlzeit dargestellt oder in Reih und Glied bei einem Aufmarsch! Aber so? Jeder Aufbruch kann der letzte sein!“
„Da habt Ihr recht, Mijnheer, jeder Aufbruch kann der letzte sein, jede Mahlzeit kann die letzte sein … Ihr tut gut daran, darüber nachzudenken.”
„Ich will nicht darüber nachdenken! Ich will mich meines Lebens freuen und Geld verdienen.”
Der kleine Mann war unsicher geworden, wie mir schien. Seine Überlegenheit hatte er selbst zerstört.
Ich sagte: „Seht Ihr, deshalb gefällt Euch Eure Gestalt auf dem Bilde nicht; sie passt nicht zum Aufbruch! Ihr steht da wie festgewachsen. Ihr müsst aufbrechen, Mijnheer Ruytenburch.”
Er sah mich erschrocken an.
„Ihr habt recht! Meine Frau und meine Kinder werden schon auf mich warten. Das dumme Bild soll sie nicht ängstigen.”
Und schon polterte er mit seinen sporenbeschlagenen Stiefeln die Treppe hinunter; und wir hörten die Tür mit einem harten Krach ins Schloss fallen.
Lächelnd hatte Mordechai die Szene beobachtet, ohne sich am Gespräch zu beteiligen. Ich wusste, warum er lächelte. Siehst du, Vater … Zwischen Bild und Bild ist ein Unterschied. Man merkt es an der Wirkung.
„Komm, Mordechai", sagte ich. „Wir wollen das Bild wieder bedecken. Wir wollen seine Ausstrahlungen zurückhalten, damit sie nicht in einen leeren Raum fallen, ohne Gegenüber."
Sorgsam breiteten wir das große Tuch wieder über das Bild, wir verhüllten es, wie man die Thora-Rolle, verhüllt. Der Ewige - gelobt sei Er! - möge mir diesen Vergleich vergeben! Aber er ist richtig.
Dann löschten wir die Laternen in dem großen Saal, Mordechai bot mir wieder seinen Arm, und wir stiegen leise die Treppe hinunter. Schweigend gingen wir durch die dunklen Straßen bis in unser Haus. Meine Frau Rebekka wartete noch.
„Was ist? Wo wart ihr? Ihr seht so eigenartig aus. Ist etwas geschehen?"
„Ja,", antwortete ich; „du sollst dir ein Bild machen lassen von einem, der dich besser kennt, als du dich selbst kennst!"
Rebekka schüttelte den Kopf.
„Manasse, hast du Fieber?"
„Nein; ich habe kein Fieber: Ich habe etwas gesehen."
Dann ging ich in mein Studierzimmer, Mordechai folgte. Nie fühlte ich mich mit meinem ältesten Sohn enger verbunden als in dieser Nacht. Wir saßen bis zum. Morgen zusammen, und unsere Gespräche kreisten immer um das eine Thema: Du sollst dir kein Bild machen … Du sollst dir ein Bild machen.
Und nun sitze ich noch immer in meinem Zimmer. Mordechai ist wieder seinen Geschäften nachgegangen. Ich aber lebe mit der Zeit und der Stille und denke nach. Ab und an blicke ich aus dem Fenster auf meinen Garten, aus dem ich abends die Sterne beobachte: Jetzt aber blicke ich auf die Rückfront eines großen, stattlichen Hauses.
„Wer ist der Maler, der die Menschen besser kennt, als sie sich selbst kennen?", hatte ich Mordechai gefragt.
„Er ist der Mann, der hinter unserem Garten wohnt: REMBRANDT HARMENSZ VAN RIJN.“
Unerwartete Freundschaft
Amsterdam, 25. Juli 1671
Porträt Manasse ben Israel, Radierung, 1636
DIES SCHRIEB MORDECHAI BEN MANASSE von der Portugiesischen Synagoge zu Amsterdam, der Kunsthändler, der Sohn des Gelehrten Manasse ben Israel, der seit einer Woche - dem Ewigen sei es geklagt! - nicht mehr unter den Lebenden weilt:
Mein Vater starb hochbetagt, ein Weiser, wie man ihn unter den Mitgliedern der Portugiesischen Synagoge unserer teuren Vaterstadt schwerlich noch einmal finden wird. Ich erfüllte am Sterbe- und Totenlager meine Sohnespflichten ohne Säumen und ohne jeden Formfehler, und ich trat mein Erbe an und bezog meines Vaters heiliggehaltenes Studierzimmer. Ich bin kein Gelehrter, aber die Bilder haben mich weise gemacht und mir den Blick in Räume eröffnet, die ich früher nicht zu betreten wagte.
In einer verborgenen Abteilung des zierlichen Schreibschrankes fand ich meines Vaters Aufzeichnungen über die Sterne und die Menschen und über den Maler Rembrandt, und sie haben mich in ein solches Erstaunen versetzt, dass ich sie in unserer Druckerei drucken lassen will, jedoch nicht, ohne ihnen gewisse Ergänzungen und Erklärungen hinzuzufügen.
Aufmerksam will ich die einzelnen Kapitel studieren, Satz für Satz, meinem teuren Vater und dem großen Rembrandt zu Ehren und den zukünftigen Lesern zum Nutzen …
Auch Rembrandt ist tot, seit einem Jahr schon, die Christen haben ihn vergessen, die Juden nicht, denn er war ihr Freund und Wohltäter, und wenn es eine Auferstehung von den Toten gibt, dann wird sie an Rembrandt geschehen. Auch Banning Cocq ist tot und der Leutnant Ruytenburch, und die Cloveniersschützen sind verarmt und haben kein Geld mehr für große Gelage, und ihr großes Bild steht wieder auf jenem Speicher, wo mein Vater es damals in der Nacht vor fast 30 Jahren besichtigte. Ich habe wieder das große Tuch darübergebreitet, damit die Strahlen des Bildes nicht ins Leere fallen, denn es ist niemand mehr da, der sich für das Bild interessiert.
Ach - mein guter Vater! Wie hat er darunter gelitten, dass ich ein Kunsthändler wurde und Bilder kaufte und verkaufte! Nach den Vorschriften unserer Religion ist es verboten, Menschen im Bild oder im Stein darzustellen, denn sie sind ein Bild Gottes, den man nicht anschauen darf, ohne zu sterben. Mein Vater hielt dieses Gebot sehr streng, doch als er an jenem Tag des Jahres 1642 das Bild der Cloveniersschützen anschaute, das erste Bild in seinem Leben, das er mit eigener Einwilligung betrachtete, da änderte sich sein Sinn. Es erging ihm wie dem berühmten Kolumbus: er entdeckte ein neues Land, das er dann später oft mit dem Gelobten Land verglich, das Reich der Bilder.
Ich war auf eine andere Weise zu den Bildern gelangt, nämlich durch mein Geschäft. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich ein Geschäftsmann bin. Niemand jedoch wird von mir behaupten können, ich habe ihn übervorteilt oder in irgendeiner Weise benachteiligt, bin ich doch der Sohn des weisen Manasse ben Israel, und diese Sohnschaft verpflichtet.
Bilderhändler muss es geben, sonst müssten die Maler verhungern. Und wir können stolz auf unsere Maler sein, sie sind die berühmtesten in ganz Europa, und nirgends gibt es so viele Maler wie in Holland. Wir kennen sie, und wir kennen auch ihre Kunden.
Wenn ein Maler fortwährend selbst nach Kunden suchen müsste, behielte er keine Zeit zum Malen, und zum Malen braucht man sehr viel Zeit. Wie lange dauert es, ehe ein gutes Porträt vollendet ist! Der Maler braucht viel Zeit, bis er den Menschen, der ihm gegenübersitzt, so gut kennt, dass er ihn malen kann, stundenlang, tagelang, oft monatelang …
Wie lange muss er die verschiedenen Stoffe studieren, sie immer wieder bei unterschiedlicher Beleuchtung betrachten, ehe er ein gutes Stillleben malen kann! Nein, er kann nicht zugleich nach Kundschaft suchen. Das übernehmen wir, die Kunsthändler.
Ich betreibe einen Laden mit einem kleinen Saal, in dem man die Bilder so aufhängen kann, dass ein jeder sie gern betrachtet. Einer von meinen Gehilfen ist immer dort, um kauflustigen Besuchern die Bilder zu erklären und ihnen die besten und berühmtesten Maler zu empfehlen. Manche Menschen brauchen solche Erklärungen und Empfehlungen, sie wissen zu wenig über Bilder und Maler, um sich selbst ein Urteil bilden zu können.
Andere freilich wissen genau, wie sie Bilder betrachten müssen. Ihnen brauchen meine Gehilfen nichts zu erklären. Sie bitten direkt darum: „Ach schweig doch bitte, ich brauche Ruhe, um mir Bilder anzuschauen!"
Meine Gehilfen ärgern sich über solche Kunden, mir aber sind diese Besucher am liebsten, denn zum Bilderanschauen braucht man Ruhe und Zeit. Ich kenne Kunden, die ein Bild eine ganze Stunde lang betrachten, ehe sie sich entscheiden, ob sie es kaufen oder nicht. Sie studieren jede Schattierung, jede Form, jede Farbnuance; sie tasten die farbige Leinwand Zoll für Zoll mit ihren Blicken ab.
Da hängt ein Gemälde mit einer Landschaft. Ein Mann steht davor, unbeweglich, in sich versunken. Gewiss versetzt er sich ganz in diese gemalte Landschaft, wandert auf ihren Wegen, wärmt sich an ihrem Sonnenlicht, fühlt Dunst und Feuchtigkeit auf seiner Haut, erfrischt das Auge am hellen Grün der Bäume und Sträucher, plaudert mit dem Kuhhirten am Weg und lässt seinen Blick zu den Windmühlen in der Ferne schweifen. ja, es ist seine Heimat. In ihr wurde er geboren, in ihr ist er aufgewachsen, hier fühlt er sich wohl, und - so kauft er das Bild.
Einen anderen lockt die Ferne. Er steht vor einem Bild, das eine Landschaft am Rhein zeigt, aber nicht, wie er bei uns aussieht, sondern in Deutschland, wo an beiden Ufern Berge und Felsen emporwachsen und halbverfallene Burgen tragen; wo sich kleine Spielzeugstädtchen voll bunten Volksgewimmels den Hang hinauf drängen und wo zahllose Schiffe den Fluss beleben. Ja, auch das malen unsere Maler, und die Bilder werden gern gekauft, denn der Betrachter kann nun unmittelbar an diesem bunten Treiben in der Fremde teilnehmen. Wie käme er sonst wohl zum Rhein, wenn er nicht gerade ein Flößer oder ein sehr reicher Kaufmann ist?
Eine Dame ist mit ihrer Zofe gekommen. Sie möchte ein Blumenstück kaufen, das ihr ewigen Frühling ins Haus bringen soll. Mein Gehilfe zeigt ihr Bilder, die wir gerade vorrätig haben. Sie entschließt sich nach längerem Zögern und Schauen für eines der modernen Blumenstücke, auf denen mitten in den Blumen allerlei Tiere und Insekten zu finden sind, so naturgetreu gemalt, dass selbst meine Gehilfen manchmal nach den gemalten Fliegen schlagen, wenn sie des Morgens mit großen Wedeln den Staub von den Bildern entfernen. Dann aber müssen sie hellauf lachen, weil der Maler sie genasführt hat, und das wollte er ja!
Ich liebe vor allem die älteren Stillleben. Manchmal ärgere ich mich über die gemalten Fliegen und Mäuse. Ich liebe und empfehle die vornehm dunklen Bilder mit weichen Früchten und kostbaren Gläsern, mit funkelndem Silber und schweren Tischteppichen. Früher habe ich an diesen Bildern viel Geld verdient, und mein Geschäft erlebte die höchste Blüte. Die Kunden kauften diese Bilder, weil sie ihren eigenen Reichtum darauf dargestellt fanden. Die Bilder gaben ihnen die Bestätigung, dass sie reich seien. Damals war Reichtum noch etwas Neues, heute ist er so selbstverständlich, dass man ihn nicht mehr auf Bildern sucht.
Heute verlangt man von den Bildern, dass sie gelehrte Sachen zeigen, und der Bilderhändler muss sich umstellen, besonders bei Versteigerungen. Ja richtig, von einer Versteigerung wollte ich erzählen.