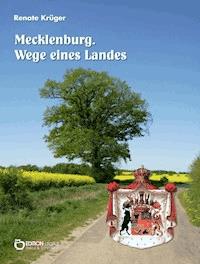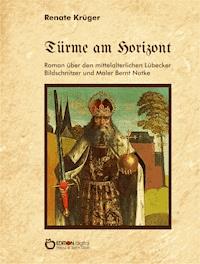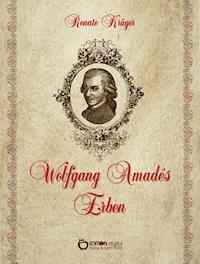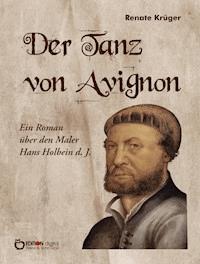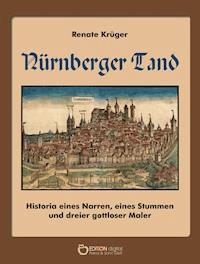7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer wenigstens ein bisschen von Friedrich dem Großen weiß, der weiß auch, dass der schon als Kronprinz die Kunst des Flötenspiels erlernt und nicht einmal so übel ausgeübt hat. Wer also diesen königlichen Flötenspieler vor Augen hat, der sieht ihn sehr wahrscheinlich mit den Augen des Malers Adolph Menzel, der kleinen Exzellenz, der dieses berühmte Ölgemälde „Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci“ in den Jahren 1850 bis 1852 gemalt hat – als Auftragsarbeit: Eines Vormittags kommt Besuch zu Menzel, ein Herr in Zylinder und dunkelgrauem Frack, mit wichtiger Miene und einer großen Tasche. Menzel fragt erst ganz genau, was er ist und was er möchte, und auch dann lässt er ihn nicht gern eintreten, denn vormittags möchte er nicht gestört werden, und der Besucher gefällt ihm nicht. Und der Auftrag, den sein Gast umständlich erklärt, gefällt ihm zuerst auch nicht. Ein Bild mit dem Schloss Sanssouci soll er malen. Der Herr im Zylinder will es dem König schenken, er habe allen Grund, sich dem König gegenüber dankbar zu erweisen, versichert er immer wieder. „Sie haben sich viel mit der alten Zeit beschäftigt, Herr Menzel. Sie sind der richtige Mann für mich.“ „So, meinen Sie?“, knurrt Menzel. „Ich habe gehört, dass unser König die alte Friedrich- und Sanssoucizeit nicht gerade liebt. Wird ihm da ein Sanssouci-Bild gefallen?“ „Warum nicht? Es kommt nur darauf an, wie es gemacht ist. Malen Sie die Landschaft, die Architektur, den Reichtum. Sie sollen das Palais des Prinzen Albrecht gemalt haben. Darf ich das Bild einmal sehen?“ Menzel holt es aus seinem Regal und kommt mit umwölkter Miene zurück, denn sein Blick hat wieder einmal das Bild mit der Aufbahrung der Märzgefallenen gestreift. Und nun ein Bild für den König? „Ein großartiges Bild“, schwärmt der Besucher. „Wenn Sie das Schloss Sanssouci vielleicht in dieser Art malen könnten?“ „So mit Wolken und Bäumen, meinen Sie? Und mit viel Stimmung?“ „Ja.“ Der Mann nickt. „So habe ich es mir gedacht.“ So beginnt eine der vielen Geschichten, in denen die Autorin anhand von Bildern aus dem Leben des Künstlers erzählt. Das fertige Bild wird übrigens ganz anders aussehen als es dem Aufraggeber vorschwebte. Auch dem König gefiel es nicht: Menzel erfährt nichts von dieser Meinung des Königs über sein Bild. Sie wäre ihm auch ganz egal. Er hat seinen Spaß beim Malen gehabt, alles andere kümmert ihn nicht. Das Original ist übrigens in Berlin zu besichtigen – in der Alten Nationalgalerie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Geisterstunde in Sanssouci
Bilder aus dem Leben Adolph Menzels
ISBN 978-3-86394-318-9 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung des Gemäldes „Flötenkonzert Friedrich des Großen in Sanssouci“ von 1852.
Das Buch erschien erstmals 1980 im Kinderbuchverlag Berlin.
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Ein Selbstbildnis: 1834
Also, Herr Erdmann Hummel, an mir soll es nicht liegen, ich führe jetzt Ihren Auftrag aus. Ich habe alle angefangenen Arbeiten weggeräumt, sitze an meinem Zeichentisch und zeichne mein eigenes Bild, ganz wie Sie es wünschen.
Ich bin es gewohnt, dass ich jedes bestellte Bild zeichne, ich muss ja schließlich meine Familie ernähren. Ja, lachen Sie nicht, Herr Hummel, Sie wissen schon, wie ich es meine. Ich bin zwar erst neunzehn Jahre alt, und in diesem Alter hat man eigentlich noch keine eigene Familie. Und doch! Seit Vater vor zwei Jahren gestorben ist — er hieß übrigens auch Erdmann, genau wie Sie, Carl Erdmann Menzel —, muss ich allein für Mutter und Geschwister, die elfjährige Emilie und den achtjährigen Richard, sorgen. Und ich kann es. Ich habe es geschafft, meines Vaters Werkstatt weiterzuführen und sogar noch zu vergrößern. Und nun kommen Sie, Herr Hummel, einer der berühmtesten Maler Berlins, und geben mir einen Auftrag, der mir zwar kein Geld einbringen wird, dafür aber Ehre und Ruhm.
Sie wollen mein Selbstbildnis für den Berliner Künstlerverein. Und ich, so meinen Sie, soll Mitglied dieses Vereins werden, obgleich ich noch jung bin und die Kunstakademie nicht bis zum Ende besucht habe. Quatsch Kunstakademie, haben Sie gesagt, deine Kunstakademie ist die Natur, Menzel, halte du dich nur an die Natur. Du sollst einer von uns werden, und als Eintrittsgeld brauchen wir dein Selbstbildnis, und nun ran an die Arbeit, zeig mal, wie du aussiehst und wie du dich selbst siehst ...
Na schön, Herr Erdmann Hummel!
Ich bin noch immer der Menzelzwerg, und daran wird sich wohl nichts mehr ändern, ich wachse nicht mehr. Meine Schwester Emilie ist fast so groß wie ich. Als sie am vorigen Sonntag zu einem Besucher sagte: „Warten Sie, ich werde meinen kleinen Bruder holen“, da habe ich ihr eins hinter die Ohren gegeben, auch wenn es mir mehr wehtat als ihr. Aber schließlich bin ich das Oberhaupt der Familie ... Auch wenn ich noch immer nicht vom Stuhl aus mit den Beinen auf den Fußboden komme und sie baumeln lassen muss wie mein kleiner Bruder Richard.
Mitglied des Berliner Künstlervereins! Bei diesem Gedanken aber fühle ich mich gleich viel größer. Und dafür will ich gern mein eigenes Bild als Eintrittspreis hergeben. Ich bin auch ziemlich neugierig, wie ich eigentlich aussehe, denn bis jetzt habe ich noch keine Zeit gehabt, mich selbst zu zeichnen. Ich hatte immer mehr als genug zu tun mit Abbildungen von Pferden und Kanonen, Pflanzen und Tieren, Handwerkern und ihren Hausbauten, Bauern auf dem Feld und im Stall.
Eigenartig ist es, wenn man sich so gegenübersitzt, sich selbst aufs Papier bringen will. Es scheint so, als blicke mir aus dem Spiegel ein fremder Mensch entgegen, mit dem ich mich unterhalten muss, damit ich ihn besser kennenlernen kann.
Woher bist du gekommen, kleiner Menzel? Na, das weiß doch fast jeder! Aus Breslau sind wir hierher nach Berlin gezogen. Vater war in Breslau Lehrer, er hatte eine eigene private Schule mit lauter Mädchen, das war ein Geschnatter im Haus! Die Mädchen mochten ihn sehr, und wer wollte, konnte eine Menge bei ihm lernen. Aber er war nicht gern Lehrer, er wollte lieber zeichnen, die Natur beobachten, Bücher illustrieren, eben das, was ich jetzt tun darf. So gab er die Schule auf und bemühte sich um Aufträge zum Zeichnen. Aber Breslau ist zu klein. Schließlich verkaufte er unser Haus, und wir zogen nach Berlin. Es war ein schönes Haus, das wir da verließen. „Zur Goldenen Muschel“ hieß es, weil über der Haustür eine Muschel aus Stein angebracht war.
Gold habe ich an ihr freilich nicht gesehen, das war schon längst abgeblättert. Unser Haus hier in der Berliner Wilhelmstraße hat keinen Namen, nur die Nummer 39, und unsere Wohnung ist auch längst nicht so groß wie die in der „Goldenen Muschel“.
Wie groß soll mein Bild eigentlich werden? Davon hat Herr Hummel nichts gesagt. Es darf nicht angeberisch werden, aber auch nicht zu klein. Dieses Blatt hier, denke ich, so groß wie eine Heftseite, wird wohl genügen. Und in welcher Technik? Ich werde es mit dem Bleistift probieren, damit arbeite ich am liebsten. Er muss ganz kurz sein. Es kommt mir dann immer so vor, als zeichne ich mit den Fingern. So wie jetzt. Ich habe nur noch einen Stummel in der Hand. Aber es geht leicht und schnell damit.
Allzu lange darf ich mich mit meinem eigenen Bild auch nicht aufhalten, denn es wartet noch andere Arbeit auf mich, und ich will meine Auftraggeber nicht enttäuschen.
Chor der alten Klosterkirche in Berlin, Aquarell 1838
Ich weiß noch genau, wie es war, als damals nach Vaters Tod der Inhaber einer Buchdruckerei persönlich zu uns kam, um alle Aufträge, die er uns erteilt hatte, zurückzuholen. Vater sei doch nun leider tot, und er als Druckereibesitzer und Geschäftsmann müsse sich wohl nach einem anderen Zeichner umsehen, aus unserer Werkstatt könne er ja nun nichts mehr erwarten.
„Weshalb nicht?“, fragte ich. „Ich bin ja schließlich auch noch da!“
„Du?“, fragte er von oben herab und maß mich von Kopf bis Fuß, und dabei hatte er wirklich nicht viel zu messen. Doch dann wurde er verlegen und fragte schnell noch einmal: „Sie?“
Ja, ich ... Ich war damals siebzehn Jahre alt, und es gab fast nichts mehr, was ich noch nicht gezeichnet, woran ich meine Augen und Finger noch nicht geübt hatte.
„Sie sollen pünktlich beliefert werden, verlassen Sie sich auf mich!“, sagte ich und hielt Wort.
Ich weiß auch noch genau, wie es war, als er die fertigen Zeichnungen abholte. Ja, er kam selbst, er war wohl gespannt. Allerdings wollte er mir weniger Geld zahlen als meinem Vater, aber darauf ließ ich mich nicht ein.
„Haben Sie etwas an meinen Zeichnungen auszusetzen?“
„Nein. Aber Sie haben keine Kunstakademie besucht ...“
Für den Maler Hummel spielt das keine Rolle. Es wäre ja wirklich besser gewesen, wenn ich Zeit für die Kunstakademie gehabt hätte, aber ich hatte sie eben nicht. Schließlich bezahlte der Druckereibesitzer doch den vereinbarten Preis. Mein erstes selbst verdientes Geld ...
Eigentlich kann ich jetzt den Kopf ganz schön hoch tragen und mich auch so zeichnen. Ich brauche mich nicht zu verstecken oder zu ducken.
Kopf hoch, Adolph Menzel! So sagte ich damals immer wieder zu mir selbst, wenn es schwer wurde. Jetzt kommt es auf dich an, auf deinen Fleiß, auf deine Ausdauer, auf deine Fantasie! Entweder du überwindest die Schwierigkeiten, oder du wirst von ihnen zu Boden gedrückt!
Friss, Vogel, oder stirb!
Dieses Wort habe ich von einem Handwerksburschen gehört. Er saß an der Spree und aß knochentrockenes verschimmeltes Brot. Natürlich schmeckte es ihm nicht, aber besser dies als verhungern!
Friss, Vogel, oder stirb!
Ein hartes Wort, aber manchmal hat es mir geholfen. Zum Beispiel, wenn mir die Augen vor Müdigkeit zufielen, ich aber noch weiterarbeiten musste, damit wieder Geld ins Haus kam.
Ich habe niemanden enttäuscht und alle Termine pünktlich gehalten. Tag und Nacht habe ich gezeichnet, entweder auf Straßen, Plätzen, im Museum oder hier an meinem Arbeitstisch. Und es hat sich gelohnt! Nicht jeder Berliner Zeichner hat schon eine so große Werkstatt wie ich.
Mein Arbeitszimmer ist größer als unser Wohnzimmer. Am linken Fenster steht noch immer Vaters Arbeitstisch, daneben meiner. Darauf in kleinen Gefäßen stehen Zeichenfedern in verschiedener Größe. In einer weißen Porzellandose habe ich alle meine Bleistifte zusammengestellt, in der blauen meine feinen Pinsel. Daneben Fläschchen mit schwarzer und brauner Tusche, Leinenläppchen. Das ist meine Welt, oder sagen wir besser ein Teil meiner Welt. Der andere und wichtigere ist draußen, bei den Menschen auf der Straße und in ihren Arbeitsstätten. Ein Künstler darf sich nicht in seiner Werkstatt verkriechen ... Ich will allen Menschen und dem ganzen Leben offen und gerade ins Gesicht sehen, so wie ich mich jetzt zeichne ...
Es geht ruck, zuck mit dem Bild. Menzel braucht keinen Radiergummi, jeder Strich sitzt beim ersten Mal.
Er wird schon zufrieden sein, der Herr Hummel, und die anderen Maler auch. Die Zeichnungen, die er neulich hier in Menzels Werkstatt gesehen hat, gefielen ihm sehr.
„Du hast ja schon halb Berlin in deiner Werkstatt, junger Kollege“, hatte er gesagt. Kollege, wie sich das anhört. Richtig feierlich. Menzel muss mal schnell selbst wieder in seinen Skizzen blättern. Schornsteinfeger auf dem Dach. Schusterjungen, denen die Stiefel über die Schulter baumeln. Leierkastenmänner, die ihren Bettelhut aufhalten. Frauen, die an der Pumpe Wäsche spülen. Droschkenkutscher, die ihre Pferde füttern oder striegeln. Hunde. Spielende Kinder. Hauseingänge. Soldaten, immer wieder Soldaten ...
Ich werde mein Bild noch heute zu Professor Hummel in die Kunstakademie bringen, denkt Adolph, ich habe so richtig Lust zu einem kleinen Stadtbummel. Ob der ulkige Dienstmann noch immer auf der Weidendammer Brücke steht? Mein Hauswirt, der Gemüsehändler Pritzerbe, nennt ihn immer Eckensteher Nante. Und die feinen Droschken auf der Friedrichstraße — aber heute werde ich nicht zeichnen, nur so dahinschlendern, die Friedrichstraße hinunter bis zu den Linden. Wenn ich die Zeichnung abgegeben habe, bleibt mir vielleicht noch Zeit für den Lustgarten und das königliche Schloss, dort gibt es für mich immer etwas zu sehen, und dort werde ich ganz bestimmt nicht anders können, dort muss ich dann doch wieder zeichnen.
So, fertig. Jetzt noch der Name auf das Bild. Adolph Menzel, geboren zu Breslau, den 8. Dezember 1815.
Etwas kommt … 1845
Balkonzimmer, Öl auf Pappe, 1845
War Menzel bei seinem Eintritt in den Künstlerverein schon bekannt, so wird er bald berühmt, ein gemachter Mann, wie es so schön heißt. Ganz Berlin ist stolz auf ihn, und er bekommt große und auch gut bezahlte Aufträge. So kann es sich die Familie Menzel endlich leisten, in eine neue, bequemere und größere Wohnung umzuziehen. Sie liegt in der Schöneberger Straße, dort, wo auch der Prinz Albrecht sein prächtiges Palais hat. Eine vornehme Gegend! Vom Balkon aus werden Menzels in Zukunft in den Garten des Prinzen sehen. Doch was heißt Garten, es ist ein Park mit gepflegten Wegen und geschnittenen Bäumen. Diese Aussicht beflügelt Frau Menzel natürlich sehr. Wir werden einen Prinzen als Nachbarn haben... Das schmeichelt ihr. Dennoch fällt ihr der Abschied von der alten Wohnung schwer. Noch einmal geht sie durch die Räume, bevor Bilder und Gardinen abgenommen, die Schränke ausgeräumt und die Möbel hinausgetragen werden. Auf dem Fußboden türmen sich Stapel von Mappen und Büchern. Immer steht die Staffelei im Weg. Man muss vorsichtig sein, dass man sie nicht umwirft. Nein, Adolph braucht wirklich eine größere Werkstatt, ein Atelier, denkt Frau Menzel und wendet sich zum Gehen.
Es ist ein kleines Fest, als die Menzels zum ersten Mal auf dem Balkon der neuen Wohnung frühstücken. Sie schauen dabei in einen herrlichen Maimorgen. Den Tisch ziert eine rot-weiß karierte Decke, weißes Porzellan und eine kleine Vase mit Frühlingsblumen. Emilie überrascht ihre Brüder mit einem Gläschen Honig, den die beiden für ihr Leben gern essen.
Mutter Menzel aber wird plötzlich unruhig, denn durch den Park nebenan spaziert der Prinz Albrecht mit seinen beiden Windhunden. Einmal sieht er kurz nach oben. Sie springt auf und macht den vorgeschriebenen Hofknicks, obgleich der Prinz das gar nicht sehen kann. Danach meint sie, es sei wohl ungehörig, in der Gegenwart eines so hohen Herrn Schrippen mit Honig zu essen, und verlegt das Frühstück kurzerhand nach drinnen. Proteste nützen nichts. Auch Adolph muss sich fügen. Aber er kommt mit seiner Tasse nicht bis ins Wohnzimmer. Er bleibt nach wenigen Schritten versonnen stehen und schaut und schaut.
„Was hast du?“, fragt die Mutter. „Möchtest du nicht den Rest Kaffee austrinken? Oder suchst du deine Zigarren?“
„Was sollen jetzt Kaffee und Zigarre ...“ Adolph sieht die Mutter groß an. „Ich sehe etwas, weißt du, das habe ich noch nie gesehen!“
„Kein Wunder!“ Frau Menzel lächelt. „Die Wohnung ist ja ganz neu!“
„Nein, es ist etwas anderes. Das muss ich malen.“
„Malen? Wieso malen? Hast du denn schon alle deine Zeichnungen fertig?“
Sie wundert sich, denn Adolph hat sich bis jetzt vor allem mit Zeichnungen beschäftigt, das Malen, den Umgang mit Farben und Pinseln, hat er doch gar nicht gelernt, sondern immer nur so nebenbei betrieben, und Aufträge zu Gemälden, zu gemalten farbigen Bildern, hat er noch nie erhalten. Oder doch?
Adolph blickt verträumt auf die Balkontür. Dabei ist er kein Träumer. Er fasst sein Gegenüber, ganz gleich, ob Mensch oder Ding, immer fest ins Auge, hält das Bild fest, bringt es aufs Papier. Jetzt aber hat er die Hände auf dem Rücken verschränkt und schaut auf die Gardine, als sei sie ein Weltwunder. Oder gefällt sie ihm nicht? Ist sie unordentlich angemacht? Aber nein, das kann nicht sein, ein Dienstmann hat sie befestigt, und er ging mit Sorgfalt ans Werk. Oder wartet Adolph auf Emilie?
„Emilchen ist in der Küche, Adolph. Und Richard ist zum Arzt gegangen, es ist ja wieder schlimmer mit seinem Husten, ob wohl nach diesem Umzug Geld für eine Sommerfrische übrig bleibt?“
„Ich warte nicht auf Emilie und nicht auf Richard. Weißt du was, Mutter? Ich werde unser Balkonzimmer malen. Ich sehe etwas ganz Neues.“
Frau Menzel muss sich erst einmal hinsetzen. Alles hat sie erwartet, nur das nicht. Da hört doch alles auf! Nun haben sie die neue Wohnung, ein Zimmer ist schöner als das andere, nur das Balkonzimmer hier, an dem ist eigentlich nicht viel dran, das ist doch nur eine Erweiterung des Korridors. Der Adolph ist wohl ein bisschen durcheinander, vielleicht war der Umzug mit all der Arbeit doch zu viel für ihn. Wenn er nun schon malen will, um sich zu erholen, dann gäbe es Besseres. Zum Beispiel den prächtigen Hauseingang mit den beiden Säulen davor und den aus Stein gemeißelten Figuren oder das Treppenhaus, dessen Geländer sogar an Marmorpfosten befestigt ist. Beim Malen könnte er sich darüber freuen, in welch prächtigem Haus er wohnt ...
„Aber Adolph!“, sagt sie vorsichtig. „Hast du denn nichts Wichtigeres zu tun? Das Balkonzimmer kann man doch nicht malen, da ist doch fast nichts drin, und etwas Neues schon gar nicht!“
„Aber Mutter, sieh doch mal! Die Sonne scheint herein, und das Licht ist so dicht, dass man es mit Händen greifen kann! Das Licht fühlt sich wohl in unserem Balkonzimmer! Es füllt jede Ecke aus, und sogar die Schatten sind lebendig. Ist das nicht herrlich?“
„Aber doch auch nichts Besonderes ... Muss man denn das gleich malen?“ Frau Menzel ist noch immer vorsichtig. Vielleicht ist Adolph krank.
„Ich glaube ja, Mutter. Diesen Auftrag gebe ich mir selbst. Es ist mein Auftrag, das Licht mit den Augen zu packen und mit Pinsel und Farben festzuhalten. Und dabei kann ich es so richtig kennenlernen. Wenn man immer nur zeichnet, immer nur schwarze Striche macht und weißen Grund ausspart, hat man Sehnsucht nach dem Licht, nach dem farbigen Licht, denn das Licht ist ja farbig ...“
Frau Menzel antwortet nicht sogleich. Adolph spricht sonst nicht viel, und schöne Dinge, wie sie meist nur in Büchern stehen, sagt er ganz selten.
Diesen Auftrag gebe ich mir selbst, hat er gesagt.
Was Adolph will, das tut er, das führt er aus! Das Licht festhalten — das ist schön gesagt, aber nicht leicht zu verstehen. Muss man nicht die Augen schließen, wenn man ins Licht blickt? Den Prinzen Albrecht hat sie vorhin sofort gesehen — aber das Licht ... Das Licht ist ja farbig ...
„Nun, Adolph, male du nur und lerne Neues kennen! Soll es ein großes Bild werden?“ Sie ist neugierig, wie gemaltes Licht aussehen soll.
„Nein, es kommt nicht auf die Größe an! Das Bild soll ja nicht in einem Schloss hängen.“
„Schließe aber die Balkontür, es zieht nämlich, weißt du ... Es genügt, wenn Richard hustet, fang du nicht auch noch damit an.
„Die Balkontür müsste schon offen bleiben, die Gardine soll ein bisschen ins Zimmer hereinwehen, das ist so lebendig ...“
Frau Menzel schüttelt den Kopf und trägt das Tablett in die Küche. Der Adolph macht ja doch, was er will. Aber wenn es etwas Gutes ist ...
Adolph Menzel geht in das Zimmer, das er sich zum Atelier eingerichtet hat, und pfeift ein Lied. Er ist glücklich darüber, dass ihm ein so schönes Bild begegnet ist. Seine Farben und Pinsel sind noch in Kisten und Kartons verpackt. Wenn die wüssten, was da auf sie wartet, sie könnten es vor Neugierde und Ungeduld wohl nicht aushalten! Die Staffelei ist auch noch zusammengepackt, erst einmal weg mit dem Packpapier! Menzel schleppt das Holzgestell ins Balkonzimmer hinüber. Das gefällt der Mutter ja nun gar nicht.
„Mach mir bloß keine Kratzer und keine Farbflecke auf den Fußboden!“, mahnt sie ihn streng. „Nun hast du ein so großes und helles Atelier, weshalb musst du nun auch noch das Balkonzimmer vollstellen und versperren?“
Solch eine Staffelei ist ja wirklich ein furchtbar sperriges Ding!
„Ich lege ja Papier drunter, Mutter“, sagt Menzel, „aber Farbflecke werden nicht ausbleiben, damit müssen wir rechnen!“ Und er macht ein schuldbewusstes Gesicht.
„Aber wenn ich dieses Bild festhalten könnte — wer fragt dann nach Farbflecken? Die gehen auch wieder ab.“
Mutter Menzel gibt sich geschlagen. Nun steht alles richtig da, die Staffelei, der Tisch mit den Farben und Pinseln, nun fehlt nur noch eine leere weiße Leinwand, dann könnte Adolph mit dem Malen beginnen. Doch so schnell wird es doch nicht gehen, er muss ja noch die Keilrahmen, auf welche die Leinwand gespannt wird, damit sie fest, stramm und glatt ist, vom Tischler um die Ecke abholen. Dann muss die Leinwand erst einen weißen Anstrich erhalten, und nicht nur einen ...
Nun gut, auf zum Tischler!
Der wohnt im Hinterhaus. Seine Werkstatt ist eng und klein. Er arbeitet ohne Lehrling und Gesellen. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten! Er ist ein griesgrämiger alter Mann und erwidert Menzels Gruß nicht.
Auf dem Hof lärmen Kinder.
„Wat? Heute kommen Se schon wejen de Rahmen?“
Er ist unwillig.
„Aber ich bringe Ihnen doch auch Geld ins Haus, Meister“, entgegnet Menzel höflich.
„Ach wat, Jeld ... Is ja doch nicht jenug! Wird ja allet jeden Tag teurer. Een janzen Taler Miete muss ick mehr zahlen.“
Menzel hat zehn verschiedene Rahmen bestellt. Jetzt möchte er nur einen kleinen mitnehmen, das Balkonzimmer ist ja nicht groß. Der Tischler gibt dem Keilrahmen mit Schmirgelpapier noch einen letzten Schliff.
„Nächstens wern Bilderrahmen ooch noch mit Maschinen jemacht. Denn verdienen wir jar nischt mehr“, brummt er. Und nach einer Pause erkundigt er sich neugierig: „Wat wolln Se denn malen, Meister?“
„Licht und Luft“, antwortet Menzel heiter. „Was so von draußen in unser Zimmer kommt. Weshalb haben Sie denn eine so alte dunkle Decke vor Ihre Tür gehängt? Es ist jetzt Mai, lassen Sie doch die Tür auf und Sonne rein!“
„Quatsch! Kommt doch keene Sonne rin! Bloß Dreck und Staub und Krach vonne Jörn! Jeld brauche ick, oder wenn eener mit’n billigen Sack Kartoffeln käme! Aber da kommt nischt Jutet von draußen. Schlechte Zeiten, Teurung, Soldatenjeschrei. Mein Schwiegersohn uff de Ritterstraße kann die Miete nicht mehr zahlen. Nu is er ooch noch bei mir wohnen jekommen mit meine Tochter und die drei Kinder. Jehn Se doch mal zum Prinzen Albrecht hier gleich um de Ecke, vielleicht kommt bei dem wat Besseret durch de Türe.“ Unter dem Gespräch ist er mit dem Schmirgeln fertig geworden. „Hier is der Rahmen. Die Jören können ihn ja bringen. Wenn Se mir’n Jroschen mehr jeben könnten ... Vielen Dank, Meister!“
Menzel wollte ohnehin noch einen Spaziergang machen. Gut, dass er nichts tragen muss.
Er schlendert gemächlich durch den Park des Prinzen Albrecht und atmet tief und langsam. Hier sollte der brummige Tischlermeister auch einmal spazierengehen, dabei würde er schon auf andere Gedanken kommen. Aber dazu hat der wohl gar keine Zeit. Und der Prinz würde nicht erlauben, dass Hinz und Kunz durch seinen Park spaziert. Warum eigentlich nicht? Alle brauchen gute Luft. Warum wohnen die einen in Schlössern, und warum haben die anderen Säcke vor der Tür?
Sonst hatte Menzel immer eine schnelle Antwort auf solche Fragen bereit. Wer Säcke vor der Tür hat, ist eben nicht fleißig genug. Oder er kann nicht wirtschaften. Oder er hat Pech gehabt. Und ordentlich muss man leben. Ohne Fleiß kein Preis. Seht mich an, ich habe auch ganz unten angefangen. Und ich war fast noch ein Kind. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, und nun habe ich es zu etwas gebracht. Aber diese Gedanken befriedigen ihn heute nicht. Es gibt zu viele Arme. Die können doch nicht alle faul und unordentlich sein!
Täglich bringt Emilie einem alten kranken Ehepaar das Mittagessen. Täte sie es nicht, würden die beiden verhungern.
Wie oft wird Menzel beim Malen gestört, weil Bettler an der Tür klingeln.
— Ham Sie’n Stück Brot? Ham Sie Arbeet für unsereenen? — Warum reicht es eigentlich nicht für alle? Menzel hat schon manche Erklärungen gehört, aber sie klingen alle so kompliziert. Gerechte Güterverteilung für das Volk zum Beispiel ... Was soll er sich darunter vorstellen? Wird etwa der Prinz Albrecht dem alten Tischler und dessen Kindern und Enkeln Wohnräume in seinem Schloss abgeben? Nie!
Menzel wird mutlos bei solchen Gedanken. Er versteht eben von diesen Dingen nichts, nur vom Zeichnen und ein bisschen vom Malen. Aber er muss doch nachdenken, sonst versteht er auch nichts von dem, was ihm tagtäglich vor die Augen kommt.
Mit welchem Recht blicken da gerade die blank gestiefelten Offiziere vom Regiment Gensdarmes so hochmütig von ihren Pferden auf ihn und alle anderen herab? Nur, weil ihre Familien große Güter besitzen, weil ihre Väter, Onkel oder älteren Brüder beim König ein und aus gehen. Und von ihnen erfährt der König niemals von den armen Leuten. Man müsste ihm von ihnen berichten, und zwar mit Nachdruck. Haben die einfachen Menschen nicht auch das Recht auf Arbeit, auf mehr Lohn, auf ein besseres Leben? Diese Rechte müsste der König garantieren, so etwas hieße dann wohl Verfassung oder so. Ob wohl Preußen mit einer solchen Garantie auch in besserer Verfassung wäre?
Nachdenklich steigt Menzel die Treppe zu seiner neuen Wohnung hinauf.
Oben jedoch beschäftigt ihn gleich wieder sein zukünftiges Gemälde.
Wieder steht er in der Tür zum Balkonzimmer und schaut und schaut. Er ist ein Mensch von raschen Entschlüssen, es muss schnell gehen bei ihm. Aber die Kinder haben den Rahmen noch nicht gebracht. Ruhig bleiben, Menzel! Aber das ist leichter gesagt als getan. Das Bild drängt, es muss heraus! So bereitet Menzel eine Pappe zum Malen vor, es muss ja kein großes Bild werden.
Erst am Abend klingelt es, die Enkel des Tischlers!
„Na, ihr seid wohl mit dem Rahmen spazieren gegangen, was?“, begrüßt er sie freundlich.
„Nee! Vatern ham se von’n Bau jebracht! Ihm is’n Balken uff’n Fuß jefallen! Mutter heult, Jroßvater schimpft. Entschuldigen Se vielmals!“
Ach du liebe Zeit, ein Unfall! Das bedeutet Arbeitsausfall, Lohnausfall!
„Na, kommt mal rein“, Menzel schiebt sie durch die Tür. „Habt ihr denn Zeit für’n paar Bilder?“ Er will die Kinder ablenken.
Der Älteste nickt. Sie waren noch nie in so feinen großen Zimmern. Was für große Schränke dieser kleine Herr Menzel hat!
In einem stehen die Bücher, die er mit Illustrationen versehen hat. Da ist das „Gedenkbuch für das Leben, der Erinnerung an wichtige Ereignisse des Familienlebens gewidmet“, darin eine sehr fein und locker gezeichnete Einrahmung für das Blatt, auf der die Eheschließung eingetragen werden soll, allerlei symbolhafte Dinge.
Zwei verschlungene Ringe, Rosen und Dornen, Trompeten und Masken. Dieses Blatt sieht Menzel gar nicht so gern, denn er hat bis jetzt keine Frau fürs Leben finden können. Die meisten lachen nur über seine kleine Gestalt. Schnell zieht er ein anderes Buch heraus.
„Der kleine Gesellschafter für freundliche Knaben und Mädchen von 5 bis 10 Jahren“, heißt es.
„Das ist was für euch! Ich habe zwei davon. Eins könnt ihr mitnehmen.“
„Wat? Een Buch? Für uns?“ Die Kinder sind außer sich. Nicht einmal der Vater besitzt ein Buch!
„Kieck mal den Hahn, wie der kräht!“
Pferd und Esel, schwer beladen, quälen sich einen steilen Bergweg hoch. Eine Gänseherde wird von Kindern gehütet. Dann zeigt ihnen Menzel Zeichnungen zu allerlei merkwürdigen Geschichten. Und schließlich holt er auch noch die vielen Zeichnungen mit dem Preußenkönig Friedrich heraus. Die Kinder legen das Buch auf den Fußboden und sich selbst auf den Bauch drum herum. Galoppierende Pferde! Das Opernhaus unter den Linden! Der Freundschaftstempel in Sanssouci!
„Kieck mal det Männecken!“
Menzel schmunzelt.
„Det ist doch keen Männecken, det is der König!“, antwortet er den Kindern schlagfertig.
So viele Zeichnungen! Und doch ist Menzel unzufrieden. Etwas Neues müsste kommen. Seit Jahren schon möchte er nicht mehr nur zeichnen, sondern auch malen. Ein Pinsel ist ihm jetzt lieber als eine feine Zeichenfeder. Warum immer nur so kleine Papierbildchen, warum nicht endlich eine größere Leinwandfläche? Farben möchte er zusammenstellen und aufeinander abstimmen, nicht nur schwarze Linien und weiße Flächen zu lebendigen Zeichnungen verbinden. Es juckt ihn in den Fingern.
„Bleibt ruhig noch da“, meint er zu den Kindern und fügt hinzu: „Aber ich muss arbeiten!“
Und schon spannt er die Leinwand auf den Keilrahmen. Als die Kinder sich dann verabschieden, ist er schon dabei, den weißen Malgrund aufzutragen. Fast hätte er etwas Wichtiges vergessen.
„Ach so! Eure Sechser! Hier habt ihr! Und gute Besserung für den Vater. Die anderen Rahmen könnt ihr mir auch mal bringen.“
Die Kinder bedanken sich für das Buch und laufen nach Hause.
Abendgesellschaft, Öl auf Pappe, 1846-1847
Menzel bleibt aber doch bei seiner Malpappe und wartet, dass der weiße Malgrund endlich trocken wird. In der Zwischenzeit muss er noch eine andere Arbeit tun, er kann ja die Stunden nicht einfach so verrinnen lassen. Da ist zum Beispiel noch die Speisekarte für den großherzoglichen Hof zu Meiningen zu entwerfen. Nicht die Abfolge der Speisen für eine Festmahlzeit, nein, die ist Sache der Hofköche, Menzel muss nur die prächtige Umrahmung zeichnen.
Er weiß schon, was dort hingehört. Eine Umrahmung von Treppen, die hinauf- und hinunterführen, Damen und Herren, die sich während der üppigen und endlos langen Mahlzeit die Beine ein wenig vertreten, um dann weiterzuessen — ach nein, die essen ja nicht, die speisen. Hofkellner, die mit Tabletts und Flaschen geschäftig auf und ab laufen. Man hört jedoch keinen Schritt, denn das würde ja die vornehmen Ohren stören. Die können gerade noch Sektkorken knallen hören. Alles andere ist ihnen zu laut, zu gewöhnlich. Diese Herrschaften haben dicke Vorhänge an den Fenstern, und die Türen sind dicht verschlossen.
Menzel stutzt und wundert sich. Weshalb nur muss er immerfort an Türen und Vorhänge denken? Er legt die Zeichenfeder hin, mit der er Treppen und Diener hingestrichelt hat. Es ging wie von selbst, als schriebe er, doch nun geht er schon wieder ins Balkonzimmer und fühlt die Leinwand an, und siehe da, sie ist trocken ... Großartig, nun kann er das farbige duftige Bild, das er in sich spürt, herauslocken, ganz behutsam, ganz vorsichtig!
„Und das willst du nun wirklich malen?“, fragt Mutter Menzel, die mit gerötetem Gesicht aus der Küche gekommen ist, da sie bemerkt hat, dass es losgeht. „Kannst du denn mit einem solchen Bild Geld verdienen?“
„Nein, ganz bestimmt nicht“, entgegnet Adolph. „Aber man muss auch mal etwas nur so aus Spaß machen, nicht immer nur zum Geld verdienen.“