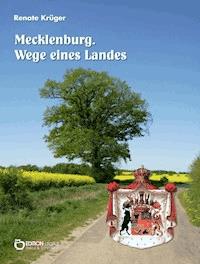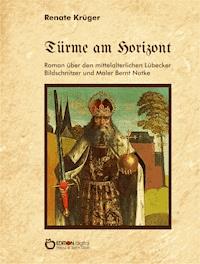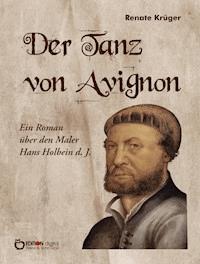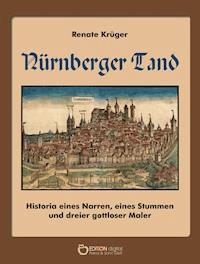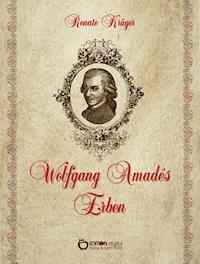
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn auch Mozart mit Einsetzen der Handlung nicht mehr am Leben ist, so ist er doch durch seine Leistungen als Wunderkind, Virtuose und Komponist in den Erinnerungen seiner Familie und seiner Freunde als geistiges Zentrum dauerhaft präsent. Die Erben: das ist seine Frau Konstanze, der er zwei Söhne und ein zunächst wertloses „Papiererbe“ hinterlässt und die nun versuchen muss, ihrem Leben einen neuen Inhalt zu geben. Die beiden Söhne Karl und Wolfgang sind durch Namen und künstlerische Hinterlassenschaft des Vaters vorbelastet und müssen sich damit auseinandersetzen. Karl verzichtet auf den Künstlerberuf und somit auf Erfolg und Ehre und findet seinen Frieden in der unbeachteten Anonymität eines kleinen Beamten, Wolfgang aber zerbricht an der Belastung. Wenige Jahre nach Mozarts Tod melden weitere Erben ihre Ansprüche an: Verleger, Sammler, Kunstfreunde, Biografen, wenig später auch das geschäftstüchtige Bürgertum des biedermeierlichen Salzburg und Wien, das sich des großen Sohnes erinnert und mit seinem Namen und Andenken eine nachhaltige Konjunktur anzukurbeln versteht. Den Freunden Mozarts und seiner Kunst bleibt es vorbehalten, seine Biografie und sein verstreutes Werk zusammenzutragen, zu sammeln, zu ordnen und vor der Mitwelt auszubreiten. Einer dieser ernsthaften Erbepfleger ist Ludwig von Köchel, pensionierter erzherzoglicher Erzieher, auf der Suche nach einer Lebensaufgabe. Dieser liberale Humanist erarbeitet mit der Hilfe von gleichgesinnten Freunden und seines einstigen Pfleglings und jetzigen Sekretärs, des rebellischen Alois Hegereiter, in über zehnjähriger fleißiger Forschertätigkeit ein Verzeichnis der Werke Mozarts. Das spannende, sehr gut recherchierte Buch erschien erstmals 1979 im VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Wolfgang Amadés Erben
Roman
ISBN 978-3-86394-337-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 1979 im VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig. Der Text wurde für die Neuherausgabe geringfügig überarbeitet.
© 2013 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
I: Opus postumum
1
Auch im Jahre 1792 gibt sich Wien als eine lächelnde Stadt. Manche sprechen lieber von einem höhnischen Grinsen oder gar von seelenlosen Lachmasken. Wien lächelt aus den zurechtgestutzten Gärten und den verschnörkelten Fenstern der Schlösser, Kirchen und Paläste, und da ist es leicht, eine gute Miene zu machen. Es lächelt aber auch aus den dunklen Stiegenhäusern und den hölzernen Hinterhofgalerien, jedenfalls dann, wenn sich einmal ein Fremder hierher verirrt, es lächelt bei Unschlittkerzen und Mondschein, jedenfalls glauben die Fremden das; und niemand korrigiert sie. Wien wahrt sein Gesicht.
Wien lächelt in seinen Salons und vornehmen Zirkeln. Wohl dem, der Zutritt in einen geselligen Salon hat, der zu einem erlesenen Zirkel gehört, zur Gesellschaft des Ignaz von Born und des Nikolaus von Jacquin etwa, die sich die Förderung der Wissenschaft angelegen sein lassen und in die man Wissenskapital als Mitgift einbringen muss. Oder zum lockeren Kreis Castellis, in den nur Humorvolle und Witzige zugelassen sind, solche, die auch unfeine Witze hören, ertragen und erzählen können. Oder zum Zirkel der Frau von Greiner, der Mutter der später berühmten Karoline Pichler, der die Geselligkeit selbst zum Hauptzweck hat und sie nach allen Regeln der Kunst pflegt, damit sich ja niemand einsam und verlassen fühlen muss. Und wenn schon, dann sollte er es nicht zeigen. Und die anderen, die Mühseligen und Beladenen, sollten die lächelnde Öffentlichkeit tunlichst meiden.
Wien lächelt. Es hat nach dem Tode der Kaiserin Maria Theresia nur kurze Zeit ein Trauergewand getragen und nach dem Tod ihres Sohnes und Nachfolgers, Josephs II., nur für wenige Tage, höchstens für eine Woche, sein Lächeln unterbrochen. Eine finstere Miene wäre eher angebracht gewesen, denn nach dem Tode dieses Kaisers kam es ziemlich arg. Wien lächelt aber, es muss sich ja beizeiten daran gewöhnen, die Lage als hoffnungslos, aber nicht ernst anzusehen. Denn der Ernst verlangt so unangenehme Konsequenzen.
Dem bitteren Ernst hat Wien auch eine feste Institution geschaffen, die Gruft des Allerhöchsten Kaiserhauses unter der Kapuzinerkirche. Hier kann der Besucher von Kaisersarg zu Kaisersarg schreiten. Prunkvollste Totengehäuse, meisterhaft gearbeitete Sarkophage, kleine Särge, die an die Stelle von Kinderbetten treten mussten. Alle geschmückt mit den Symbolen der Macht und des Todes. Der Besucher kann sich ernsten Gedanken hingeben, wenn ihm danach zumute ist; er kann auch lächeln, wenn ihm das Leben so erträglicher erscheint. Braucht er nach dem Durchschreiten der Kapuzinergruft eine Stärkung seines Bewusstseins von Macht und Ordnung und Dauer, sollte er um Eingang in die Kaiserliche und Königliche Schatzkammer nachsuchen und die Reichskleinodien betrachten, die bei allen Irr- und Wirrwegen Beständigkeit und Bleibendes garantieren, und wer könnte beim Anblick von so viel Gold und Silber, von so vielen Perlen und Edelsteinen, gestickten Gewändern und geschnitztem Elfenbein, von so vielen Jahrhunderten und so großer Machterinnerung nicht lächeln? Die Krone, der Mittelpunkt des Reiches. Das Reichsschwert, unter das sich viele Völker beugen. Die heilige Lanze, die die Seite Christi am Kreuz öffnete und den Bewohnern der Donaumonarchie den Eintritt in himmlische Bereiche sichert. Die Krönungsgewänder der Kaiser, der toten Kaiser. Mit großem Aufwand trug man sie in den Stephansdom und dann in die Kapuzinergruft zur ewigen Bewahrung.
Vom Tod Wolfgang Amadé Mozarts hat Wien kaum Notiz genommen. Mozart war nicht Mittelpunkt der Salons und der geselligen Zirkel. Manchmal hatte er als bewunderungswürdige Zugabe am Rande gestanden, und so wurde auch nur am Rande von seinem Sterben erzählt. Sein Grab wurde nicht zur festen Institution. Aber durch ihn wurde Wiens krankes Lächeln geheilt.
2
Einige Monate nach jenem grauen Dezembertag, an dem Wolfgang Amadé zu Grabe getragen wurde, ist Constanze Mozart fähig, die Hemden und Anzüge aufzuräumen, die Halstücher und Strümpfe, die Westen und Haarbeutel. Diese Sachen sind nicht viel wert, nur auf 55 Gulden geschätzt; Constanze würde freilich gar kein Geld mehr herausschlagen können. Vielleicht fände sie jemanden, etwa eine mütterliche Nachbarin, die aus Wolfgangs Anzügen Höschen und Jäckchen für den Karl schneidern könnte, wenigstens für den Karl. Der Kleine, Franz Xaver Wolfgang, Wowi genannt, ist noch kein Jahr alt und vorläufig mit Kleidchen versorgt; er kann ja in die Kleider des Bruders hineinwachsen.
Wann wird sie wieder Geld haben, um neue Sachen kaufen zu können? Täglich wird alles teurer. Eine Witwe mit zwei kleinen Kindern und ohne Vermögen kann da nicht mithalten. Alle anderen Kinder werden wärmer und hübscher gekleidet gehen als ihre beiden Buben. Bei fremden Leuten werden sie sich durchschlagen müssen, frühzeitig lernen, ihre Füße unter fremde Tische zu strecken. Das ist nun einmal so bei Musikantenwaisen. In der großen Welt sind die geistigen Kinder der Künstler beliebter und angenehmer, die kraftvollen Erfindungen, die Schönheit der Melodien, dargeboten mit höchster Geschmeidigkeit und Beweglichkeit der Finger. Wer fragt nach den leiblichen Kindern und ihrem Wohlergehen? Und vor allem wer fragt nach ihr, der Witwe?
Die Kinder werden ihren Weg schon finden. Kinder haben es leichter. Sie sind klein und niedlich. Schnell erobern sie alle Herzen. Den achtjährigen Karl wollen die Prager Freunde aufnehmen. Sie werden ihn mit allem versorgen, was er zum Leben braucht, mit Essen, Trinken, Kleidung, Lehrern und vor allem mit Musik. Und vielleicht wird man später auch den Kleinen liebevoll in der goldenen klingenden Stadt an der Moldau aufnehmen. Sie müsste nur vorsichtig genug anfragen. Der Name Mozart gilt ja in Prag mehr als in Wien.
Doch was wird aus ihr selbst? Eine alternde Witwe … Das hat ihr die Mutter gesagt, die alt und bitter gewordene Cäcilia Weber. Constanze kann sich nicht zu gemeinsamer Einsamkeit mit der Mutter entschließen. Sie fürchtet sich davor, noch einmal von der Mutter verheiratet zu werden. Eigentlich war die Ehe mit Wolfgang der Plan der Mutter gewesen. Dass diese Ehe dann einen anderen, glücklichen Weg ging, war nicht das Verdienst der Mutter. Und darüber war Cäcilia Weber böse.
Was nützte der Tochter jetzt die Kunst und die Liebeserinnerung? Hätte sie eine Metzgerei oder auch nur einen Milchladen, so wäre die Sache halb so schlimm. Erstens wirft ein solcher Laden genug ab, dass man davon leben könnte. Zweitens wären gewiss ältere Witwer oder Junggesellen der Überzeugung, man dürfe eine Frau mit einem solchen Gewerbe nicht allein lassen, es sei viel zu schwer für sie. Man müsse sie von dieser Last befreien, indem man sie von der Stelle weg heirate. Und sie, Constanze, brauchte ja nicht jeden zu nehmen.
»Ich bin nicht solch ein undankbares, ungetreues Weib!«, hat sie der Mutter entgegengehalten. »Ich denke nicht schon jetzt ans Heiraten, kaum, dass der Wolferl unter der Erde ist …«
Doch wie soll es weitergehen? Sie kann sich nicht auch noch nach Prag einladen lassen. Sie erinnert sich mit gemischten Gefühlen an die Stadt an der Moldau, in der Wolfgang sich so wohl fühlte. An die Villa Bertramka, in der sie bei den Duscheks wohnten. An die gemalte Balkendecke, unter der Wolfgang so gut arbeiten konnte und unter der sie, Constanze, neben der Frau des Hauses ein Nichts war, obgleich die berühmte Sängerin Josepha Duschek sich so freundlich zeigte. Lieber denkt sie an Professor Niemetschek vom Kleinseitner Gymnasium. Ein freundlicher, ein hilfsbereiter Mann. Doch was nützt das alles?
Aus ist es mit der Kunst. Denn eine Musik, die nur auf dem Papier steht, ist eben keine Musik mehr, wenn sie niemanden findet, der ihr zum Klingen verhilft. Alle diese Notenblätter, diese flüchtigen Skizzen, ausgeführten Stimmen und sorgfältig zusammengeschriebenen Partituren kommen ihr jetzt wie eine schöne Erinnerung vor, wie ein Brief, der niemals mehr vorgelesen wird. Ein wertvolles Andenken.
Nur noch denken, nichts mehr hören kann sie, während sie die Noten durchblättert. Sie weint über der Entdeckung, dass ihr kein Ton entgegenkommt, dass alle ihre Erinnerungen ohne Melodien bleiben, wiewohl sie viele Erinnerungen hat und wiewohl im Hause Mozart nichts geschah, was nicht mit Tönen, Akkorden, Melodien, Rhythmen und wechselnden Harmonien verbunden war. Die schwarzen Zeichen sind nur kalligrafische Schnörkel einer raschen und zielbewussten Hand, die dem Strom, der sich durch sie drängte, niemals Widerstand entgegensetzte. Die selbst mitformte, mitschwang, mitsang.
Constanze war niemals müde geworden, die Hand ihres Mannes beim Arbeiten, Schreiben und Spielen zu beobachten. Wolfgang war kein schöner Mann gewesen, doch eine schönere Hand als die seine hat sie nie gesehen. Jede Bewegung des Leibes und des Geistes prägte sich auch in dieser Hand aus. Klein war sie, zierlich, nervig und kräftig. Sie besaß nicht nur eine durch die Natur gegebene Kraft, sondern auch eine durch Übung und Erziehung erworbene. Diese Hand war aller Lautstärken fähig. In ihr lebte das zarteste Pianissimo ebenso wie das kräftigste Forte, das Legato wie das Staccato. Constanze kann sich jetzt leichter an die Hand erinnern, die alle diese Noten schrieb, als an die Klänge und Empfindungen, die in ihnen verborgen liegen.
Nun hält sie ein Taschenbüchlein in grünem, blumengemustertem Pappeinband in der Hand, Rücken und Ecken sind von Leder, um dem Büchlein Dauerhaftigkeit zu sichern. Ein Bändchen, geeignet für verliebte Verse oder empfindsame Abendgedanken. Doch für solchen Luxus hatte Wolfgang niemals Zeit gehabt. Er spielte, arbeitete, komponierte. In dieses Büchlein hatte er alle seine Kompositionen eingetragen, genau und ordentlich, fast wie ein Schulmeister. Er hatte eben doch Pedanterie vom Vater geerbt, der immer wieder mahnte, die Noten nicht zu verschleudern, nur bestes wasserfestes Notenpapier zu benutzen und mit unauslöschlicher Tinte zu schreiben. Constanze hatte sich die Ohren zugehalten, wenn sie solche Reden hörte. Und was nützt nun das pedantische »Verzeichnüß aller meiner Werke vom Monath Februario 1784 bis Monath …?«
Wolfgang hatte damit gerechnet, dass er selbst noch das Abschlussdatum einsetzen könnte, ehe er ein neues Heft begann, ein Verzeichnis neuer, noch erfolgreicherer Kompositionen, die ihm Ruhm und Anerkennungen eingebracht hätten, eine einträgliche angemessene Anstellung und vor allem Geld ... Geld für die wichtigsten Lebensbedürfnisse und noch darüber hinaus. Geld für Badeaufenthalte mit komfortabler Wohnung. Geld nicht nur für Bier, sondern auch für Champagner.
Was alles hätte er noch auf diese vierzehn leeren Seiten von rastriertem Papier eintragen können! Konzerte und Opern für die große Gesellschaft. Lieder für den Hausgebrauch. Nichts davon … Nun musste Süßmayr kommen und als letzte Komposition das Requiem einschreiben, das er zu Ende komponiert hatte, weil der Wolferl nicht mehr konnte. Ein Requiem, ausgerechnet eine Totenmesse … nein, das nicht! Der Süßmayr soll nicht kommen. An der letzten Stelle dieses grünen Büchleins soll kein Requiem stehen.
Das wird die letzte Eintragung bleiben: »Eine kleine Freymaurer-Kantate. Bestehend aus 1 Chor, 1 Arie, 2 Recitativen und ein Duo. Tenor und Bass …« Natürlich nur Tenor und Bass, Frauenstimmen sind in diesem Männerverein der Freimaurer nicht geduldet, die müssen sehen, dass sie an anderen Orten zur Geltung kommen. Dennoch, die Maurer der Loge »Zur neugekrönten Hoffnung« wollten an Frau Constanze ein gutes Werk tun. Sie gaben ihren Willen sogar in der Zeitung kund: »Verehrung und Dankbarkeit gegen den verewigten Mozart veranlassten eine Gesellschaft Menschenfreunde, die Herausgabe eines Werkes dieses großen Künstlers zum Vortheil seiner hülfsbedürftigen Wittwe und Waisen anzukündigen, eines Werkes, das man billig seinen Schwanengesang nennen kann, das er mit der ihm eigenen Kunst bearbeitet, und dessen Ausführung er zwei Tage vor seiner letzten Krankheit im Kreise seiner besten Freunde selbst dirigiert hat. Es ist eine Cantate auf die Einweihung der Freimaurerloge in Wien ...«
Hülfsbedürftige Witwe ... Constanze hatten diese Worte unbeschreiblich wohl getan. Als jemand sie fragte, ob es ihr denn nicht unangenehm sei, öffentlich in solcher Bedürftigkeit vorgestellt zu werden, war sie erstaunt.
»Warum nicht? Hat Wolferl nicht für die Öffentlichkeit gearbeitet? Nun soll die Öffentlichkeit für uns sorgen!«
Viel hatte die Sorge nicht eingebracht.
Im Anblick dieser sorgfältig geschriebenen Eintragungen erscheint ihr die Vergangenheit als sichere, geordnete, schöne Welt. Sie vergisst, dass sie immer in unsicheren Verhältnissen gelebt haben, dass sie nur selten über den morgigen Tag hinaussehen konnten, dass sie oftmals nur deshalb tanzten, um sich zu erwärmen, denn im Kellerverschlag war oftmals kein Holz mehr zu finden. Warum hat Wolfgang ihr und den Kindern kein Erbe aus dieser schönen, sicheren, heiteren Welt hinterlassen?
Sie vergisst, dass sie ihren Mann bewundert hatte, weil er aus solcher Lebensfülle lebte, dass er über Vorräte nicht nachzudenken brauchte. Vorräte hätten ihn gestört, seine innere Fülle gemindert. Constanze hatte sich ihm angepasst und nur an das Strahlen des heutigen Tages gedacht, an den Widerschein der Sonne auf den Wiener Palästen und Kirchenkuppeln. Jeder Tag brachte neue Farben, neue Klänge, wozu Vorräte? Doch dann kam das Erwachen. Kein Vermögen, kein Haus, keine üppige Pension. Nur diese Berge von wasserfestem, aber wertlosem Papier. Ein Papiererbe … Immer wieder sagt sie dieses Wort vor sich hin: »Ein Papiererbe, ein Papiererbe …«
Dann tritt sie vor den Spiegel. Sie ist noch immer eine ansehnliche Frau, noch nicht dreißig Jahre alt. Und doch hat sie das Leben schon hinter sich. Das Witwentum ist das langsamste und qualvollste Warten auf den Tod, das man sich vorstellen kann, mag die Witwe auch noch so jung sein!
Einförmig und gleichmäßig fließen die Tage dahin. Sie ist allein. Sie hat niemanden, dem sie sich anpassen könnte, sei es mit oder ohne Vorratsammeln. Es liegt doch nun einmal in ihrer Natur, sich anzupassen. Mozart hat ihr seine Lebensform gegeben, vielmehr, sie hat sie sich genommen. Sie hat in den Tag hineingelebt wie er, die Gunst der Stunde genossen, auf Sicherheiten verzichtet, den Klang des Geldes vor allem als lustiges musikalisches Geräusch empfunden. Nun merkt sie, wie diese Lebensform von ihr abbröckelt, und sie kann sie nicht festhalten.
Sie fühlt sich wieder dort angekommen, wo sie vor zehn Jahren aufgehört hat, bei dem Ölbild, das der Schwager Joseph Lange von ihr gemalt hatte, damals im Jahre 1782, am Anfang ihrer Ehe. Dieses Bild hatte seinen Platz über Wolfgangs Klavier gefunden.
Bedeutsame Stunden waren es für sie gewesen, als sie vor ihrem Malerschwager saß, mit Triumph angefüllt, denn sie, Constanze, war von dem jungen berühmten Musikus gewählt worden, ausgerechnet sie, die weder die Schönste, noch die Klügste unter den vier Schwestern Weber war, doch sie wurde nun Madame Mozart und kam heraus aus der Weberischen Enge mit dem ständigen häuslichen Ärger. Heute aber erscheint ihr der Triumph, der aus ihrem Porträt spricht, wie ein Hohn. Das hat sie nun geschafft, erreicht, das hat sie geerbt, hier im vierten, dem Musikzimmer:
1 harter Tisch, 1 Kanapee von altem Damast, 6 dito Sessel, 1 Rollschreibkasten, 1 Uhr und ein Gehwerk in vergoldetem Kasten, 1 Fortepiano mit Pedal, 1 Bratsche im Futteral, 1 lackierter Schriftenkasten, 2 Büchergestelle, 60 St. verschiedenes Porzellan, 1 messingnes Mörserl, 3 dito Leuchter, 2 Kaffeemühlen, 2 Glasleuchter, 1 blecherne Teekanne …
So steht es im amtlichen Inventarium. Das ganze Musikzimmer ist 125 Gulden wert, mit den Büchern und Musikalien kommen noch 23 Gulden und 41 Kreuzer dazu.
Auf all das schaut ihr Porträt überaus ernsthaft herab.
Jetzt erfreut sie nur, dass beide Buben ihr Aussehen geerbt haben, die weit geschwungenen Jochbögen, die fein gezeichneten Augenbrauen. Wolfgang hatte sich von diesem Bild eine Kopie anfertigen lassen und mit auf Reisen genommen. Wenn er keinen Erfolg hatte, wollte er sich durch dieses Bild trösten lassen und sprach mit ihm, wie er mit ihr selbst sprach: »Grüß dich Gott, Stanzerl! Grüß dich Gott, Spitzbub! - Krallerballer! - Spitzignas! - Bagatellerl! - Schluck und Druck! -«
Sie kämpft die Tränen nieder, Tränen halten nur auf. Soll sie sich zutrauen, auf eigene Faust Konzerte zu geben? Wenn nur der Kleine erst entwöhnt wäre! Aber er schreit noch immer nach der Mutterbrust. Auch jetzt. Vielleicht ist er das Erbe, das ihr wenigstens einen ruhigen Lebensabend sichert. Wolfgang … Sie will in diesem Namen eine Vorbedeutung sehen, eine Sicherheit. Bis sich diese Vorahnung erfüllt, bis dieses Erbe endlich Zinsen trägt, muss sie sich durchschlagen. Vielleicht hat sie Glück.
Sie klappt endlich das grüne Heft zu und legt es zu anderen Notenpapieren in eine eisenbeschlagene Truhe. Bei allen ihren Umzügen - und wie oft waren sie in Wien umgezogen! - waren der Flügel und diese Kiste immer am schwersten unter ihren Habseligkeiten gewesen. Die Kistenträger hatten darüber geschimpft, doch Wolferl verlangte, sie sollten vorsichtig mit diesen wertvollen Dingen umgehen.
Dann nimmt Constanze das schreiende Kind aus dem Bett und legt es an die Brust. Möge wenigstens dieser Sohn das zurückzahlen, was er jetzt aus ihr heraussaugt! Vier andere Kinder haben sich bereits davongemacht. Doch was wäre gewesen, wenn alle am Leben geblieben wären? Für zwei langen die Kleider des Vaters erst einmal.
»Schau da den Vater, Bub!«, sagt sie und tritt vor Mozarts Bild, das auch ihr Schwager Lange begonnen, aber nicht abgeschlossen hat, dieser Hans Dampf in allen Gassen. Bei ihm wurde nur selten etwas fertig. Wenigstens das Gesicht war schon ganz da, Wolfgangs alltägliches Gesicht. Er saß am Klavier und sah in die Noten, das Notenblatt jedoch war nicht auf dem Bilde zu sehen, nur das große Gesicht. Ganz von selbst setzt der Betrachter Mozarts Blick fort, der auf das begonnene Werk fällt. Man muss an diesem Werk arbeiten, man muss es fortsetzen um jeden Preis, man muss es vollenden. Irgendwie muss man dieses angefangene Bild vollenden. Constanze ist kein Mensch des unverbindlichen anonymen »man«; sie ist Wolfgangs Frau, nicht nur seine Witwe. Es ist ihre Sache … »Nun schläfst du ein und schaust nicht auf den Vater, du bist mir ein Schöner!«
Der Kleine schläft fest, und sie legt ihn zurück. Sie kann nun also ausgehen, schwarz gekleidet, wie es einer Witwe geziemt, selbstverständlich, das ist sie ihrem Gatten schuldig. Doch warum soll sie nicht auch schon weiße und sogar ein paar gelbe Tupfen von ihrem Gewand blitzen lassen; das ist sie ihrem Gemahl auch schuldig … Sie sieht in den Spiegel und rückt ihr Hütchen zurecht. Es ist neu und die Modistin gütig genug, auf die Bezahlung zu warten.
Constanze hört Schritte draußen auf der Treppe stampfen. Kann dieser Mensch nicht leiser gehen? Er wird den Kleinen aufwecken, und dann ist es nichts mehr mit dem Spaziergang. Und nun hört sie, wie nach ihr gefragt wird. Auch das noch! Der Mensch will zu ihr. Wenn er nur kein Gläubiger ist! Blitzschnell setzt sie das Hütchen ab. Man darf nicht sehen, dass sie etwas Neues besitzt, dass sie Geld hat oder auch nur Kredit …
Soll sie überhaupt öffnen? Aber wenn der Mensch sich dann lauter bemerkbar macht, wird der Kleine erwachen und schreien, und alles ist ärger als zuvor.
Also öffnet sie. Sie hört es schon an der Sprache: dieser Mann ist kein Wiener. Also kein Gläubiger. Sie atmet auf. Ein wohlaussehender, stattlicher Mann. Sie versteht den Namen nicht, nur dass der Herr ein Baron und der preußische Gesandte in Wien ist. Hätte sie doch nur das Hütchen aufbehalten! Doch jetzt kann sie es nicht aufsetzen, der Baron denkt sonst, sie wolle ihn hinauskomplimentieren. Und dazu hat sie keinen Grund. Sie traut ihren Ohren nicht:
»Ich komme im Auftrag und mit einer Bitte Seiner Majestät des Königs von Preußen …«
Constanze führt ihren Gast in Wolferls Arbeits- und Musikzimmer. Hat sie noch Kaffee im Haus?
»Ich schätze mich unendlich glücklich, Sie, sehr verehrte gnädige Frau, aufsuchen zu dürfen. Wie hart traf es mein empfindsames Herz, als ich hörte, dass Ihr begnadeter, genialer Gatte, unser aller Freund, so früh von seiner Kunst und seiner Familie scheiden musste! Was alles hätte er uns noch schenken können! Um wie viel ärmer ist die Welt durch seinen Tod geworden!«
Constanze nickt zu jedem Satz schmerzlich lächelnd und denkt: Was mag er nur wollen? Soll er doch sagen, was er möchte! Empfindsames Herz … Ein schönes Wort! Doch der Wolferl hätte ganz bestimmt darüber gelacht.
»Seine Majestät, der König von Preußen, würde sich unendlich glücklich preisen, wenn er einige Kompositionen Ihres Mannes erwerben könnte.«
Hat sie richtig gehört?
»Aber gnädiger Herr Baron, mein Mann ist tot, Sie sagten es doch selbst! Wie sollte er da …«
Der Baron lacht.
»Sie haben mich missverstanden, gnädige Frau. Seine Majestät, der König von Preußen, wünscht Handschriften aus dem Nachlass. Er hat mich beauftragt, Ihnen ein Honorar auszusetzen. Ich hoffe, dass Sie jetzt nicht mehr so stark angegriffen sind, dass Ihre Trauer und Ihr Schmerz Ihnen noch immer Geschäfte verbieten.«
O nein, möchte Constanze hinausjubeln, aber sie sagt nur:
»Ich sehe ein, dass es sein muss. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass Seine Majestät, der König von Preußen, bei meinem armen Mann etwas bestellt hat.«
»So verstehen Sie mich doch richtig! Ich möchte den Nachlass Ihres Gatten sehen, seine Handschriften. Ich möchte einige Stücke davon auswählen, ganz gleich, ob sie für den König von Preußen geschrieben wurden oder nicht.«
Constanze nickt. Mit dieser Möglichkeit hat sie nie gerechnet. Der Inhalt dieses Musikzimmers ist doch nicht nur ein Papiererbe. Es gibt Leute, die dafür Geld bieten, klingende Münze. Sie könnte sogleich das kokette Hütchen bezahlen. Und vielleicht brauchte sie den Karl nicht aus dem Haus zu geben.
»Ich kann warten, gnädige Frau. Ordnen Sie die Sachen, lassen Sie sich Zeit.«
Sie wird sich schon beeilen, denkt der Baron. Es geht ihr nicht gut. Er überreicht ihr seine Karte und geht.
Welch ein Wunder - der Kleine ist nicht aufgewacht! Constanze kann endlich ausgehen. Jetzt hat sie ein Ziel. Abbé Stadler muss helfen, der Freund, der Priester, der Orgelspieler, der stets Hilfsbereite. Sie weiß, dass er gerade in Geschäften seines Stiftes Kremsmünster in Wien weilt, sie wird ihn aufsuchen. Ihm wird sie von diesem Besucher erzählen, nicht dem Süßmayr und nicht dem Baron van Swieten. Stadler wird nicht gleich in alle Welt hinausposaunen, dass man sich um die Witwe Mozart und ihre unmündigen Kinder nun keine Sorgen mehr machen müsse, denn der König von Preußen kaufe Wolfgangs Noten, und andere würden seinem Beispiel folgen. Niemand sonst soll es erfahren und sein eigenes schlechtes Gewissen entlasten, denn davon ist Frau Constanze fest überzeugt, dass ihr und ihren Kindern gegenüber jedermann ein schlechtes Gewissen haben müsse. Wie gut, dass es den Abbé Stadler gibt! Doch sie wird es lernen müssen, Wolfgangs Kompositionen selbst zu beurteilen und zu verkaufen. Man wird sie sonst betrügen und hintergehen und übervorteilen. Die Welt ist schlecht und Abt Maximilian Stadler nicht immer zur Hand.
Ein junger Priester verweist Frau Constanze in die Kirche.
»Er übt. Er übt meistens. Ein fleißiger Mensch!«
Der fleißige Mensch ist erstaunt über Constanzes Besuch. Er ist sofort bereit, sein Spiel zu unterbrechen, kann es aber nicht lassen, Frau Constanze noch mit seiner virtuosen Fußtechnik in Erstaunen zu versetzen.
»Das sind halt die Tänze, die unsereinem erlaubt sind. Sehr angenehme Tänze übrigens. Es wird einem warm dabei. Doch Ihnen, liebe Madame Mozart, ist damit nicht geholfen. Sie frieren gewiss wie ein armer Wiener Schneider. Lassen Sie uns an einen freundlicheren und wärmeren Ort gehen.«
»Meinetwegen können wir hierbleiben. Hier haben die Wände keine Ohren.«
»Wollen Sie mir ein Geheimnis anvertrauen? Haben Sie etwa eine Erbschaft gemacht?«
Und Constanze sprudelt alles heraus. Der König von Preußen … Der preußische Gesandte … Jacobi oder so ähnlich heißt er, ja, das ist ein komischer Name, aber die Preußen heißen nun einmal so. Er sieht ganz gut aus, ein Mann von Welt und von feiner Lebensart, und er wird wieder kommen.
»Hat er Ihnen einen Antrag gemacht? Sollen Sie preußische Gesandtin werden?«
»Mit Ihnen kann man auch nicht vernünftig reden, Stadler! Sie sind genau wie der Wolferl.«
»Nein, leider nicht. Er war viel ernster als ich. Und er konnte träumen. Wie kann ich Ihnen helfen, liebe Frau Constanze?«
Als es Frau Constanze endlich gelungen ist, verständlich zu erklären, was der preußische Gesandte wollte, wird der Abbé nachdenklich und still.
»Sie sagen gar nichts, lieber Stadler! Gönnen Sie mir diesen kleinen Erfolg etwa nicht? Diesen ersten bescheidenen Lichtblick nach so vielen düsteren Wochen und Monaten?«
»Es tut mir weh, dass dieser Schatz, diese nicht gespielte Musik auf eine so weite Reise gehen soll. Wir werden sie niemals hören. Wir sollten sie zuvor abschreiben.«
»Dazu werden wir keine Zeit haben. Seine Majestät, der König von Preußen, wird nicht warten wollen. Und auf unsere Gefühle nimmt er ganz bestimmt keine Rücksicht. Wann kommen Sie?«
»Sofort, Frau Constanze, wenn ich Ihnen damit einen Dienst tun kann.«
Abbé Maximilian vergisst die Tür zur Orgelempore abzuschließen, er geht sogar am Weihwasserbecken vorbei, ohne sich zu bekreuzigen.
Der Kleine ist wach und schreit. Es riecht nach beschmutzten Windeln. Constanze muss zuerst den kleinen Wolfgang säubern.
»So führen Sie mich doch an den Papierberg, dann kann ich schon damit beginnen, etwas Brauchbares herauszusuchen«, brummt der Abbé, dem das Kindergeschrei missfällt.
»Diese eiligen Mannsleute … Die Kleinen sind schon genau so schlimm, wie die Großen. Hier, suchen Sie, Sie haben ja einen Blick dafür!«
Das ist leicht gesagt. Wie soll Stadler so schnell einen gangbaren Weg durch diese Tausende von beschriebenen Notenblättern finden? Und wie mit seinem Ordnungssinn vereinbaren, nicht zuerst eine Liste anzufertigen? Wie soll er seine Wissbegierde zurückdrängen? Er wird jedes einzelne Stück in die Hand nehmen und lesen wollen, wird es dabei zwischen den Notenlinien klingen hören. Wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate darf das dauern? Die Noten sind in einem heillosen Durcheinander. Die vielen Umzüge! Stadler kann sich vorstellen, wie es dabei zugegangen ist. Mit beiden Armen raffte Mozart alles, was auf seinem Flügel lag, zusammen und verwahrte es in Kisten und Truhen, was gerade da stand. Und wenn er dann heraussuchte, was er brauchte, dann wühlte er alles um und um, bald lag das Unterste zuoberst, und das Oberste kam nach unten. Dass ja die Witwe Mozart niemanden auf eigene Faust in diesem Notendurcheinander wühlen ließ!
Ihm fällt ein mit einem Bindfaden zusammengebundener Stapel von Notenblättern in die Hand. Es könnten Streichquartette sein. Man sollte sie für den Gesandten mit dem drolligen Namen bereit legen, dann liegt wenigstens etwas verfügbar da. Die Witwe Mozart braucht Geld, das weiß auch Stadler. Aber die Ordnung …
Auch alte Briefe oder Briefentwürfe scheint Mozart zwischen seine Noten gelegt zu haben. Die müsste man erst einmal herausnehmen. Ist es indiskret, sie zu lesen? Ach, das alles ist ja längst vorüber; wer fragt da schon groß nach alten Geheimnissen?
»Allerliebstes Bäsle Häsle! … Ob Sie mich noch immer lieb haben - das glaub ich … Ja, so geht es auf dieser Welt, der eine hat den Beutel, der andere das Geld, mit wem halten Sie es? Mit mir, nicht wahr? Das glaub ich. Jetzt ists noch ärger …«
Diesen schnell gekritzelten Briefentwurf steckt Stadler in die Tasche, in die eigene. Frau Constanze soll ihn nicht lesen. Noch nicht.
Sie kommt mit dem Kleinen auf dem Arm herein.
»Ich habe schon etwas Passendes gefunden, liebe Madame Mozart. Der preußische Baron kann kommen.«
3
Es dauert lange, ehe Seine Majestät, Friedrich Wilhelm II., seit 1786 König von Preußen, einen inneren Grund und somit auch die erforderliche Zeit findet, die teuer bezahlten Streichquartette von Mozart anzuhören. Viel zu teuer bezahlt, das finden alle, die davon wissen. Und ausgerechnet Streichquartette, die kann man auch am preußischen Hof herstellen, die braucht man wirklich nicht aus Wien kommen zu lassen! Wenn es sich noch um eine Oper gehandelt hätte; mit den Opern hapert es in Berlin.
Solche Reden sind natürlich auch an des Königs Ohren gedrungen, und er fürchtet sich vor allem, was gegen ihn spricht. Er muss in Zukunft noch vorsichtiger werden. Von seinen Absichten, Plänen, Wünschen und Sehnsüchten darf er der Öffentlichkeit noch weniger preisgeben. Gerade jetzt. Der Pariser Pöbel hat den König von Frankreich kurzerhand auf das Schafott befördert, nein, nicht den König, sondern den Bürger Louis Capet. Ein königliches Haupt war in die Sägespäne gerollt. Von diesem Bild kann sich der preußische König nicht befreien. Gewiss, die Franzosen sind Feinde von alters her, aber König ist König.
Friedrich Wilhelm II. kann einige Nächte schlecht schlafen, und da fallen ihm Mozarts Streichquartette ein. Jetzt, gerade jetzt will er sie hören. Und zwar ganz allein. Königlichen Schmerzen kommt königlicher Trost zu. Die anderen haben ja seine Sorgen nicht. Sie sollen an seinen Tröstungen nicht teilnehmen. Nicht der Reichardt oder der Neefe soll sich mit diesen Streichquartetten abgeben, sondern der Chef der Tafelmusik - wie heißt er doch gleich?
»Am Sonntag Abend möchte ich zwei Quartette hören!«
Der Chef der Tafelmusik verbeugt sich verblüfft; am preußischen Hof gerät die musikalische Weltordnung durcheinander! Er schreibt die Stimmen ab und übernimmt selbst die erste Violine. Auf den Blättern steht kein Name. Hat sich etwa ein Neuer beworben? Der würde gewiss sofort genommen - bei dieser Musik!
Großes Rätselraten bei der Tafelmusik. Soll man gut oder schlecht spielen? Wenn man diese Musik auch noch gut spielt, dann nimmt der König den neuen Bewerber ganz bestimmt. Doch die Musiker können nicht anders, diese Musik müssen sie gut spielen. Es ist fast gemütlich am Sonntagabend, eine kleine Runde nur, der König, die vier Musiker, der Leibkammerdiener. Keine offizielle Tafelmusik, keine Damen, keine Staatsgeschäfte, keine Intriganten. Die Musikanten vergessen beim Spielen sogar die Anwesenheit des Königs. Und der König vergisst einen Teil seiner Angst.
Dies sollen sie mir nicht nehmen. Es muss Dinge geben, die nur dem König gehören. Gärten, in denen nur er spazieren gehen darf. Pferde, die nur ganz allein ihn tragen. Frauen, die nur für ihn lächeln. Und Musik, die nur für ihn erklingt. Er will diese Quartette als nur für sich geschrieben betrachten. Mozart wird ähnliches für niemanden mehr schreiben. In Frankreich haben sie den König vom Thron gestoßen, und nicht nur das. Auch auf mich schauen sie mit scheelen Augen. Auch an den Grundfesten meines Staates werden sie rütteln. Ich werde ihnen die Hände abschlagen, wenn es sein muss. Besser wäre es, wenn es nicht sein müsste. Es muss noch ein Reich geben, an dem sie nicht rütteln können. Niemand außer mir soll diese Musik hören. Sie ist nicht für den Pöbel.
Nachdem die Musikanten auch das zweite Streichquartett gespielt haben, geschieht etwas Ungewöhnliches: Der König lässt sich die Noten geben. Nein, sie sollen nicht in der Bibliothek aufbewahrt werden. Dorthin hat ja fast jeder Zutritt. Der König klemmt die Noten unter den Arm und geht mit ihnen hinaus.
Seit jenem Abend hat niemand mehr diese Streichquartette gehört oder gesehen.
4
Maria Anna Thekla Mozart sieht schon die Schwelle des Matronenalters vor sich, und sie fürchtet sich mit allen Kräften ihres Herzens davor, hat sie doch die Schwelle des Frauentums noch nicht einmal überschritten, muss sie doch noch immer die Anrede Jungfer ertragen, wenigstens die Anrede. Und wenn schon Matrone und doch nicht Frau, dann wenigstens Mutter … Lass die Leutewelt reden, wichtig ist allein, dass ihre eigene Welt stimmt, dass ihr Herz einen Punkt findet, auf den es zufliegen, an den es sich klammern kann; und an welchem Punkt, an welchem Halt hinge ein Frauenherz fester als an der Mutterschaft?
So hat sie keine Rücksichten mehr genommen, keine Widerstände entgegengesetzt, hatte sich nehmen und geben lassen, was die Natur mit sich brachte. Aus dem Spiel ist Ernst geworden, auch noch an der Schwelle zur Matrone. Eine Frucht drängt zur Reife, eine herbstliche Frucht schon, mit aller Süße und Qual des Herbstes.
Geschickt und verständnisvoll hantiert die Wehmutter neben der Stöhnenden, hält ihre Hand, kühlt die Stirn, fragt nicht nach dem Mannsbild, das dies alles verursacht hat. Hier ist es nicht mehr nur um Lust und Spiel und Rausch gegangen, das sehen die erfahrenen Augen der Wehmutter, hier ging es um das Überleben, um das Weiterleben. Die Mozartin braucht einen Platz in der Welt, und sie braucht jemanden, für den sie diesen Platz verteidigen kann, denn dem Menschen gehört nur das, was er verteidigen muss. Mit 35 Jahren hat es Maria Anna Thekla Mozart längst erfahren, weiß es mit aller Bitterkeit und Entschlossenheit.
Sie wehrt sich nicht gegen die wütenden rasenden Schmerzen, die durch ihren Körper schneiden, die sie auszulöschen drohen; entweder dies - oder nichts. Lieber die Schmerzen zu einem Gipfel auf einen Tag zusammentürmen, als sie auf den langen Rest des Lebens verteilen. Was ist alles Gerede der Menschen gegen die Schmerzen der zweiten Lebenshälfte?
»Seien Sie tapfer, es kann noch dauern.«
Das ist die Stimme der Wehmutter, der unverwüstlichen Augsburgerin, deren geschicktem Dienst so mancher Bürger sein und das Leben seiner Familie am Lech verdankt.
Familie - das allerdings wird es nicht geben für Maria Anna Thekla Mozart. Bis zu ihrem 30. Lebensjahr hat sie nicht an Familie gedacht, und hernach war es zu spät. Sie war das Bäsle vom Wolfgang Amadé Mozart gewesen. Allerliebstes Bäsle-Häsle … Sie hatten so viel miteinander gespielt, dass sie dann für die Wirklichkeit keine Kraft und Stärke und vielleicht auch keinen Blick mehr hatten. Fand ihre damalige Liebe deshalb keine Erfüllung, weil sie kein Ende des Spiels finden konnte? Solche Gedanken pressen nur die Schmerzen aus ihr heraus.
Sie glaubt fest, dass sie mit einem hohen Einsatz an Kraft das, was ihr jetzt noch zu einer Familie fehlt, wird ersetzen können.
Ein Kind wird sie haben, Mutter wird sie sein, das braucht sie nicht mehr zu spielen. Und ein männliches Wesen als Beschützer und Teilhaber an solchem Idyll findet sich vielleicht, und wenn nicht, wird sie diese Rolle auch noch übernehmen. Die Schmerzen bringen noch andere Gedanken ans Tageslicht. Das Spiel von damals ist noch nicht aus, noch nicht vorüber. Eigentlich fühlte sie sich immer an ihn gebunden. Dieses Kind hat sie sich und dem andern erst erlaubt, als Wolferl tot war. Bei der Nachricht von Mozarts Tod hatte sie nicht nur Schmerz empfunden, sondern auch erleichtert aufgeatmet. Nun endlich fühlte sie sich entlassen. Doch jetzt bei der nächsten Schmerzwelle steigt neue Unruhe, neues Erstaunen in ihr auf. Irrtum, großer Irrtum! Das Spiel ist nicht aus. Denn der Herr Vetter ist gar nicht gestorben. Nur seinen Körper haben sie irgendwo verscharrt. Die Frau, die mit ihm verheiratet war, geht nun schwarz gekleidet, doch der Herr Vetter wird weiter leben, weiter spielen. Soll sie davor Angst haben? Nein. Doch sie fragt sich: Wie wird er an dieser, ihrer neuen Gemeinschaft teilnehmen? Jetzt gehört er ihr genau so viel und so fest, wie er zu richtigen Lebzeiten den anderen gehört hat. Jetzt gibt es doch keine Eifersucht mehr. Nicht gegenüber Constanze, nicht gegenüber der Mutter, auch nicht gegenüber der Base Nannerl. Mein Gott, was gäbe das Bäsle darum, einmal mit dem Nannerl sprechen zu dürfen. Nannerl ist die Vernünftigste aus der Familie. Solche Vernunft muss schließlich zur Weisheit führen.
»Wie - lange - noch?«, stöhnt sie die Wehmutter an.
Die lächelt nur. »Nicht mehr lange, nicht mehr lange …«
Seltsam! Ist es Einbildung, ist es Wirklichkeit, ist es eine Mischung aus beidem? Seitdem Mozart in des Bäsles Erinnerung, in ihr Gedächtnis zurückgekehrt ist - wiewohl er niemals ganz daraus verschwunden war -, der ganze Mensch, nicht nur in der überschäumenden Lustigkeit seiner frühen Jahre, seitdem geht der Atem trotz aller Schmerzen ruhiger, entkrampfen sich ihre Hände, entspannt sich ihr gequälter Körper, und die Wehmutter erschrickt: Ist diese Jungfer doch schon zu alt zum Gebären? Gibt sie so kurz vor dem Ende den Kampf auf? Nein! Leicht und fast lächelnd geht Maria Anna Thekla durch das Ziel, und als die Sonne sinkt, hält sie das Kind in den Armen, ein Mädchen. Und das Bäsle weiß, dass sie dieses Mädchen Viktoria nennen wird, zum Zeichen des Sieges über die Schmerzen der zweiten Lebenshälfte. Viktoria! Dazu werden ihre eigenen Namen kommen, Maria Anna. Eigentlich sind es nicht nur ihre Namen, auch Nannerl heißt ja so, auch andere Mädchen aus den verschiedenen Mozart-Familien. Wichtig ist dieser Name vor allem wegen Nannerl, Nannerl, die Fast-Schwägerin wird sie verstehen.
Bald sind die Schmerzen vergessen, und die Wehmutter freut sich. Grüß dich Gott, du neues Augsburger Menschenkind, grüß dich Gott!
So herzliche Grußgedanken hegt Nannerl nicht, als ihr nach längerer Zeit die Nachricht von diesem neuen Menschenwesen zukommt. Wie sehr hat sie sich mit ihrem letzten Kind herumquälen müssen, dem Kind eines vierundfünfzigjährigen Vaters, kein Wunder! Nach wenigen Monaten war es gestorben, ausgelöscht, trotz aller Mühe und Pflege und Ängste. Und diese Augsburgerin ging hin, schaffte sich in ihren Jahren noch ein Kind an und trug es aus, brachte es zur Welt, als sei das gar nichts, ohne Mann, ohne Haus - diese Mühe hatte sie sich gespart. Und trotzdem hat sie nun ein Kind und, wie es hieß, ein kräftiges, gesundes. Es würde ihr bleiben, sich nicht gleich wieder davonmachen als undankbares Geschöpf. Und dieses Kind hieß Maria Anna, was sollte dabei noch dieser ungewöhnliche Name Viktoria?
Doch dies ist nicht Nannerls größter Kummer. Am meisten schmerzt es sie, dass dieses Kind den Namen Mozart tragen darf, tragen muss. Unter welchen Schmerzen hatte Nannerl damals ihren Namen Mozart geopfert, ihn dafür in die Wagschale geworfen, dass sie ihren Platz in der Welt finden durfte. Gewiss, es war ein begehrter, ein höchst angenehmer Platz, den Nannerl sich da erkauft hatte, das Pflegegerichtshaus in St. Gilgen am Abersee, und dieses Haus bot so wertvolle Erinnerungen, war es doch von Nannerls Großvater, dem Pfleger Wolf Niklas Pertl, erbaut worden, war doch darin doch ihre Mutter geboren worden. Nun ist der Reichsfreiherr Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburg Pfleger zu St. Gilgen. Er trägt seinen Namen zu Unrecht. Von Sonne ist bei ihm nicht viel zu spüren … Doch das zweigeschossige langgestreckte Haus liegt wohlig unter der Sonne von St. Gilgen.
Nannerl wirft einen kleinen Hass auf das Augsburger Mädchen, das Mozart heißen darf, und sie fühlt dabei die Last ihres eigenen Namens: Maria Anna von Berchtold zu Sonnenburg. Gut, dass diese Augsburger Verwandten so weit entfernt leben, gut auch, dass Wolferl das nicht mehr erleben muss: ein lediges Kind in seiner Familie. Sie streicht ihrer vierjährigen Tochter Jeanette über die Haare und beschließt, nicht mehr an das Bäsle zu denken. Für sieben Kinder hat sie zu sorgen. Sie ist die dritte Frau ihres Gatten, fünf Kinder hat sie aus den ersten beiden Ehen übernehmen müssen. Oftmals geht dieser Nachwuchs über ihre Kräfte. Nicht genug mit der Arbeit und der Last, die ohnehin da ist, von selbst, eine so große Familie bringt eben Arbeit mit sich - die Kinder, zumal die Jungen, denken sich zusätzliche Lasten aus, räsonnieren, treiben Schabernack, machen der neuen Mutter das Leben schwer und empfinden das als einen Riesenspaß. Und der Vater? Dieser trockene Mensch stellt sich meist auf die Seite seiner Kinder … Erst, als Nannerl ein eigenes Kind trug, ergriff er Partei auch für sie.
Damals hatte Nannerl eine schöne, eine angenehme Zeit für sich heraufziehen sehen. Ein Sohn! Am 27. Juli 1785 wurde er in der Salzburger Andräkirche auf den Namen Leopoldus Alois Pantaleon getauft, Leopold von Berchtold zu Sonnenburg. Großvater Leopold Mozart war überglücklich. Ein Erbe, ein Salzburger Erbe! Es fiel Nannerl nicht gerade leicht, aber sie überließ das Kind dem Großvater. Sollte er es um sich haben, er hatte es verdient. Und er glaubte, dass sich wiederholen könnte, was sich in seinem Hause schon einmal ereignet hatte: das Reifen und Erstarken eines musikalischen Genies. Ein Spross aus der Familie Mozart musste musikalisch sein, wenn er auch einen anderen Namen trug!
Stundenlang saß der Großvater am Bettchen des Kleinen und betrachtete die winzigen Hände. Der geschickteste Klavierspieler konnte seine Finger nicht so schön auf die Klaviatur setzen, wie Nannerls Sohn seine Händchen auf die Bettdecke legte, wenn er schlief. Großvater Leopold hörte inwendig leise Klaviermusik und bedauerte nichts mehr, als dass der Enkel noch nicht drei Jahre alt war, denn zu diesem Zeitpunkt würde er ihn sogleich ans Klavier setzen und spielen lassen. Leopold Mozart freute sich auf den Augenblick, in dem er den Kleinen zum ersten Mal mit den Tönen einer Geige bekannt machen wollte, er, der Verfasser einer weit bekannten Violinschule. Vorerst versuchte er es mit einem metallenen Leuchter. In den Händen eines geschickten Musikers kann eben alles zum Musikinstrument werden. So schlug er mit einem Schlüssel gegen das Metall, bald laut, bald leise, dazu sang er, und der Kleine horchte auf, wandte kein Auge vom Großvater, hielt die Händchen still, lag unbeweglich und versuchte nicht einmal, sich die Strümpfchen auszuziehen, was er sonst immer zu tun pflegte. Diese Aufmerksamkeit hielt der Großvater für ein sicheres Anzeichen des musikalischen Genies. Er, Leopold Mozart, starb im Jahr darauf, und so blieb ihm die große Enttäuschung erspart. Nannerl verfiel in tiefe Trauer und nahm ihr Söhnchen mit nach St. Gilgen, fand jedoch nur selten Zeit, sich um die Pflege seiner musikalischen Anlagen zu kümmern. Bald konnte sie feststellen, dass sich das auch gar nicht lohnte. Klein-Leopold konnte die Töne eines Klaviers kaum von denen einer Geige unterscheiden, er war nicht imstande, das allerkleinste Kinderlied zu behalten, brummte nur die Worte in willkürlichen Tonabständen vor sich hin, war dabei zwar vergnügt und fröhlich, bereitete aber seiner Mutter alles andere als Vergnügen. Kein Mozart, sondern ein Berchtold. Ein zukünftiger Beamter oder Soldat.
Ob das Kind des Bäsle musikalisch ist?
5
An jedem Montagnachmittag empfängt Frau Constanze Freunde und Freundinnen, so wie es jetzt Brauch auch in der bürgerlichen Welt Wiens ist. Man sitzt beieinander und nimmt bescheidene Speisen und noch bescheidenere Getränke ein. Man versichert einander ewiger Freundschaft und vergießt bisweilen Tränen im Gedenken an die Verstorbenen. Man ergötzt das Ohr mit Gesang und Instrumenten. Constanze setzt ihren Ehrgeiz daran, dass sich jedermann in ihrem Hause wohlfühlt. Sie hat herausgefunden, dass sie etwas besitzt, was ihren ständigen Geldmangel aufzuwiegen imstande ist: ihren Namen. Sie fühlt sich wohl bei der Erfahrung, dass ein Name Kredit sein könne. Mozart … Nicht einmal ein besonders schöner, ein musikalisch wohlklingender Name. Die italienischen Namen klingen besser: Salieri, Paisiello … Und dennoch, jeder spricht es voller Ehrfurcht und Bewunderung aus: Madame Mozart …
Und fast jeder bemüht sich darum, ihr kleinwinzige Freuden zu bereiten. Man bringt ein Stückchen Marzipan mit, eine seltene Blume, eine neue Arie, einen Scherenschnitt zum Angebinde. An diesem Montag erhält Constanze ein Buch. Madame N. gibt es ihr mit Nachdruck in die Hand, als sei es etwas ganz Wertvolles, Einmaliges.
»Eigentlich hat man es mir verehrt. Doch als ich es durchblätterte, wurde es mir deutlich, dass nur Ihnen, liebste Madame Mozart, dieses Büchlein zukommt. Schauen Sie nur, Sie werden staunen. Wer hätte das gedacht, dass das Andenken Ihres lieben Gatten einmal so …«
Schon hat Constanze das Buch aus dem Papier gewickelt.
Nekrolog auf das Jahr 1791 - steht darauf geschrieben, umgeben von Schnörkeln und Schwüngen. Auch zu einem Bild hat sich der Herausgeber dieses Büchleins aufgerafft, ein Bild, wie Frau Constanze es liebt. Auf einem runden, aus Ziegeln gemauerten Opferaltar brennt ein Opfer- und Gedächtnisfeuer. Davor kniet verschämt ein nackter Knabe, hat eine große Tafel an den Opferaltar gelehnt und schreibt mit einem ehernen Griffel ein Totengedächtnis, wie es einem Nekrolog zukommt. Ein Totengedächtnis etwa auf … ?
Ja. Das Büchlein enthält den Nachruf auf Wolfgang Amadé. Frau Constanze schlägt das Herz heftiger.
Diesen Nachruf hat Monsieur Friedrich von Schlichtegroll verfasst, Bibliothekar und Gymnasialprofessor in Gotha im fernen Thüringen, in einem fremden Land. Woher hatte der Autor seine Informationen bezogen? Von ihr jedenfalls nicht. Ihr Gesicht bewölkt sich. Hoffentlich steht in diesem Büchlein nicht der übliche Klatsch und Tratsch der Wiener Gesellschaft, von dem auch sie schon Kostproben schlucken musste, was ihr sehr missfiel, obgleich sie im Allgemeinen dem Klatsch nicht abgeneigt ist. Was wird alles erzählt! Mozart, der Leichtfuß, der Don Juan, der Spieler, der Schuldenmacher. Mozart, der den Kopf nur hoch tragen und sich keiner gottgewollten und gottgegebenen Obrigkeit beugen wollte …
Constanze dankt der Freundin mit überschwänglichen Worten, dann bittet sie die erstaunte Gesellschaft, sie für ein halbes Stündchen zu entschuldigen, sie müsse sich ein wenig zurückziehen. Nanu? Übelkeit, Launen, Verstimmungen, Kopfschmerzen? Die Madame wird doch nicht etwa …? Sie ist jung und kraftvoll, eigentlich wartet jedermann darauf, dass sie …
Constanze kommt umwölkten Blickes zurück, ist ungewöhnlich schweigsam und mit ihren Gedanken nicht bei der Montagsgesellschaft. Und die ersten gehen früher als sonst, und schon auf der Treppe beginnen sie zu tuscheln. Sieh mal einer an, die Madame Mozart … Und überhaupt … Und einen Kult macht man jetzt mit diesem Mozart! Sogar Bücher werden über ihn geschrieben. Wenn man nun über jeden Musikus Bücher schreiben wollte, das Papier reichte nicht aus!
Constanze ist empört. Sie hat den Nachruf zwar nur überflogen, längere Zeit wollte sie der Gesellschaft nicht fernbleiben, aber das ist ihr klargeworden: Mit diesem Nachruf erweist man dem armen Wolfgang und ihr selbst keinen Dienst. Der größere Teil der Informationen stammt von Mozarts Schwester in St. Gilgen. Nun ja, das mag hingehen, obgleich Constanze überzeugt ist, dass Schwestern schlechte Informantinnen sind, weil für sie nur die Kinderzeit und Jugend ihrer Brüder wichtig, interessant und von eigenen Erfahrungen geprägt ist. Was danach kommt, sehen sie mit der Brille des Kritikers oder des Sittenrichters. Und überhaupt weiß eine Ehefrau am meisten. Sie allein kennt Seiten ihres Mannes, die für alle anderen im Verborgenen bleiben müssen. Wiener Klatsch und Gerüchte! Das alles ist nun gedruckt, und sie kann sich nicht mehr dagegen wehren, nichts verbessern.
»Wem, der jemahls bei den Harmonien dieses großen Tonkünstlers sich bald in süsse Empfindung verloren gefühlt, bald den unerschöpflichen Reichthum seiner Ideen bewundert hat, … muss es nicht willkommen seyn, etwas von der merkwürdigen Lebensgeschichte dieses frühentwickelten, grossen und originellen Genies zu hören! … Der Mensch mit wunderähnlichen Gaben und Fertigkeiten von der Natur beschenkt, ist selten ein allgemeines Muster zur Nachahmung für Andere. So wie seine Vollkommenheiten uns übrigen unerreichbar sind, so können auch seine Fehler nicht zu unserer Entschuldigung gereichen. Um sich brauchbare Regeln für das praktische Leben abzuziehen,. . . müssen wir nicht jene seltenen Menschen zum Muster auswählen, sondern vielmehr Geister von mittleren Gaben … ER erfüllte die großen Erwartungen, ... auf eine vollkommen befriedigende Art und ward … der Lieblingskomponist seines Zeitalters … Mozart zeichnete sich durch keine besonders einnehmende Körperbildung aus. Er war klein, hager, blass, und verrieth nichts ausserordentliches in seiner Physiognomie. Sein Körper war in ständiger Bewegung; immer musste er mit den Händen oder Füssen etwas zu spielen haben … Denn so wie dieser seltne Mensch früh schon in seiner Kunst Mann wurde, so blieb er hingegen - diess muss die Unparteylichkeit von ihm sagen - fast in allen Verhältnissen beständig Kind. Er lernte nie sich selbst regieren; für häusliche Ordnung, für gehörigen Gebrauch des Geldes, für Mässigung und vernünftige Wahl im Genuss hatte er keinen Sinn. Immer bedurfte er eines Führers, eines Vormundes, der an seiner Statt die häuslichen Angelegenheiten besorgte, da sein Geist beständig mit einer Menge ganz anderer Vorstellungen beschäftigt war, und dadurch überhaupt alle Empfänglichkeit für andere ernsthafte Überlegung verlor … So beträchtlich sein Einkommen war, so hinterliess er doch, bey seiner überwiegenden Sinnlichkeit und häuslichen Unordnung, den Seinigen weiter nichts, als den Ruhm seines Namens …«
An den folgenden Montagnachmittagen ist Constanze befangen. Sie glaubt den Gratulationen zu Schlichtegrolls Aufsatz, der inzwischen in Wien bekanntgeworden ist, nicht. Überall wittert sie Ironie und Kritik. Mozart hinterließ ihr nichts als den Ruhm seines Namens. Ihr einziges Kapital ist das Bild des genialen strahlenden Kindes Mozart, das gewissermaßen ihrer Pflege anvertraut war. Der Tod hat daran nichts geändert. Sie trägt das Kinderbild mit sich herum, hütet es eifersüchtig und wehrt sich doch dagegen, zugleich ist sie böse auf diesen fernen Schlichtegroll, der das Kinderbild seiner Strahlen entkleidet. Unsicher ist sie, das ist es! Doch das darf niemand erfahren. Wenn dieser Aufsatz nur bald in Vergessenheit geriete!
Da trifft sie eine neue erschreckende Nachricht. Der Aufsatz aus dem Nekrolog soll gesondert gedruckt und unter dem Titel »Mozarts Leben« veröffentlicht werden. Dann braust diese ihr so unangenehme Welle noch einmal über die Musikwelt hinweg. Das aber muss Constanze verhindern, koste es, was es wolle.
Es kostet viel. Es bleibt ihr nämlich nichts anderes übrig, als alle Abdrucke von »Mozarts Leben« selbst aufzukaufen und so ihre Verbreitung zu verhindern. Sie stapelt die Hefte neben die Bücher und Musikalien in Wolfgangs Arbeitszimmer. Noch mehr Papier, bezahlt mit einem Teil des Geldes, das sie vom preußischen König erhielt. Vielleicht wird sie diese Abdrucke vernichten, wenn ihr danach zumute ist, sie zerreißen, darauf herum trampeln, verbrennen …
Sie muss alles daran setzen, die Fäden, die zum Namen Mozart führen, selbst in der Hand zu behalten. Dieser Name ist ihre wichtigste Erbschaft.
6
Während eines langen Vormittags hat Constanze die Wohnung aufgeräumt. Lange hat es gedauert, denn nichts lag an dem Platz, an den es gehörte. Sie musste endlich versuchen, ein Ende der bunten Verstreutheit zu finden. Die Fränzi half, die Fränzi aus dem Laden unten, die sich wundert, dass Madame Mozart ihr schon vor Arbeitsbeginn ein nicht einmal kleines Trinkgeld in die Hand drückt, Madame Mozart, die doch Wert darauf legt, nichts zu beißen und zu brechen zu haben. Fränzi seufzt beim Anblick der Wohnung. Sie ist in die Jahre gekommen, in denen es sie mit Abscheu erfüllt, immer wieder einen neuen Ordnungsanfang finden zu müssen. Werden die Leute niemals vernünftig und ordentlich? Muss man immer wieder von vorn beginnen? Mit den Taschentüchern, die auf dem Fußboden herumlagen, mit den seit Tagen nicht gereinigten Kaffeetassen, mit den verklebten Bonbonresten, den vertrockneten Blumen im übel riechenden Wasser? Hatte die Madame Mozart keinen Mechanismus in sich, der alles von selbst erledigte, wenn man nur mit dem richtigen Handgriff begann? Nein, diesen Mechanismus gibt es nicht, stellt Fränzi fest. Die Madame bemüht sich zwar, gewiss. Sie streicht die Deckchen auf den Tischchen glatt und zupft sie in die Mitte und in rechte Winkel. Dann aber läuft sie schon wieder fort und kocht einen Kaffee, dass es nur so durch die unordentliche Wohnung duftet. Sie setzt sich ans Klavier und klimpert darauf herum, erschrickt dann über sich selbst und bindet die Schürze fester - ach, auch sie sucht nach diesem Uhrwerk, nach dem die Tage regelmäßig und ordentlich und gesichert verlaufen müssen, und wie sie danach sucht!
Doch nun ist alles fertig, Constanze fühlt sich erschöpft, aber ihr ist wohler. Aus dem Anblick dieser aufgeräumten Wohnung will sie aufbrechen zu neuen Zielen. Nun sitzt sie wieder bei einer Tasse Kaffee und überlegt, wie sie es zu solcher Sicherheit bringen könnte, dass sie sich ein eigenes Dienstmädchen leisten könnte, ein junges, unerfahrenes, das sich nicht einmal in Gedanken über ihre Herrschaft wundert oder sie gar kritisiert. Und nicht fragt:
»Weshalb kann die gnädige Frau diesem dänischen Legationssekretär nicht selbst die Tür öffnen? Weshalb muss ich warten, bis er kommt? Mir pressiert's doch auch; bei meiner Herrschaft gibt's doch auch genug zu tun!«
»Du wartest«, entscheidet Constanze und bewilligt ein weiteres Trinkgeld. Man ist zwar aus den schwierigen Jahren heraus, muss sich aber doch noch immer vorsehen mit den Mannsbildern. Das Dienstmädchen wird öffnen. Das Dienstmädchen ist da, man ist nicht allein, man hat das nicht nötig.
Es klingelt, und das Dienstmädchen nimmt die Karte entgegen, lässt den Besucher einige Augenblicke warten, sagt dann: »Die gnädige Frau lässt bitten!« Atmet auf. Endlich kann Fränzi gehen.
Georg Nikolaus Nissen, Däne, Sekretär an der dänischen Gesandtschaft, tut sich noch immer schwer in der Wiener Umgebung. Er merkt, dass man hierzulande das allzu Blonde, allzu Breitschultrige nicht gerade schwärmerisch verehrt, dass die Zuhörer und Gesprächspartner mitunter ihr Lächeln verbergen müssen, wenn er sein dänisches Deutsch spricht, sein breitgedrücktes, gequetschtes sch, seinen weichen Singsang. Diese Sprache ertragen die Wiener dennoch wohlwollender als das abgehackte, kurzvokalige Preußisch. Trotzdem klingt ihnen Nissens Tonfall zu treuherzig, gar zu unbeholfen, zu unstädtisch.
Nissen hat erfahren, dass die Wiener ein gutmütiges Völkchen sind, dass sie weder Aversionen noch Aggressionen gegen Fremde hegen, aber diese Erfahrungen bestärken ihn noch in seiner Unbeholfenheit. Er zieht sich gern hinter seine Legationssekretärsmiene zurück und gewinnt darin seine einzige Sicherheit. So tritt er heute auch Frau Constanze gegenüber, die ihn kürzlich auf einer Gesellschaft kennengelernt hat, befleißigt sich diplomatischer, aber steifer Umgangsformen. Es ist ihm bewusst, dass die Madame Mozart weiß, ein wie kleines Amt er zu verwalten hat, wie wenig es abwirft, wie klein das Land ist, aus dem er kommt, wie wenig er gilt auf dem Wiener Diplomatenparkett.
Constanze kommt ihm wohlwollend und freundlich entgegen, bietet ihm einen bequemen Platz an, schwätzt munter drauflos und lächelt nicht darüber, dass er seines Singsangs so gar nicht Herr werden kann.
Es dauert nicht lange, und er fühlt sich wohl in dieser Wiener Wohnung. Wie freundlich und gemütlich und wohnlich ist das alles! Nichts von der in Dänemark sprichwörtlichen Wiener Schlamperei! Sollen sie doch schweigen! Hier lebt man nicht schlampig, auch nicht in Künstlerkreisen.
»Noch einen Kaffee, Herr Hofrat?«
Sie schenkt nach, ohne die Antwort abzuwarten. Sie ist geübt im Kaffeeschenken und weiß genau, dieser da möchte immer noch einen.
Nissen lehnt sich zurück. Er weiß, dass er den Wiener Titeleien nicht trauen darf, dennoch - Hofrat tut gut. Ob er hier vielleicht auch über seine persönlichen Schwierigkeiten sprechen kann, über die Einsamkeit, über seine unerfreulichen Dienstgeschäfte, über seine schlechten Einkünfte? Doch er bringt es nicht über sich. Seine steife straffe Haltung aber löst sich. Sein Rückgrat wird weich und rund, er hält sich nicht mehr kerzengerade, sondern schlägt sogar ein Bein über das andere, behält auch die Hände nicht auf den Knien, sondern begleitet seine Gespräche mit Gesten, die dann und wann sogar heftig werden.
Die Kaffeekanne ist leer. Constanze klingelt mit dem Porzellanglöckchen, wartet einen Augenblick, murmelt etwas von Dienstbotenimpertinenz, geht dann selbst in die Küche und brüht neuen Kaffee. Nissen atmet freier und bewegter, steht auf, geht im Zimmer auf und ab. Als Constanze mit dem Kaffee zurückkommt, springt er diensteifrig entgegen, will ihr die Kaffeekanne abnehmen, fasst ungeschickt zu, lässt die Kanne fallen und gießt sich den heißen Kaffee über das linke Bein. Er schreit leise auf und versucht dann sogleich, sich zu entschuldigen. Constanze ist böse, was nun? Das Bein brennt wie Feuer, aber er kann doch nicht …
»Nur rasch das Beinkleid von der Wade!«, ruft Constanze. »Nun zieren Sie sich nicht! Sie müssen starke Schmerzen haben!«
Das stimmt freilich, aber er kann doch nicht … Doch, er kann! Die Schmerzen sind zu groß, und Constanze steht da wie ein Arzt, ganz sachlich, dann läuft sie wieder in die Küche, schneidet ein dickes Blatt vom Brandbaum, es tropft dick und klebrig aus der Schnittstelle. Sie lässt den Saft auf die verbrannte Wade tropfen, streut Mehl darüber.
»Ist es besser?«
Kochend war das Wasser zum Glück nicht mehr gewesen, dennoch muss Nissen die Zähne zusammenbeißen. Aber trotz der Schmerzen ist er sich des Unschicklichen seiner Lage bewusst. Constanze möge sich doch erbarmen! Sie tut es, reicht ihm eine Decke, er breitet sie über die Knie, atmet auf und merkt nicht, dass es dänische Worte sind, mit denen er sich bedankt. Constanze denkt einen Augenblick lang an die Truhe, in der sie Wolfgangs Kleider aufbewahrt, aber nein, sie wischt den Gedanken unwillig fort.
Wolfgang war schmaler als Nissen, und überhaupt, so war und ist es nicht gedacht … Nissen muss so lange bleiben, bis seine Beinkleider getrocknet sind.
»Wir sprachen ja neulich schon über meine Angelegenheit, Herr von Nissen. Ich möchte Sie ersuchen, sich der Nachlasssachen meines unglücklichen Wolfgang anzunehmen. Sie wurden mir von verschiedenen Seiten empfohlen, und ich darf annehmen, dass dieser Nachlass bei Ihnen in guten, in sehr guten Händen ist ... Wenn alles so verläuft, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir wünsche, werde ich Sie fürstlich entlohnen können.«
Nissen setzt sich wieder gerade. Nun ist alles wie zuvor. Die Fronten sind abgesteckt. Er hat kein Geld, die Witwe Mozart hat kein Geld. Er hat keinen Hoftitel, die Witwe Mozart kein Dienstmädchen. Ein Verzeichnis des Nachlasses also soll er anfertigen. Gut. Keine Schwierigkeit. Ein hochwillkommener Nebenverdienst.
Constanze betrachtet ihren Gast nicht ohne Wohlgefallen. Eigentlich hätte sie den anderen, den hilfsbereitesten Freund des Hauses, den Abbé und Organisten Maximilian Stadler, auch einladen sollen. Er hatte sich ihrer Sorgen und Schwierigkeiten so herzlich angenommen. Auch die Kinder konnten sich mit allen ihren Wehwehchen und Wünschen immer an ihn wenden. Er half. Und doch hat Constanze ihn nicht eingeladen, aus einer plötzlichen Abneigung heraus nicht.
Stadler hatte sich angeboten, selbst das Nachlassverzeichnis anzufertigen. Er würde es umsonst tun, davon war Constanze überzeugt. Und sie war einverstanden - zuerst. Sie wollte ihm sogar die Notenpakete in die Wohnung schicken, er war ja ein Freund Wolfgangs und über jeden Zweifel erhaben. Doch Stadler hatte abgelehnt. Diese Papiere seien zu kostbar. Er könne sie in seiner Wohnung nicht vor Unglücksfällen oder Diebstahl schützen. Lieber käme er jeden Tag zu Frau Constanze in die Wohnung. Bei dieser Gelegenheit könne er auch täglich nach dem kleinen Franz Xaver Wolfgang und seinen musikalischen Fortschritten sehen.
»Er heißt nicht mehr Franz Xaver Wolfgang, verehrter Abbé! Ich habe ihm den Namen seines Vaters gegeben, denn er verspricht ein ebensolches Wunderkind und musikalisches Genie zu werden, wie Wolferl es war, das sagen alle.«
»Ich weiß, Frau Constanze, man hat mir davon erzählt, auch von Wowis neuem Namen, dergleichen bleibt nicht verborgen in Wien, auch nicht unwidersprochen, auch nicht von mir … Und so wollte ich mir die Freiheit nehmen und auch die Zeit, um mit Ihnen gemeinsam das Für und Wider dieser Namensänderung abzuwägen. Mir tut der kleine Kerl leid, da er nun eine solche Last zu tragen hat, die er freilich jetzt noch nicht ermessen kann.«
»Last sagen Sie? Dieser Name ist keine Last, sondern unausschöpflicher Kredit. Auf den Knien wird das Bürscherl mir danken, dass ich ihm des Vaters Namen gab. Da ist nichts mehr abzuwägen, das ist geschehen.«
Sie beschloss, den Abbé vorläufig nicht in ihre Wohnung zu bitten.
Und doch kann sie nicht ganz auf Stadler verzichten. Er kennt sich als einziger aus mit diesen vielen Papieren, Partituren, Einzelblättern, Notenheften, Skizzen, Abschriften. Nissen versteht leider nichts davon, noch nicht, er ist ja kein Musikant, sondern nur ein Mann der Ordnung. Irgendwie muss Stadler ihm helfen. So nähme diese Arbeit weniger Zeit in Anspruch, und auch darauf kommt es an. Je eher dieses Verzeichnis abgeschlossen wäre, desto eher käme vielleicht wieder Geld ins Haus.
Geld ist jetzt Constanzes einziger Wunschtraum. Freundschaft und Liebe gaukeln Sicherheit und Beständigkeit nur vor. Geld aber garantiert dafür. Was hilft alle wohlwollende Fürsprache wegen Wowis Ausbildung? Hat sie genügend Geld, kann sie dafür die besten, angesehensten Lehrer einfach nur so kaufen. Der große Wolfgang Amadé hat es leichter gehabt. Er bekam den guten Lehrer bei seinem Eintritt in die Welt gleich mitgeliefert, und er brauchte nichts dafür zu bezahlen: Vater Leopold …
Constanze hatte den Schwiegervater nicht geliebt, doch das muss sie ihm zugestehen: Er war ein guter, strenger, haushälterischer Lehrer. Der kleine Wowi hat es nicht so gut getroffen; kurz nach seinem Eintritt in die Welt verabschiedete sich der Vater von ihm. Allerdings war es mehr als fraglich, ob er ein guter Lehrer für seinen Sohn geworden wäre. Er hätte gewiss nie Zeit gefunden, sich um den Sohn zu kümmern, so wie sich sein Vater um ihn gekümmert hatte, sorgsam Schritt für Schritt beobachtend, in weisem Maße lobend oder tadelnd, geduldig und anfeuernd zugleich …
Schade, dass Nissen kein Musiker ist! Constanze war einmal Zeugin gewesen, wie er sich in einer Gesellschaft auf dem Klavier produzierte, und danach hatte es sie Überwindung gekostet, ihn wieder zu sich einzuladen. Im übrigen ist er freilich ein hochgebildeter Mann. Die Musik, das Musische, Schöne, das Elegante und Kapriziöse ist nun einmal nicht seine Welt. Dennoch wird Constanze von seiner zurückhaltenden Stärke angesprochen. Jetzt sehnt sie sich nach einer sicheren Zuflucht, und dieser Wunsch wird in ihr umso stärker, je länger sie mit diesem freundlichen Mann zusammensitzt. Sie meint, seine Dankbarkeit ihr gegenüber zu spüren, Dankbarkeit dafür, dass sie ihn sprechen und ausreden lässt, dass sie ihm etwas von seiner Befangenheit genommen hat. Und sie wird ganz beschwingt und fröhlich und bedauert, dass sie keinen Wein oder gar Champagner im Hause hat, er sei ihr leider zufällig ausgegangen … Nissen durchschaut sie, ach, auch ihm geht der Wein sehr oft zufällig aus, weil ihm einfach kein Geld zufällt.
Geld … Ob dieser Mozart auch nach dem Tode noch eine Zukunft hat? Das soll es ja geben bei Künstlern. Es kommt also darauf an, den Nachlass so günstig wie möglich zu verkaufen. Das Verlagshaus Breitkopf & Härtel in Leipzig hat Interesse und trägt immer wieder seine Wünsche und Bitten vor. Constanze zeigt Nissen die Briefe aus Leipzig, und er liest sie langsam und sorgfältig, ängstlich darauf bedacht, nichts zu übersehen, er liest so, wie er die wenigen Briefe in der dänischen Gesandtschaft liest, die ihm zur Beantwortung übergeben werden und meist lächerliche Kleinigkeiten enthalten; hier aber geht es um mehr, um Großes, um das Lebensbild und Lebenswerk eines Verstorbenen. Man verlangt Noten, man verlangt Anekdoten, eigenhändige Zeugnisse.
»Helfen Sie mir, Herr von Nissen! Ich schreibe zwar gern Briefe, aber ich bin ein schwatzhaftes Weib, und man kann mich so leicht übers Ohr hauen …«
Wenn er doch nur mehr davon verstünde! Constanze zeigt ihm die Noten. Das einzige, was er versteht, ist, dass sie in einem unbeschreiblichen Durcheinander sind. Die aufeinanderliegenden Blätter scheinen nicht zusammenzugehören, überhaupt sind lose Blätter für Nissen ein Gräuel! Es juckt ihn in den Fingern, hier sogleich Ordnung zu schaffen. Dieses Haus ist eine kleine Hoffnung für ihn, wirklich nur eine kleine, doch er fühlt sich wohl darin. Er nimmt sich wieder vor zu lernen, noch mehr dazuzulernen, auch in musikalischen Bereichen. Vielleicht fiele es ihm nicht schwer, denn er war ein guter Schüler und hatte es durch Fleiß und Beharrlichkeit sogar zu einem königlichen Stipendium gebracht. Wenn man verkaufen, auch nur verkaufen helfen will, muss man die Sprache des Käufers genau verstehen. Nur dann wird der Käufer von sich aus einen höheren Einsatz wagen. Lernen also, auch wenn er dabei ganz auf sich gestellt ist. Auch daran ist er gewöhnt, in vielen Bereichen war er Autodidakt seit Kindertagen.
Wowi kommt nach Hause gepoltert, der Kleine, nun ist es vorbei mit der Beschaulichkeit und der stillen Nachdenklichkeit. Doch die kleine Hoffnungsflamme auf einen neuen Anfang beiderseits bleibt.
»Grüß dich Gott, Maminka! Wer ist der Onkel? Und warum hat er sich mit einer Decke zugedeckt? Es ist doch gar nicht kalt!«
Nissen wird rot.
»Das ist Onkel Nissen. Vielleicht friert er doch. Heute scheint ja keine Sonne. Und was hast du getrieben in der Musikstunde?«
»Auf der Fläte habe ich gespielt, Maminka, es war schään …«
»Dieser Bub bringt mich mit seiner Sprache noch zur Verzweiflung!«, stöhnt Constanze. »Die Prager Aussprache ist zäh an ihm hängengeblieben, obgleich er nicht lange dort war. Und nun scheint er sie sogar zu lieben ...«
Nun mischt sich Nissen hilfs- und erziehungsbereit ein.
»Flöte heißt es, Herr Wolfgang, und schön heißt es! Sag es nach!«
Selbstverständlich kann Wowi es nachsprechen. Aber trotzdem: »Fläte klingt viel schääner …«
Er ist gerade aus einer seiner vielen Musikstunden gekommen. Constanze hat ihn bei den besten Lehrern Wiens untergebracht, auf Kredit.
»Haben Sie denn gar keine Angst, den Jungen allein durch Wien gehen zu lassen?«, fragt Nissen mit der Miene eines besorgten Vaters.
Das steht ihm gut, denkt Constanze, das gefällt mir.
»Aber nein! Jedermann kennt ihn ja! Wer sollte einem Mozartkind in Wien etwas antun wollen?«
»So, Wowi, wir gehen jetzt hinaus, wir lassen den Onkel Nissen einen Augenblick allein. Inzwischen ist wohl alles trocken. Und morgen könnten wir eigentlich mit der Arbeit beginnen.«
Noch ohne den Abbé Stadler. Nissen soll diese Arbeit und ihre Schwierigkeiten erst einmal allein kennenlernen. Später kann er Fragen stellen. Er soll nicht sogleich nur Antworten erhalten, ohne dass er etwas gefragt hätte. Abbé Stadler, der Lustige, der Überlegene, ist schnell zum Antworten bereit. So muss das gemacht werden und so und so … Soll er dem Nissen einen eigenen Anfang gönnen!
7
Nissen, der kleine Gesandtschaftssekretär aus Hadersleben in Schleswig, kehrt in seine Dachwohnung zurück, zum ersten Mal vergnügt, ohne Widerwillen gegen diese Behausung, über die er nie in die Heimat berichtet hat. Sie sollen dort nicht wissen, wie seine Diplomatenlaufbahn in Wien begonnen hat. So wird sie jedenfalls nicht enden, daran glaubt er jetzt. Er macht ein kleines Feuer an, denn er will noch arbeiten. Er hat einige Abschriften anzufertigen, die er nach der Anzahl der Seiten bezahlt bekommt, und dabei sollen ihm die Finger nicht steif werden, heute nicht. Oder nein, heute wird er nicht mehr arbeiten, heute weiß er etwas Besseres. Sein Blick fällt auf die Violine an der Wand. Er hat sie von zu Hause mitgebracht, um Erinnerungen an seine Kinder- und Jugendjahre lebendig werden zu lassen, wenn es nötig sein sollte. Es ist nur eine Bauerngeige, nichts Besonderes, mit Verzierungen am Hals und einigen bunten Bändern, nichts für die verwöhnten Wiener Augen und schon gar nicht für die noch verwöhnteren Ohren. Er könnte diesen Ohren nichts bieten, denn über Tänze und volkstümliche Lieder geht sein Repertoire nicht hinaus.
Das soll jetzt anders werden, ich werde üben, wenn ich auch weniger Zeit habe als daheim … Jetzt kann ich auch andere damit erfreuen, die Madame Mozart zum Beispiel.