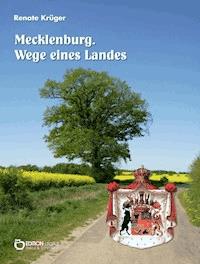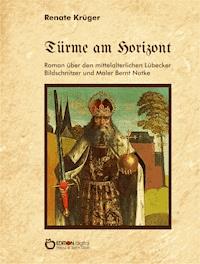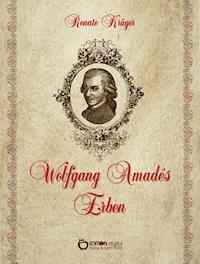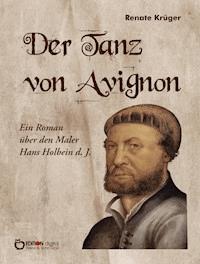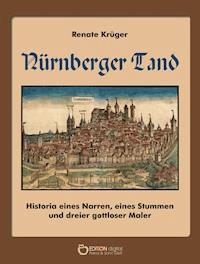8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Internet-Lexikon Wikipedia beschreibt den Helden dieses historischen Romans mit der sachlichen Zusammenfassung: Lucas Cranach der Ältere (* vermutlich um den 4. Oktober 1472 in Kronach, Oberfranken; † 16. Oktober 1553 in Weimar) war einer der bedeutendsten deutschen Maler, Grafiker und Buchdrucker der Renaissance. Er war ab 1505 Hofmaler am kursächsischen Hof unter Friedrich dem Weisen, Johann dem Beständigen und Johann Friedrich dem Großmütigen. Neben zahlreichen Altarwerken und allegorischen Gemälden fertigten er und seine Werkstatt vor allem auch eine große Zahl an Porträts seiner Dienstherren sowie der Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon. Aber wie war dieser Mensch, Künstler und Unternehmer? Wie hat er gelebt, gedacht und gearbeitet? Können wir uns ein Bild von ihm und seiner Kunst machen? In ihrem Roman gelingt Renate Krüger eine dreifache Annäherung an den Menschen, an den berühmten Hofmaler und Chef einer Kunst-Werkstatt in Wittenberg, der es fern seiner Heimat zu Ansehen und Wohlstand gebracht hat, der aber keine Zeit hat, seine Bilder selbst zu beenden. Zu Beginn erleben wir, wie der zu Ansehen und Wohlstand gekommene Hofmaler Friedrichs dem Weisen auf einem kurfürstlichen Pferd auf die Stadt seiner Kindheit zureitet. Es trifft sich gut, dass er im Auftrag des allergnädigsten Herrn Kurfürsten von Sachsen auf der Veste Coburg einige Bilder restauriert. Da hat er es nicht weit nach Kronach, wo er selbst fast wie ein Fürst empfangen wird. Sein Vater war gestorben und Lucas muss Ordnung schaffen. Er sehnt sich danach, nach langer Zeit die Mutter wiederzusehen. Und der berühmte Mann hat Pläne, wie er ihr sagt: „Ich bin in mein Vaterhaus gekommen, um dich, den Matthes und auch den Thomas in mein Wittenberger Haus einzuladen. Nicht nur zu einem schnellen Besuch, sondern für immer, denn ...“ Doch es gibt Schwierigkeiten, die den erfolgreichen Mann, der kein Nein als Antwort mehr gewohnt ist, irritieren. Werden die Seinen nach Wittenberg kommen? Und wie wird sich das gemeinsame Leben dort gestalten? Neben Lucas Cranach und seiner Frau, der Bürgermeisterstochter aus Gotha, seiner Mutter, seiner Schwester und seinen beiden Brüdern werden in diesem Zeit- und Gesellschaftsbild auch Zeitgenossen lebendig wie der freundliche Doktor Johannes Cuspinian, der Rektor der Wiener Universität, Martin Luther und Philipp Melanchthon. Und man kann am Ende sehr gut auf den Gedanken kommen, Lucas Cranach nahe gekommen zu sein, sehr nahe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Malt, Hände, malt
Ein Roman über Lucas Cranach d. Ä.
ISBN 978-3-86394-324-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Selbstporträts von Lucas Cranach d. Ä.
Das Buch erschien erstmals 1975 im Prisma-Verlag Zenner und Gürchott, Leipzig.
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Kronach ist nicht die geringste unter den oberfränkischen Städten, aber nicht einmal seinem Bürgermeister würde es in den Sinn kommen, es höher zu stellen als die Nachbarstädtchen mit ihren lang vertrauten Namen: Berneck, Kulmbach, Staffelstein oder Lichtenfels. Sie alle ducken sich unter dem Schutz der Veste Coburg, wohin sich des Öfteren der allergnädigste Herr Kurfürst von Sachsen zurückzieht. Man ist geschützt, und man ist abhängig. Man spricht die Sprache der Franken und tanzt nach der Pfeife der Sachsen. Man ist nicht Nürnberg und hat keine eigene Melodie. Aber einen kleinen Stolz hat man doch, und man erhält ihn mit allerlei Wirtshauswortreichtum am Leben, auch wenn man die Augen auf die Veste Coburg richtet.
Unverwandt schaut der Stadtknecht am Tor auf die Coburger Landstraße, während die Schatten der Bäume, Sträucher, Mauern und Häuser länger und länger werden. Der Sommer hatte es eilig, Äpfel und Birnen sind schnell gereift und klein geblieben, in einigen Wochen wird man die letzten Früchte einholen. Auch gut. Soll der Winter kommen, in Kronach sind die Vorratskammern gefüllt. Auch die des Stadtknechtes. Er denkt daran, wie es in seinem Keller duften wird. Doch er soll ja nicht träumen, er hat eine wichtige Aufgabe: Ausschau soll er halten nach Coburg! Von dort wird Lucas der Maler kommen, der Sohn des berühmten Malers Sunder aus Kronach - einige nannten ihn auch Möller -, der zu Beginn des Sommers selig in Gott entschlafen ist. Seinen Ältesten hat er nicht mehr gesehen, der war zu weit weg. In Kronach gab es einst keinen Platz mehr für ihn, doch er soll es in der Ferne, in Wittenberg, zu Ansehen und Reichtum gebracht haben. Auch gut. Nun wird ihn der Kronacher Rat mit Ehren empfangen, die beiden Ratsstuben sind schon gekehrt und geschmückt.
Soll er also kommen, Lucas der Maler, der im Dienste des allergnädigsten Herrn Kurfürsten von Sachsen gerade auf der Veste Coburg einige Bilder restauriert. Das ist klug von ihm, so verschafft er sich Ansehen auch in Kronach.
Wie soll der Stadtknecht den Sohn des Meisters Sunder anreden? Er hat den Lucas schon als Kind gekannt, ein Kronacher Kind wie die anderen, doch nun Maler des Kurfürsten, mit der Tochter eines Bürgermeisters verheiratet und sogar in hohem Ansehen beim Kronacher Rat ... Es wäre nicht ausgeschlossen, dass er es in Kronach zum Ratsherrn, wenn nicht zum Bürgermeister bringt.
Lucas der Maler reitet derweil singend durch einen dichten Wald. Er liebt den Wald über alles, doch nicht nur Lebensfreude treibt den Gesang aus seiner Kehle. Auch Furcht. Jeder, der auf einem guten Pferd durch den Wald reitet, fürchtet sich, selbst ein gepanzerter Ritter. Über den Wald hat die Veste Coburg keine Macht. Im Wald leben die Gesetzlosen, die sich nehmen, was man ihnen nicht gibt. Die Gestalten von wilden Männern und Frauen in zottigem Haarpelz und von übermenschlichen Kräften leben in der Furcht des Volkes, und die Herren leben von dieser Furcht des Volkes. Das Volk soll beim Gesetz bleiben und sich vor den Gesetzlosen fürchten, die Reisende und Wanderer ausrauben und erschlagen. Lucas hat nicht viel Geld bei sich, aber das Pferd ... Sollte ein kurfürstliches Pferd den Waldmenschen nicht besonders in die Augen stechen? Nichts rührt sich. Er begegnet niemandem. Er sagt seinen Namen vor sich her wie eine Beschwörung. Er hat einen Namen beim allergnädigsten Herrn Kurfürsten, und die daheim werden sich wundern, wenn er ihnen diesen Namen sagt, wenn er ihn zeigt, ja zeigt, denn dieser Name ist aufgeschrieben wie ein Gesetz; er, Lucas der Maler, wird niemals zu den Gesetzlosen gehören ...
Das Malerhaus am Markt gehört zu den größeren Kronacher Bürgerhäusern. Es war ein festlicher, unvergesslicher Tag, als Meister Sunder sich endlich dieses Haus kaufen und seine Werkstatt darin einrichten konnte. In diesem Haus konnte die Kunst des Sohnes heranwachsen, doch für zwei Meister war es zu eng. Lucas war fortgezogen und nicht zurückgekehrt. Nun hat Meister Sunder dieses Haus verlassen - für immer. Der junge Meister kann einziehen, endlich! Die Witwe Sunder sitzt an einem Fenster des oberen Stockwerkes, sieht auf den Markt hinunter und in die Straße, die zum Coburger Tor führt, und wartet. Es ist lange her, seit der Sohn zuletzt daheim war. Jetzt muss er kommen und Ordnung schaffen, die Spreu vom Weizen trennen, den guten Nachlass zu guten Preisen verkaufen, denn die Witwe Sunder braucht etwas, wovon sie leben kann, und sie möchte nicht schlechter leben als bisher. Schmalz und Bier sind ohnehin nie reichlich gewesen, Brot und Wachs jedoch haben immer genügt. Der Magen knurrte keinem vergeblich, an Kerzen musste man nicht sparen. Ein gutes Handwerk ernährt die Familie, wenn der Meister fleißig ist und die Meisterin das Geld zusammenhält. Ihr eigener Vater war ein fleißiger, guter Schuhmacher gewesen, und noch heute stecken manche älteren Füße in seinen Schuhen. Ihre Mutter hatte lieber die pralle Geldkatze gestreichelt, als dass sie das runde Geld rollen ließ. Wie wird Barbara sein, die Schwiegertochter? Ihr Vater ist Bürgermeister, man braucht sich ihrer nicht zu schämen in Kronach. Sie wird sich des Ansehens ihres Schwiegervaters würdig erweisen können, mit Stolz seine Bilder in den Kirchen und in den Bürgerstuben betrachten. Nun gehören die Kronacher Malflächen dem Sohn, ihrem Ehegemahl. Der Zunftstuhl in der Kirche ist sein Eigentum. Und er findet ein großes Haus vor, alles gehört ihm.
Trotz aller dieser angenehmen Gedanken erinnert sich die Witwe Sunder an einen Traum, der sie in Angstschweiß versetzt hatte. Der Sohn war gekommen, doch er wollte nicht bleiben. Er fühlte sich nicht mehr wohl in diesem großen neuen Haus, er hatte sich daran gewöhnt, in Schlössern zu leben und zu arbeiten, er stieß sich den Kopf an den niedrigen Decken der Kronacher Zimmer, er klagte über den muffigen Geruch und über das Nebeneinander von wertvollen Möbeln und zerbrochenem Gerümpel. Er nahm dem Pferd nicht einmal den Sattel ab ... »Ist er noch immer nicht zu sehen, der Lucas?«
Anna Sunder fährt herum, und ihr Unmut über den Traum entlädt sich über ihren Sohn Matthes, der in der Tür steht.
»Wie siehst du aus! Blaue Farbe im Gesicht! Grün am Hemd! Wie vorsichtig hat dein Vater gemalt! Ich kann mich nun wieder mit den Flecken plagen. Nein, er ist noch nicht zu sehen. Wasch dich und zieh dich ordentlich an. Wo ist Thomas?«
»Im Wirtshaus.«
Ist das auch ein schlechter Traum? Lucas will nicht bleiben, und Thomas ist im Wirtshaus?
»Im Wirtshaus? Am helllichten Tag, mitten in der Woche? Und gerade dann, wenn wir auf den neuen Hausherrn und Meister warten? Was ist in Thomas gefahren?«
Matthes zieht die Schultern hoch.
»Du weißt ja, der Thomas und der Lucas ...«
»Geh jetzt und wasch dich! Es wird Zeit, dass der Lucas kommt und Ordnung schafft. Er muss es tun, er ist der Älteste. Er arbeitet für den Kurfürsten. Du musst dich anstrengen, wenn du etwas bei ihm gelten willst. Er soll dich endlich auf Wanderschaft schicken.«
Matthes weiß, was ihn jetzt erwartet, und er schließt schnell die Tür hinter sich.
Zwanzig Jahre bist du alt und stehst noch immer nicht auf eigenen Füßen. Lässt den Thomas für dich arbeiten und schmierst selber nur ein wenig mit Farben herum wie ein Kind. Du bist eben zu spät geboren, Gott sei es geklagt! Es ist nichts mit den Kindern des Alters ...
Lucas der Maler treibt sein Pferd an. Tummel dich, Schwarzer, schneller, wir müssen heim. Keine Zeit heute für alte Gespenstertannen, für knorriges Wurzelwerk, für all das, was man malen oder wenigstens zeichnen müsste. Mein Herz weint, weil wir so schnell an dieser sonnigen Lichtung vorüberreiten müssen. Diese zackige Burg im Hintergrund! Doch weiter, ich will zur Mutter. Ich brauche sie schon jahrelang, und doch habe ich nie Zeit für sie gefunden, oder fürchtete ich mich vor dem Vater? Nun habe ich die Mutter ganz für mich, und ich werde glücklich sein mit ihr, mit Barbara habe ich kein rechtes Glück ... Mein Leben ist reich und gesegnet, aber der Mensch, der mir am nächsten ist, bringt mir kein Glück ... Wie werde ich sie begrüßen nach all den Jahren? Schau her, Mutter, was aus deinem Sohn geworden ist! Du kannst stolz auf mich sein, ich sage es ohne alle Eitelkeit! Meine Bilder betrachtet man nicht nur, man spricht auch von ihnen, und nicht nur in der Stadt Wittenberg. Ich zeige dir die beiden großen Bilder der letzten Jahre. Nein, natürlich habe ich sie nicht bei mir, sie sind längst dort aufgestellt, wo man sie erbeten hat, und doch leben sie in mir weiter. Ich bin noch immer innig verbunden mit der heiligen Katharina, der Schutzpatronin der Gelehrten, deren Bild ich malen, neu erschaffen durfte. Wittenberg soll eine Stadt der Gelehrten werden, so hat es der allergnädigste Herr Kurfürst beschlossen. Und so wird es sein. Übelwollende, verblendete Menschen ließen einst der Heiligen das Haupt abschlagen. Ein grausames, beängstigendes Bild, das ich da malen musste, doch du brauchst nicht davor zu erschrecken, denn die Schönheit ist stärker als der Tod. Ach Mutter, wenn du wüsstest, wie sehr ich die Schönheit liebe, wie ich mich nach ihr sehne! Barbara, meine Frau, ist schön, und doch sehne ich mich nach mehr Schönheit. Auf den Altarflügeln habe ich Schönheit vervielfacht. Je drei liebliche Jungfrauen stehen dort, es sind die lieben alten Heiligen, die ewig jung bleiben. Ich habe sie in den Jungbrunnen getaucht, Barbara, Ursula, Margaretha, Dorothea, Agnes und Kunigunde, lauter schwere, schöne Namen. Hinter ihnen habe ich die Schutzburg erbaut, damit sie gesichert leben können in dieser rauen, schönheitsfeindlichen Welt, die Veste Coburg ist dort zu sehen, denn mein Herr Kurfürst ist ein Schützer der Schönheit und der Kunst, und ich vertraue auf ihn. Ein eigenes Kind habe ich mir dazu erträumt und gemalt, und glaube mir, eines Tages werde ich es haben, dieses liebliche Geschöpf, das Blumen in einem Körbchen austeilt. Gefällt dir mein Bild, Mutter? Gefällt dir mein Kind? Oder sind die anderen dir lieber und nützlicher, die vierzehn Nothelfer, die ich aus ihren himmlischen Wohnungen geholt und auf der engen Tafel versammelt habe? Ungern habe ich mich von ihnen verabschiedet, als man das Bild von mir holte, am liebsten hätte ich jeden einzelnen festgehalten. Weißt du, Gestalten, die aus den Träumen und den Händen hervorgehen, leben.
So, Schwarzer, jetzt noch ein Trunk für dich und für mich aus dem Bach hier, das schöne, saftige Gras für dich, Brot und Speck für mich, dann geht es weiter, und bald sind wir daheim.
Thomas sitzt finster im Wirtshaus. Zur größten Verwunderung des Wirtes fordert er nicht Bier nach seiner sonstigen Gewohnheit, sondern scharfen Branntwein, und auf Fragen knurrt er nur.
»Was ist mit dir? Ärger mit der Meisterin?«
»Hm.«
»Hat die Unruhe oder die Unordnung dich aus dem Haus getrieben?«
»Hm.«
»Hast du Angst um dein Erbe? Oder gibt es für dich sowieso nichts?«
»Hm.«
»Trink lieber Bier, Thomas! Branntwein taugt nicht für dich. Er schwächt die Augen und lässt die Hände zittern. Und du brauchst doch beides für die Arbeit, Augen und Hände, nicht wahr?«
»Noch einen von dem scharfen Zeug da! Aber schnell!«
»Thomas, sei vernünftig! Du darfst dem Hausherrn und Meister nicht betrunken begegnen!«
Thomas schlägt mit der Hand nach den Fliegen.
»Ach der! Lass mich doch bloß zufrieden mit dem da!«
Er stützt den Kopf in die Hände und starrt zum Fenster, doch durch die Butzenscheiben kann man nichts sehen. Seit Jahren hat er sich nicht so einsam, so verlassen, so überflüssig gefühlt wie heute. Nun kommt er also, Lucas der Maler, der Erbe, Ehegemahl der Gothaer Bürgermeisterstochter Barbara Brengbier, Hofmann des Kurfürsten Friedrich in Wittenberg. Einer von den Schlauen, den Gewitzten, die sogleich etwas geworden sind in der neuen Residenz im Norden, über die alle Welt lacht, besonders die Welt in Nürnberg und Augsburg, und nach der Thomas sich sehnt. Und nun wird man den weit gereisten und emporgekommenen Sohn hier mit offenen Armen und großen Lobreden aufnehmen, ihn, der die Last des Kronacher Alltags nicht mitgetragen hat. Und man wird ihn mit Aufträgen überhäufen und ihm vielleicht ebenso viel zahlen wie dem Maler Sunder ... Und auf ihn, Thomas, wird man wieder herabsehen, auf den Mann ohne Namen, den Mann ohne Vater, den Vater ohne Ehefrau, den Maler mit starken, zarten, fleißigen, wissenden Händen und Augen, aber ohne Rechte, den Menschen ohne Ehre ... Und nun gar Barbara Brengbier mit ihren schillernden Augen ...
»Warum stehst du nicht draußen bei den anderen und wartest auf den Sohn deines seligen Herrn?«
»Und du, Adlerwirt? Weshalb hockst du hier drinnen? Den Branntwein kann mir auch dein Knecht bringen. Du wagst dich wohl nicht hinaus, hast noch genug von damals? Es war ja dein Vater, der behauptete, Meister Sunder fertige gezinkte Spielkarten an, mit denen man so gut betrügen, aber auch betrogen werden kann ... So ist es oft in dieser Wirtsstube geschehen. Du warst wütend darüber, nur weil du niemals Glück im Spiel hattest. Dein Vater hat den Meister Sunder verklagt, den Prozess habt ihr verloren. Hast wohl Angst vor solchen Erinnerungen?«
»Dummes Geschwätz! Ich muss bereitstehen, wenn sie alle hier hereinkommen, denn das werden sie tun, so wahr ich der Adlerwirt bin. Lass die alten Geschichten. Und hör jetzt auf zu trinken, du brauchst einen klaren Kopf.«
»Bring mir noch einen Großen! Aber ohne Predigt!«
Der Wirt überlegt. Soll er seinen Knecht zur Witwe Sunder schicken? Holt den Thomas nach Hause, ehe es ganz finster wird in ihm. Auch wenn ihm dadurch ein paar Batzen verloren gehen. Und überhaupt - heute kommen die ganz Ehrenwerten ...
Der Stadtknecht steht auf dem Turm und sieht in der Ferne einen Reiter herantraben. Das muss er sein, Lucas der Maler. Er hat es eilig, er sehnt sich also nach seiner mauerumgürteten Heimatstadt mit ihren dicken Toren, ihrem Gassengewinkel und Giebelgedränge unter der Veste Rosenberg, der alten Burg der Bamberger Bischöfe. Der Stadtknecht eilt vom Turm und geht dem Reiter entgegen, das ist sonst nicht seine Gewohnheit.
»Ich grüße dich, Lucas! Wir alle freuen uns, dass du wieder nach Kronach kommst! Ich habe einen großen Wunsch: male mir einen Packen Spielkarten. Zwei oder drei Spiele aus deines Vaters und auch aus deiner Hand habe ich schon verspielt. Die Bilder sind unansehnlich geworden, abgegriffen. Sei so freundlich und male mir ein neues Spiel. Ich will es gut bezahlen. Und ich habe nie geglaubt, dass dein Vater die Karten gezinkt hat ...«
Lucas blickt vom Pferd auf den Stadtwächter herunter.
»Auch ich grüße dich. An deinen Namen kann ich mich leider nicht erinnern ...«
»Ich bin doch der Moritz!«
»Also gut, Moritz! Spielkarten kann ich dir nicht malen. Dazu habe ich nämlich gar keine Zeit.«
»Aber Lucas, das geht doch ganz schnell! Du brauchst dazu nicht einmal zwei Tage.«
»Zwei Tage sind für mich sehr viel. Ich habe nämlich andere Dinge zu tun, als Spielkarten zu malen. Ich bin der Hofmaler des Kurfürsten von Sachsen.«
Er grüßt freundlich und reitet weiter zum Markt. Der Wirt stürzt an die Tür.
»Meister Lucas! Meister Lucas! Willkommen daheim in Kronach!«
So rufen die Kinder. So rufen auch die Handwerksmeister, die hinter ihren Läden gewartet haben. So rufen sogar die Ratsherren. Und auch der Wirt stimmt ein. Kein Gedanke mehr an den einstigen Prozess! Dann geht er zurück in die Wirtsstube, reibt sich die Hände. Schreien macht durstig. Ratsherrendurst bringt mehr ein als die trübe Stimmung des Malerknechtes Thomas. Bald kommt der Wirt ins Schwitzen. Er und sein Knecht schleppen Kannen über Kannen, zapfen ein neues Fass an, bringen Brot und Speck, streichen Geld ein.
Anna Sunder winkt aus dem Fenster. Zwar wäre auch sie gern auf den Marktplatz gegangen, aber die vielen Menschen! Und jetzt soll der Sohn ihr endlich einmal ganz allein gehören. In diesem Stübchen will sie ihn mit niemandem teilen, nicht mit dem Kurfürsten, nicht mit ihrer Schwiegertochter, nicht mit den Kronacher Bürgern.
Mit wenigen Schritten ist Lucas oben, reißt die Tür auf, fällt der Mutter um den Hals, küsst sie auf die Wangen, auf die Stirn, sagt nichts von seinen Bildern, drückt und streichelt immer wieder ihre Hände.
»Hier bin ich, Mutter, hier bin ich!«
Anna Sunder bringt kein Wort heraus. Endlich hat sie ihren Sohn! Doch noch während er ihre Hände hält, beunruhigt sie der Gedanke: >Wird er nicht Hunger haben und Durst? Ich muss in der Küche nach dem Rechten sehen !< Lucas bemerkt, wie sie nach der Türklinke tastet und mühsam den linken Fuß über die Schwelle zieht, sie geht mit schlurfenden Schritten und gebeugtem Rücken. Vierundfünfzig Jahre ist sie jetzt alt. Kann er noch fest auf sie bauen?
Bald duftet es im Nebenzimmer nach Braten und Wein, nach frischem Brot und nach Kräutern, die man nur daheim in Kronach verwendet. »Darf ich kommen?«
»Komm, Lucas!«
Welche Seligkeit, endlich einmal wieder diesen Sohn zu bewirten! Nicht nur, weil er berühmt, vielleicht sogar schon reich ist, sondern weil er der Älteste ist, in Liebe erwartet, liebevoll erzogen. Wie gut zu wissen: Es hat sich gelohnt. Selten, dass man erlebt, was man sich erträumt. Sie trinken den Wein aus durchsichtigen Gläsern, die seit vielen Jahren den eisenbeschlagenen Eckschrank nicht verlassen haben. Meister Sunder hatte in seiner letzten Lebenszeit keine Zeit mehr zu fröhlichem oder besinnlichem Trinken gefunden. Anna Sunder sucht nach einem Trinkspruch, doch dann streichelt sie dem Sohn wortlos die Hände. Es ist ja alles klar zwischen ihnen. Ihm gehören jetzt Haus und Werkstatt. »Schön sind unsere alten Gläser. Ich habe in Wittenberg ähnliche. Du sollst die erste sein, die daraus trinkt. Wir werden deinen Einzug in mein Wittenberger Haus festlich begehen.«
Anna Sunder setzt das Glas ab, ohne getrunken zu haben.
»Ich? Nach Wittenberg sind es viele Tagereisen, und ich bin eine alte Frau. Ich werde ruhig sterben, auch ohne Wittenberg gesehen zu haben.«
»Trink, Mutter. Danach habe ich dir etwas zu sagen.«
Lucas hält das Glas gegen das Licht, setzt an, nimmt einen tiefen Schluck. Die Mutter achtet kaum auf den Geschmack des Weines. Der Sohn stellt das Glas zurück auf den Tisch und wischt den Mund ab. »Ich bin in mein Vaterhaus gekommen, um dich, den Matthes und auch den Thomas in mein Wittenberger Haus einzuladen. Nicht nur zu einem schnellen Besuch, sondern für immer, denn ...«
»Aber Lucas! Hier wartet alles auf dich, das Haus, die Werkstatt, Matthes und Thomas und auch ich ... Wir alle rechnen ganz fest damit, dass du ...«
»Ich kann nicht bleiben, Mutter. Kronach ist nicht der Rahmen für meine Bilder. Ich liebe Kronach, aber ich gehöre nicht hierher. Mein Platz ist in Wittenberg. Ich muss viel arbeiten, mehr als ein Maler jemals arbeiten musste, und ich werde nur selten nach Kronach kommen können. Gewiss, ihr lebt gut hier, ihr leidet keinen Mangel, das sehe ich. Aber du und Matthes und Thomas - ihr alle habt hier keine rechte Aufgabe. Der Mensch aber braucht eine Aufgabe, auch dann, wenn er älter geworden ist. Man kann nicht einfach auf das Ende warten. In Wittenberg wartet viel auf euch. Auf euch alle. Ich habe ein großes Haus, größer als dieses Kronacher Malerhaus. Ich muss manchmal mehr arbeiten, als ein Mensch in Fröhlichkeit schaffen kann. Ich kann mich nicht viel um meine Frau kümmern. Bis jetzt hat uns Gott den Kindersegen versagt. Noch haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben. Du kannst dir gewiss vorstellen, wie es einer jungen Frau zumute ist, wenn sie ohne Kinder bleibt. Und der Mann sitzt in der Werkstatt, und sie darf ihn nicht stören. Oder er ist unterwegs, tagelang, wochenlang. Still ist das Haus, und die dunkle Melancholie schleicht sich ein.
So habe ich beschlossen, mein Haus zu vergrößern, nicht mit Kammern und Anbauten, sondern mit den Menschen, die mir die liebsten sind. Kommt nach Wittenberg! Barbara braucht jemanden, dem sie sich anvertrauen kann, dem sie von ihren schwarzen Tagen und Stunden erzählen kann. Und in meiner Werkstatt kann ich viele gute Maler beschäftigen, den Thomas allemal, und der Matthes wird erstaunt feststellen, dass man auch außerhalb Kronachs malen kann. In meiner Werkstatt wird er es zu etwas bringen. Meine Werkstatt wird so groß sein, wie sie noch kein anderer Maler hatte. Wir werden ein Leben führen, wie es kein anderer Maler führen kann. Wir werden Ansehen genießen ...«
»Lucas! Wir werden ... Wir werden ... Jetzt werde ich erst einmal ein Wörtchen reden. Meinst du, es ist für mich selbstverständlich, Kronach zu verlassen? Hier wurde ich geboren. Meine Kindheit habe ich hier verlebt. Hier wartete ich auf den Freier. In Kronach habe ich meine Kinder zur Welt gebracht. Nur zweimal habe ich diese Stadt verlassen, einmal, um meine Tochter ins Nürnberger Klarenkloster zu begleiten, einmal, um sie dort zu besuchen. Kronach auf immer verlassen? Du weißt doch, dass es nicht taugt, alte Bäume zu verpflanzen.«
»Du bist nicht zu alt. Du bist noch ein starker Baum, und ich will ein vorsichtiger Gärtner sein, deine Wurzeln kommen in gutes Erdreich. Wittenberg ist fruchtbarer Boden. Die Stadt ist neu, die Luft rein und frisch. Außer mir gibt es dort keine Maler, ich bin der erste, der einzige. Verstehst du, was das bedeutet? Schau doch, wie ist es in Nürnberg, in Augsburg! Es sind zwar die Städte des Kaisers, aber dort regieren die Geschlechter, die Geldleute, und es gibt mehr Maler als Bäcker. In Wittenberg regiert der allergnädigste Herr Kurfürst, und er sucht sich seine Leute aus, und er hat mich ausgesucht, und niemand verliert ein böses, ein neidisches Wort, denn mit dem Herrn Kurfürsten darf es niemand verderben. Was ist Kronach? Später wird man nur noch an mich denken, wenn man diesen Namen hört.«
»Stolz und hochmütig bist du geworden! So hast du dein Vaterhaus nicht verlassen. Wo hast du diesen teuflischen Geist aufgenommen?«
»Aus mir spricht kein unreiner Geist. Schau her, was ich habe!«
Das Reisegepäck steht noch unberührt. Lucas holt eine in Wachstuch eingeschlagene Rolle heraus, zieht sie auseinander, streicht zärtlich darüber und legt sie vor der Mutter auf den Tisch.
»Was ist das? Du weißt, meine Augen ...«
Lucas denkt zurück und berichtet.
Um die Wende zu diesem Jahre 1508 war Kurfürst Friedrich von Sachsen mit seinem Gefolge nach Nürnberg aufgebrochen. Es war sehr kalt, die Äste und Zweige neigten sich unter der Schneelast, Flüsse und Bäche waren dick vereist. Trotz des Schnees blieben die Tage dunkel, immer wieder schoben sich prall gefüllte Schneewolken vor die Sonne. Vermummt kamen die Menschen aus ihren Häusern, um den vornehmen Zug zu sehen. Sie schauten, winkten, riefen und froren. Aus den Schornsteinen stieg dünner Rauch. Hungrig und zahm wagte sich das Wild dicht an die Häuser. Dem Kurfürsten juckte es in den Fingern. Fragend schauten ihn die Knechte an, er gab jedoch keinen Befehl zum Halten, er musste so schnell wie möglich nach Nürnberg. Unterwegs sprach er noch weniger als sonst. Einmal fragte er, ob der Maler Lucas wirklich im Gefolge sei und ob er sich wohl befinde. Lucas ritt frierend mit den anderen, sehr wohl fühlte er sich nicht, doch das verschwieg er. Weshalb fragte der Kurfürst nach ihm? Jetzt war keine Zeit zum Zeichnen oder gar zum Malen. Wären sie doch erst in Nürnberg!
Auch aus anderen Richtungen bewegten sich große Herren mit ihrem Gefolge durch den strengen Winter auf die Stadt Nürnberg zu. Für viele war es das erste Mal. Weshalb musste es mitten im Winter sein? Weil der Kaiser in Nürnberg wartete, Maximilian, der eigentlich noch nicht richtig Kaiser war, und dessen war er sich bewusst und wollte es ändern. Er war auf dem Wege nach Rom. Am Dreikönigstag wollte er von Nürnberg aufbrechen, um sich vom Papst zum Kaiser krönen zu lassen. Am Anfang dieses beschwerlichen Winterweges über die Alpen sollte und musste die Huldigung der Großen des Reiches stehen. Sie war seine wichtigste Mitgift, sie durfte im Reisegepäck nicht fehlen. Er musste wissen, dass sie hinter ihm standen, Kurfürsten, Bischöfe, Grafen und Städte, allen voran die Kaiserstadt Nürnberg.
Der Maler Lucas atmete auf, als sich endlich Nürnberg vor ihnen auftürmte, Nürnberg, der Mittelpunkt des Reiches, die Stadt des Kaisers Türme, Tore, Kirchen, Klöster, Mauern, Häuser, Menschengewimmel. Hier schien man der Herrschaft des Winters zu spotten. Kurfürst Friedrich richtete sich im Sattel auf, als er in die Stadt einritt, sie sollten auf ihn schauen, der Kaiser würde über die Alpen ziehen, und er, Friedrich von Sachsen, würde das Reichsregiment führen, Statthalter des Kaisers sein. Lucas aber konnte unehrerbietigen Gedanken nicht wehren: Was bedeutete schon der Kurfürst gegen den Kaiser? Was war schon Wittenberg gegenüber Nürnberg? In Wittenberg war er, der Maler Lucas aus Kronach, Hofmaler, in Nürnberg aber lebte Albrecht Dürer, und der hatte es nicht nötig, Hofmaler zu sein.
Lucas erhielt Quartier bei einem Büchsenmacher, der ihn kaum beachtete. Ein Maler! Wenn es noch ein Hofmann gewesen wäre, den man ihm da eingewiesen hatte! Lucas sollte sich dem Kurfürsten zur Verfügung halten, nicht stundenlang durch die Stadt streifen, wie man es von einem Maler gewohnt war, nicht überall herumschauen. Dieser Befehl kam Lucas hart an. Ob er wenigstens den Ausritt des Kaisers sehen durfte?
Maximilian entfaltete kaiserlichen Glanz in der Nürnberger Burg. Er hatte die Großen um sich versammelt und erbat von ihnen die Sendung nach Rom. Sie wünschten ihm Segen auf die Reise, manche mit höflichen, manche mit herzlichen, manche mit spröden Worten. Kurfürst Friedrich gehört zu den spröden, aber er meinte es herzlich. Möge der Kaiser wohlbehalten über das große Gebirge kommen! Möge er in der Person des Papstes einen gewogenen Gönner finden! Mögen ihm auch die Länder und Städte des Südens zujubeln.
Maximilian nickte zu jedem Wunsch. Friedrich von Sachsen würde hinter ihm stehen, wenn er in der Ferne weilte.
Der Kurfürst fühlte die Last und die Lust seiner gewachsenen Macht. Er sah sich unter dem Gefolge um. Wer stand mit allen Kräften des Herzens und der Gedanken hinter ihm? Er musste sich auf jeden Einzelnen verlassen können. Sächsische Adelsnamen klangen vor ihm auf. Boten sie Sicherheit? Jetzt hatte er es in der Hand, jetzt durfte er Wappenbriefe verleihen, den Stand bestimmen, seine Sicherheit vermehren. Fahre wohl, Kaiser Maximilian! Möge dir dein Reisekleid leicht sein, das dich kaum noch von deinem Gefolge unterscheidet. Durch das Spittlertor zogen sie aus, ganz Nürnberg war auf den Beinen. Auch Lucas wagte sich hervor, er wollte wenigstens diese Entschädigung für den Ritt durch die Kälte. Er liebte die Pauken und die Trompeten, die bunten Fahnen und Pferdedecken, die flatternden Wimpel und das Geräusch der stampfenden Hufe. Er schaute und schaute und merkte nicht, dass er im Blickfeld des Kurfürsten stand. Der winkte ihn heran. »Komm, Meister Lucas! Jetzt ist deine Stunde!«
Sie gingen in das Kammergericht. Dort wartete der Schreiber des Kurfürsten. Er hatte seine Arbeit beendet, der Brief war fertig. Nur die Unterschrift des Kurfürsten fehlte noch.
»Lies!«, befahl der Kurfürst.
Klar und deutlich sprach der Schreiber die Worte aus, die er schon so oft geschrieben und gelesen hatte.
»Von Gottes Gnaden Wir Friedrich Herzog zu Sachsen, des Heiligen Römischen Reiches Erzmarschall und Kurfürst...«
Lucas richtete sich auf: Diese Worte waren für ihn bestimmt! Er geriet in solche Aufregung, dass er nur einzelne Wortgruppen deutlich wahrnahm.
»Wir haben Unseres Dieners und lieben Getreuen Lucas von Cranach Ehrbarkeit, Kunst und Redlichkeit kennengelernt ... Nicht Lucas Sunder oder Lucas Maler, wie man ihn sonst zu nennen pflegte, sondern Lucas von Cranach, Lucas aus der Stadt Kronach, südlich der kurfürstlichen Veste Coburg gelegen ... Wir haben die angenehmen und gefälligen Dienste gesehen, die er Uns erwiesen hat ... Wir wissen, dass er der Römischen Königlichen Majestät, dem Heiligen Reich, Uns und Unseren Erben auch künftig dienen wird ... Wir verleihen dem Lucas von Cranach dieses Wappen ...«
Jetzt las der Schreiber so schnell, dass Lucas fast nichts verstand. Da war die Rede von einer Schlange, Fledermausflügeln, Krone, Ring, Rubinstein, gelbem Pausch. Ja, ein solches Wappen hatte Lucas einmal für sich erträumt, und von diesem Traum hatte er in Wittenberg erzählt. Er konnte es nicht glauben, er wollte den Schreiber um die Wiederholung dieser Worte bitten, aber er wagte nicht, das Lächeln des Kurfürsten zu unterbrechen.
»Zur Beurkundung haben Wir Unser Siegel wissentlich an diesen Brief hängen lassen, der gegeben ist zu Nürnberg am Dienstag der Heiligen Drei Könige, nach Christi Unseres lieben Herrn Geburt fünfzehnhundert und im achten Jahr ...«
Der Kurfürst lächelte und unterschrieb. Lucas würde ihm ebenso viel nützen wie jeder einzelne Herr in seinem Gefolge, vielleicht sogar mehr. Ein Maler arbeitet mit dem Kopf und mit den Händen, nicht mit dem Mund. Ein Maler denkt an seine Bilder, nicht an seine Burgen und Ländereien. Ein Maler ist gut zu brauchen. Die anderen sollten ihn anerkennen, nicht nur wegen seiner Bilder. Er war nun ihresgleichen, er gehörte zwar nicht zum Adel, doch er war mehr, er besaß einen Wappenbrief des Reichsstatthalters.
»Und nun trage ich diesen Namen, Mutter, und ich will immer daran denken, woher ich kam: aus Kronach. Aber auch daran muss ich denken: Dass ich hier nicht bleiben darf. Dass ich weitergehen muss, weil ich einen neuen Namen habe. Komm mit, Mutter!«
Undeutlich erkennt Anna Sunder die geflügelte Schlange. So weit hat es Lucas also gebracht! Viel weiter als die Maler, von denen sie gehört hat, Wolgemut und Dürer. Sie fühlt sich plötzlich jünger. Einem großen Haus vorstehen - das könnte sie wohl noch. Aber die Augen ... ? Und - wird die Schwiegertochter damit einverstanden sein? Wenn man keine Kinder hat, wirft man alle Kräfte ins Haus.
»Was sagt deine Frau zu solchen Plänen?«
»Sie weiß noch nichts davon. Ich weiß nur, dass sie sich einsam fühlt.«
Lucas Cranach. Der Name klingt gut. Anna Cranach, Matthes Cranach, Thomas ... Nein, das nicht! Man wird den Namen der Heimatstadt mitnehmen können, man wird Kronach nicht vergessen.
»Gib mir Bedenkzeit. Du meinst es ernst. Und verzeih meine harten Worte von Stolz und Hochmut.«
Anna Sunder erhebt das Glas.
»Auf deine Gesundheit, Lucas Cranach!«
»Großen Dank, Frau Meisterin!«
Jetzt schmeckt ihr der Wein, der lange sorgfältig gehütete. Auch die Speisen schmecken ihr. Sie isst mit größerer Lust als an den vergangenen Tagen und Wochen. Gut sieht er aus, der Sohn! Breit in den Schaltern, mit kräftigen Händen und mit einem Gesicht, das immer hellwach ist. Keine Müdigkeit in seinen Augen, trotz des anstrengenden Rittes, trotz der vielen Arbeit.
Als es schon dunkel geworden ist, geht Lucas selbst ins Wirtshaus, um den Malerknecht Thomas nach Haus zu holen. Es dauert lange, ehe er ihn zum Mitkommen bewegen kann. Dann sitzen sie endlich gemeinsam am Kronacher Tisch.
»Was willst du von mir? Weshalb hast du mich geholt?«
»Ich habe dir etwas zu sagen. Warten wir noch auf Matthes, die Mutter holt ihn schon. Er muss sich noch waschen und umziehen.«
Thomas grinst. Das muss Matthes immer: sich waschen und umziehen. Aus dem wird kein Maler. Höchstens ein Gelehrter, ein Bücherwurm. Auf Malgerüsten ergreift ihn der Schwindel. Vom Wandern hält ihn die Angst vor Husten und Schnupfen zurück.
»Du wirst ihn wohl endlich zur Ordnung erziehen müssen, Lucas!«
Anna Sunder, die wieder in der Stube ist, nickt zu diesen Worten. So ist es ihr recht: Ordnung schaffen, Aufgaben verteilen, du machst dies, du arbeitest das - wann ist die Arbeit fertig? Gut eingeteilt werden muss der Tag von morgens bis abends. Jede Tageszeit, jede Stunde hat ihr eigenes Maß, ihr eigenes Licht, eigene Frische und Müdigkeit. Jede Minute muss wie ein voller, runder, satter Wassertropfen sein oder wie ein Körnchen in der Sanduhr, das vom oberen Trichter der noch ungenutzten Zeit in den unteren der erfüllten Stunden rieselt. Bei Matthes aber ist kein sichtbarer Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Uhrglas. Sein Handgriff um den Malpinsel ist viel zu locker, zu lose, der Farbstrich verliert sogleich die Richtung, die Farbe tropft auf die Hemdärmel, auf die Hosen, auf die Schuhe.
Nun tritt Matthes endlich ein, leidlich gesäubert.
»Ich möchte euch mitnehmen nach Wittenberg. Ich möchte euch in mein Haus aufnehmen.«
»Nein!«
Thomas springt auf.
Lucas erschrickt. Dieses Wort ist ein Fremdling in seinem Mund. Immer wenn er nein sagen müsste, schweigt er. Wenn sein Gegenüber kein Schweigen erlaubt, holt er ein anderes Thema aus seiner Gedanken- und Planschatzkammer hervor. Nein - das gibt es nicht! Nein - das ist niemals der Schlüssel zu einem großen Haus, zu lohnenden Aufträgen, zu einer Reise in die Niederlande. Dieses Wort riecht nach verdorbenem Öl. Es lässt leuchtende Farben blind werden. Lucas sieht eine ganze Kette von Nein-Worten an sich vorüberziehen. Seine Hand ballt sich zusammen. Er möchte ein anderes Nein entgegenstellen. Aber er ist ungeübt im Neinsagen, jedoch geübt genug, um seine Verlegenheit zu verbergen.
»Aber Thomas! Ich denke nicht nur daran, mir Arbeit vom Hals zu schaffen, du sollst nicht nur mein Gehilfe sein, sondern mein Mitarbeiter, Mitarbeiter; du sollst teilhaben an meinem Reichtum und an meinem Ansehen.«
»Hast du keinen anderen Teilhaber? Ich bin nicht mehr allein. Ich habe einen Sohn, das wird dir neu sein. Seine Mutter starb bei der Geburt, und sie war nicht meine Frau. Wusstest du das nicht?«
»Nein.«
So muss er es doch sagen, dieses unfreundliche Wort. Schnell einen Schluck Wein, damit sich keine Verlegenheit einnistet. Ordnung schaffen sollte er im Kronacher Sunder-Haus, hat die Mutter gesagt. Dass sich eine solche Unordnung eingestellt hat! Gleichviel, Kronach ist Kronach, und Wittenberg ist Wittenberg. Die Wittenberger haben ihren eigenen Klatsch und Tratsch. Ein in Unehren geborener Sohn eines Zugereisten wird sie nicht erschüttern.
Aber mich erschüttert er. Ich bin in Ehren geboren, in Ehren verheiratet, ein angesehener Mann, und ich habe keine Kinder ... Werde ich den Sohn des Thomas ertragen können?
»Woher sollte ich es wissen? Ich bin lange nicht in Kronach gewesen. Wie heißt er denn, dein Sohn?«
»Lorenz.«
»Lorenz ... Auch für ihn gibt es Platz in meinem Haus. Es hat viele Ecken und Winkel zum Spielen und auch einen hübschen kleinen Garten. Dein Sohn wird sich wohlfühlen bei uns.«
»Hat er dort Spielgefährten?«
Herausfordernd sieht Thomas den Meister an.
»Nein!«
Wieder dieses Wort, nicht nur hässlich, sondern auch schmerzhaft. »Aber es werden sich Spielgefährten für deinen Sohn einstellen. Kinder, die er beschützen kann. Meine Frau ist noch jung.«
»Der Abschied von Gotha ist ihr wohl zu schwer geworden? Oder gefällt ihr der Name Sunder nicht, dass sie ihn nicht weitergeben will?«
»Sunder war und ist ein guter Name. Jetzt aber führe ich einen anderen Namen. Unser allergnädigster Herr, Kurfürst Friedrich, hat ihn mir erlaubt. Ich heiße Lucas Cranach.«
»Einen neuen Namen hast du? Wohl auch gar ein Wappen?«
Lucas lässt Thomas’ Spott vorbeiziehen.
»Ja, ich habe auch ein Wappen. Hier ist es.«
Zum zweiten Mal an diesem Abend rollt er den Wappenbrief auseinander, enthüllt die schwarze Schlange mit den Fledermausflügeln auf einem gelben Schild. Eine rote Krone ziert den Kopf. Aus dem Maul rollt ein goldener Ring mit einem Rubin.
Eine freundliche, lächelnde Gestalt aus der blauen Ferne scheint in das Sunder-Haus zu treten, ein blonder, blauäugiger Dichter, überall gern gesehen, stets herzlich willkommen, immer angefüllt mit Märchen und lehrreichen Geschichten: Doktor Johannes Cuspinian, der Rektor der Wiener Universität. Lucas hat ihn auf seiner Donaufahrt kennengelernt. Er war anfangs sehr zurückhaltend, denn Johannes stand ja so hoch über ihm. Sie waren zwar gleich an Jahren, aber Johannes war ein berühmter Mann und Lucas nur ein wandernder Malergeselle; doch während er den Dichter malte, wurden sie Freunde. Cuspinian hatte besondere Wünsche.
»Oben an den Himmel malt mir eine Eule. Sie ist das Tier des Melancholikers, und ich gehöre trotz aller Heiterkeit nun einmal zu dieser traurigen Spezies. Doch wenn man den Dämon beim Namen ruft, bannt man ihn, macht man ihn dienstbar. Darum haltet ihn fest, Malersmann, hängt ihn hoch in den blauen Himmel.«
Lucas verließ sofort die blonden weichen Haare, an denen er gerade malte, und ließ eine kleine Eule aus seinem Pinsel herausflattern. Die Eule war also das Tier des Melancholikers! Wieder hatte er etwas Neues gelernt!
»Verzeiht, Doktor Johannes, wenn ich Euch eine Frage stelle. Welches Tier empfehlt Ihr mir zum Bannen und Beschwören, zum Helfen und zum Wachsen?«
Cuspinian dachte nach.
»Dreißig Jahre seid Ihr jetzt alt? Und noch immer unterwegs und unbehaust? Ich sehe, dass Ihr in der Zukunft einmal ein großes Haus haben werdet. Und wegen dieses großen Hauses braucht Ihr einen guten Hausgeist. Ich wünsche Euch die Schlangenkönigin, die königliche Schlange mit Krone und Ring. Sie wohnt in den Häusern der Glückskinder und bringt ihnen noch mehr Glück. Aber nur, wenn sie sich dort wohlfühlt. Sonst zieht das Schlänglein aus und macht einem anderen Tier Platz. Das ist die teuflische Schlange aus der Bibel. Die aber fühlt sich nur dort wohl, wo der Mensch meint, er sei wie Gott.
Gott schenke Euch die kleine, feine Schlangenkönigin, Freund Lucas aus Kronach!«
Schade, dass sich die Gestalt des Johannes Cuspinian so schnell zurückgezogen hat. Dass Thomas’ Stimme jetzt wieder auf ihn eindringt. »Fürchtest du dich nicht vor diesem Schlangenzeichen? Kein Tier ist von Gott verflucht, nur die Schlange. Fürchtest du dich nicht vor diesem Fluch?«
»Aber Thomas, was redest du da ...«, murmelt Anna Sunder. Doch auch sie muss jetzt an den Baum im Paradies denken, um den sich die Schlange windet. - Iss von dem Apfel, Eva, ihr werdet sein wie Gott ... Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang.
»Überlass dich nicht der Macht der Schlange, mein Sohn ...! Dein Wappenbrief ist wie ein zweischneidiges Schwert.«
Lucas lächelt, obgleich er lieber gegrollt hätte. Er will ja nicht den Apfel, sondern den Namen Cranach. Er muss es nicht mehr hören: Unser getreuer Diener Lucas Maler ... Lucas Maler möge diesen Auftrag erhalten. Maler, Maler, das kann jeder sein.
»Der Name Cranach soll schwerer wiegen als die Schlange.«
»Es wird Zeit, dass auch ich mich nach einem Namen umsehe«, sagt Thomas. »Es scheint jetzt so üblich zu sein unter den Malern. Wisst ihr, wie ich mich nennen werde? Thomas Nemo.«
»Dummes Zeug!«, ereiferte sich Matthes. »Nemo - das bedeutet Niemand!«
»Sieh da, unser Schriftgelehrter! Ein kluger Kopf ist er, der Matthes, die wahre Freude seines Lateinmeisters. Wenn der Name Cranach so schwer wiegen soll, dass das Gewicht in der anderen Waagschale ein Wappenbrief sein muss, dann ist jeder andere Name daneben ein Niemand ...«
»Thomas! Du hast zuviel getrunken!«, rügt Anna Sunder.
»Jawohl! Aber seid beruhigt, Frau Meisterin, ich werde Euch jetzt nicht länger zur Last fallen; ich werde die Wiedersehensfreude der Familie Cranach nicht stören. Gute Nacht!«
Krachend fällt die Tür ins Schloss. Der Luftzug löscht die Kerze, man sitzt im Dunkeln. Jeder zögert, das Licht wieder anzuzünden; es ist, als seien alle Köpfe und Hände geprügelt.
Ich bin Lucas Cranach. Niemals habe ich daran gedacht, dass ein anderer neben mir ein Niemand sein müsse. Die Welt und die Stadt Wittenberg sind groß genug für uns alle. Unrecht hat er, der Thomas. Was soll ich nur tun - was soll ich nur tun? Ihm nachgehen, ihm die Hand auf die Schulter legen, hinter ihm stehen, wenn er sich über das Schlaflager seines Sohnes beugt? Was bedeutet der Name Cranach, was wiegt der Wappenbrief gegen einen Sohn? Nihil, nemo ... Brächte doch jemand eine neue Flamme auf die Kerze ...!
Trüber noch sind Anna Sunders Gedanken. Ich habe gelobt, feierlich gelobt und versprochen, ihn zu lieben. Nicht nur wegen des Priesters mit der Stola um den Hals und wegen der brennenden Kerze in meiner Hand wird mein Gelübde zur Pflicht, sondern tief, ganz tief drinnen weiß ich, ich muss ihn lieben. Wie aber kann ich einen Niemand lieben? Weshalb macht sich jemand, der so viele Zeichen der Liebe empfangen hat und noch empfängt, zum Niemand? Warum löscht er die Kerze aus?
Und Matthes Sunder denkt: Wenn er ein Nemo - ein Niemand - ist, dann hat er keine Gewalt mehr über mich. Ich werde meine Ohren ganz verschließen, wenn er über mich verfügt: Male den Baum besser! Seit wann ist ein Baum eine Kugel? Die Äste, die Zweige, die Blätter ...! Lege das Buch aus der Hand und schaue auf die Natur! Gib mir den Schlüssel zu deiner Studierstube und lass dir von der Mutter den Wandersack packen, allein bringst du es ja nicht fertig. Zieh nach Nürnberg oder nach Augsburg ... Was weiß denn ein Niemand von Nürnberg und Augsburg! Hier sind meine Bücher, und hier will ich bleiben. Matthes geht in die Küche und holt Feuer vom Herd. Die Flamme auf der Kerze wächst wieder, und Lucas und Anna Sunder sehen einander in traurige, enttäuschte Gesichter. Die Mutter gießt den letzten Wein aus dem Flaschenkrug in den grünen Glasbecher.
»Lass dich’s nicht verdrießen, Lucas«, sagt sie leise. »Es ist eine große Kunst im Leben, vergessen zu lernen. Übe sie rechtzeitig, damit du sie im Alter beherrschst. Glaube mir, im Alter lebt man mehr von dem, was man vergessen hat, als von den Erinnerungen.«
»Ich will mich bemühen. Welch einen schönen Krug hast du da auf den Tisch gestellt!«
Anna Sunder schiebt die Kerze an den braunen Steinzeugkrug.
»Dein Vater kaufte ihn kurz vor seinem Tode von einem Kölner Händler, der durch Kronach kam. Dein Vater hat diesen Krug nicht mehr benutzt. Du bist der erste, Lucas Cranach.«
Die breite kühle Krugkugel möchte man mit beiden Händen umspannen. Über die Kugel ringelt sich Eichenlaub mit feinen Blättern und Früchten, wie von einem geschickten, geduldigen Schnitzer aus dem harten Steinzeug herausgeschält.
»Gefällt dir der Krug? Er wird jetzt auch dein Eigentum sein, wie alles in diesem Haus. Aber für uns musst du sorgen, für den Matthes und mich, und auch für den Thomas.«
»Weshalb soll ich für ihn sorgen, wenn er sich zu einem Niemand macht?«
»Vergiss ... Du musst es, es ist der letzte Wille deines Vaters.«
Lucas trinkt den letzten Schluck. Leicht wiegt das lichtgrüne hohe Glas in seiner Hand. Wie zart und fein es geblasen ist! Jede einzelne der aufgesetzten Noppen spiegelt das Licht der Kerze wider, welch eine Fülle von Licht!
»Sagen wir diesem Tag Valet, Mutter. Lass mich jetzt schlafen, endlich wieder einmal im Vaterhaus schlafen. Es ist selten, dass ein Maler ins Vaterhaus zurückkehrt. Er muss unterwegs sein, er muss die Welt erfahren, sie in sich hineintrinken.«
Als Lucas Cranach am nächsten Morgen die Werkstattschwelle überschreitet, fühlt er sich in alte Zeiten zurückversetzt. So roch es damals auch schon, nach Farbe, nach einem besonderen Firnis, nach klebrigen Flüssigkeiten, mit denen man immer so sparsam umgehen musste, weil sie viel Geld kosteten. Drei Fenster lassen das Licht von der Straße vorsichtig durch die dicken Butzenscheiben in den großen Raum eindringen. Das mittlere, das größte Fenster gehörte dem Vater. Dem Meister gebührte das beste Licht. Am hinteren Fenster hatte Lucas gearbeitet. Nicht jeder Neugierige, der über die Schwelle trat, sollte sich sogleich auf sein angefangenes Bild stürzen ... Am vorderen Fenster hatte sich Thomas niedergelassen, Thomas, der aus dem Nichts eines Tages in die Werkstatt gekommen war und die Malerei lernte, obwohl man wusste, dass ihn nie eine Zunft aufnehmen würde, war er doch von unehelicher, unehrlicher Geburt. Woher er kam, von wem er gezeugt und geboren war - niemand sprach darüber. Er war begabt und fleißig, und Meister Sunder lobte ihn nicht weniger als seinen Sohn Lucas.
Es gefällt Lucas nicht, dass Thomas das mittlere Fenster für sich beansprucht. Er ist kein Meister und wird nie einer sein. Doch schon der erste Blick auf die Staffelei belehrt ihn, dass Thomas meisterhaft zu malen versteht. Von Matthes kann man das nicht sagen. Er hat den Platz vorn an der Tür für sich gewählt, den verführerischen, von dem man leicht wegschlüpfen kann. Ihm gehört eigentlich der Platz in der Mitte, aber er kann ihn nicht ausfüllen. Er malt einen Altarflügel. Lucas könnte sagen, er streicht ihn an, denn von fleißiger Malerei ist da nicht viel zu spüren. Ein hartes Gelb steht neben einem bläulichen Grün; Mauritius, der Mohrenheilige, ist nicht bräunlich schwarz, sondern dunkelviolett. Schülerhaft ungelenk ist die Zeichnung, an vielen Stellen verbessert, Lucas seufzt.
Ruhe auf der Flucht, 1504
Thomas malt die Mitteltafel des Altaraufsatzes, eine Szene von der Flucht der heiligen Familie in das Land Ägypten. Die Eltern halten mit dem Kind Rast. Lucas schaut und schaut. Auch er hat sich einst mit der heiligen Familie auf die Flucht begeben, ist mit Maria, Josef und dem Kind in den Wald gezogen - das Land Ägypten lag ihm nicht am Herzen, aber der Wald! - er hat sich mit ihnen an die Lagerstätte gesetzt, innige Stunden waren es. Das damals entstandene Bild muss noch hier irgendwo in der Werkstatt stehen. Er sieht sich um, da fragt Thomas: »Was sagt Ihr zu meinem Bild, Herr Meister?«
Lucas hebt abwehrend die Hände, aber des Thomas Stimme verträgt keinen Widerspruch, scharf ist sie, schneidend und fordernd. Und doch hastig und ängstlich. So ist auch sein Bild: keine Rast, sondern Flucht, ängstliche Blicke nach allen Seiten, keine freundlichen, Schatten spendenden Bäume, sondern gezackte Gespenster, die ihre Fangarmäste nach den heiligen Gestalten ausstrecken. Josef hat die Greisenschwelle längst überschritten, mit welchem Glauben will er das Land Ägypten erreichen? Maria reißt das Kind an sich, bei ihr wird es nie spielen dürfen, sie wird alle die kleinen Engel verscheuchen, ihre Augen flackern vor Angst. Fürchte dich nicht, Maria, aber gib dich auch keinen Hoffnungen hin, man wird dir das Kind doch entreißen ... In der Ferne tauchen schon die Häscher auf, sie reiten auf schnellen Pferden, jetzt dürfen sie das Kind noch nicht finden, davon steht nichts in der Bibel, aber sie werden es schon aufspüren, denn ihre Pferde kreisen immer um die heilige Familie, immer schmaler der Weg zur Flucht, wie eng wird einst der Weg zum Kreuz sein?
»So rede doch, Lucas Cranach!«
»Was für eine Rede erwartest du von mir? Bilder soll man nicht bereden, sondern betrachten.«
»Du suchst wohl nach deinem eignen Bild, auf dem du die heilige Familie rasten ließest? Ich habe es mir genau angesehen, bevor ich dieses Bild begann, aber du siehst, es ist mein Bild geworden, mit deinem hat es nichts zu schaffen. Ich habe dir nichts gestohlen. Dort steht es, die heilige Familie blickt schon lange in die Wand hinein, wende sie nur ruhig zum Licht, sie wird dir dankbar sein dafür.«
Lucas zieht die Holztafel hervor, ist überrascht und beglückt wie damals vor vier Jahren, als er dieses Bild in Wien vollendet hatte. Heimweh steigt plötzlich in ihm hoch. Weshalb? Er ist ja daheim. Und doch hat er Sehnsucht nach jenen Jahren, als er nach Wien wanderte, als er dort die Welt eroberte, unauslotbar tiefe Gespräche und Arbeitsstunden durchlebte und dann mit diesem Bild zurückkehrte. Damals glaubte er, die ganze Welt müsse nun auf ihn warten. Er hatte sich nicht ganz getäuscht: auf ihn wartete Barbara Brengbier, auf ihn wartete der allergnädigste Herr Kurfürst Friedrich der Weise, auf ihn warteten Häuser, die zu einer berühmten Stadt werden wollten - aber warteten auch solche Bilder auf ihn? Diese Tafel hatte er damals aus seiner tiefsten Tiefe an das Tageslicht geholt, wie aus einem wohlgefüllten Brunnen, wie aus einem reichen Bergwerk; er hatte sie ganz allein geholt. Heute sagen ihm immer andere, was er an das Tageslicht zu befördern habe und von welcher Beschaffenheit es sein müsse. In solche glücklichen Tiefen wie damals ist er noch nicht wieder hinabgedrungen.
Einen Wunschtraum hat er damals gemalt, seine Sehnsucht hat er geformt, er wünschte sich eine Familie. Hat er sich selbst gesehen in der Gestalt des Josef, der da mitten im Bild steht, überragt von der Tanne, die ihre Zweige über die kleine Familie mitsamt dem Engelbesuch ausschirmt? Freundlich ist die Natur, wenn der Mensch ihr freundlich entgegenkommt. Noch jetzt sieht er diese Familie manchmal unter einer Tanne sitzen, wenn er durch die Wälder reitet. Maria ist noch Mädchen und doch schon Frau. Sie umsorgt und schützt das Kind und lässt es dennoch spielen ... Welches Kind könnte sich solchen Spielgefährten versagen, die hier den weichen Waldboden bevölkern, schwebend, hüpfend, singend? Ungebrochene, unvermischte Farben hat er damals auf die Holztafel aufgetragen. Wie im Rausch hat er gemalt, zur Eile gedrängt, um diese reichen Stunden ganz auszuleeren, und dennoch zurückhaltend, weil ja immer ein Rest zurückbleiben muss, ein Stückchen Sauerteig, das dann wieder wachsen kann zu neuem Brot, zu neuen Bildern. Lucas hatte Selbstzucht gelernt bei seinem Vater.
Er sieht hin zum Bild des Thomas und weiß, es ist ein Bild ohne innere Zucht, schnell gemalt, gut gemalt, tief heraufgeholt, aber das Malen war zum schnellen Genuss geworden. Thomas hatte sein inneres Bild nicht so lange wie möglich festgehalten. Wie viele Tage hatte Lucas damals allein mit dem Blauhimmel zugebracht; zu allen Tageszeiten war er an die Donau hinausgegangen und hatte über den weiten Ebenen das unendliche Blau in sich einströmen lassen, immer wieder Veränderungen entdeckt, Wandlungen, feinste Übergänge, kaum wahrnehmbare Schleier, Schimmer wie von Perlmutt. Seine Augen hatten alles mit sich herumgetragen, verarbeitet, und nach diesem langen Weg war es aus den Händen auf die Holztafel gebannt worden. Alle Wiener Maler waren gekommen, um das Blau auf seinem Bild zu sehen und zu bewundern. Sie hatten nicht mit Lob und nicht mit Neid gespart und dann solche Blauträume auch vor ihren eigenen Tafeln geträumt. Bei manchen aber waren es Albträume geworden ... Noch kühnere Eroberungsfahrten als in das Blau unternahm er in das Grün, lag wie ein Jäger auf der Lauer, entdeckte den ersten Grünschimmer in den winterlichen Zweigen, ließ die Natur das zarte Frühlingsgrün vor sich entfalten, aber es schien ihm zu zerbrechlich, um es auf seinen Bildern festzuhalten; er wählte das satte, tiefe Sommergrün, in dem die Blätter schon gefestigt waren durch Regen, Wind und Sonne. So taugten sie für seine Bilder, so standen sie kräftig vor dem klingenden Blau. Er hatte beobachtet, er wurde dafür belohnt, nach jedem Ritt durch den Wald durfte er farbige Früchte ernten. Doch die Sehnsucht nach der Familie blieb unerfüllt. Aus einem entfernten Zimmer des Malerhauses dringt Kindergeschrei. So schreit also der Sohn des Thomas.
»Du musst etwas zu meinem Bild sagen, du bist der Meister und Erbe. Mir ist es gleich, was du sagst, ja oder nein, aber Schweigen ertrage ich nicht.«
»Nein sage ich selten, mit Nein komme ich nicht durchs Leben. Du aber bist ein anderer Mensch, dir steht das Nein wohl eher an, aus deinem Bild tönt mir sehr viel Nein entgegen. Es ist dein Bild, dein eigenes, und ich freue mich, dass du eigene Bilder malen kannst.«
»Mehr willst du darüber nicht sagen?«
Lucas sagt nicht nein, wendet sich wieder seinem eigenen Bild zu. Ich freue mich, dass du eigene Bilder malen kannst, denkt er. Auch ich kann es, dies da ist mein ganz eigenes Bild, ich begegne mir darin wie einem alten Freund. Es ist gut, sich selbst zum Freunde zu haben, ich will auch diesem alten Freund meinen neuen Namen geben: Lucas Cranach ...
»Gib mir einen feinen Pinsel und dunkle Farbe!«, wendet er sich an Matthes im gleichen Ton, in dem er in seiner Wittenberger Werkstatt zu den Malerjungen spricht.
»Willst du jetzt noch etwas ändern? Das Bild ist fertig. Wir müssten es endlich verkaufen.«
Matthes reicht dem Bruder nicht dunkle, sondern gelbe Farbe. Matthes wird eben kein Maler. Aber die gelbe Farbe gefällt dem Meister, schnell greift er zum Pinsel, sättigt ihn mit Gelb. Am linken vorderen Bildrand kriechen zwei Baumstümpfe aus der Erde, sie stehen da wie ein kleiner Tisch und ein Stuhl. Maria hat sich mit dem Kind auf einer Rasenbank niedergelassen, Tisch und Stuhl sind noch frei. Auf den Baumstumpfhocker also werde ich mich setzen, beschließt Lucas. Er beugt sich über das Bild und schreibt mit seiner feinen kräftigen Hand die Anfangsbuchstaben seines neuen Namens auf die braune Rinde: ein kleines L und ein größeres C, dessen Rundung den Längsbalken des L überschneidet. Und auf die Sägefläche des Baumstumpfes schreibt er die Jahreszahl: 1504. Vier Jahre sind seither vergangen, und doch sind sie geblieben, Zeit, aus der man Gestalten, Farben und Formen, Mauern und Türme werden lässt, vergeht nicht, sie bleibt. In weiteren vier Jahren wird er vierzig Jahre alt sein - und das Bild bleibt, die Zeit bleibt. Ob er siebzig oder gar achtzig Jahre alt wird? Gleichviel, das Bild wird bleiben, die Zeit wird bleiben.
Mit verschränkten Armen starrt Lucas auf sein Bild und merkt nicht, dass Thomas mit zusammengekniffenen Lippen vor der Staffelei am mittleren Fenster steht, den gelb getränkten Pinsel in der Hand hält und zwei Anfangsbuchstaben an den Himmel schreibt: T und N. Das T und das N erhalten einen gemeinsamen Längsbalken, so ist es Malersitte. Darunter malt er die Jahreszahl: 1508. In diesem Jahr beginnt im fernen Rom Michelangelo mit der Ausmalung der Sixtinischen Kapelle, und diese Arbeit wird ihn bis 1512 an die Wand fesseln; Raffael setzt seinen Pinsel an die Wände der Stanzen im Vatikan - aber von Michelangelo und Raffael, diesen Wettstreitern um den Glanz des neuen ewigen Rom, hat Thomas noch nichts gehört, sie haben keinen Platz in seinen Gedanken, er führt jetzt einen Zweikampf zwischen LC und TN.
»Thomas, was machst du da?«, fragt Matthes heftig. »Das kommt dir nicht zu! Du weißt, dass die Bilder, die in dieser Werkstatt entstehen, mit meinem Namen signiert werden müssen, denn du hast ja keinen ...«
»Schweig!«, donnert Lucas dazwischen. »Mit deinem Namen wird hinfort nicht mehr gezeichnet. Deine Klecksereien sind keinen Namen wert, dein Name auf den Bildern des Thomas kommt einem Diebstahl gleich. Thomas ist ein guter Maler, aber er muss sich an die Zunftgesetze halten, leider ... Ich jedoch habe mit der Kronacher Malerzunft nichts zu schaffen und bin nicht der Hüter ihrer Gesetze. In meinem Haus herrscht meine Ordnung. In Wittenberg erkennt man meine Gesetze an, und wenn ihr in meiner Ordnung leben wollt, müsst ihr mit mir nach Wittenberg ziehen. Entscheidet euch rasch, ich habe größere Aufgaben, als Namensstreitereien zu schlichten.«
Hinter Lucas fällt die Tür ins Schloss. Matthes und Thomas wechseln feindselige Blicke, dann beschimpfen sie sich so laut, dass Lucas es oben in seiner Kammer hört.
Was kümmert mich dieses Gezänk? Und doch - ich muss Ordnung schaffen. Die Mutter soll ihr weiteres Leben nicht zwischen diesen eifersüchtigen Männern - ha, der Matthes, ein Mann! - verbringen. Der Thomas muss einen Namen haben. Ich werde den allergnädigsten Herrn Kurfürsten darum bitten. Nicht vergeblich, dessen bin ich gewiss.
Im Dachstübchen hat sich seit Lucas’ Weggang nichts geändert. Er lebt in größeren Räumen, hier ist es eng, aber dennoch freut er sich über die Ruhe, nun ist auch das Gebelfer unten in der Werkstatt verstummt, jetzt umschleichen sie einander wohl misstrauisch wie feindliche Katzen. Lucas kennt solche Werkstattluft. Gleichviel, wenn sie nur ruhig sind. Unter Lärm kann man nicht arbeiten.
Da steht noch die eisenbeschlagene Truhe, ein Geschenk des Vaters, als Lucas zum ersten Mal den Stift in die Kinderhand genommen hatte, um die Vorzeichnung zu einem Holzschnitt zu entwerfen. Ein Kronacher Meister hatte die Truhe gebaut und mit einem starken Schloss geschützt. Lucas lächelt; diese Truhe war ja für Holzschnitte und Kupferstiche, nicht für Diebe anlockende Reichtümer bestimmt. Er schlägt den Deckel hoch. Da liegen sie noch, seine Blätter mit den Engeln und Heiligen, mit den Bäumen, Bäume hat er schon immer geliebt ... Er wollte einen Baum pflanzen, wenn ihm ein Sohn oder auch nur eine Tochter geboren würde; aber es wurde bisher nichts mit dem Pflanzen.
Er nimmt einen Kupferstich heraus, legt ihn auf den Kastentisch unter das Fenster, tritt einen Schritt zurück, als fürchte er sich vor dem schwarz-weißen Stückchen Welt - fürchtet er sich wirklich? Eine Waldlandschaft. Über eine liebliche Lichtung der Blick auf eine ferne Burg. Eng umschlungen sitzt ein junges Paar, man sieht es nur von hinten, den keck-schief aufgesetzten Federhut des Jünglings, die aufgelösten, weich fließenden Haare des jungen Mädchens; es sieht so aus, als betrachteten sie die Burg in der Ferne ... Lucas weiß, dass sie nur sich selbst betrachten, dass sie ineinander ruhen, dass diese ganze Welt um sie nur ein schöner Rahmen ist, ein Spiegel für sie selbst. Oben in der Ecke des Blattes steht in zarten Buchstaben: das bin ich und mein liebster Buhl Margarethen ... Sie waren miteinander durch die Wälder und die Flüsse entlanggezogen. Er wusste nicht, woher sie kam. Sie war ein Geschöpf des hohen Farnkrautes und der sonnigen Gräser. Für ihn war es damals keine Frage, dass es schwebende Heilige gäbe und liebliche Feen und Elfen in den Wäldern. Dann aber kam er nach Wien und vergaß sein liebstes Buhl, dann wurde er ein angesehener Mann in Wittenberg mit einer Bürgermeisterstochter als Gemahlin, und die Liebe in der Ehe war ein Teil der Ordnung, von der die Arbeit in der Werkstatt und das Ansehen beim Landesherrn und bei den Mitbürgern lebte, doch in dieser Ordnung schwebten die Menschen nicht, sondern traten mit festen Schritten auf die Erde, und Feen und Elfen waren nur noch seltene Traumgäste. Die Liebe in den Wäldern war anders als die Liebe in einem Wittenberger Bürgerhaus. Dieser Kupferstich hatte die Zeit mit ihren Geschenken nicht festgehalten, sondern machte ihm den Verlust dieser Geschenke deutlich. Nicht die Bilder sind die Schatzkammern der Zeit, sondern die Erinnerungen, die sich mit diesen Bildern verbinden.
Lucas Cranach seufzt, sucht nach einer Schere, schneidet die obere Ecke mit den Schriftzügen ab, seufzt noch einmal, es ist schon ein Stöhnen, und dann schließt er die Truhe.
Am nächsten Tag reitet er weiter zur Veste Coburg.
Nachdem Anna Sunder drei Nächte lang nicht schlafen konnte, beschließt sie, nach Nürnberg zu reisen, sobald es die Jahreszeit erlaubt, um mit ihrer geistlichen Tochter im Klarenkloster die Übersiedlung nach Wittenberg zu beraten. Sie träumt schlecht in dieser Zeit. An die Mitternachtsträume kann sie sich nicht erinnern, um so bunter stehen die Morgenträume vor ihr. Längst gesprochene und längst vergessene Worte kehren zurück, treten ein, ohne anzuklopfen, lassen sich auf allen Stühlen nieder, erfüllen jeden Winkel.
- O ich verdorbener, schlechter Mensch! Ich ersticke unter der Last meiner Sünden, von dicken Schatten sind meine Bilder eingehüllt. Wer wird die Wolken verjagen? -
Tagelang, wochenlang war sie von solchen Worten ihres Eheherrn gepeinigt worden. Sie tröstete ihn, behielt krampfhaft den Kopf oben.
- Lucas soll nicht unser einziges Kind bleiben. Vielleicht übernimmt ein Kind die Buße für dich. Widersagt allen fleischlichen Lüsten, geht durch die schmale Pforte, lebt hinter Klostermauern. Lass uns das Gelübde ablegen, um ein solches Kind zu beten. -
Sie gelobten, und sie wurden erhört. Die Tochter Margarethe war still und in sich gekehrt und doch dem größeren Bruder Lucas und später auch dem Matthes in Liebe zugewandt, auch den Eltern, besonders dem Vater, auch den Bildern des Vaters, den Engeln, den Heiligen, dem Gekreuzigten, nicht aber den bunten Kleidern, dem blitzenden Schmuck, dem Reigentanz mit heißen Wangen. Man hatte ihr zwar bunte Kleider und blitzenden Schmuck geschenkt, man hatte sie den Reigentanz gelehrt, auch ihre Wangen hatten geglüht, aber dann fuhren Vater und Mutter mit ihr nach Nürnberg, Margarethes erste Reise, eine Fahrt ohne Wiederkehr. Lebt wohl, liebe Eltern, habt Dank für alles, jetzt wird ein anderer für mich sorgen.
Reichlich waren die Tränen geflossen. Das Schuldgefühl hatte sich in Meister Sunder während der Jahre ohnehin verkleinert. Die Erleichterung darüber, dass seine Tochter hinfort für seine Sünden büßen werde, vermischte sich mit dem Stolz des Kronacher Handwerkers, dem es gelungen war, seiner Tochter die Pforte eines Nürnberger Patrizierklosters zu öffnen, in dem es an wohlklingenden Namen nicht mangelte: Tücher, Ebner, Pirckheimer ...
Für Anna Sunder ist die Tochter Gottes Mund.
Unterwegs werden sie nach dem Reiseziel gefragt.
»Nach Nürnberg wollt Ihr? Womit handelt Ihr?«
Es ist unverständlich, dass man nach Nürnberg fahren kann, ohne handeln zu wollen.
»Wir wollen ein Ja oder ein Nein hören«, sagt Anna Sunder, und Thomas fügt schnell hinzu: »Nein, nur nein ...«
Am Nürnberger Thiergärtnertor fragt man nach dem Namen. Schnell kommt es über Frau Annas Lippen: »Wir kommen aus Kronach und heißen Cranach, mein Sohn Lucas ist Hofmaler, er lebt beim allergnädigsten Herrn Kurfürsten in Wittenberg, und meine Tochter Margarethe ist Nonne im Nürnberger Klarenkloster.«
Die Stadtwache ist zufrieden und Frau Anna auch. Den Weg zum Klarenkloster hat sie vergessen. Der Wagen zwängt sich durch enge Straßen, in denen es von Menschen wimmelt, für die ein Reisewagen nichts, aber auch gar nichts bedeutet. Thomas geht neben dem Wagen her und fragt: »Wo finden wir das Klarenkloster?«
Die Nürnberger belustigen sich über diese Frage.
»Zuerst müsst Ihr durch den Strom schwimmen. Es ist besser, Ihr steigt am anderen Ufer als Frau aus dem Wasser, denn so werden sie Euch wohl nicht nehmen, aber versucht es nur, man kann nie wissen ... In St. Klaren soll es bisweilen viel Gelächter geben ...«
»Dummes Zeug! Wir suchen dort ...«
»Nun verstehe ich! Eure Liebste hat Euch verlassen. Sucht Euch eine neue, das Klarenkloster gibt niemanden mehr heraus!«
»Dummes Zeug! Wir wollen ... unsere Schwester besuchen.«
Weshalb erst lange erklären, dass Margarethe nicht seine Schwester ist, die Nürnberger spotten doch über alles.
Das, was sie einen Strom nennen, ist ein breiter Bach, die Pegnitz, man muss auch nicht hindurchschwimmen, sondern kann über eine Brücke rumpeln, sie schwankt, aber sie trägt. Aus dem Klarenkloster dringt ihnen kein ausgelassenes Gelächter entgegen, sondern freundliches Fragen, woher, wohin, wer, zu wem?
Die Nonne Beatrix, ehemals Margarethe Sunder, setzt sich auf den harten Schemel jenseits des verschleierten Gitters.
»Margarethe, bist du da?« Anna Sunders Stimme ist leise und fest und sehr deutlich. Nichts Fremdes schwingt darin, keine Trauer und keine Unzufriedenheit.
»Ich möchte dir erzählen. Und ich möchte dich etwas fragen.« Nichtigkeiten kriechen durch den Schleier, erträglich nur durch die Geduld der Tochter, die große Kunst der Nonnen. Margarethe ist Meisterin dieser Kunst. Meisterin auch im Bildermachen. In ihr wachsen Bilder, die sie nie oder nie so gesehen hat. Nach einer Stunde schon hat sie rund um die Mutter ein Bild gemalt: die Kronacher Welt mit den schmalbrüstigen Fachwerkhäusern zwischen den Wäldern, aus den hohen Schornsteinen steigt Rauch, was bringt Frau Nachbarin heute auf den Tisch? Unerschöpflicher Gesprächsstoff, verdrängbar nur durch Kleiderpracht oder Reisegeschichten. Nun steht die Mutter in der Mitte dieser Welt: der Sohn der Witwe Sunder hat den Namen Cranach ins Haus gebracht, berühmt ist er, und fast jeden Tag sieht er einen richtigen Kurfürsten, und auch die Witwe Sunder könnte ihn sehen, wenn sie nach Wittenberg ginge, für immer ... Wenn sie in Kronach bleibt, wird sie hinfort nur noch davon träumen, wie es gewesen wäre, wenn ... Sie muss die Wirklichkeit kennenlernen, sonst wird ihr Alter von Gaukelträumen vergiftet sein, und es ist ja auch nicht wahr, dieses oft geseufzte Wort, dass man einen alten Baum nicht verpflanzen soll.
»Zieht nach Wittenberg. Alle, auch der Thomas!«
Nach diesem Wort geht Margarethe in die Kirche, unverschleiert, denn dort ist sie in der Gemeinschaft ihrer Schwestern, und sie singen mit ihren dünnen Stimmen die Psalmen und Hymnen, wie es schon seit tausend Jahren bei den Nonnen üblich ist.
Thomas trägt nur noch ein schwaches Bild von Margarethe Sunder in sich. Er hatte sie nie leiden können, weil sie schon als Kind von den Hausgenossen als etwas Besonderes angesehen wurde. Etwas Feines, Fremdes ging von ihr aus, sie war nicht stolz oder hochmütig, aber Thomas ging ihr aus dem Weg, ohne darüber nachzudenken, warum. Es ist ihm recht, dass er sie nicht sehen wird, nur hören. Nach den Vormittagsgebeten wird er mit der Witwe Sunder in das Gitterzimmer gebeten. Es ist alles wie am Vortag, aber Anna Sunder weiß nun nicht mehr viel zu sagen, es ist ja alles entschieden.
Die Nonne Beatrix hört das Kratzen in der Stimme des Mannes. Für ihn gibt es also noch unentschiedene Fragen. Man muss sie aussprechen, sonst werden sie zur unerträglichen Last.
»Ich freue mich, dass du mitziehen wirst nach Wittenberg. Du wirst dort eine neue Heimat finden und dein Sohn auch.«
Was weiß sie von mir und meinem Leben, von meinen Freuden und Schmerzen? Ich kann diese sanften Worte nicht ertragen. Das ist Nonnenrede. Ich muss ihr Mannesrede gegenüberstellen, wenn auch unehrlichen Mannes Rede.
»Ich widerspreche Euch. In Wittenberg wird es keine Heimat, sondern neue Schmerzen für mich geben. Und Gefahren für die Familie Cranach. Ich will Euch sagen, warum, jetzt, ehe es zu spät ist. Schon einmal rief mich der Lucas, damals, vor vier Jahren, als er Hofmaler wurde, soeben verheiratet mit Barbara Brengbier, die nicht ihn, sondern mich liebte ...«
»Thomas, was redest du da ...?« Anna Sunder reißt die Augen auf, erschrocken, das kann, das darf nicht sein, das passt nicht in ihre Welt, in ihre Pläne.
Die Stimme hinter dem Gitter bleibt ruhig wie zuvor.
»Weshalb heiratete sie dann ihn, wenn sie dich liebte?«