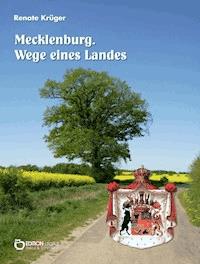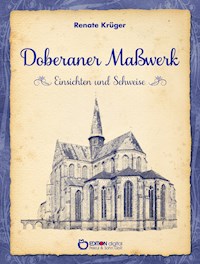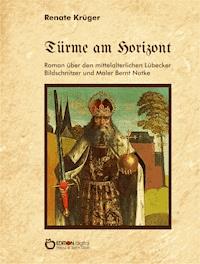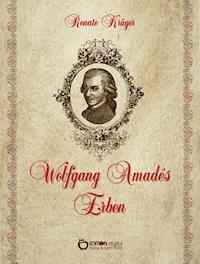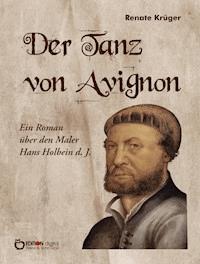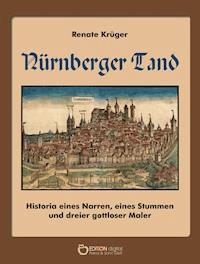7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ereignisse des Romans beginnen in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg und reichen bis zum Ausgang des 2. Weltkrieges. Der Bäckermeister Joseph Fabisiak lebt als wohlhabender, tüchtiger und geachteter Bürger in einer westpreußischen Kleinstadt. Er schämt sich seiner polnischen Herkunft, ist fleißig, um in den Rufpreußischer Tüchtigkeit zu kommen, und fromm,um als ehrsamer Bürger dazustehen. Den Beginn der Handlung bildet das Liebensverhältnis von Sofie Fabiasak, der einzigen Tochter des Bäckers, mit dem jüdischen Kaffeehausmusiker Ignaz Freudenfeld. Der junge Ignaz hat sich von seiner orthodoxen Familie getrennt, um eigene Wege zu gehen, über die er aber zunächst keine klaren Vorstellungen hat. Seine wirtschaftliche Notlage lässt ihn nicht zum Musikstudium kommen. Als Sofie ihm langweilig wird, verlässt er die Stadt. Sofie erwartet ein Kind und wird von ihrem Vater verstoßen. Sie findet Aufnahme bei Fabisiaks Schwester Wanda, die während des 1. Weltkrieges die Geliebte eines deutschen Offiziers und somit zum Abscheu der Familie geworden ist. In Norddeutschland unterhält sie jetzt eine kleine Gemüsehandlung. Und ohne diese tüchtige Frau, die so selbstverständlich menschlich und resolut ist, würde es mit Fabisiaks Familie ein böses Ende nehmen, denn Joseph Fabiasiak ist ein unseliger Mensch, ein Frömmler und ein Streber, der nichts liebt als sich und den Nutzen, der alle menschlichen Beziehungen zerstört und zum Verräter wird, wenn er sich bedroht fühlt. Mit ihm gelingt der Autorin ein ausgezeichnetes Porträt eines Spießers, dem Geschäft und Religion zu einer nützlichen Einheit verschmelzen. Auch die positiven Romanfiguren folgen keinem Schema, sind nicht nur typisch fromm und tüchtig. Der Autorin sind in diesem Roman überzeugende und differenzierte Charaktere gelungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Saat und Ernte des Joseph Fabisiak
ISBN 978-3-95655-589-3 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 1969 im St. Benno-Verlag, Leipzig.
© 2015 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Regelmäßig und eintönig ist das Leben in der kleinen Stadt Großenau, Provinz Posen. In ihrer Geschichte hat es nicht an Unruhen und vielerlei Auseinandersetzungen gefehlt. Manche Bewohner hatten daran sogar eine Art von Gefallen gefunden und mit demselben Wohlgefallen auf die Unruhestifter geblickt wie auf fahrende Schauspieler oder Tierführer, mit denen man sich zwar nicht an einen Tisch setzte, die aber endlich einmal Abwechslung in das Städtchen brachten. Meist waren die Unruhestifter Fremde: Polen, Russen, Juden - immer die anderen, denn die eigentlichen Bewohner lebten bieder und ordentlich, sie nannten das „solide Gesinnung“, aber sie langweilten sich. Und wenn sie ein wenig Unruhe als Unterhaltung empfanden, bekamen sie ordnungsgemäß ein schlechtes Gewissen. So ist es heute noch, im Jahr des Herrn 1929.
Mitten in der Stadt ist der Marktplatz. Mitten auf dem Marktplatz steht das Rathaus und hält mit seinen blanken Fenstern obrigkeitlich nach allen Seiten Ausschau. Im Rathaus sitzt der Bürgermeister und regiert, und er fühlt sich sehr wohl dabei; denn sehr viel Ärger hat er nicht, abgesehen von gelegentlichen Plänkeleien mit Polen oder Juden. Aber dieser Ärger erhält elastisch, er gleicht einer täglichen Gymnastik und bedeutet für den Bürgermeister dasselbe wie für den Stadtmusikanten das Geigeüben. Wenn sich der Bürgermeister eine Regierungspause gönnt - und das tut er oft -, blickt er aus dem Fenster seines Amtszimmers auf den Marktplatz, und dies Bild erfreut sein Auge. Es ist ja ein wirklicher Marktplatz, nicht nur ein historischer, und es wird auf ihm verkauft und gehandelt. In regelmäßigen Reihen prangen die bunten Marktschirme, darunter stehen die Marktfrauen mit ihren Waren. Dort gibt es fast alles zu kaufen. Aus weidengeflochtenen Körben leuchten Pilze, es duftet nach der Feuchtigkeit des Waldes, je nach der Jahreszeit gibt es Blaubeeren oder Preiselbeeren; im Frühjahr liefert der Wald Birkengrün und im Spätherbst Kien, er schenkt Reiserbesen, Waldmeister, Tannenzapfen, Moos. Ja, unser lieber Wald - so sagen die Polen; denn die Polen und die Wälder gehören zusammen. Dort können sie ein ungebundenes Leben in ihrer angeborenen Wildheit führen - das sagen die Deutschen. Für die Stadt taugen die Polen nicht. Sie haben keinen Sinn für Ordnung und solide Lebensart. Aber draußen auf dem Markt machen sie sich ganz gut, findet der Bürgermeister, wenn er aus dem Fenster blickt. Das unterwürfige Handeln liegt ihnen. Und es tut dem Käufer gut, wenn so mit ihm gehandelt wird.
Von weit her aus den Dörfern kommen die Polen, die Frauen mit grellbunten Kopftüchern, die sie tief in die Stirn hineingebunden tragen. Manche sehen wie Nonnen aus: Haare und Stirn sind nicht zu sehen. Neben sich haben sie große Körbe mit Eiern, Hühner mit zusammengebundenen Beinen, Hähne in prächtigem buntem Gefieder, schwere Enten und schneeweiße Gänse, eigens für den Markt sauber gemacht, ja, und sie haben saure Gurken und salzige Käse, geflochtenes Brot und Piroggen. Es gibt nichts, womit ein Pole nicht handeln könnte. Früher kamen sie barfuß, aber das hat ihnen der Bürgermeister untersagt. Nun kommen sie in Pantinen und schweren Schuhen.
Sorgfältig von den Wald- und Dorfpolen geschieden, sitzen die deutschen Marktfrauen, die Aristokratie dieser ambulanten Händler: Arbeiterinnen aus den städtischen Gärtnereien, Kleingartenbesitzerinnen, Tierzüchterinnen. Ihre Marktschirme sind nicht so bunt. Sie tragen keine Kopftücher, sondern im Winter Mützen und im Sommer Sonnenhüte, manche sogar Sonnenbrillen.
Der Bürgermeister freut sich auch über die Kulisse zu diesem bunten Treiben, zusammengebaut aus den Fassaden der Apotheke, des Arzthauses, des einzigen Hotels der Stadt, in dessen Anbau sich das Café Imperial befindet, einiger stattlicher Wohnhäuser und der Bäckerei des Joseph Fabisiak. Alle Fassaden sind frisch verputzt und sauber gestrichen, wie es sich für eine Stadt, und sei sie auch noch so klein, gehört. Ordnung und Sauberkeit überall! Die Bewohner fleißig und sparsam, die Polen als farbenfreudige Randverzierung für Markttage.
Der Bürgermeister ist wirklich der Repräsentant der kleinen Stadt; denn die meisten seiner braven Bürger denken genau wie er. Auch der Doktor blickt aus seinem Ordinationszimmer auf das Marktgewimmel und erholt sich dabei von dem gerade abgefertigten Patienten. Schwere Leiden sind unter seinen Besuchern selten. Im Herbst und Winter behandelt er Erkältungen, im Sommer Durchfälle und Sonnenbrände. Bei älteren Leuten gibt es Rheuma und Herzbeschwerden. Von Neurosen und Psychosen hat der Doktor nur in Büchern gelesen, und diese Lektüre liegt recht weit zurück. Im Übrigen ist er eine Respektsperson und besitzt ein Auto, das besonders von den polnischen Kindern immer wieder bewundernd angestarrt wird. Neben dem Doktor wohnt der Apotheker, nicht ganz so hoch im Ansehen, aber fast. Er hat kein Auto, aber er hat schon einmal mit einer Seidenraupenzucht begonnen, und das ist ebenso sensationell. Seine dunkle kühle Apotheke ist ein geheimnisumwitterter Ort, und manche Kinder fürchten sich, die vom Doktor verschriebene Medizin vom Apotheker abzuholen, denn an der Wand hängen Haifischflossen, und was in den Gläsern und bemalten Flaschen und Gefäßen enthalten ist, lässt sich nicht so einfach bestimmen, und man tut gut daran, seine Geschäfte schnell abzuwickeln. Andere hingegen sind sehr neugierig und halten sich länger als nötig in der Apotheke auf. Dann aber wird der Apotheker ungeduldig und blickt nach der Uhr, und das ist für die meisten seiner Kunden ein ungewohnter Anblick. Wer von den übrigen Einwohnern des Städtchens würde je auf den Gedanken kommen, auf die Uhr zu sehen? Die allgemeine Uhr, die den Rhythmus der ganzen Stadt bestimmt, befindet sich hoch oben, allen sichtbar, am Turm der Pfarrkirche zur Heiligen Familie, einem etwas derben Barockbau mit geschwungenem Turmhelm und ungewöhnlich hohem Satteldach. Hier liegt das geistliche Zentrum der kleinen Stadt Großenau, bestehend aus Kirchhof, Pfarrhaus, Schwesternhaus und Kirche. Dieser Komplex erstreckt sich etwas abseits vom Treiben des Marktes, aber doch nicht abseits genug, als dass dieses Treiben nicht bis hierher spürbar würde. Insbesondere die Polen zieht es nach guten Markttagen in das stille, kühle Gotteshaus, und dann ärgert sich Schwester Veronika als langjährige Sakristanin immer über die grellbunten Papierblumen, die als Ausdruck der Dankbarkeit für gute Geschäfte von den polnischen Marktfrauen vor dem Bilde der Matka Boska aufgestellt worden sind. Schwester Veronika empfindet diese Blumen als Zumutung, weniger für die Matka Boska, als vielmehr für sich selbst und die Herren Kapläne.
Der Herr Dechant wird in dieser Hinsicht nicht ganz ernst genommen, denn sein polnischer Name - er heißt Stefan Bogdanski - scheint ihn immun gegen solche Geschmacksverirrungen zu machen. Er lächelt nur, wenn Schwester Veronika es manchmal wagt, ihre Missbilligung über die Papierblumen zum Ausdruck zu bringen, und sagt, es gäbe schwerere Sünden. So geht Schwester Veronika an jedem Sonnabend seufzend auf den Markt und kauft frische Blumen in großen Mengen wenigstens für den Hochaltar, denn hier bestimmt sie, was aufgestellt wird, und die besten Blüten sind gerade gut genug. Papierblumen, die sie hier findet, befördert sie kurzerhand auf den Abfallhaufen. Und über all diesem Treiben lässt die Kirchenuhr rasselnd und ächzend die Zeit vergehen, Gottes Zeit, für alle Menschen gleich.
Die große Uhr korrespondiert aufs Engste mit den drei Kirchenglocken: mit der kleinen Angelusglocke, die dreimal täglich die Menschen - oder doch einige von ihnen - aufhorchen lässt, damit sie sich erinnern, dass das Wort Fleisch geworden ist; mit der größeren Messglocke, die an den Werktagmorgen die Eifrigeren zum Gottesdienst ruft; und schließlich mit der ganz großen alten Glocke, die an Sonn- und Feiertagen gemeinsam mit den beiden anderen ihre gewichtige Stimme erschallen lässt. Hat der Uhrzeiger eine bestimmte Stellung erreicht, löst er damit gleichsam von selbst das Räderwerk der Glocken aus, denn Schwester Veronika hält auf Pünktlichkeit und hat ein wachsames Auge auch auf ihre Läutejungen. Pünktlich läuten die Glocken in der frühen Heimlichkeit des Advents, in der Kerzenpracht der Weihnachtstage, schweigen am Karfreitag mit der fast ganz schwarz ausgeschlagenen Kirche, jubeln in den Ostermorgen hinein, bilden eine prächtige Kulisse zu Pfingsten und setzen die heiße Luft des Sommers mit ihren Schwingungen in Bewegung, - alles nach der Uhr, die Gottes Zeit vergehen lässt.
Aus mehreren Gründen sind viele der Gemeindeglieder mit ihrem geistlichen Oberhaupt, dem hochwürdigen Herrn Dechanten Bogdanski, nicht immer brüderlich eines Sinnes. Der vorige Pfarrer war denn doch eine ganz andere Persönlichkeit. Er hatte mitgeholfen, das Gesicht der Stadt zu prägen und die Marktplatzperspektive zu erhalten. Er war als Gast ein regelmäßiger Akteur hinter den frisch verputzten Fassaden bei den Erstkommunion- und Hochzeitsfeiern der angesehensten Gemeindeglieder; er nahm auch nicht ungern an einem Leichenschmaus teil. Seine eigene Leichenfeier wurde daher zu einem Ereignis, von dem man noch lange sprach: Wie viel Kränze er bekommen; wie schön der Bürgermeister am Grabe gesprochen hatte; wie ergreifend der Kirchenchor sang und wie gut nun die Grabstelle in Ordnung gehalten wird. Dechant Bogdanski ist leider von anderer Art. Die Besuche hinter den Fassaden beschränkt er auf ein Mindestmaß, und er kehrt immer in provozierender Weise den Seelsorger heraus. Nie geht es ohne größere Spenden ab. Man wagt schon gar nicht, auf die eigene Tüchtigkeit anzuspielen, denn daraus schlägt der Dechant sofort Kapital. „Na, denn können Sie ja mal.. Niemand weiß genau, was er mit dem Geld macht. Gerüchte werden laut: Damit unterstützt er seine polnischen Landsleute! Dagegen empört man sich natürlich mit aller Kraft. Man empört sich auch gegen sein ironisches, überlegenes Lächeln, mit dem er auf die Aufmärsche der Kriegervereine, Schützengilden und dergleichen herabsieht. „Die Fronleichnamsprozession sollte euch genügen!“, pflegt er zu sagen. Die Aufmärsche aber werden in dem kleinen Städtchen für sehr wichtig gehalten, denn bei ihnen kann man den Sinn für Ordnung und Exaktheit in den eigens für diese Werte geschaffenen Formen allen Andersgläubigen sinnfällig für Auge und Ohr demonstrieren. Aber der Dechant lächelt nur - manche sagen, er grinse! Manchmal grinst er wirklich, nämlich wenn er auf der Kanzel steht und über sein Lieblingsgleichnis predigt: über die Begegnung von Pharisäer und Zöllner beim Gebet im Tempel. Aber er predigt zu oft darüber, alle Gemeindemitglieder sind an sein Grinsen und an seine Schlussfolgerungen gewöhnt.
Der schärfste Gegner des Hochwürdigen Herrn Dechanten Stefan Bogdanski ist Herr Joseph Fabisiak, Bäckermeister, Mitglied des Kirchenvorstandes, Tenor im Kirchenchor und stellvertretender Vorsitzender des Kriegervereins. Herr Fabisiak ist klein, untersetzt und hat einen so starken Hals, dass man meinen könnte, er habe gar keinen. Er wirkt beim ersten Anblick stiernackig und vierschrötig, aber dieser Eindruck täuscht. Beim Sprechen gewinnt er an Charme und sogar ein wenig an Eleganz. Da er sehr viel spricht und somit viel Charme und Eleganz erzeugt, gilt er im allgemeinen als sehr liebenswürdiger Mann. Als Jüngling besaß er spärliches schwarzes Haar und einen kleinen Schnurrbart. Mit zunehmendem Alter wurde das Haar noch spärlicher, der Schnurrbart aber nahm an Dichte und Umfang zu. Herr Fabisiak ist 45 Jahre alt, wirkt aber wegen seiner Beweglichkeit jünger.
Und nicht nur wegen seiner Beweglichkeit. Seine Gesichtszüge zeigten sich äußeren Einflüssen gegenüber wenig aufgeschlossen. Sie führten die Bewegungen der Zeit einfach nicht weiter, blieben daher glatt und unausgeprägt und nahmen nur an äußerem Volumen zu. Für einen oberflächlichen Beobachter wirken sie jung. Aber es ist die Scheinjugend der verpassten, weil nicht wahrgenommenen Chancen. Fabisiaks Haut ist straff und glatt, seine Wangen schimmern rosig, über die Stirn ziehen sich kleine Falten. Manchmal versucht er, ernsthaft und besorgt auszusehen und ein gefurchtes Gesicht zu zeigen. Fast alle Angestellten und Nachbarn glauben an Herrn Fabisiaks Sorgen und seinen tiefen sittlichen Ernst. Joseph Fabisiak ist ein sehr angesehener Mann im kleinen westpreußischen Städtchen Großenau. Man bewundert seinen Fleiß, seine Rechtschaffenheit, seine Ordnungsliebe und seine Frömmigkeit.
Täglich zelebriert er den gleichen Tagesablauf, er tut es mit großem Ernst. Sehr zeitig steht er auf, wie es ja die Pflicht der Bäcker ist. Im Nebenbett seufzt seine Frau ein wenig und macht Miene, gleichfalls aufzustehen. Täglich wartet sie darauf, dass er, lehr- und gönnerhaft zugleich, sagt:
„Schlafe ruhig weiter, Meta. Der Mann ist das Haupt der Familie. Er vor allem muss sich plagen und Geld verdienen.“ Trotz der frühen Stunde hat er schon sein lange einstudiertes Pathos. Er wäscht Gesicht, Hände und den feisten Hals und zieht seine Arbeitskleidung an. Als letztes Stück setzt er die weiße Bäckermütze auf wie ein Bischof die Mitra. Dann betet er sein Morgengebet. Da es ein Gebetsverslein seiner Kindheit ist, betet er es polnisch, aber leise, damit seine Frau es nicht hört. Dann geht er in die Backstube, und sein Tagewerk beginnt. Auf diesen Begriff legt Herr Fabisiak großen Wert: „Wer so wie ich auf ein langes, mühsames Tagewerk zurückblicken kann … Wer so wie ich sein schweres Tagewerk vollbracht hat ...“ Vollendet werden diese Sätze nicht. Sie dienen der Werterhöhung von Herrn Fabisiak, nicht einer Mitteilung oder einer Aussage. Diese Sätze sagt Herr Fabisiak niemals polnisch, immer deutsch. Und weil er sein Tagewerk so ernst nimmt; weil er fleißig ist, seine Untergebenen richtig anzupacken versteht und einen Sinn für Konjunktur hat, ist er wohlhabend geworden, ja es ist nicht übertrieben, ihn als reich zu kennzeichnen.
„Ja, ich habe es zu etwas gebracht“, pflegt er bisweilen zu sagen, auch, wenn ihm niemand zuhört. Den letzten Teil des Satzes aber denkt er nur, er spricht ihn niemals aus. „Ja, ich habe es zu etwas gebracht, obwohl ich - ein Pole bin.“ Das Wörtchen „nur“ - „obwohl ich nur ein Pole bin“ - aber denkt er nicht einmal mehr, es ist schon tief ins Unterbewusstsein abgesunken.
Er hat es also zu etwas gebracht, und daher kann er es sich leisten, ein ausgiebiges Frühstück zu sich zu nehmen, gemeinsam mit Frau und Tochter und dem Altgesellen. Während des Frühstücks liest er die Zeitung, auch den Text auf der ersten Seite. Er denkt auch darüber nach und wertet die Ereignisse aus seiner Sicht. Dann geht er wieder in die Backstube ans Tagewerk und arbeitet bis zum Mittag.
Das Mittagessen beginnt bei der Familie Fabisiak genau mit dem Angelusläuten. Der Angelus ist ein Teil ihres Tischgebetes. Wenn sich Schwester Veronika ausnahmsweise mit dem Läuten verspätet, essen Fabisiaks alle Gerichte kalt. Nach dem Essen pflegt Herr Fabisiak eine halbe Stunde zu schlafen. Er legt Wert auf eine gesunde Lebensführung und betont, dass er mit der Schlafdauer ja irgendwie auf seine Kosten kommen müsse, da sein Beruf ihn nun einmal zum Frühaufstehen zwinge.
„Der Meister schläft.“ Bei diesem mahnenden Hinweis verstummt jedes Gespräch im Hause. Halina, das polnische Dienstmädchen, vermeidet es, beim Abwaschen mit den Tellern zu klappern. Frau und Tochter Fabisiak schließen alle Türen geräuschlos. Lehrlinge und Gesellen sind der Meinung, dass ein kurzer Mittagsschlaf nach dem Vorbild ihres Meisters am wenigsten Geräusche bereite. So legen sie sich auf die Mehlsäcke und schlafen, schlafen, bis Türenschlagen und Geschirrklappern sie wecken und daran erinnern, dass beim Meister nunmehr Kaffee getrunken wird. Seufzend beginnen sie mit der Arbeit. Nach dem Kaffeetrinken erscheint der Meister wieder in der Backstube, und die Arbeit geht weiter bis in den späten Nachmittag hinein. Dann wird die Backstube aufgeräumt und gereinigt: Das Tagewerk ist getan.
Für Herrn Fabisiak beginnt der Abend. Zunächst geht er in die Kirche und betet einen Rosenkranz. Dann geht er zu einer Probe des Kirchenchores oder zu einer Sitzung des Kriegervereins oder zu einer Zusammenkunft des Kirchenvorstandes. Niemals aber geht er ins Wirtshaus. Er raucht nicht, und er trinkt nicht. So sieht der Tag von Herrn Joseph Fabisiak aus. Jeder Tag.
Joseph Fabisiak ist von Geburt Pole und stammt aus einer kinderreichen Kleinbauernfamilie aus der Posener Gegend. Seine Kindheit war schwer und freudlos. Mit kleinbäuerlicher Energie brachte es sein Vater fertig, Joseph zu einem deutschen Bäckermeister in die Lehre zu geben. Fabisiak war ein Muster von Lehrling. Schon frühzeitig hatte er erkannt, wo seine Chancen lagen. Sein Meister war stolz auf sein Deutschtum und seine Frömmigkeit. Joseph lernte also Deutsch, benutzte jede Gelegenheit, sich darin zu vervollkommnen und sprach es schließlich so gut, dass niemand in ihm einen Polen vermutete. Freilich störte der Name manchmal. Wurde er danach gefragt, sagte er mit leichtem bedauerndem Achselzucken: „Nun ja, ich habe polnische Vorfahren gehabt.“ Sein Eifer, auf jeden Fall für einen Deutschen gehalten zu werden, wirkte rührend. Besonders die Deutschen waren davon gerührt und erblickten darin einen Erfolg ihrer zivilisatorischen Bemühungen.
Dieser Pole möchte über seine nationalen Beschränktheiten hinauswachsen! Man muss ihm dabei helfen!
Der eifrigste Helfer war sein eigener Meister. Er zeichnete ihn häufig vor den anderen Lehrlingen aus, selbst vor den rein deutschstämmigen, und er gewährte ihm Anschluss an die eigene Familie. Am Ende stand eine Hochzeit: Fabisiak heiratete die schon etwas ältliche Tochter des Meisters und übernahm später das Geschäft. Nicht, dass er bei dieser Entwicklung besonders raffiniert vorgegangen wäre! Nichts von Verführungsgeschichten und einer Zwangsheirat! Es ging alles ganz natürlich - um nicht zu sagen organisch - zu. Joseph tat immer nur, was von ihm verlangt wurde. Da sein Einfühlungsvermögen gut ausgebildet war, merkte er sehr schnell, was von ihm verlangt wurde. War sein Meister traurig, machte auch er ein trauriges Gesicht; war er hingegen fröhlich, lachte auch Joseph, dass seine Augen ganz klein wurden. Er arbeitete weit über das verlangte Maß hinaus. Er wusste, dass übergroßer Fleiß nicht als Charakteristikum eines Polen galt. Ein Pole legt keine berechneten Vorräte an. Er arbeitet so viel, wie er braucht. Unser tägliches Brot gib uns heute! Morgen gibt es neues Brot. Bei manchem kindliche Überzeugung, bei manchem Ausrede. Joseph aber schuf sich Vorräte, Vorräte an Prestige, an Ansehen, an Vertrauenswürdigkeit. Von diesen Vorräten lebt er noch heute, da er es zu etwas gebracht hat, obwohl er - nur - ein Pole ist.
Joseph strebte also nach gewissen deutschen Eigenschaften, die er bei seinem Meister feststellte. Er bemühte sich aber auch um die Frömmigkeit seines Meisters. Von Haus aus fromm erzogen, war sein Leben fest eingebunden in den Ablauf des Kirchenjahres und erhielt von hier alle seine Impulse; aber er merkte bald, dass er seine Frömmigkeit etwas kultivieren müsse, um sich von den Polen abzuheben. Nicht, dass er sie verachtet hätte. Für seinen Ehrgeiz aber taugte die polnische Frömmigkeit nicht, dieses ständige Küssen und Weinen in der Kirche, diese weiche slawische Gefühlsseligkeit. Bei den Deutschen war die Frömmigkeit wohltuend geregelt. Sie vollzog sich nach Plan und Ordnung. Das hatte er bald heraus. Sein Meister fühlte sich in tiefster Seele berührt und angesprochen von dem Tugendstreben seines Lehrlings und Gesellen, daher förderte er die Verheiratung seiner Tochter.
So kam der Tag, an dem Joseph am Ziel aller seiner Wünsche stand, nämlich mit Meta Salzmann vor dem Altar. Der Pfarrer hielt eine schöne Brautrede - auf deutsch natürlich. In der zweiten Reihe saßen Josephs Verwandte. Obwohl sie fast nichts von dieser schönen Rede verstanden, schluchzten sie ergriffen. Joseph ärgerte sich furchtbar darüber, um so mehr, als auch er das Schluchzen nur mit Mühe unterdrücken konnte.
Vor der Hochzeit war er in sein Heimatdorf gefahren, um die Familie zu instruieren, wie sie sich auf seiner Hochzeit zu benehmen habe. Sie hatten ihn angestaunt, sodass er ganz verlegen geworden war. Wie gut und vornehm war doch seine Kleidung, wie gepflegt sein Haar und sein Bart, wie gewandt und sicher sein Auftreten, wie gemessen waren seine Bewegungen!
„Gott hat uns gesegnet! Ein solches Kind - nein! Wie ist es nur möglich!“ So sagte immer wieder seine Tante Stasska und streichelte ihn. Anfangs ließ er sich das Streicheln gefallen und empfand sogar ein wenig Stolz dabei. Dann aber wurde es ihm zu viel, und er entwand sich Tante Stasskas bewundernden Liebkosungen. Mutter Fabisiak saß still in einer Ecke, und ihr ganzes runzeliges Gesicht strahlte vor Freude über einen so erfolgreichen Sohn. „Ein Herr wird er sein - wer hätte das nur je gedacht!“
Vater Fabisiak schlachtete zur Feier des Tages ein Kaninchen - ein Genuss, den man sich sonst nur zu Ostern und zu außergewöhnlichen Gelegenheiten gönnte.
„Wir müssen ihm Gutes tun, damit er uns nicht vergisst!“ Das Häschen zappelte ein wenig, dann streckte es die Beine aus, lag still, wurde abgezogen und zum Essen vorbereitet.
Joseph war lange Zeit nicht daheim gewesen. Zum ersten war es ziemlich weit und schwierig mit dem Weg. Zum anderen war er froh gewesen, sein Elternhaus verlassen, auf eigenen Füßen stehen und sich einer anderen Lebensart öffnen zu können als der so überaus einfachen häuslichen. Er hatte sich bewusst von daheim ferngehalten. Um keinen Preis wollte er in das häusliche Arme-Leute-Milieu zurückkehren. Über seine Hochzeitspläne hatte er natürlich nach Hause berichtet, und als sein Bruder Stanislaw den ersten Brief vorlas, schlug die Nachricht wie ein Blitz ein. Nur Vater Fabisiak äußerte Bedenken:
„Eine Deutsche will er heiraten? Das taugt nicht für uns einfache Menschen!“
Aber Tante Stasska hatte ihn sogleich übertönt:
„Schäm dich! Gönnst deinem Sohn keine reiche Braut! Sind Polen reich? Nein, Polen sind arm, Gott sei es geklagt. Arm und arm: das gibt nie Geld. Sei stolz auf Joseph, dass er es so weit gebracht hat!“
Vater Fabisiak sagte nichts mehr, blieb aber bei seiner Meinung, dass diese Heirat nichts tauge.
Joseph hatte Geschenke mitgebracht. Er hatte sich bei ihrer Anschaffung nach Kräften verausgabt: eine blanke Tuchmütze für den Vater, ein wollenes grellbuntes Kopftuch für die Mutter, ein Paar Stiefel für Bruder Stanislaw, bunte Röcke für die Schwestern, einen Rosenkranz für Tante Stasska. Diese bedankte sich mit besonders großem Wortschwall und wünschte ihm Gottes Segen für jeden Tag extra. Sie hätte zwar auch lieber ein so schönes Kopftuch gehabt wie ihre Schwägerin, aber das sagte sie nicht. Die Gabenpracht erfüllte das ganze enge Haus, und die Mädchen liefen sofort ins Dorf, um ihre neuen Röcke überall zu zeigen. Konnte man nicht stolz sein auf einen solchen Bruder? Ein Herr wird er werden, Bäcker ist er schon. Und eine Deutsche wird er heiraten, Salzmann heißt sie. Joseph hatte ihnen den Namen wohl ein dutzendmal vorgesprochen. Aber in ihrem Munde hörte er sich nach wie vor polnisch an.
Am häuslichen Tisch war Joseph natürlich der Ehrengast. Er erhielt den größten Anteil vom Kaninchen. Bei seinem Meister gab es nie Kaninchenbraten. Meister Salzmann wusste sicher nicht, wie ein solches Tier schmeckt. Joseph schmeckte das Essen nicht. Der Kaninchengeschmack erinnerte ihn an seine Kindheit, an die spärlichen Feiertage, die ein bisschen Freude in das öde Einerlei der Wochen und Monate brachten, an die ganze Armseligkeit und Enge des häuslichen Lebens der Familie Fabisiak. Um jeden Preis wollte er da hinaus. Diese niedrige Stubendecke! Diese kleinen, windschiefen Fenster mit den zum Teil blinden Scheiben - gewiss, sie waren zu Ehren seines Besuches geputzt worden! Draußen standen die Dorfkinder, um den vornehmen Sohn der Fabisiaks anzustaunen. Das ganze Haus roch nach Essen, nach Schweiß, nach Tierfellen. Joseph dachte voller Sehnsucht an sein Dachstübchen bei Meister Salzmann.
Als sie mit dem Essen fertig waren, rückte er mit seinem Anliegen heraus. Es ging um seine Hochzeit, um die Feier in der Kirche. Sie sollten sich gut benehmen in der Kirche. Auf keinen Fall sollten sie weinen. Wenn es sich gar nicht vermeiden ließe, sollten sie ein Taschentuch benutzen. Außerdem sollten sie der Familie seiner Frau nicht auf die Nerven fallen, sie nicht dauernd küssen und nicht soviel sprechen, da sie kein Deutsch konnten. Sie sollten sich gut anziehen; vielleicht- könnten sie sich irgendwo etwas leihen, wenn die eigenen Vorräte nicht für alle reichen sollten. Auf keinen Fall dürften die Frauen in Kopftüchern in die Kirche gehen. So redete Joseph mit lange überlegten Worten auf sie ein. Vater Fabisiak zog die Brauen zusammen, sagte aber nichts. Mutter Fabisiak berauschte sich immer noch am Anblick ihres Sohnes, hörte gar nicht zu und sagte auch nichts. Tante Stasska nickte zu jedem Satz, zu jeder neuen Anweisung. Nur Wanda, die jüngere Schwester Josephs, brauste auf - sie war die Temperamentvollste der Familie.
„Mein lieber Bruder, du bist sehr hochmütig. Wenn wir dir nicht gut genug genug sind, bleiben wir eben daheim. Wir sind arm und keine Herren. Wenn du etwas Besseres werden kannst - wir wollen dich nicht hindern. Ich weine, wann es mir passt, und ich küsse, wen ich will. Ich gehe immer im Kopftuch in die Kirche, Mutter ebenfalls, und der Herrgott hat sich noch nie beklagt. Fremde Sachen ziehe ich nicht an. Das kannst du nicht von mir verlangen.“
Joseph wurde rot. Er suchte nach Worten. Verstand denn Wanda gar nicht, worum es ging? Einen Augenblick lang wollte er aufbegehren. Aber er beherrschte sich, wie er es gelernt hatte, und versuchte, seine Schwester zu überzeugen.
„O Wanda, du weißt nicht, was du redest! Du solltest mir glauben, denn ich habe mehr von der Welt gesehen als du. Du kennst nur dieses kleine Dorf. Ich aber kenne auch die Stadt, sogar eine große Stadt. Die Menschen dort leben anders, besser als ihr hier. Und sie beurteilen die Dorfleute nun einmal nur nach dem Äußeren und lachen über sie. Ich aber möchte nicht, dass man über meine Familie lacht! Dann lacht man nämlich auch über mich, und dazu gibt es keinen Grund. Und deswegen müsst ihr euch ein wenig anpassen. Wenigstens auf meiner Hochzeit. Was ihr hier treibt, ist eure Sache. Aber verderbt mir nicht mein Ansehen!“
Diese Rede beeindruckte die Familie. Tante Stasska begann auf Wanda zu schimpfen. Wanda aber pfiff nur ein wenig durch die Zähne, zog wortlos ihren neuen Rock aus, legte ihn Joseph über den Arm und ging hinaus.
Seit diesem Tag hat Joseph seine Schwester nicht mehr gesehen. Zu seiner Hochzeit war sie nicht gekommen. Er hatte es aufrichtig bedauert. Sie allein hätte Eindruck auf die Familie seiner Frau machen können. Sie war hübsch und temperamentvoll und sprach ein wenig Deutsch. Alle anderen hingegen verhielten sich noch schüchterner als sonst, lächelten unentwegt und schüttelten die Köpfe vor Verwunderung. Joseph schämte sich seiner Familie. Nur seine Schwiegermutter, Frau Salzmann, versuchte, mit den Fabisiaks ins Gespräch zu kommen. Aber es blieb beim Versuch. Joseph war froh, als alles vorbei war und seine Verwandten wieder in der Eisenbahn saßen. Diese Freude war beinahe größer als die Freude am Besitz einer so reichen und angesehenen Frau.
Da Joseph nun, wie er sich vorgenommen hatte, ein musterhalter Ehemann, Familienvater und Bürger wurde, kränkte es ihn unbeschreiblich, dass seine Schwester Wanda Schande über die Familien Salzmann und Fabisiak brachte, als sie sich kurz nach seiner Hochzeit zur Geliebten eines deutschen Offiziers erniedrigte. Er erfuhr es von seinen Eltern. Was für eine verworfene Tochter! Ihre Päckchen und Geschenke an die Familie wies man entsetzt zurück. „Lieber essen wir weiterhin trockenes Brot!“ Tante Wanda wurde zum Schreckgespenst. „Werde nur nicht so wie Tante Wanda!“, ermahnte man die Kleinen. Bei der kleinsten Verfehlung bekamen sie zu hören: „Das ist Sünde, und wenn du sündigst, wirst du bald wie Tante Wanda!“ So schreckte man sie vor verbotenen Handlungen ab. Tante Wanda und die Sünde - diese Begriffe erschienen gleichwertig. Fabisiaks betrachteten die Sünde ak etwas Personales und identifizierten sie stets mit dem Sünder. So traf es sie tief, dass es auch in ihrer Familie Sünder gab.
Frau Meta Fabisiak geborene Salzmann - Herrn Fabisiak tat es immer wieder leid, dass nicht ihr, sondern sein Name zum Familiennamen geworden war -, versuchte anfänglich, ihren Mann zu beschwichtigen und um Nachsicht für seine Schwester zu bitten. Das aber wies er entrüstet von sich. „Liebe Meta, was verlangst du von mir!“ entgegnete er beinahe beleidigt. „Hier muss ich doch streng und konsequent sein. Ich bin es meiner Familie und meiner Berufsehre schuldig.“
Und er distanzierte sich in aller Öffentlichkeit von seiner Schwester, obgleich sie noch niemals ein besonders herzliches Verhältnis zueinander gehabt hatten. Er distanzierte sich ebenso öffentlich von allen Sündern, und das nahm mitunter groteske Formen an.
Am Dienstag in der Passionswoche des Jahres 1929 kam Herr Dechant Bogdanski zu einem kurzen Besuch in das Fabisiaksche Haus. Aus Achtung für das hohe Amt seines Gastes verzichtete Meister Fabisiak auf seinen Mittagsschlaf und empfing den Priester im Wohnzimmer.
„Wünschen die Herren ein Glas Wein?“, fragte Frau Fabisiak durch die Tür.
„Aber Meta, wo denkst du hin! Mitten in der Fastenzeit! Das wäre ja fast eine Zumutung!“, antwortete Herr Fabisiak streng. Dechant Bogdanski lächelte - oder war es ein Grinsen? Es war der bekannte höhnische Gesichtsausdruck, über den Herr Fabisiak jedes Mal wütend wurde. Heute aber nahm er sich mit Rücksicht auf die Passionswoche zusammen, auch als der Priester sagte:
„Ach wissen Sie, mir wird allerlei zugemutet, ich bin vieles gewöhnt, tun Sie sich meinetwegen keinen Zwang an.“
„Bring dem Hochwürdigen Herrn ein Glas und eine von den Flaschen, die wir zu Ostern trinken wollten!“, befahl Herr Fabisiak. „Ich halte mich natürlich an meine Vorsätze“, fügte er leiser und fast entschuldigend hinzu. Frau Fabisiak brachte die Flasche und das Glas.
„Was führt Sie zu mir, Hochwürden?“, fragte Fabisiak. Bogdanski zeigte sich zurückhaltend. Er ging niemals auf ein Ziel los, sondern betrachtete es erst einmal von allen Seiten, kreiste es ein.
„Zunächst möchte ich mich nach Ihrem Befinden erkundigen“, sagte er höflich, ohne jeden spöttischen Unterton. Höflichkeit schätzte Herr Fabisiak. Er lächelte und verneigte sich fast unmerklich, dann endlich öffnete er die Flasche und schenkte seinem Gast das Glas voll.
„Danke, Hochwürden, ich bin zufrieden.“
Der Dechant kostete erst ein wenig vom Wein, dann erhob er sein Glas und sagte:
„Trinken wir also auf die stete Zufriedenheit der Familie Fabisiak!“
Fabisiak wurde unsicher, denn es hatte schon wieder wie leiser Hohn geklungen.
„Wie geht es Ihrem Fräulein Tochter?“, fragte der Dechant. „Sie ist sehr still und blass in letzter Zeit. Ist sie etwa krank?“ Herr Fabisiak machte ein besorgtes Gesicht. Auch ihm war das gedrückte Wesen seiner Tochter schon aufgefallen, aber er hatte nicht weiter darüber nachgedacht. Was sollte ihr denn schon fehlen! Sie erhielt alles, was sie brauchte, litt keinen Mangel und wurde mit allem Guten reichlich bedacht. Dennoch war sie auffallend still, manchmal auch mürrisch und unfreundlich. Vielleicht war sie nicht ganz gesund.
„Ach, so schlimm wird es ja nicht gleich sein“, versuchte Herr Fabisiak den Dechanten und vor allem sich selbst zu beruhigen. „Vielleicht hat ihr der lange Winter zu schaffen gemacht. Ich könnte sie vielleicht in ein Bad schicken.“
„Es ist gut, dass Sie sich um die Gesundheit Ihrer Tochter sorgen. Die Gesundheit ist wichtig, sehr wichtig.. Weil wir gerade dabei sind: auch ich möchte einem Menschen helfen, seine Gesundheit wiederherzustellen. Eine Badereise ist freilich nicht erforderlich, sondern Essen, gutes, kräftiges Essen. Das aber kostet Geld, und Geld ist knapp, jedenfalls dort, wo es so dringend gebraucht wird. Kurz und gut - ich bin wieder einmal zum Betteln gekommen, denn die das Geld so nötig brauchen, schämen sich ja meist zu betteln.“ Fabisiak hatte ein mitleidiges Herz und sagte sehr selten nein. Auch heute war ihm nicht nach Neinsagen zumute. „Wie viel möchten Sie haben, Hochwürden?“
„Ich nehme natürlich jeden Betrag. Aber zunächst würden ...“, er nannte eine mittlere Summe, „reichen, denke ich.“ Fabisiak holte sogleich eine Stahlkassette herbei, fingerte den kleinen Schlüssel aus seiner Westentasche, schlug sein Geschäftsbuch auf und öffnete dann auch die Kassette. Er übergab dem Priester das gewünschte Geld in einem Umschlag. Dann schrieb er den Betrag in sein Geschäftsbuch. Danach blickte er den Geistlichen fast ein wenig verlegen an und sagte:
„Herr Dechant, Sie wissen, ich bin ein Geschäftsmann. Die Säulen eines Geschäftes sind Fleiß und Ordnung. Ist es vermessen, zu fragen, für wen das Geld gebraucht wird? Nur der Ordnung wegen.“ Der Priester schüttelte den Kopf. „Nein, keineswegs, ganz im Gegenteil! Sie sollen sogar wissen, für wen das Geld gebraucht wird. Es ist für Elzbieta Sluczna, eine Frau, die Sie wahrscheinlich nicht kennen. Sie arbeitete in der Gärtnerei von Vinzenz Hellwig. Vor einigen Wochen aber musste sie aufhören, weil sie einem kleinen Mädchen das Leben schenkte. Es war eine schwere Geburt. Beinahe wäre die Mutter gestorben. Und nun kann sie nicht wieder zu Kräften kommen. Die ohnehin sehr bescheidenen Ersparnisse werden in Kürze verbraucht sein. Ich habe Elzbieta besucht und versprochen, ihr zu helfen. Ich konnte es versprechen, weil ich glaubte und wusste, dass Sie mich nicht im Stich lassen würden. Und das haben Sie ja auch nicht getan.“
„Ja, aber hat der Mann denn keine Arbeit?“
Auf diese Frage hatte der Dechant gewartet.
„Wenn sie einen hätte! Ich weiß nicht, wer der Vater des Kindes ist. Aber man muss ihr helfen.“
Herr Fabisiak zog seine Stirn in Falten, so gut es gehen wollte. „So! Muss man? Da bin ich aber ganz anderer Meinung! Wenn es nachher immer wieder einen Ausweg gibt - gutmütige Leute, die ihr Geld verschenken -, wird dieses sittenlose Treiben ja niemals aufhören! Dann werden die Leute immer weiter sündigen, weil sie genau wissen, dass andere für ihre Sünden und deren Folgen bezahlen. Und das unterstützen Sie, Hochwürden?“
„Christus hat für unser aller Sünden bezahlt, Herr Fabisiak - und nicht nur mit einem Geldschein ... Wir können uns diesem Anspruch daher nicht entziehen.“
„Wir sind alle arme Sünder - ich weiß. Aber Sünde und Sünde, das ist ein Unterschied! Diese Sünde des Fleisches wiegt doch schwerer als alle anderen. Sie vergiftet doch den ganzen Menschen. Es ist dann gar kein Unterschied mehr da zwischen Sünde und Sünder. Die Fleischessünde sitzt im ganzen Menschen. Man muss sie mit allen Mitteln bekämpfen. Auch mit wirtschaftlichen, Hochwürden!“
Der Dechant seufzt. Er lächelt nicht mehr. Er sieht aus dem Fenster und ist nun wieder in der armseligen Dachkammer, in der er Elzbieta besucht hat. Gewiss, es gibt ärmere Behausungen. Aber auch diese ist arm: ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Regal an der Wand, ein billiger Druck der Heiligen Familie; Krankheit, Armut, Mangel, Ausweglosigkeit. Die beste Gelegenheit, noch tiefer in das dunkle Element zu sinken, das Herr Fabisiak so voller Abscheu als Fleischessünde gegeißelt hat. Gegen diese Gelegenheit muss man kämpfen, nicht gegen die Sünde, die man ja doch nicht fassen kann. Und gegen den Sünder? Was heißt überhaupt kämpfen? Der Dechant seufzt noch einmal. Herr Fabisiak wird ein wenig verlegen.
„Verzeihen Sie meine Heftigkeit, Hochwürden. Selbstverständlich bleibt es bei meiner Spende. Ich habe genug Geld und leide keinen Mangel. Sie sind ein geweihter Priester und werden nichts verschleudern. Ich bin in diesem Punkt besonders empfindlich, Sie wissen es, wegen der Schande, die meine Schwester, die Sünderin, über unsere Familie brachte.“ Es hätte nicht viel gefehlt, und Herr Fabisiak hätte zu weinen begonnen. Aber er beherrschte sich und seufzte nur. Der Herr Dechant hingegen seufzte nicht mehr.
„Wissen Sie denn etwas von Ihrer Schwester?“
„Nicht eben viel, Hochwürden. Sie lebt in einer kleinen norddeutschen Stadt. Dorthin hat er sie mitgenommen. Und dann soll er sie im Stich gelassen haben. Sie soll dort einen kleinen Handel betreiben. Aber glauben Sie vielleicht, sie kommt zurück? Nein, sie ist halsstarrig und stolz. An ihre frühere Herrschaft hat sie geschrieben, dass es ihr gut ginge. Diese Herrschaft kauft bei mir. Das Mädchen hat es meiner Frau erzählt. Zurück kommt sie nicht. Sie hat auch ein Kind gehabt. Das ist tot - vielleicht zu seinem Glück. Sie hatte es sogar taufen lassen. Stellen Sie sich das vor!“
„Na, dann ist ja alles in Ordnung! Weshalb sollte sie das Kind wohl nicht taufen lassen?“
„Ein Kind der Sünde - und dann die heilige Taufe? Und dann noch der Name Fabisiak? Mir dreht es das Herz im Leibe um, wenn ich nur daran denke.“
„Beten Sie für Ihre Schwester, lieber Herr Fabisiak! Vielleicht hat sie es nötig! Und vielen Dank für Ihre Spende. Vielen Dank auch für den Wein.“
Dechant Bogdanski verabschiedete sich. Herr Fabisiak gab ihm das Geleit zur Haustür.
Ja, beten konnte er schließlich für seine Schwester Wanda. Dass Gott ihre Halsstarrigkeit und ihren Stolz in Demut verkehren möge - wir bitten dich, erhöre uns! Er konnte aber nicht verstehen, dass der Dechant die Sünde und den Sünder nicht mit scharfen Worten geißelte, sondern sie unterstützte.
So stand Joseph Fabisiak in scharfem Gegensatz zum Herrn Dechanten Stefan Bogdanski, der nichts gegen Papierblumen und anscheinend nichts gegen uneheliche Kinder hatte.
II. Kapitel
Sophie Fabisiak wuchs vom ersten Tage ihres Daseins an in der Furcht des Herrn auf. Herr - Gott - Vater: diese Begriffe waren und blieben für sie eins. In den Mittelpunkt ihrer gesamten Empfindungswelt schob sich von allen Seiten das Bild ihres Vaters und erfüllte sie mit Furcht und Respekt. Unveränderlich stand dieses Bild auf dem Untergrund ihres Bewusstseins, meist wohlwollend und heiter, aber zugleich unerbittlich und streng. Der Vater - das waren die Zehn Gebote: Du sollst ... du darfst nicht ... du musst ... Die Gebote schienen des Vaters wegen dazusein. Der Vater schien wegen des Einhaltens der Gebote dazusein. Und der liebe Gott - das war eine unermessliche Steigerung des Vaters, von härtester Konsequenz, die allerletzte und unumgängliche Autorität. Ihm musste man das Versprechen geben, den lieben Eltern in allen Dingen gehorsam zu sein. Dies Versprechen war ein fester Bestandteil in Sophies Abendgebet, dessen Durchführung der Vater pflichtbewusst überwachte, wenn er sein Tagewerk vollbracht hatte. Das Gehorsamsversprechen seines Kindes war die Bestätigung der Tagesarbeit für Joseph Fabisiak. Es hatte sich also gelohnt. Nicht nur die Mühe dieses Tages, sondern auch die Mühsal der schweren Jugend, des Strebens nach Erfolg und Anerkennung. Joseph war stolz auf sein Kind. Das tägliche Abendgebet des Kindes war die schönste Anerkennung, die es für Herrn Fabisiak geben konnte. Das Kind war seine Ausweitung, die Verdoppelung seines Selbst. Er war mehr geworden.
Alles, was Sophie - von den Eltern zärtlich Fiechen genannt - tat, geschah auf Veranlassung, Wunsch oder Befehl des Vaters. Morgens betete Fiechen gemeinsam mit den Eltern. Es war das offizielle Gebet Fabisiaks, ein privates hatte er ja schon in der Frühe auf polnisch gebetet - der letzte Rest seiner Kindheit, zweifellos sein wertvollster Wesenskern! Dann ging Fiechen in die Schule, nicht ohne zuvor vom Vater ermahnt worden zu sein, sich nur ja recht gut zu führen und aufzupassen, zu allen Lehrern und Kindern freundlich zu sein und sich gegen jedermann gefällig zu erweisen. Von den Rüpeln und Schmutzfinken sollte sie sich fernhalten und überhaupt nur wenigen ihre Freundschaft schenken. Da Joseph Fabisiak diese Ermahnung jeden Morgen in etwas abgewandelter Form gab, ging sie Fiechen allmählich in Fleisch und Blut über. Sie führte sich gut, fiel nicht auf, weder durch Wissen noch durch Nichtwissen, sie war freundlich und gefällig, spielte nur mit den Kindern des Arztes und des Apothekers und galt bei Lehrern, Schwestern und Kaplänen als wohlerzogenes, farbloses und langweiliges Kind, gutwillig, zuverlässig, uninteressant.
„Sophie Fabisiak? Wird natürlich versetzt!“ So hieß es jedes Jahr nach den Versetzungskonferenzen. Sophie stand nie zur Debatte, weder im Bösen noch im Guten.
Der Höhepunkt des Tages ist für Fiechen das Angelusläuten und die damit eingeleitete Mittagsmahlzeit. Herr Fabisiak lässt sich von seiner Tochter berichten: „Wie war es in der Schule? Was hat der Lehrer gesagt? War der Herr Kaplan mit den Katechismuskenntnissen zufrieden? Ist Ida Schneider, die Tochter des Apothekers, noch immer krank?“ Fiechen antwortet willig und aufmerksam, hat sie doch schon den ganzen Vormittag mit diesen Fragen gerechnet und sich darauf vorbereitet. In der Schule war es schön wie immer. Fiechen geht gern in die Schule. Sie liebt den gleichförmigen Ablauf und eine genau vorgeschriebene Tagesordnung. Der Lehrer hat nichts Besonderes gesagt. Der Herr Kaplan war mit ihren Katechismuskenntnissen zufrieden, und sie hat wieder ein „Gut“ erhalten. Sie erhielt meistens ein „Gut“, manchmal auch ein „Genügend“. Darüber hinaus ging es nach beiden Seiten nicht. Ida Schneider ist noch immer krank. Sie leidet oft an Ohrenschmerzen. Fiechen soll sie dann am Nachmittag, nachdem sie ihre Schularbeiten erledigt und der Mutter ein wenig geholfen hat, besuchen und ihr ein Stück Fabisiaksche Torte mitnehmen. Sie soll auch ihr neues Kleid anziehen und bunte Schleifen ins Haar flechten. Herr Fabisiak legt sehr viel Wert auf adrettes Aussehen und Sauberkeit. Immer wieder loben die Kunden die Sauberkeit in seinem Geschäft, und er bekommt immer mehr Kunden.
„Sei adrett und sauber, es lohnt sich!“, ist darum eine ständige Mahnung an Fiechen. Und Fiechen folgt, wie immer.
Am Nachmittag geht sie also im steif gestärkten Kleidchen und mit großen weißen Haarschleifen, die wie Schmetterlinge aussehen, mit einem Kuchenkörbchen zu Ida Schneider. „Sieh da, die kleine Fabisiak“, sagen die Leute, die hinter den Gardinen an den Fenstern stehen. „Wie niedlich!“
Bei Schneiders gibt es eine kleine Kindergesellschaft, Idas Vetter ist auch da, Frau Schneider kocht Schokolade, und man lässt sich den Fabisiakschen Kuchen schmecken. Die Kinder unterhalten sich wie die Erwachsenen über das Wetter, sie belustigen sich über die Polenkinder in ihren schweren Holzpantinen und stellen Betrachtungen über die in Aussicht stehende Feier der ersten heiligen Kommunion hinsichtlich der zu erwartenden Geschenke an. Am späten Nachmittag geht Sophie wieder nach Hause, erzählt dem Vater in der Backstube von ihrem Besuch, geht dann ein wenig mit ihm spazieren.
So ähnlich geht es Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Die Gesprächsthemen ändern sich nur wenig. Die Art, die Dinge zu sehen und zu beurteilen, ändert sich gar nicht. Sie wird nur systematischer, selbstverständlicher, starrer. Herr Fabisiak wird älter, Sophie wird älter, selbst Frau Fabisiak, geborene Salzmann, wird älter.
Wer ist Frau Fabisiak? Sie ist der Typ der demütig Dienenden, die niemals Forderungen oder Ansprüche stellt, die immer mit dem zufrieden ist, was ihr zufällt. Frau Fabisiak lebt vom Zufall, ist still und freundlich, unauffällig und farblos. Sie ist einige Jahre älter als ihr Mann und hat im Lauf der Jahre das Aussehen einer älteren, dem Hause treu verbundenen Magd gewonnen. Sie ist groß und hager und hält sich leicht gebeugt. Ihr Haar ist zeitig ergraut, das liegt in ihrer Familie. Ihre kräftigen, knochigen Hände sind stets rot und aufgesprungen wie bei einer Waschfrau. Sie versteckt ihre Hände gern in ihrer Schürze, rollt sie darin ein, und das verleiht ihr noch mehr das Aussehen eines Dienstmädchens, einer Magd. Mehr kann man eigentlich über Frau Fabisiak nicht sagen.