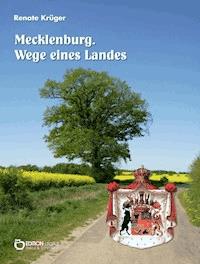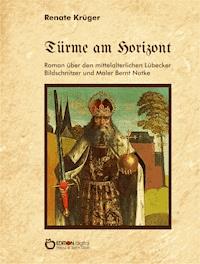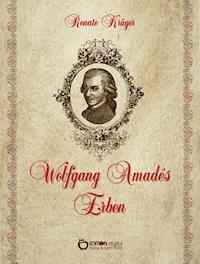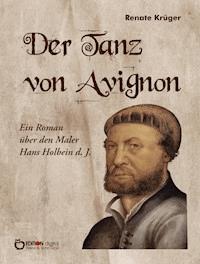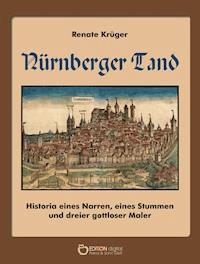7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die titelgebende Figurensammlung taucht zum ersten Mal in dieser Erzählung auf, als ein Lkw mit Antiquitäten ankommt und sich Schwester Helga Schneider bei einem der italienischen Fahrer danach erkundigt, was er denn geladen habe: „Was bringen Sie denn eigentlich? Was haben Sie in Ihren großen Autos?“ „O Signora, wunderschöne Sachen, alte Schränke, alte Bilder, alte Stühle, neue Arbeit, neue Sorgen ... Und haben wir auch ganze Clownschule in Auto.“ „Was haben Sie?“, rief Helga Schneider und sprang auf. „Wunderschöne Clownschule, Signora! Große Figuren, kleine Figuren, Jacken karierte, große Schuhe, kleine Hütchen ...“ „Zeigen Sie! Das muss ich sehen!“ „Warum so agitato? Was hat Signora zu tun mit Clownschule?“ „Viel! Alles! Ich war früher beim Zirkus. Ich kenne das alles. Wo ist die Clownschule?“ Eben diese Clownschule gibt nicht zuletzt dem Leser einen Blick auf die geheimnisvolle Vergangenheit von Helga Schneider frei. Aber Geduld. Zunächst unternimmt sie eine Reise nach Mecklenburg, nachdem ihr während eines Friseurbesuchs eine Anzeige aufgefallen war: Sie nahm die erste beste Illustrierte zur Hand, obgleich sie sich vor diesen zerlesenen und abgegriffenen Papierbündeln immer ein wenig ekelte, und blieb sogleich an einer fett gedruckten und bunt bebilderten Werbung hängen: KlevenowWellness, Kirch-Wodendorf. Ungläubig starrte sie auf das Bild. Es zeigte ein stattliches Schloss in einem Park, das zu einem Kuraufenthalt einlud, Schwerpunkt Ayurveda. Dort wollte sie hin. Offenbar kannte sie die Anlage von früher. Und offenbar trifft sie dort auch auf Menschen, von denen sie sich sicher ist, dass sie sie kennt. Aber auch andere Menschen suchen dort nach den Spuren ihrer Vergangenheit oder den Spuren der Vergangenheit ihrer Familie wie Ursula von Klevenow. Etwas später versucht sie, mit Helga Schneider in Kontakt zu kommen. Der Leser erfährt zudem von verwickelten Ereignissen aus einer anderen Zeit, als bestimmte Dinge auf verschwiegene Weise geregelt werden sollten. Aus dem alten Schloss war das Objekt 5 als Rehabilitationsstätte für verdienstvolle, aber mit Sicherheitsrisiken behaftete Staats- und Parteifunktionäre eingerichtet worden. Für solche, deren Verstöße gegen die Einheit und Reinheit der Partei zwar mit Krankheit erklärt werden konnten, die aber doch Isolierung erforderlich machten. Um sie kümmerten sich die Sicherheitsorgane. Einer der Leute von der Sicherheit ist ein gewisser Budjonny. Aber was hat das alles mit Helga Schneider zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Clownschule
Erzählung
ISBN 978-3-95655-593-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 2011 im Wagner-Verlag, Gelnhausen.
© 2015 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Schwester Consolata - mit bürgerlichem Namen Hedwig Puchalla - war neugierig auf das, was nun immer deutlicher an ihrem Lebenshorizont heraufzog. In ihrer Sprache nannte man es „die letzten Dinge“ , auf Latein „novissima“ - das Allerneuste ... Das Alte hatte sie in 84 Lebensjahren zur Genüge kennengelernt, das stand unabänderlich fest, da gab es nichts mehr zu entdecken oder zu deuten, und Schwester Consolata interessierte sich kaum noch dafür. Was aus diesem Haus, aus diesem riesigen Anwesen im schwäbischen Oberach werden würde, wenn auch die letzten Ordensfrauen gestorben waren - damit befasste sich Schwester Consolata nicht, sehr zur Entrüstung ihrer Mitschwestern.
„Wir werden nicht mehr da sein, aber die Welt wird nicht untergehen. Vielleicht wird hier eine Bananenplantage eingerichtet, wenn es mit der Klimaerwärmung so weiter geht. Oder eine Zitronenfarm. Vielleicht werden unsere Gräber im Palmenschatten liegen. Was weiß ich?“
Schwester Consolata war von hoher hagerer Gestalt und hielt sich gebückt. Ihre harte oberschlesische Aussprache hatte sie nicht abgelegt und baute damit ständig eine Mauer gegen ihre schwäbische Umwelt, der sie sich nie zugehörig fühlte, auch wenn sie nun einmal ihr Arbeitsfeld war. Die Ländlesprache verstand sie noch immer nicht. Eines Tages würde es nach Hause gehen, und das Himmelreich war nun einmal schlesisch. Das Schlesische gab es nur noch im Himmelreich. Alles Schlesische war himmlisch.
Als sie ausgehungert, zerlumpt und mit angesengten Kleidern kurz vor Weihnachten 1945 hier ankamen, mussten sie sich mit unheizbaren Verschlägen auf dem Dachboden begnügen, denn die alte Abtei St. Polykarp diente als Lazarett und als Lager für Staatenlose. Die Mönche, die hier gelebt hatten, waren von den braunen Behörden vertrieben worden. Nur zwei hatten sich nach dem Krieg zurückgemeldet und hausten im Keller unter der Kirche. Viele Kranke wurden geheilt, noch mehr starben, und die Staatenlosen verließen das Land.
Die vertriebenen Ordensfrauen blieben. Sie richteten die ehemaligen Klausurräume wieder her und konnten schließlich den Dachboden verlassen, sich in einem Seitenflügel der ehemaligen Abtei häuslich einrichten und ihr strenges abgeschiedenes Leben wieder aufnehmen. In den anderen weiträumigen Gebäudeteilen fanden weiterhin Entwurzelte und Heimatlose so lange Zuflucht, bis sie in die sich stabilisierende Nachkriegsgesellschaft eingegliedert werden konnten.
Den alten Gebäuden haftete jedoch nach wie vor der Ruf eines unreinen Ortes an und setzte sich intensiver in der Oberacher Erinnerung fest, als die jahrhundertealte Geschichte eines Ortes der Barmherzigkeit und der Wissensvermittlung und deren Weiterführung. St. Polykarp - das klang nach Flöhen und Läusen, dort lebten Fortgejagte und Hergelaufene und Habenichtse, und jeder behauptete, er habe ein prächtiges Haus besessen, reicher noch als die fest gefügten Oberacher Steinhäuser mit den kunstvollen Putzfriesen und den beschaulichen Ziergärten auf den Innenhöfen. Auch die Nonnen nebenan fanden keine Gnade in den Augen der Oberacher, sie waren und blieben anders, sie sprachen anders, und eigentlich waren sie doch halbe Polen.
Als Helga Schneider ins Haus der Nonnen kam, begriff sie sehr schnell, worin ihre einzige Chance lag: so zu werden wie die Oberacher, ohne es mit den Nonnen zu verderben. Als erstes musste sie die Sprache lernen, und diese Aufgabe bewältigte sie in allerkürzester Zeit. Worte und Sätze, die sie gehört hatte, sprach sie so lange nach, bis sie sich einheimisch anhörten.
Und sie verstand es meisterhaft, solche schwäbischen Errungenschaften so anzubringen, dass die Oberacher aufhorchten und sich fragten, ob die Frau Schneider wirklich eine Zuag‘reisde sei, eine von weither Zugereiste, oder nur eine Raig‘schmeggde, eine, die aus der näheren Umgebung kam und hier nur schnell einmal herein riechen wollte. Ganz echt klang es ja freilich nicht, aber auch nicht so abscheulich preußisch wie die Sprache der Nonnen, die man freilich selten genug zu hören bekam, besonders, seit sie die Frau Schneider als Zugehfrau hatten. Sie kaufte ein, sie bediente die Klosterpforte, sie verkaufte Äpfel von den Klosterbäumen, sie war Mädchen für alles.
Man erzählte sich in Oberach, Frau Schneider sei eine Meisterin in der Spätzleherstellung, allerdings hatte niemand jemals von ihren Produkten probiert. Dennoch sah man bald bewundernd zu ihr auf. Niemand hatte etwas dagegen, dass sie im Kirchenchor mitsang, zumal sie eine schöne volle Altstimme hatte. Da sie eine beachtliche Höhe erreichte, konnte sie in Notfällen auch im Sopran aushelfen. Sie sang vom Blatt, und die schwierigen lateinischen Texte sprach sie mühelos aus. Der Organist und Chorleiter Stenzle war außer sich vor Entzücken und überhäufte das neue Chormitglied mit Komplimenten, ohne dass bei den anderen eine neidvolle Regung entstand.
„Wo haben Sie das nur gelernt?“, fragte Herr Stenzle.
„Ach, lassen wir das ... Es würde zu weit führen. Hauptsache, man kann es,“ entgegnete Helga Schneider und brachte somit viele Fragezeichen in die Leutemeinung. Man wusste nur so viel: die Schneider kam aus der Ostzone. Aus einem kommunistischen Kerker? War sie geflohen?
Der Nonnenkonvent verkleinerte sich zusehends. Die verbleibenden Schwestern konnten das alte Gemäuer nicht mehr mit Tätigkeit und Leben erfüllen. Ein Raum nach dem anderen musste geschlossen werden. Das große Anwesen verursachte viele Kosten und brachte keinen Nutzen mehr. Die kirchliche Behörde entschloss sich zum Verkauf, aber es dauerte lange, ehe sich ein zahlungskräftiger Interessent fand, und zwar ein renommiertes ausländisches Antiquitätenhaus, das in den schützenden Klostermauern sein Hauptlager einrichten wollte, dazu eine Restaurierungswerkstatt und eine zentrale Datenbank.
Der Chef des Antiquitätenhauses kam persönlich aus Paris und war entzückt über die Möglichkeiten, die sich da auftaten. Besser ging es nicht. Sogar die alten Nonnen ließen sich in die Marketingstrategien einbeziehen. Das wäre ein idealer Ort für eine Ausstellung. Hier würden sich neue Bezugsquellen erschließen, denn es war ja damit zu rechnen, dass eine Kirche nach der anderen aufgegeben werden musste, und die Verlockung des Geldes würde ihre Wirkung nicht verfehlen. Das neue Lager würde sich mit Heiligenfiguren, frommen Tafelbildern, Rauchfässern und alten Messgewändern füllen.
Ein Jahrhundertgeschäft bereitete sich vor, ganz abgesehen von den hiesigen Steuervorteilen. Was war dagegen schon die Investition in ein Häuschen am Rande des Grundstückes, das die Nonnen und ihre Pflegekraft aufnehmen sollte! Die kirchliche Behörde hatte durchaus auch in Erwägung gezogen, die greisen Nonnen in ein klösterliches Pflegeheim umzusiedeln. Aber die Nonnen und Helga Schneider wollten nicht. Man wisse ja jetzt genau, wie alles ablaufen musste, bis es zur Sterbestunde kam und wie es danach weiter ging. Helga Schneider hatte dieses Ritual wohl ein Dutzend Mal gemeistert. Alle ihre Schutzbefohlenen waren sanft und friedlich hinübergegangen, wurden gewaschen, mit ihrem Ordensgewand bekleidet, bekamen einen Rosenkranz um die Hand gewickelt und wurden dann dem Bestatter übergeben. So würde es auch mit den letzten Schwestern geschehen - weshalb sollte man sie zuvor noch an einen anderen Ort bringen?
Die kirchliche Behörde fühlte sich entlastet und setzte einen Vertrag auf, der Helga Schneider finanzielle Zuwendungen garantierte, sowie lebenslanges Wohnrecht in dem Häuschen, in das die Schwestern nun ziehen sollten.
Das Häuschen wurde fertig und nahm die beiden letzten Schwestern auf. Helga Schneider bezog die Dachwohnung. Eigentlich hätte sie sich gleich eine Wohnung in der Stadt suchen können, am besten im Erdgeschoss, denn das Treppensteigen wurde ihr von Tag zu Tag beschwerlicher.
Aber so war das nun einmal - mitgegangen, mitgefangen ... Zum Hängen würde es schon nicht kommen. Und dazu müsste man schon ein sehr dickes Seil auftreiben, denn Helga Schneider hatte sich seit ihrer Ankunft in Oberach mehr als verdoppelt. Nahezu unbemerkt war Gramm um Gramm dazu gekommen. Helga Schneider war von kleiner und ursprünglich durchaus ebenmäßiger Statur, die sich im Lauf der Jahre in eine Walzenform wandelte. Bauch und Hüften traten mit den übrigen Körperteilen in Wettbewerb und trugen den Sieg davon. Zuerst störte sich Helga Schneider nicht an ihren Kugeltonnen, ja, sie empfand sogar ein gewisses Wohlgefallen, wenn sie in den Spiegel blickte und sich erst allmählich in ihrem eigenen Bild erkannte. Sie hatte braune Augen und noch immer dunkles Haar, und ihr ebenmäßiges Gesicht wies nicht eine Falte auf.
Ihre Rundlichkeit wirkte mütterlich, sogar auf Schwester Consolata, die immer dünner und hektischer wurde. Die Schneider aber ruhte in sich selbst und wusste immer, was zu tun, und vor allem, was zu lassen war. Sie hatte sich ein gemächliches Tempo angewöhnt, dazu die Überzeugung, dass sich manches von selbst erledige. Schließlich blieben die beiden allein in ihrem neuen Häuschen.
Als Helga Schneider vor Jahrzehnten in Oberach ankam, glich sie einem Gespenst, wog keine hundert Pfund und wirkte wie ein Erdmännchen, das sogleich im nächsten Loch verschwinden würde. Sie wurde im Dienstwagen eines Bundesministeriums gebracht. Neben ihr saß ein Ministerialrat, der Bruder von Schwester Consolata. Sie fuhren auf den inneren Klosterhof, wo schon der Wagen des örtlichen Landrates wartete. Nach einem längeren Gespräch zu viert hinter verschlossenen Türen stand unumstößlich fest, dass Frau Helga Schneider fortan bei den Schwestern leben und arbeiten und sich in den ersten Wochen oder sogar Monaten nicht außerhalb der Klostermauem zeigen sollte. Auf keinen Fall sollte sie sich mit der Presse einlassen. Ihr Haar sollte sie wachsen lassen. Auch sollte sie jenseits der Klosterpforte eine Brille mit dicken Gläsern tragen. Im Städtchen sollte sie sich als Verwandte von Schwester Consolata ausgeben, später, wenn man sich an ihre Anwesenheit gewöhnt hatte und Fragen stellte. Als man ihr in sachlich-dienstlichem Ton empfahl, sie solle jeden telefonischen Kontakt meiden, weder selbst telefonieren, noch Anrufe entgegennehmen, wurde sie rot. Schließlich erhielt sie einen funkelnagelneuen Personalausweis.
Die Jahre und Jahrzehnte verliefen ohne Höhepunkte und ohne Zwischenfälle. Helga Schneider gab keinen Anlass zu Klagen oder Besorgnissen. Mit jedem Tag gehörte sie mehr dazu. Nach einigen Jahren stellte Ministerialrat Puchalla seine Kontrollfragen betreffs Helga Schneider ein. Und der nächstgewählte Landrat nahm den Fall Schneider erst gar nicht in seine Topsecret-Sammlung auf. Die Telefonabstinenz blieb bestehen, Helga Schneider hatte inzwischen vergessen, wie man mit einem Telefon umgeht.
An einem nebligen Novembermorgen musste Helga Schneider das große schmiedeeiserne Tor aufschließen und öffnen, da zwei Transporter einer Speditionsfirma ungeduldig Einlass begehrten. Sie suchte lange nach dem richtigen Schlüssel. Als sie ihn endlich gefunden hatte, ließ er sich nicht im Schloss bewegen. Die italienischen Fahrer waren müde und durchgefroren. Schließlich sprang der vordere von seinem Sitz und rannte auf das Tor zu: „Warum nicht öffnen? Warum nicht weiter? Ich kalt und hungrig.“
Helga Schneider wies nur stumm auf das offene Seitenpförtchen. Der Fahrer kam herein, machte sich am Schloss zu schaffen und nach einiger Zeit war der Weg frei.
„Ihre Leute sind noch gar nicht da. Ich weiß nicht, wann sie kommen, ich habe damit nichts zu tun“, sagte Helga Schneider, die sich so schnell wie möglich in ihre warme Wohnung zurückziehen wollte. Was ging sie der Betriebsablauf des Kunsthandels an!
Inzwischen hatte sich auch der Fahrer des anderen Wagens eingefunden. „Was ist? Wo ist Chef?“
„Liegen noch in Bett und schnarchen laut“, sagte Helga Schneider. „Fahren Sie dort vor die große Freitreppe und warten Sie, bis Ihre Leute kommen.“
„Signora, ganze Nacht gefahren, nix Kaffee, nix Frühstück, und nun warten?“
Was habe ich damit zu tun, wollte Helga Schneider fragen. Wir haben doch nur noch unser kleines Haus, alles andere gehört uns nicht mehr.
Aber sie sagte es nicht, sondern lud die beiden Übernächtigten in ihre Küche ein. Aber sie sollten nur ja ihre Schuhe gründlich reinigen, es sei alles noch ganz neu. Einen Kaffee könnten sie bekommen, ein Frühstück auch, aber nur ein kleines. Vor allem sollten sie sich rasieren. Die Fahrer bedankten sich überschwänglich.
Nach einer halben Stunde saßen alle in der warmen hellen Küche am Frühstückstisch, es duftete nach Kaffee und aufgebackenen Brötchen, und der ältere Fahrer hatte schon alle mitgeführten Familienfotos vor sich auf dem Tisch ausgebreitet.
„Das ist Gina, mein Frau, fast so schön wie Sie, Signorina“, sagte er, und drückte einen lautstarken Kuss auf das Bild. „Und das Luigi, Anna, Marietta, Giovanni ...“
Als nun auch der andere Fahrer nach seinen Familienbildern suchte, fragte Helga Schneider schnell dazwischen: „Was bringen Sie denn eigentlich? Was haben Sie in Ihren großen Autos?“
„O Signora, wunderschöne Sachen, alte Schränke, alte Bilder, alte Stühle, neue Arbeit, neue Sorgen ... Und haben wir auch ganze Clownschule in Auto.“
„Was haben Sie?“, rief Helga Schneider und sprang auf.
„Wunderschöne Clownschule, Signora! Große Figuren, kleine Figuren, Jacken karierte, große Schuhe, kleine Hütchen ...“
„Zeigen Sie! Das muss ich sehen!“
„Warum so agitato? Was hat Signora zu tun mit Clownschule?“
„Viel! Alles! Ich war früher beim Zirkus. Ich kenne das alles. Wo ist die Clownschule?“
Helga Schneiders Walzenkörper geriet in heftige Bewegung.
„Sie bei Zirkus, Signora? Etwa auf die Pferd? Ich kann nicht glauben ...“
„Nicht auf die Pferd! Auf die Seil!“
Es folgte eine Seilpantomime, und sie wirkte überzeugend.
„Mamma mia! Aber das muss Stahlseil gewesen sein, so dick wie Unterwasserkabel.“ Die beiden Männer lachten ohrenbetäubend, und Helga Schneider tänzelte weiter über ihr imaginäres Seil. Die Tür öffnete sich, und Schwester Consolata trat ein, von einem heftigen Hustenanfall geplagt. Die beiden Männer sprangen auf.
„O santissima madre! Ave Maria, gratia plena! Was ist dies für ein Zirkus?“
„Guten Morgen, die Herren! Ihr Chef sucht Sie. Sie sollen ausladen.“
„Dürfen wir Kaffee noch austrinken? Und Ei aufessen? La Signora Ballerina ist schon fertig mit Seiltanz, sie wird zaubern neue Eier aus die Hut. Oder aus Nase.“
„So früh und schon so ausgelassen? Jetzt zaubert erst einmal die Wagen leer.“
Helga Schneider hatte sich wieder gesetzt und wirkte abwesend. Ihr war, als sei sie in einen unwiderstehlichen Sog gerissen. Sie wusste genau, woher dieser Sog kam, aber sie verstellte sich und tat so, als wisse sie von nichts. Nach dreißig Jahren hatte ihr früheres Leben sie eingeholt. Aber das durfte doch nicht sein, sie hatte sich doch so sehr um ein anderes Leben bemüht, es durfte doch gar keine Verbindung mehr geben.
Abgesehen von zwei kleinen Reisen mit dem Kirchenchor hatte sie Oberach nie verlassen. Und nun kam die Vergangenheit in einem Möbelwagen.
Beim Ausladen konnte Helga Schneider nicht dabei sein, denn Schwester Consolata wurde wieder einmal von einer hartnäckigen Bronchitis gequält und brauchte etwas aus der Apotheke. Auch gut, dachte Helga Schneider und machte sich auf den Weg. Es kommt alles noch früh genug ...
In der Apotheke dauerte es länger als geplant, denn das gewünschte Mittel musste erst zubereitet werden. Mit der Apothekenbesitzerin war Helga Schneider gut bekannt, ja vertraut, denn sie sangen beide im Alt. Aber bei den gestrengen Proben kam man nur selten zu einem Schwätzchen.
„Also Oberach wird jetzt eine Antiquitätenstadt“, begann die Apothekerin, „das ist doch mal etwas Neues.“
„Die ersten Sachen sind schon da und werden gerade ausgeladen. Ist schon schade, dass ich jetzt nicht dabei sein kann. Und“ - Helga Schneider dämpfte ihre Stimme - „eine Clownschule ist auch dabei.“
Das hatte sie eigentlich gar nicht sagen wollen.
„Eine was?“
„Na, so eine Schule, wo man das alles lernen kann. Anziehen und stolpern und fallen.“
„Und das in Oberach?“
„Wenn ich’s doch sage ... Vielleicht können Sie sich das alles einmal anschauen, ich weiß, wie man hineinkommt.“
Clownschule ... Viele Jahre hatte sich das Wort nicht gezeigt, nicht hören lassen. Helga Schneider war ihm nicht begegnet. Diese Welt verbarg sich hinter einem dicken Vorhang. Doch nun wurde dieser Vorhang mit Schwung auf die Seite gezogen und gab den Blick auf eine freilich undeutlich gewordene Vergangenheit frei.
Sie fuhren mit Budjonny in Försters Haus. Es ging in Richtung Berlin, Förster hatte in einem Berliner Vorort gewohnt. Man hatte ihn nun in angemessener Entfernung untergebracht, um ihn zu isolieren und Kontakte zu seiner früheren Umgebung zu verhindern oder doch wenigstens zu erschweren.
Försters Haus war nur wenige Hundert Meter von Westberlin entfernt. Es war verschlossen und versiegelt. Schon seit Längerem stand unumstößlich fest, dass der bisherige Bewohner nicht hierher zurückkehren werde.
Das Namensschild hatte man vorerst am Eingangstor gelassen. Die Nacht gab noch genügend Helligkeit her, dass man den Namen lesen konnte. Kurt Förster.
„Das Schild hier wird entfernt, sobald sich alles beruhigt hat“, sagte Budjonny. „Dann ziehen hier andere ein, solche, die sich um unsere Gesellschaft verdient gemacht haben.“
Aus einem Auto, das gegenüber vom Haus geparkt hatte, stiegen zwei Männer und zeigten ihre Ausweise. „Also an die Arbeit!“, sagte der eine, löste die Siegel, schloss die Haustür auf und beleuchtete mit der Taschenlampe den Weg durch den Flur.
Der Wohn- und Arbeitsraum lag im hellen Mondschein. Die Rücken der Bücher glänzten. Budjonny war verunsichert wegen der vielen Bücher. Er hatte nur eine Dorfschule besucht und immer noch Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung.
Man hatte nicht erwartet, dass die Räume in so guter Ordnung waren; man hatte eher Durcheinander und Chaos vermutet. Die Zimmer wirkten bewohnt, obgleich der Hausherr doch schon mehrere Monate abwesend war.
Hatte Försters Haushälterin noch immer einen Schlüssel? Allerdings gab es keine Pflanzen oder Blumen, die waren wohl inzwischen zugrunde gegangen, und man hatte sie entfernt. Und bei näherem Hinsehen konnte man feststellen, dass die Gardinen staubig und grau geworden waren.
An der Wand über dem Schreibtisch im Arbeitszimmer hing ein Bild; es zeigte einen dunkelhaarigen schmächtigen Mann mit kreisrunder Brille und eine unscheinbare Frau mit Spitzenkragen und erstaunt abgerissenen Augen.
Aus dem Nebenzimmer ertönte ein Ruf des Erstaunens. Sie gingen ihm nach und trafen Budjonny in einer ungewöhnlichen Umgebung und Gesellschaft.
,Ja, was ist denn das?“, entfuhr es ihm. Er hatte inzwischen das Licht eingeschaltet.
Auf einer Schneiderpuppe war ein verschlissenes Clowngewand befestigt, eine großkarierte rot-schwarze Jacke mit tellergroßen weißen Knöpfen, darüber die übliche Clownmaske mit zerzauster roter Perücke und kleinem schwarzen Hütchen. Aus den Jackenärmeln hingen große Handschuhe heraus, die einmal weiß gewesen sein mochten. Unter den unförmigen aufgekrempelten Hosen von undefinierbarer Farbe standen riesige Schuhe, die sich auch schon von ihrer ehemals weißen Farbe verabschiedet hatten.
„Das lebt ja richtig! War Förster Clown?“, fragte Vietinghoff.
Sie gaben sich Mühe, ernsthaft und dienstlich zu bleiben, was ihnen aber angesichts der über hundert auf sie gerichteten Clownaugen nicht gelang. Das geräumige Zimmer war von Clownfiguren unterschiedlicher Größe angefüllt und belebt, von Weißclowns und Dummen Augusten; es gab Clowns in langen quergestreiften Hemden und in kostbaren venezianischen Gewändern, und damit nicht genug: an den Wänden hingen Clownbilder dicht an dicht, sodass man kaum noch ein Stückchen Tapete dazwischen sah, Fotos von Zirkusclowns, Ölbilder, Plakate. Zeitungsausschnitte in russischer Sprache.
Wie kam Förster, diese graue Maus, zu solcher Clownwelt? Einige dieser Figuren waren zweifellos selbst gebastelt, einige mochten von Auslandsreisen stammen - Förster war ja Reisekader (d. h. er durfte ins westliche Ausland reisen) - und sogar schon in Amerika gewesen. Eine Zimmerecke war von einem Gestell ausgefüllt, an dem Clownmarionetten an feinen Fäden hingen. In einer Vitrine stellten sich zierliche Porzellanfigürchen zur Schau. Dergleichen konnte man sonst nur in Museen sehen. Man hätte fast Eintritt für die Besichtigung dieser Ausstellung verlangen können!
Die Bronchitis von Schwester Consolata hatte sich festgekrallt und wollte nicht weichen. Tag und Nacht wurde sie von Hustenanfällen gequält. Helga Schneider erwies sich als geschickte und tatkräftige Pflegerin, geriet aber immer tiefer in Ermüdung und Erschöpfung. Ihr war, als sähe sie ihren täglichen Arbeiten aus weiter Ferne, und aus solcher Ferne fühlte sie sich auch gesteuert, ob sie mit dem Fahrrad zum Einkaufen fuhr oder das Mittagessen zubereitete.
Der Winter brach mit den üblichen Beschwerden ein, Dunkelheit, Kälte, Glättegefahr. Man begegnete ihnen mit den üblichen Mitteln: Lichtinstallationen in den Fenstern, an den Häusern und auf den Straßen, Weihnachtsmarktzauber mit Glühwein und Bratwurst, Lebkuchen und Streusand. Auch Helga Schneider schlenderte über den Weihnachtsmarkt. Glühwein und Bratwurst brachten nur geringfügige Aufwärmung.
Sie ging früh zu Bett, schlief rasch ein und verfiel in farbglühende Traumspiralen. Dann wieder meinte sie wach zu sein und nahm heftige Windstöße wahr und dazwischen eine menschliche Stimme, die immer wieder einen Namen rief. Helga Schneider wusste nicht, ob sie träumte oder wachte, aber sie verstand den Namen. Kurischka, rief es draußen, Kurischka, das war doch ganz deutlich, das war doch Realität!
Mit einem Ruck sprang sie aus dem Bett und eilte ans Fenster Draußen war es still und finster, nur über der Tür zum Antiquitätenlager brannte eine Lampe. Helga Schneider fühlte Tränen in den Augen. In ihr war nur ein Gedanke: diesem Ruf muss ich nachgehen. Mit raschen Bewegungen kleidete sie sich an. Dann nahm sie den Schlüssel aus ihrer Schrankschieblade, dazu eine Taschenlampe, und schlich sich leise die Treppen hinunter und aus dem Haus. Noch weithin war das Husten von Schwester Consolata zu hören. Die Zeit war günstig, es war noch vor Mitternacht, und der Sicherheitsdienst kam erst kurz nach zwei.
Im Schatten der noch leer stehenden Gebäude erreichte sie den Eingang zum Lager, das in der Turnhalle der ehemaligen Schule eingerichtet worden war. Mühelos ließen sich die Türen öffnen, Helga Schneider trat zum ersten Mal ein und fand sich allmählich in der Dunkelheit zurecht. Die übereinandergestapelten Möbel wirkten wie bedrohliche Gebirge. Vorsichtig tastete sich Helga Schneider durch die schmalen Gänge und war darauf bedacht, nicht zu stolpern und nichts umzustoßen. Ab und an gebrauchte sie den Strahl ihrer Taschenlampe, um sich zurechtzufinden.
Im Hintergrund leuchtete es weiß, und sie lenkte ihre Schritte in diese Richtung. Da stand sie, die große Clownfigur mit dem weiß geschminkten Gesicht. Helga Schneider tastete nach dem Kopf, auf dem ein kleines Hütchen saß, sie fühlte die viel zu weiten und langen Ärmel, beleuchtete die großen verbeulten Schuhe und schließlich auch das Gesicht.
„Kurischka“, flüsterte sie. „Kurischka ... Du bist zurückgekommen. Wo warst du nur so lange? Ich weiß doch noch alles von dir, aber ich darf es nicht einmal mir selbst erzählen. O ja, es geht mir gut, sehr gut sogar, aber ich fühle mich schlecht. Mir fehlt etwas, mir fehlt alles. Kurischka, du fehlst mir ...!“
Sie umklammerte die Figur und begann zu weinen. Sie weinte, bis sie von draußen Motorengeräusch hörte und erschrak. Der Sicherheitsdienst, immer dieser Sicherheitsdienst! Sie versteckte sich in einem barocken Beichtstuhl und zog den Vorhang zu.
Am nächsten Tag wusste es Helga Schneider so einzurichten, dass man sie zu einer Besichtigung der bunten Altertümer einlud. Die Mitarbeiter des Antiquitätenhandels waren freundlich und ohne Misstrauen, ließen sie längere Zeit allein mit den bunten Hinterlassenschaften, wunderten sich über das besondere Interesse und fragten, woher es käme. Helga Schneider blieb verschlossen: „Ach, nur so ...“
Sie umfasste die skurrile Welt mit ihren Blicken und bemühte sich, Einzelheiten wahrzunehmen. Die große Clownfigur bestand aus einem verschlissenen Gewand, das auf einer Schneiderpuppe befestigt war, einer großkarierten rot-schwarzen Jacke mit weißen Knöpfen, darüber die übliche Clownmaske mit roter Perücke und schwarzen Hütchen. Aus den Jackenärmeln hingen große Handschuhe heraus, die einmal weiß gewesen sein mochten. Unter den unförmigen aufgekrempelten Hosen von undefinierbarer Farbe standen riesige weiße Schuhe. Das habe ich doch alles schon einmal gesehen, dachte Helga Schneider. Die Erinnerung an Kurischka blieb jedoch jetzt blass, zumal Helga Schneider viele andere Clownaugen auf sich gerichtet fühlte. Auf den Tischen und in den Regalen standen Figuren unterschiedlicher Größe, Weißclowns und Dumme Auguste, es gab Clowns in langen quergestreiften Hemden und in kostbaren venezianischen Gewändern, und damit nicht genug; an Stellwänden hingen Clownbilder dicht an dicht, sodass man kaum noch ein Stückchen Hintergrund dazwischen sah, Fotos von Zirkusclowns, Ölbilder, Plakate. Zeitungsausschnitte in vielen Sprachen. Und das sollte nun alles verkauft werden?
An einem Gestell hing eine Reihe von kunstvoll ausgeführten Marionetten mir geneigten Köpfen. Wie Erhängte, dachte Helga Schneider. Eröffnet wurde die Reihe von Colombine, der Tänzerin, der Schmeichlerin, der Verführerin. Sobald sie eines Mannsbildes ansichtig wurde, kam sie angetrippelt, angeflattert, ergriff Besitz von ihrer Bühne, ließ sich sehen und hören, schmiegte sich hingebungsvoll an ihr Opfer und nahm es gefangen. Colombine verfügte über zahlreiche Methoden, um zum Ziel zu kommen. Und doch blieb sie irgendwann auf der Strecke und wurde achtlos auf die Seite geworfen. Oder eben aufgehängt ...
Aber auch den beiden Schlaubergern erging es nicht anders, Arlecchino und Brighella, die eigentlich Diener waren und die doch ihre Herren in Dienst nahmen, ohne dass die es merkten. Die mit dem unschuldigsten Gesicht die abgefeimtesten Intrigen einfädelten und sich genussvoll freuten, wenn alles durcheinandergeriet: die Gewohnheiten, die Beziehungen, die Rangordnung. Und dann kamen sie und richteten alles wieder her und machten sich unentbehrlich.
Da hing der hässliche Pantalone, der alte gichtige Geizkragen, der immer auf der Jagd nach jungen Mädchen war, um selbst verjüngt zu werden, um warmen, liebreizenden Besitz mit kalten Händen zu greifen und festzuhalten.
Und dann der Dottore, der Rechtsverdreher, der immer dicke Bücher mit zahllosen Paragrafen und Unterparagrafen zur Hand hatte, aus denen er beweisen konnte, dass Schwarzes weiß war und Diebesgut Eigentum.
Da hing auch der stets säbelrasselnde Capitano, immer bereit, draufzuhauen, dreinzuschlagen, der seine Stimme nur selten dämpfte und immer seine Augen rollen ließ.
Es war eine Kumpanei aus Gestalten, die miteinander und voreinander Theater spielten, jeder seine Rolle, immer die gleiche, immer mit dem gleichen Ausgang. Man hatte für diese Kumpanei den Ausdruck italienische Komödie gefunden, aber eigentlich war es doch eine weltweite Tragödie, die sich auf fremden Befehl hin abspielte.
Diese Kumpanei war noch einmal als Elfenbeingruppe zu sehen, in goldener Fassung, mit goldgefassten Edelsteinen besetzt, sehr kostbar. Arlecchino saß auf einem Fass, in der Rechten eine Flöte, auf dem Kopf einen großen Schlapphut mit fein ausgearbeiteter Krempe, der Dottore im eng anliegenden Anzug, Kniehosen, mit Schleifen. Pantalone umarmt die Colombine, daneben ein Hund. Ein anderer Arlecchino saß mit einem Dudelsack auf einem großen Kürbis, der freilich auch eine Melone sein konnte.
Helga Schneider ließ ihre Augen umherschweifen. Sie hatte noch ein anderes Bild fest in ihrer Erinnerung, eine zierliche Porzellangruppe mit den Figuren der italienischen Komödie, die sich um den Arlecchino versammelten. Der trug karierte Beinkleider, ein keckes Hütchen. In seiner Rechten schwang er die aus dünnen Holzbrettern bestehende Narrenpritsche, um zu rügen und zu strafen. Aber diese Gruppe konnte sie nicht ausfindig machen.
An einer Stellwand waren drei venezianische Masken auf Stäben befestigt, weiß-gold, hellblau-gold, rot-weiß, daneben prangte ein portugiesischer Fächer mit den Figuren der Commedia dell`Arte vor einer Fantasielandschaft. In einer Vitrine standen Elfenbeinschnitzereien mit Figuren des japanischen No-Theaters.
Schwester Consolata starb einen leichten Tod, ohne Schmerzen, ohne Beklemmungen und Ängste. Sie schloss einfach die Augen und schlief hinüber. In Oberach nahm man davon kaum Notiz, und es gab nur eine kleine Beerdigung. Die Ära der oberschlesischen Nonnen war nun endgültig vorbei und würde keine Spuren hinterlassen. Niemand bemühte sich um einen Nachruf, niemand entfaltete noch einmal das Schicksal, das in diesem Leben lag und das über so vielen Lebensläufen gelegen hatte.
Der Geistliche, dem die Trauerrede zugefallen war, nannte ein Geburtsjahr, das die Verstorbene um noch zehn Jahre älter machte, und es fiel niemandem auf, nicht einmal Helga Schneider, die ohnehin wie in einem Zustand von Erstarrung lebte und nicht wusste, durch welche Tür sie dem Gefängnis entrinnen könnte. Sie hatte ihre Wohnung, sie hatte ihr Auskommen. Aber sie hatte keinen Lebensraum, die Vergangenheit war verschlossen und die Gegenwart nicht fassbar.
Nachdem sich wieder eine Art von Alltag entwickelt hatte, wurde Helga Schneider von einer bleiernen Müdigkeit befallen. Morgens wachte sie müde und erschöpft auf. Mit dem klösterlich frühen Aufstehen war es vorbei. Es langte gerade dazu, dass sie sich eine Tasse Kaffee zubereitete, dann schlüpfte sie wieder ins Bett, die anregend duftende Tasse neben sich, doch sie schlief sogleich wieder ein, und der Kaffee wurde kalt. Meist wachte sie dann erst am späten Vormittag auf, war aber nicht erfrischt und ausgeschlafen.
In solcher Stimmung beschloss sie, zum Friseur zu gehen. Sie hatte schon öfter erlebt, dass eine ordentliche Frisur zu spürbarem Wohlbefinden führte. Und sie musste sich ja auch wieder einmal unter Menschen aufhalten, in den letzten Monaten war sie sehr ans Haus gebunden gewesen.
Mit der Inhaberin des Friseursalons war Helga Schneider gut bekannt, und es gab eine herzliche Begrüßung. Aber leider müsse sich die Frau Schneider noch eine kleine Weile gedulden, denn es habe sich ein Schaden in der Wasserleitung eingeschlichen, kein Tropfen käme aus den Hähnen. Aber der Klempner sei schon da, und der Schaden werde in kürzester Zeit behoben sein.
„So’n Schiet!“, sagte Helga Schneider, und die Saloninhaberin fragte: „Wie bitte?“
„Was habe ich da eben gesagt?“, murmelte Helga Schneider.
Das waren Worte aus einer fernen Vergangenheit, aus einem früheren Leben, die aus dem Zustand der Vergessenheit plötzlich an die Oberfläche gelangt waren, wie - das wusste Helga Schneider nicht zu erklären.