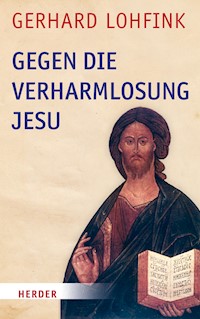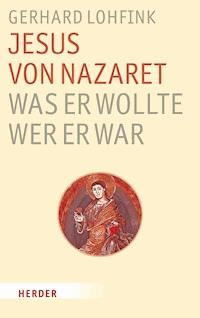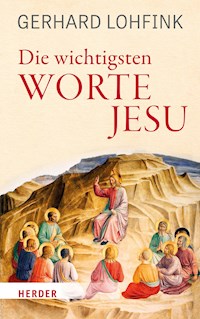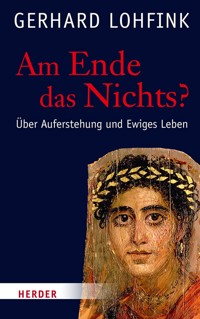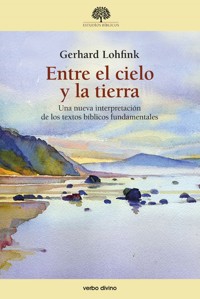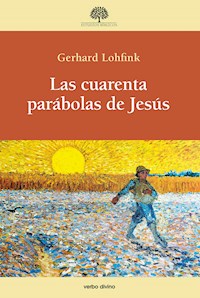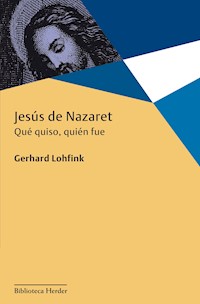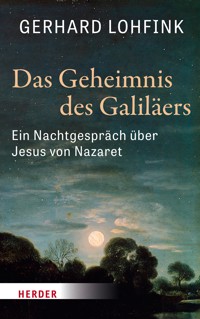Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die glauben, sind ausgespannt zwischen Himmel und Erde. Sie blicken auf zum Himmel – und stehen fest auf der Erde. Sie bewundern die Unermesslichkeit des Kosmos – und bestaunen eine winzige Blume. Sie kennen die Abgründe des menschlichen Herzens – und werden getröstet von dem Lächeln eines geliebten Menschen. Sie haben erkannt, dass sie selbst alles tun müssen – und erfahren dabei ständig, dass alles Gnade ist. Sie leben ganz im Heute – und strecken sich aus nach dem, "der kommen wird". Sie wissen, dass sie Staub sind – und wissen sich zugleich von ihrem Schöpfer unbegreiflich geliebt.Diese Spannweite können schon Kinder und Jugendliche erahnen, aber noch nicht ermessen. Es braucht dazu ein ganzes Leben. Und es braucht dazu den lebendigen Umgang mit der Heiligen Schrift. Die Auslegungen von rund 70 zentralen biblischen Texten richten sich an Menschen, die Sehnsucht danach haben, die Bibel besser und tiefer zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder, Freiburg
Umschlagmotiv: Joseph Mallord William Turner,
Blick aus der Ferne auf Chambéry, 1836, Aquarell, Privatbesitz
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-82810-2
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-82581-1
ISBN (Print) 978-3-451-38810-1
LINDA M. MALONEYin Dankbarkeit gewidmet
Inhalt
Vorwort
TEIL I Grundlegendes
Bedeutungslos im Kosmos?
Aus der Rippe des Adam
COVID-19
Hat Gott einen Namen?
Die zwei Seiten des Glaubens
Eine veränderte Welt
Auf dem Wasser gehen
Kompliment und Gegenkompliment
Anscheinend gegen jede Vernunft
Wo ist das Land?
Die »Armen« der Bergpredigt
Noomi und Rut
Die Kostbarkeit des »Jetzt«
Kann Erinnerung erlösen?
Geistliche Gemeinschaften im Licht der Bibel
TEIL II Festzeiten und Feste
Adventliche Naherwartung
Wie der Menschensohn kommt
Weihnachten ohne Krippe und Hirten
Ein ersehntes Kind
Der Weihnachtsfriede ist anders
Die Sternkundigen aus dem Osten
Weshalb lässt sich Jesus taufen?
Worin Jesus versucht wurde
Das Problem mit den Fastenvorsätzen
Die Todesangst Jesu
Die Klagen des Gekreuzigten
Das österliche Halleluja
Von den Emmausjüngern lernen
Die längste Ostergeschichte
Die Stimme des wahren Hirten
Ein Zerrbild der Himmelfahrt Christi
Eine Geschichte des Widerwillens
Wer ist der Heilige Geist?
Kann man den Geist Gottes wahrnehmen?
Der sich verschenkende Gott
Der dreieine Gott im Hochgebet
»Ihr seid Gottes Tempel«
Noch nie so viele Märtyrer!
Unser Dienst an den Toten
Die Aktualität des Christkönigsfestes
Das Warten auf den Bräutigam
TEIL III In der Freude des Glaubens
Die Freude des Zachäus
Die Basis christlicher Sorglosigkeit
Wie Gott tröstet
Die Last und das Glück der Erwählung
Die Härte und die Leichtigkeit der Nachfolge
Überströmender Reichtum
»Wenn Brüder in Eintracht beisammen wohnen«
Die Tischordnung des Reiches Gottes
Generiert der Glaube Gewalt?
Verfluchen damals und heute
Ein Kampf in der Wüste
Elija wünscht sich den Tod
Ein Mantel fliegt durch die Luft
Maria und Marta
Das Flehen des Aussätzigen
Krankheit und Schuld
Die Basis des biblischen Ethos
Die Mitte der Tora
Wie sich das Reich Gottes ereignet
Die Biologie des Reiches Gottes
Die Fremdheit des Vaterunsers
Das unablässige Gebet
Unandächtig
Der Reichtum der armen Witwe
Wie die Kirche wächst
Distanziert und unerschütterlich?
Taufe als Tod und Auferstehung
Tätiges Warten
Das Weinwunder zu Kana
Danksagung
Der Ort der einzelnen Kapitel im Kirchenjahr
Verzeichnis der Schriftstellen
Vorwort
Wer glaubt, lebt in einer unendlichen Weite. Er blickt auf zum Himmel – und steht doch fest auf der Erde. Er bewundert die Unermesslichkeit des Kosmos – und bestaunt eine winzige Blume. Er kennt die Abgründe des menschlichen Herzens – und wird getröstet von dem Lächeln eines Kindes.
Er setzt auf den Einzelnen – und hat doch begriffen, dass Gott in der Welt ein Volk braucht. Er hat erkannt, dass er selbst handeln muss – und erfährt dabei ständig, dass alles Gnade ist. Er lebt ganz im Heute – und streckt sich aus nach dem, »der kommen wird«. Er weiß, dass er Staub ist – und zugleich von seinem Schöpfer unendlich geliebt. Er glaubt an das Gericht – aber ebenso an das abgrundtiefe Erbarmen Gottes. Er hat unzählige Väter und Mütter im Glauben – aber entscheidend ist sein Leben in Christus.
Alles, was seit Abraham in dem unablässigen Experiment des Glaubens erfahren wurde, steht in dem einen, einzigen Buch – und dennoch ist sein Glaube keine Buchreligion, sondern Freude im Heiligen Geist. Immer neu fasziniert ihn, wie sehr der christliche Glaube ein radikal vernünftiger Glaube ist – doch zugleich ist er glücklich, dass eben dieser Glaube alle Vernunft in das Geheimnis des dreieinen Gottes hinein übersteigt.
Wer auf Jesus Christus setzt, ist ausgespannt zwischen Himmel und Erde. Diese Spannweite des Glaubens können schon Kinder und Jugendliche erahnen, aber noch nicht ermessen. Wir brauchen dazu ein ganzes Leben. Wir brauchen dazu Brüder und Schwestern, die zusammen mit uns zu Gott unterwegs sind. Und wir brauchen dazu den lebendigen Umgang mit der Heiligen Schrift, damit wir sie immer besser erkunden und uns auf das Wagnis einlassen, sie zu leben.
Dementsprechend richten sich die folgenden Texte nicht nur an Fernstehende, die vorhaben, Jesus Christus und seine Botschaft genauer kennenzulernen. Sie richten sich genauso, ja noch mehr, an Christen, die Sehnsucht danach haben, die Bibel besser und tiefer zu verstehen. Ich wünsche meinen Leserinnen und Lesern viel Spannung und Freude auf den Wegen durch die Heilige Schrift, die in diesem Buch gegangen werden.
Ich widme es in Dankbarkeit meiner ehemaligen Schülerin in Tübingen Rev. Dr. Linda M. Maloney. Sie lebt längst wieder in den USA und ist eine unermüdliche Arbeiterin im Sinne von Röm 16,12. Neben all ihren beruflichen Pflichten übersetzt sie gewandt und sachgerecht meine Bücher ins Englische.
Am 6. Januar 2021
Gerhard Lohfink
TEIL I
Grundlegendes
Bedeutungslos im Kosmos?
Der bekannte englische Autor Ian Mc Ewan schildert in einem seiner Romane, der den schlichten Titel »Saturday« trägt, einen einzigen Tag, einen Samstag. Es ist ein dramatischer Tag im Leben des Neurochirurgen Henry Perowne. Zu dessen Beruf gehört es, dass er immer wieder Schädel öffnet und dann tief in das Hirn, tief in die graue und weiße Hirnsubstanz eindringt. Perowne versteht sich als Materialist. Schon auf den ersten Seiten des Romans fängt er an, über die Gottgläubigen nachzudenken. Er nennt sie allerdings nicht »gottgläubig«, sondern »übernatürlich Veranlagte«. Er versucht, sie psychiatrisch zu verorten. Und das sieht dann folgendermaßen aus:
All diese »übernatürlich Veranlagten« (der Leser kann vom Zusammenhang her nur an Muslime und Christen denken) leiden an einer »gefährlich überzogenen Subjektivität«. Sie leben in einem »Beziehungswahn« und ordnen die Welt allein »nach dem Maß ihrer eigenen Bedürfnisse«. Sie sind krank, und ihre Krankheit besteht darin, dass sie die völlige »Bedeutungslosigkeit« des Menschen nicht wahrhaben wollen. Deshalb schaffen sie sich ein bombastisches Bezugssystem mit Größen wie Gott, Schöpfung, Himmelfahrt, ewiges Leben.
Dieses Bezugssystem, das genau genommen ein Wahnsystem ist, ermöglicht ihnen, sich selbst als unendlich wichtig und bedeutungsvoll zu betrachten. In Wahrheit ist der Mensch ein völlig unbedeutendes Stäubchen in einem leeren und kalten Kosmos. Doch das wollen die »übernatürlich Veranlagten« eben nicht wahrhaben. Deshalb das Wahnsystem, das sie sich entworfen haben und das sie trösten soll! Deshalb der ins Krankhafte gesteigerte Versuch, aus der völligen Bedeutungslosigkeit des Menschen metaphysische Gebirge aufzubauen! Am äußersten Ende ihres Systems und überhaupt aller religiösen Systeme wartet die Psychose.
Allerdings formuliert unser Gehirnspezialist das alles nicht ganz so konturiert, wie es hier erscheint. Er ist kein aggressiver Atheist, sondern ein höflicher und sympathischer Wissenschaftler. Aber an seiner tiefen Skepsis ist nicht zu zweifeln. Unsere Zukunft wird nicht von »irgendwem im Himmel« bestimmt. Den »kinderliebenden Vater im Himmel« gibt es nicht, und »Verheißungen« werden hier in »dieser Welt wahr und nicht in der nächsten«. Deshalb »lieber Einkaufen als Beten«.
Das alles assoziiert Henry Perowne schon in den allerersten Stunden jenes Samstags, an dem der gesamte Roman spielt. Dieser Tag wird sich dann dramatisch entwickeln.
Ein Wahnsystem?
Wenn uns dieser Neurochirurg gegenüberstände – wie könnten wir mit ihm ins Gespräch kommen? Sollten wir ihm sagen, dass nicht diejenigen, die an Gott glauben, in einem Wahnsystem leben, sondern möglicherweise er selber? Leiden vielleicht gerade diejenigen, die Gott leugnen, unter eingeschränktem Sehvermögen, das sauberes Denken verhindert? Um nur ein einziges Beispiel zu nennen: Fliehen die dezidierten Atheisten nicht vor der Frage, wieso es den Kosmos, wieso es die Welt gibt? Wieso gibt es überhaupt Seiendes und nicht lieber das absolute Nichts? Christen haben auf diese grundlegende Frage eine vernünftige Antwort. Atheisten müssen sie ständig verdrängen oder dümmliche Antworten geben wie zum Beispiel: Der Kosmos war halt schon immer da, oder: Er ist durch einen Zufall ganz von selbst entstanden.
Könnte es vielleicht sogar sein, dass es Menschen gibt, die Gott nur deshalb leugnen, weil sie es nicht ertragen, nicht selber Gott zu sein? Ein wenig anders formuliert: Sie selbst wollen Herr sein, wollen die Macht haben, wollen ihr eigenes Gesetz sein. Und genau das hieße, in einem Wahnsystem zu leben. Als Raymond Kurzweil, Director of Engineering bei Google, einmal gefragt wurde, ob es einen Gott gäbe, antwortete er: »Noch nicht!« Die Antwort enthüllt die brennende Sehnsucht des Menschen, Gott zu spielen und alles, wirklich alles, was technisch machbar ist, auch zu machen – gleichgültig, was die Folgen sind.
Aber solches Argumentieren hätte wohl wenig Sinn. Wir würden dann nur den Stein zurückwerfen, mit dem auf uns gezielt wurde. Und wir könnten ewig darüber streiten, wer von den beiden Seiten denn nun wirklich in einem irrealen Bezugssystem lebt, das die Wirklichkeit der Welt nicht zur Kenntnis nimmt oder sie sogar pervertiert.
Die Macht Jesu
Wenn ich mich mit solchen Fragen beschäftige, hilft mir am Ende immer ein relativ einfaches Procedere: Ich schaue mir der Reihe nach die großen Menschen der Weltgeschichte an – diejenigen, die der Philosoph Karl Jaspers die »maßgebenden Menschen« genannt hat. Und dann bleibt mir am Ende immer nur Jesus übrig, der im letzten Kapitel des Matthäusevangeliums von sich selbst sagt: »Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde« (Mt 28,18). Worin besteht diese verborgene Macht, mit der Jesus jetzt seit fast 2000 Jahren unaufhaltsam in der Geschichte wirkt?
Es ist nicht die Macht eines Staates. Es ist nicht die Macht der Gewehre, der atomaren Rüstung oder der schnelleren Forschung. Es ist erst recht nicht die Macht des Kapitals. Es ist auch nicht die Macht der Massen, die auf den großen Plätzen protestieren. Und es ist schon gar nicht die Macht der Propaganda und der schlagkräftigen Parolen, der raffinierten Indoktrination und der Verführung.
Die Macht Jesu ist anderer Art. Sie besteht darin, dass er die »Wahrheit« ist (Joh 14,6). Er ist die Wahrheit in dem Sinn, dass er allein die Lösung hat für das Leid der Menschen und die schreckliche Not der Gesellschaft. Seine Lösung sind Gemeinden, in denen Menschen in Freiheit ihr Leben miteinander verbinden und nach der Bergpredigt leben. Eine andere Lösung für das Elend in der Welt gibt es nicht. Es ist ja längst alles durch-experimentiert worden: Der Egoismus, der sich selbst zum Mittelpunkt der Welt macht und immer nur fragt: »Was ist für mich gut?« Der Hedonismus, der meint, das Glück des Menschen läge im Kitzel des Augenblicks, im Verbrauchen und Konsumieren. Der Individualismus, der sagt: »Jeder für sich allein! Vertraue niemandem!« Der Kommunismus und der Faschismus, die den Menschen in ein Kollektiv verwandeln und zu seinem Glück zwingen wollten.
Das 19. und 20. Jahrhundert waren eine Kette unablässiger Experimente, was für die Menschheit das Beste wäre – und all diese Experimente hatten schreckliche Folgen: den Tod oder das namenlose Elend vieler Millionen. Der einzige Weg dahin, dass Menschen in Frieden und Freiheit zusammenleben können, ist die Bergpredigt Jesu, gelebt in Gemeinden, die seiner Spur folgen. Jesus hat wirklich die Lösung gebracht – und das ist seine »Macht«.
Frei von sich selbst
Noch tiefer gesehen besteht die Macht Jesu aber darin, dass er nichts für sich selbst gewollt hat. Er wollte einzig und allein, dass der Plan Gottes gelingt: Er lebte ganz für die Sammlung und Erneuerung des Volkes Gottes, in dem jeder Einzelne als Einzelner kostbar und unersetzbar bleibt – und das doch ein wirkliches Volk ist. Weil Jesus frei war von sich selbst, war er frei für Gott. Und so konnte Gott durch ihn handeln und in ihm Gegenwart werden für die Welt.
Es ist eine leise, sanfte, den Menschen zu seiner Freiheit aufrichtende Macht – völlig anders als die Macht der Mächte dieser Welt. Diese Art »Macht« kann man sich nicht nehmen, nicht erkämpfen, nicht erschleichen. Sie kann nur »gegeben« werden. Deshalb sagt Jesus in jener gewaltigen Szene am Ende des Matthäusevangeliums als der Gekreuzigte und von Gott in den Himmel Erhöhte: »Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.«
Wenn ich die maßgebenden Menschen dieser Welt vor meinen Augen vorüberziehen lasse, finde ich bewundernswerte Männer und Frauen, von denen ich lernen kann. Aber ich finde niemanden, der solche Macht hat, solche Wahrheit, solche Eindeutigkeit, solches Wissen über den Menschen und die Welt – und von dem zugleich eine Faszination ausgeht, die nicht verführt, sondern letzte Freiheit schenkt.
Das christliche Bezugssystem
Deshalb ist der Glaube an den Gott Jesu Christi kein Bezugssystem, das wir Christen uns erdacht hätten, um uns in der Unendlichkeit des Kosmos als bedeutungsvoll ansehen zu können. Unser Bezugssystem ist einzig und allein Jesus von Nazaret – und sind die, die ihm seit Abraham vorangegangen sind. Wir sind nicht einer Projektion gefolgt, sondern tausendfach geprüfter, erprobter, durchlittener Erfahrung mitten in der Welt und ihrer Geschichte, die in diesem Jesus ihre Summe und ihr Ziel gefunden hat.
Und wie steht es mit dem Vorwurf, wir würden die Bedeutungslosigkeit des Menschen im Kosmos nicht akzeptieren? Dieser Vorwurf hat keine Ahnung von dem, was die biblische Tradition wirklich sagt. Wir Christen bezeugen mit größter Nüchternheit, dass wir tatsächlich völlig bedeutungslos sind. Blätter im Wind sind wir, Staub im Kosmos, am Ende eine Handvoll Erde.
Bedenke, Mensch, du bist Staub,
und zum Staube kehrst du zurück –
wird uns am Aschermittwoch gesagt, wenn uns ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gezeichnet wird. Wir glauben aber zugleich, dass wir von Gott geliebt sind und in Christus schon jetzt »mitauferweckt und miteingesetzt sind in die Himmel« (Eph 2,6). Genau das feiert das Fest »Christi Himmelfahrt«. Um die Wahrnehmung dieses Ausgespannt-Seins zwischen Erde und Himmel wird es in diesem Buch gehen.
Aus der Rippe des Adam
In Genesis 2,4–25 wird erzählt, wie Gott den Menschen aus Lehm vom Ackerboden formt, ihm Lebensatem in die Nase bläst und ihm einen Wohnsitz im Garten Eden gibt. Wenig später schafft Gott für den Menschen eine Frau, indem er ihn in Tiefschlaf versetzt, ihm eine Rippe herausoperiert und aus dieser Rippe die Frau formt.
Als ich zehn Jahre alt war, kam es mir komisch vor, dass Gott wie ein Chirurg an der Rippe des Adam herumgeschnipselt haben soll. Heute bewundere ich den Text. Ich höre ihn nicht mehr naiv und erst recht nicht fundamentalistisch.
Fundamentalisten müssen die Erzählung Gen 2,4–25 als historischen Bericht verstehen und sich Gott als Anästhesisten und Chirurgen vorstellen. Doch wir haben die wunderbare Freiheit, die Erzählung der Erschaffung von Mann und Frau am Anfang der Bibel sachgerecht wahrzunehmen. Das heißt: Uns dürfen die Bilder wirkliche Bilder bleiben. Gerade so bleiben wir bei dem, was sie theologisch sagen wollen. Und gerade so gewinnen die Bilder ihre Kraft und ihre Wahrheit.
Die Heilige Schrift beginnt mit zwei Schöpfungserzählungen, die schon in sich völlig verschieden sind und uns so darauf hinweisen, dass sie richtig gelesen sein wollen. Die erste Schöpfungserzählung steht in Gen 1,1–2,4 a. Die zweite in Gen 2,4b-25. Wer diese beiden Texte als Dokumentarberichte liest, gerät mit der Tatsache der Evolution in einen unlösbaren Konflikt. Als man einst der Gattin des anglikanischen Bischofs von Worcester in England von Charles Darwin erzählte und von seiner Evolutionstheorie, soll sie ausgerufen haben: »Lieber Gott, lass es nicht wahr sein, und wenn es doch wahr ist, dann lass es wenigstens nicht bekannt werden!«
Diese kindische Angst brauchen wir nicht zu haben. Wer die Bilder der Schöpfungserzählungen Bilder sein lässt, hat mit der Evolution keine Schwierigkeiten. Und was viel wichtiger ist: Er begreift dann wirklich etwas vom Geheimnis des Menschen.
Der Mensch und die Tiere
Greifen wir eines der großartigen Bilder von Gen 2 heraus: Gott formt aus Lehm »alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels«, um dem Menschen eine »Hilfe« zu schaffen – eine Hilfe, die ihm »entspricht«, die ihm »ebenbürtig« ist und seine Einsamkeit beendet. Und er führt dem Menschen alle Tiere vor, eins nach dem anderen.
Doch der Versuch misslingt. Er führt noch nicht zum Ziel. Der Mensch gibt zwar jedem der Tiere einen Namen, das heißt, er ordnet die Welt, die ihn umgibt und schafft sie durch die Namensgebung noch einmal neu. Er fasst die Welt in Begriffe und »begreift« sie auf diese Weise. Aber ein Lebewesen, das ihm selbst entspricht, kann er dabei nicht finden.
Welch ein Bild, wenn wir es als Bild wahrnehmen! Der allwissende und allmächtige Gott probiert. Er experimentiert und macht Versuche, die fehlschlagen. Damit ist der Text schon sehr nahe am Geschehen der Evolution, die zwar zielgerichtet ist, aber ihren Weg über »Versuch und Irrtum« nimmt.
Das Bild zeigt freilich noch mehr: Wenn der Mensch in keinem Tier den zutiefst ersehnten Partner findet, so will das doch vor allem sagen, dass er anders ist und dass er mehr ist als alle Tiere. Die Gentechniker haben zwar recht, wenn sie sagen, 98 %unseres Erbguts würden mit dem Erbgut des Schimpansen übereinstimmen. Aber über den Geist Gottes, der von Anfang an die noch ungeformte Welt umgab und den Gott (wieder im Bild gesprochen) dem Menschen »als Lebensatem« eingehaucht hat – über diesen Geist reden die Naturwissenschaftler nicht und darüber dürfen sie wegen der Grenzen ihrer Methode auch gar nicht reden. Sobald sie nämlich behaupten, das »Gesamt der Wirklichkeit« ließe sich restlos mit naturwissenschaftlichen Methoden beschreiben und erklären, setzen sie eine Grundentscheidung, die ein reines Postulat bleibt.
Doch unser Text geht weiter: Gott hat mit den Tieren noch nicht erreicht, was er erreichen wollte: ein Wesen, das dem Menschen »ebenbürtig« ist. Das heißt übertragen in unser heutiges Weltbild: der Mensch ist noch kein Gemeinschaftswesen. Er lebt zwar soziobiologisch gesprochen schon in Sippen, er heult mit der Horde, er jagt im Rudel, er stürzt sich auf das erlegte Wild und teilt die Beute, aber das, was personale Gemeinschaft ausmacht, ist noch nicht oder erst in rudimentären Ansätzen Realität geworden.
»Als Mann und als Frau«
Und so baut Gott aus einer Rippe des Menschen die Frau und führt sie dem adám, dem Menschen, zu. Und der bricht in einen Jubelruf aus. Was er sagt, ist im Hebräischen mitten in einem reinen Prosatext rhythmisch geformt. Der Mensch ruft:
Das endlich ist Bein von meinem Bein
und Fleisch von meinem Fleisch! (Gen 2,23)
Die Feministinnen und Feministen sind mit dieser Darstellung zwar höchst unzufrieden. Sie wittern männliche Herrschaftsgelüste und übelste patriarchalische Allüren. Dass der Mann zuerst da gewesen sei und die Frau aus einem Rippenstück des Mannes hergestellt werde, zeige doch das arrogante Überlegenheitsgefühl des Mannes, das solchen Texten anhafte.
Aber man kann den Text auch anders verstehen. Man darf ihn im Gesamt der Bibel lesen. Und da war in Gen 1,1–2,4 eben schon eine erste, umfassende Schöpfungserzählung vorangegangen, die überhaupt keine Priorität des Mannes kennt, sondern geradezu lapidar sagt:
Und Gott erschuf den Menschen als sein Bild.
Als Bild Gottes erschuf er ihn.
Als Mann und Frau erschuf er sie. (Gen 1,27)
Außerdem: Muss man denn gleich an Geschlechterkampf denken, wenn gesagt wird, dass die Frau aus der Seite des Mannes genommen sei? Da ist ein jüdischer Kommentar der gemeinten Sache viel näher:
Gott hat die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes geschaffen, dass sie über ihn herrsche, aber auch nicht aus seinen Füßen, dass sie seine Sklavin sei, sondern aus seiner Seite, dass sie seinem Herzen nahe sei.
Im Übrigen heißt es ja später in der zweiten Schöpfungserzählung nicht: »Darum verlässt die Frau Vater und Mutter und hängt ihrem Mann an«, sondern völlig im Gegensatz zu den damals herrschenden Institutionen und Sozialstrukturen:
Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an, und sie werden ein Fleisch. (Gen 2,24)
Weil damals die Frau Vater und Mutter verlassen musste und nicht der Mann, ist dieser Text revolutionär. Er entwirft konträr zu den sozialen Konventionen des Alten Orients eine Gegenwelt, die ganz von der elementaren Kraft der Liebe zwischen Mann und Frau ausgeht.
Doch nicht nur dieser Abschluss der zweiten Schöpfungsgeschichte, sondern die gesamte Erzählung ist von einer nicht auszulotenden Tiefe. Wie unergründlich schon der Anfang:
Gott, der HERR, formte den Menschen aus Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. (Gen 2,7)
Wir dürfen dasselbe heute abstrakter und differenzierter sagen, ohne dass wir dabei die Kraft der alten Bilder je einholen könnten. Wir dürfen sagen: Gott hat die Materie damit begabt, sich zum Menschen hochzuentwickeln, auch wenn sie dazu unfasslich lange Zeit gebraucht hat. Sie sollte es in Eigenständigkeit tun können. Gott ließ der Materie alle Zeit, die sie benötigte, um schließlich im Menschen zum Bewusstsein ihrer selbst zu kommen.
Der Mensch braucht Hilfe
Aber kehren wir noch einmal zu unserem Text zurück. Er sagt nicht nur: »Gott machte den Menschen zu einem lebendigen Wesen« (Gen 2,7). Er sagt: Der Mensch ist mehr als nur ein lebendiges Wesen. Sonst hätten ihm die Tiere als Partner genügt. Der Mensch ist ein Wesen, das erst in Gemeinschaft mit einem anderen »Du« ganz zu sich selbst kommt. Das schildert die Erschaffung der Frau aus der Seite des Mannes und die Zuführung der Frau zu dem Mann durch Gott selbst. Und das schildert der Ausruf des Mannes, der eben nicht das Gebrüll eines Herrschers, sondern ein Jubelruf ist. Menschsein, wollen diese Bilder sagen, ist Mitsein – Miteinandersein im Vertrauen und in der Freude gegenseitiger Hilfe.
Das alles sagt sich so schön. Doch wenn wir die Welt betrachten, müssen wir feststellen, dass Leben gerade kein »Miteinander im Vertrauen« ist. Der Vogel, der auf der Wiese nach Würmern sucht, hebt immer wieder das Köpfchen und sichert nach allen Seiten. Sein nie nachlassendes Sichern ist ein Bild reinen Misstrauens. Vertrauen ist eben kein naturgegebener Zustand, sondern muss gestiftet werden. Vertrauen muss unter Schmerzen und Opfern errungen werden.
So wird deutlich, dass die beiden Schöpfungsgeschichten am Anfang der Bibel gar nicht in erster Linie von einem vergangenen Ur-Anfang erzählen wollen. Sie erzählen vielmehr, wie Gott den Menschen gedacht hat und wozu er ihn bestimmt hat. Die Menschwerdung des Menschen brauchte eine extrem lange Zeit, und sie fand erst in der Befreiung und Erlösung durch Jesus Christus ihr Ziel.
So drängt uns die Bibel geradezu, den Text von der Erschaffung der Frau auch auf die neue Schöpfung Gottes, nämlich auf die Kirche hin zu lesen. Dann schildert dieser Text in seinem tieferen, gesamtbiblischen Sinn, wie die Kirche als die »neue Eva« aus der Seite Christi, des »neuen Adam«, hervorgegangen ist. Die Theologen der frühen Kirche orten diesen Hervorgang der Kirche aus der Seite Christi im Kreuzesgeschehen. So viel hat es gekostet, wirkliches Miteinander zu stiften. Erst in der Ausweitung bis zu dem Kreuz Christi hin wird die unheimliche Wahrheit von Gen 2 erkennbar: Der Mensch ist auf ein »Du« hin geschaffen, ja, aber dass diese Beziehung auf den Anderen hin gelingt, ist von der bloßen Natur, ist von der reinen Biologie her nicht möglich.
Sicher, es gibt den seltenen Fall von Ehen, die aus einer glücklichen Konstellation oder einer fast naturhaften Begabung gelingen. Aber davon kann die Kirche nicht ausgehen. Sie ist sehr realistisch. Sie weiß, dass der Mensch Hilfe braucht. Diese Hilfe ist die Kirche selbst, die aus dem Kreuzesleib Christi entstanden ist. Diese Hilfe ist das Miteinander der christlichen Gemeinde.
In ihr wird es möglich, dass auch Ehelose ein erfülltes Leben führen. In ihr wird es möglich, dass Ehen gelingen. In ihr wird es möglich, dass Verheiratete einander neu finden. In ihr wird es sogar möglich, dass Verheiratete getrennt und doch nicht allein sind. In ihr gibt es Ehen um des Himmelreiches willen und Ehelose um des Himmelreiches willen – weil es die »neue Familie« gibt, nämlich die Kirche.
Die Kraft des Christentums
Und das alles nicht deshalb, weil die Kirche eine Ansammlung von Helden und Heroen wäre. Der britisch-deutsche Journalist Alan Posener schrieb 2002:
Die ungeheure Kraft des Christentums beruht nicht zuletzt darauf, dass es seine Protagonisten so schwach sein lässt. Hier handeln keine Übermenschen. Verrat und Verleugnung, Käuflichkeit und Todesfurcht gibt es selbst im innersten Kreis. Keine andere Weltreligion hat einen vergleichbaren Mut. Keine andere Weltreligion sieht dem Menschen so fest und unerschrocken ins Auge. Es ist dies allerdings ein Erbe des Judentums […]. Kein Volk hat sich in seinen heiligen Büchern so schonungslos selbst kritisiert, seine Könige so konsequent demontiert, seine Helden so menschlich scheitern lassen wie das auserwählte […]. Es ist eine Geschichte, in der selbst Niedertracht und Verrat zum Werkzeug des Heils werden.
»Zum Werkzeug des Heils.« Dürfen wir diesen Text von Alan Posener nicht auch einmal auf die Verheirateten und die Nicht-Verheirateten in unseren Pfarreien anwenden? Da ist so viel Fragment, so viel Schwäche. Da sind so viele Niederlagen und so viele Blütenträume, die sich nicht erfüllt haben!
Und doch kann das alles zum Werkzeug werden für die eine Sache, die viel größer ist als unsere Träume. Für die eine Sache, die Gott als Ziel schon immer vor Augen steht: eine durch das Lebenszeugnis des Gottesvolkes veränderte Welt. Und sobald sich Christen mit ihrer ganzen Kraft diesem Ziel zuwenden, das die Bibel »Reich Gottes« nennt, geschieht das Erstaunliche: Ehen werden wieder heil. Partner, die sich fremd geworden waren, finden neu zueinander. Kinder wenden ihre Herzen erneut den Eltern zu. Oder aber es geschieht doch wenigstens, dass Einsame getröstet werden, dass Getrenntsein zum »sanften Joch und zur leichten Last« wird (Mt 11,30), dass die Würde von Mann und Frau wiederhergestellt wird.
Ich denke mir manchmal: Was Gen 1–2 schildert, ist noch gar nicht zu Ende: Gott arbeitet noch immer an der Rippe, das heißt an dem Zueinander von Mann und Frau – und an der neuen Familie der Kirche, die aus dem Kreuzesleib Christi hervorgeht. Die Kirche ist noch immer auf dem Weg. Gott schafft durch sie noch immer und unentwegt an der Welt. Und er lädt uns ein, seine Mitarbeiter zu werden.
COVID-19
Seuchen, Epidemien und Pandemien gibt es in der Geschichte der Menschheit seit langem. Ich erinnere an die Zeiten der Pest, in denen in Europa ganze Landstriche entvölkert wurden. Fachleute errechnen für die Pest der Jahre 1331–1353 eine Zahl von ungefähr 140 Millionen Toten. Allerdings ist die Pest für uns keine lebendige Erinnerung mehr. Zeitlich viel näher liegt die »Spanische Grippe«, die in den Jahren 1918–1920 wütete. Ihr fielen weltweit 25 –50 Millionen Menschen zum Opfer. Aber auch das ist längst ferne Vergangenheit.
Trotz der schwindelerregenden Opferzahlen dieser »historischen Seuchen« dürfen wir sagen: Noch keine Pandemie hat die Weltbevölkerung mit solcher Wucht getroffen wie COVID-19 (= coronavirus disease 2019), und noch keine hat zu einer vergleichbaren weltweiten Beschädigung aller gesellschaftlichen Bereiche geführt. Der Grund dafür ist natürlich das 21. Jahrhundert mit seiner Geschäfts- und Urlaubsmobilität, seiner Verkehrsdichte und der so noch nie dagewesenen Vernetzung der Wirtschaft.
COVID-19 wird fast überall in der Welt als tiefe Zäsur empfunden. Und zwar deshalb, weil das Virus unser Leben beherrscht. Das betrifft in irgendeiner Form jeden, und keiner kann sich der neuen Situation entziehen – auch diejenigen nicht, die so tun, als brauche man die Pandemie nicht zur Kenntnis zu nehmen oder man könne sie gar leugnen. Diese Seuche wird die Gesellschaft, in der wir leben, verändern. Selbstverständlich stellt sie auch bohrende Fragen an die Theologie und an die Kirche.
Was bedeutet es, dass die Kirche, die ihrem Wesen nach »Versammlung« ist, sich plötzlich nicht mehr leibhaft versammeln kann – oder es nur tun kann, wenn alle Teilnehmer einen Atemsschutz tragen, seltsamen auf dem Boden ihres Gotteshauses klebenden Richtungspfeilen folgen, dann auf Lücke sitzen, nicht mehr gemeinsam singen, einander keinen Friedensgruß bieten und nach dem Gottesdienst praktisch nicht mehr miteinander reden? Man verstehe das nicht falsch! Ich bin sehr dafür, dass sich die Kirche bei ihren Versammlungen an staatliche Vorschriften hält. Jedenfalls wenn es sich um einen Rechtsstaat handelt. Aber was würde es für sie bedeuten, wenn sich eine Krise dieser Art mit entsprechenden Restriktionen einmal über Jahre hinziehen sollte?
Und was bedeutet COVID-19 für die »Theodizee«, also für die Frage nach der Allmacht Gottes und der Zweckmäßigkeit der Schöpfung? Kann der christliche Glaube noch von einem allmächtigen und gütigen Gott sprechen, wenn durch die Gnadenlosigkeit dieser Pandemie zahllose alte und kranke Menschen dahingerafft werden, die Wirtschaft auf Krücken geht, die Armen in Brasilien, Indien und anderswo nichts mehr zu essen haben und das soziale Miteinander zutiefst gestört wird?
Die Theodizee-Frage stellte sich in Europa zum ersten Mal mit aufreizender Schärfe, als bei dem Erdbeben von Lissabon am Allerheiligentag des Jahres 1755 fast die ganze Stadt zerstört wurde. Die Menschen, die sich vor den verheerenden Bränden noch zum Meer hin retten konnten, wurden von einer riesigen Flutwelle ertränkt. Fast alle Kirchen Lissabons wurden zu Trümmerhaufen. Unzerstört erhalten blieb angeblich nur das Rotlichtviertel. Viele europäische Intellektuelle weigerten sich nach den Nachrichten über diese Katastrophe, noch weiter an die Vorsehung und die Vatergüte Gottes zu glauben.
Seitdem ist das Problem der Theodizee immer wieder virulent geworden, vor allem beim Blick auf den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas. Und jetzt erhebt sich die ganze Frage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für viele von neuem.
Manche Theologen versuchen, das Problem der Theodizee zu lösen, indem sie die Schöpfermacht Gottes verkleinern. Oder sie gehen noch weiter und sagen, angesichts des globalen Elends könne Gott keineswegs mehr »allmächtig« genannt werden. Man könne ihn nicht mehr als »Herrn der Geschichte« denken. Er sei hilflos gegenüber dem nicht endenden Leid, habe sich aber in Christus selbst in dieses Leid hineinbegeben, um mit der Welt solidarisch zu sein.
Der Gedanke des Mitleidens Gottes mit der Welt ist richtig. Aber darf die Allmacht Gottes beschnitten werden? Die Vorstellung eines hilflosen und ohnmächtigen Gottes ist in sich widersprüchlich. Was freilich noch viel schwerer wiegt: Sie ist absolut unbiblisch. Nicht einmal im Buch Ijob wird an der Allmacht Gottes und an seiner Schöpfungsweisheit das Geringste weggenommen. Ganz im Gegenteil! Die großen Gottesreden in den Kapiteln Ijob 38–41 wollen gerade die Souveränität Gottes erweisen. Allerdings betonen sie auch die Unzugänglichkeit Gottes und das Geheimnis der göttlichen Schöpfungsweisheit.
Das Problem der Theodizee kann von der Theologie also nicht dadurch gelöst werden, dass sie die Allmacht Gottes in Frage stellt. Das Problem muss anders angegangen werden – nämlich zunächst einmal mithilfe einer vernünftigen Schöpfungstheologie, die ernst macht mit dem, was Evolution in ihrem ganzen Ausmaß bedeutet.
Ich habe jetzt bewusst gesagt: »… zunächst einmal mithilfe einer vernünftigen Schöpfungstheologie«. Das heißt: Die Schöpfungstheologie hat in der Theodizeefrage keineswegs das letzte Wort. Das letzte Wort hat der Tod Jesu und hat die Auferweckung Jesu von den Toten – und dieses »letzte Wort« soll (zumindest in diesem Kapitel) ausgespart bleiben. Man kann nicht ständig und überall »letzte Worte« sprechen. Es gibt auch »vorletzte Worte«. Umsie soll es hier gehen. Denn wenn man nicht verstanden hat, was »Schöpfung« ist, kann man auch nicht verstehen, was »Auferstehung« als das Ziel aller Schöpfung bedeutet.
Ein kleines Stück Schöpfungstheologie
Ich setze ein bei dem Phänomen menschlicher Liebe – und zwar einer Liebe, die im Miteinander geläutert wurde und die zu wahrer Hingabe fähig ist. Selbstverständlich ist eines der Fundamente der Liebe zwischen Mann und Frau der sexuelle Bereich, den der Mensch mit seinen tierischen Vorfahren gemeinsam hat: die Anziehung, das Verlangen, die Lust, die Befriedigung. Das heißt aber gerade nicht, dass für den Menschen Anziehung, Verlangen, Lust und Lustbefriedigung einfachhin tierisch seien. Gewiss: Sie können es werden, wenn sich der Mensch wie ein Tier oder sogar noch tierischer als jedes Tier verhält. Verlangen und Lust können aber auch menschlich geprägt sein. Und das müssen sie sogar. Ihre spezifisch menschliche Reife erreicht die Liebe erst in dem Augenblick, in welchem sie nicht mehr nur ihre eigene Lust, sondern vor allem das Glück des Anderen sucht, dann also, wenn sie im vollen Sinn »Du« sagt: »Du mit allem, was Du bist« – »Du allein« – »Du für immer« – »Mit Dir zusammen für Andere«. Und genau an dieser Stelle setzt die Liebe Freiheit voraus.
Wahrhaft menschliche Liebe kann nicht versuchen, den Anderen für die eigene Lust zu instrumentalisieren oder den Anderen auf das eigene Bild hin zu formen und zu modellieren. Wahre Liebe kann auch nicht bedeuten, dass man einem anderen Menschen ausgeliefert ist. Dann wäre sie ein Gefängnis der übelsten Sorte. Wirkliche Liebe hat den Anderen in Freiheit gewählt, und sie setzt voraus, dass ihr jene Würde entgegengebracht wird, die jedem Menschen zusteht. Wirkliche Liebe ist deshalb untrennbar mit Freiheit verknüpft. Liebe, die man sich nicht gegenseitig in vollem Einverständnis schenkt, bleibt ein Fragment. Das Größte, das Schönste und das Menschlichste, das es in der Welt gibt, setzt also Freiheit voraus – freie, ganzheitliche Annahme des Anderen.
Und nun gehen wir einen Schritt weiter! Auch die Freiheit hat ihre Voraussetzungen. Freiheit setzt nämlich Geschichte voraus. Das sollte unmittelbar einleuchten. Denn Freiheit ist eben nicht eines Tages vom Himmel gefallen und war dann einfach da. Sie brauchte eine lange »Freiheitsgeschichte«, um allmählich das zu werden, was sie sein kann. Freiheit musste ersehnt, errungen und oft bitter erkämpft werden. Sie war keine Selbstverständlichkeit. Wir alle leben von den Freiheitsräumen, die uns andere im Lauf der Geschichte aufgetan haben. Irgendwann, am Morgen der Menschheit, muss es Einzelne gegeben haben, die nicht einfach wie die Tiere ihren Instinkten folgten, sondern stattdessen etwas wählten, das sie für gut und sachgerecht bzw. für besser und sachgerechter hielten als anderes. So begann die Freiheitsgeschichte des Menschen. Sie ist mehr als bloße »Naturgeschichte«. Sie begann langsam zu wachsen wie eine noch sehr zarte, ständig gefährdete Pflanze.
Das gewaltige Feld der Geschichte, an dem sich die Historiker abarbeiten, ist eine immer wieder gestörte – aber letztlich nicht aufzuhaltende Geschichte der Aufklärung, der Emanzipation und der Suche nach Freiheit. Die Freiheitsgeschichte jedes Einzelnen lebt von dieser größeren Geschichte, gibt ihr aber auch immer wieder ihre Anstöße.
Die Geschichte der Emanzipation und der Freiheit geht also weit über bloße Naturgeschichte hinaus. Sie transzendiert und verwandelt sie. Aber sie setzt sie natürlich auch voraus. Die Freiheitsgeschichte des Menschen hat ihre Basis und sie ist eingebettet in die Geschichte der Natur, in die Geschichte des Kosmos, in die Evolution. Dies zu sehen, ist der entscheidende Punkt, auf den es mir hier ankommt. Man kann sich diesen springenden Punkt am Phänomen der »Generationenfolge« verdeutlichen.
Freiheitsgeschichte entwickelt sich in Epochen. Es gab, um ein Beispiel zu nennen, die Epoche der Europäischen Aufklärung – mit all ihren Einseitigkeiten, aber auch mit all ihren Einsichten. Der 1. Weltkrieg und alles, was auf ihn folgte, hat dann zwar den naiven Fortschrittsoptimismus des 18. und 19. Jahrhunderts endgültig erschüttert, aber keineswegs grundlegende Einsichten der Aufklärung zu Schanden gemacht. Ähnliches geschah einst in Griechenland, Ähnliches in Israel. Wirkliche Freiheitsgeschichte setzt die Aufeinanderfolge von Generationen voraus, braucht je neue Generationen, die auf den Einsichten ihrer Vorläufer aufbauen, sie aber auch modifizieren, verbessern oder sogar revolutionieren. Und eben weil die Freiheits- und Aufklärungsgeschichte der Menschheit ohne das Aufeinanderfolgen und den Dialog vieler Generationen nicht denkbar ist, setzt sie auch das Ende und den Tod ihrer Vorläufer und Vorkämpfer voraus.
Damit aber sind wir schon mitten in dem ungeheuerlichen Geschehen der Evolution. Denn diese lebt geradezu von Beendigung, Abbruch und Tod – eben weil sie Platz braucht, um Neues zu erproben und das Gelungene weiter voranzutreiben. Evolution setzt ständige Mutation, setzt das Weiterleben gelungener Mutanten, setzt aber auch den Abbruch und das Ende überholter Formen voraus.
Genau an dieser Stelle lohnt sich der Blick in ein Buch, das 1895 veröffentlicht wurde. Sein Verfasser war Herbert George Wells, und es hatte den Titel: »Die Zeitmaschiene« (»The Time Machine«). Dieses Buch wurde zum Vorläufer und Wegbereiter der berühmten dystopischen Romane »Schöne neue Welt« von Aldous Huxley (1932) und »1984« von George Orwell (1949).
Der »Zeitreisende«, die Hauptfigur des Buches von H. G. Wells, hat eine Zeitmaschine erfunden, mit der er in die 4. Dimension gelangen und durch die Jahrtausende rasen kann. Bei seiner 1. Reise versetzt ihn sein Gerät in das Jahr 802.701. Als er seiner Maschine entsteigt, trifft er an der Stelle, an der sein Haus gestanden hatte, auf eine neue, radikal veränderte Welt. Als er schließlich nach schrecklichen Erlebnissen wieder zu dem Tag seiner Abreise zurückgelangt ist, versucht er seinen Bekannten, die ihm mit größter Skepsis zuhören, diese veränderte Welt, mit der er konfrontiert war, zu deuten. Und das hört sich folgendermaßen an:
Die ganze Welt wird [eines Tages] intelligent und gebildet zusammenarbeiten; alles wird schneller und schneller auf die Unterjochung der Natur hinzielen. Am Ende werden wir das Gleichgewicht tierischen und pflanzlichen Lebens klug und sorgfältig verschieben und unseren menschlichen Bedürfnissen anpassen.
Diese Anpassung, möchte ich behaupten, musste in dem Zeitraum, den meine Maschine übersprungen hatte, gut und für alle Zeiten gelungen sein. Die Luft war jetzt frei von Mücken, die Erde von Unkraut und Pilzkrankheiten; überall sah ich Früchte und liebliche und köstliche Blumen; leuchtende Schmetterlinge flogen hin und her. Das Ideal der Gesundheitsvorsorge war erreicht. Krankheiten waren ausgerottet. Während meines ganzen Aufenthaltes habe ich kein Zeichen irgendeiner ansteckenden Krankheit gesehen. Und ich werde Ihnen später noch berichten können, dass selbst die Prozesse der Fäulnis und der Zersetzung durch diese Veränderungen tiefgehend beeinflusst worden waren.
In diesem Abschnitt seiner Erzählung trägt der Zeitreisende einen utopischen Menschheitstraum vor: nämlich den Traum von einer Welt, in der es kein Unkraut mehr gibt, sondern nur noch Kulturpflanzen; keine lästigen Stechmücken mehr, sondern nur noch herrliche Schmetterlinge; keine gefährlichen Mikroben, keine Krankheiten und überhaupt nichts Bedrohliches mehr. Die Erde ist durch eine internationale Wissenschaft bis tief in ihre Mikrowelt hinein verändert worden.
Es spricht allerdings für die Intelligenz von H. G. Wells, dass sich die gerade zitierte Deutung des Zeitreisenden während des Buches langsam als hochgefährliche Täuschung erweist. Die anscheinend erlösende Verwandlung der Welt war begleitet von der Entstehung einer tierisch-abgründigen Gegenwelt, von der unaufhörlich Angst, Schrecken und Tod ausgehen.
Aber bleiben wir bei dem zitierten Abschnitt! Kein Unkraut, keine Stechmücken, keine Mikroben, keine Fäulnis mehr? Wir sind inzwischen aus bitterer Erfahrung dabei, solche Verirrungen zu korrigieren. Wir sprechen nicht mehr von »Unkraut«, sondern von »Wildkräutern«. Wir lassen an den Rändern der Äcker und Straßen bewusst »Unkraut« wachsen, weil langsam auch der Letzte zu begreifen beginnt, dass es sonst bald keine Insekten mehr gibt und ohne Insekten auch viele Vogelarten nicht mehr – und wegen der Vernetzung unserer Lebenswelt auch noch unvorstellbar vieles andere nicht mehr.
Außerdem wissen wir: Ohne Mikroben und ohne Fäulnis würde sich unser Planet sehr schnell in einen riesigen Abfallhaufen verwandeln. Denn Mikroben sorgen für die Müllabfuhr der Natur, und Verwesung reinigt unablässig unseren Planeten. Allerdings: Der Illusion einer Welt ohne Krankheiten jagen wir noch immer nach. Weil wir nämlich verkennen, dass Krankheiten etwas mit der Evolution zu tun haben – und dass es eine völlig sterile und für immer durchgestylte Welt nicht geben kann und auch gar nicht geben darf.
Wir müssen also den vollen Umfang und die ganze Radikalität des Phänomens »Evolution« in den Blick nehmen: von dem Entstehen erster organischer Verbindungen, der Entwicklung von Makromolekülen und erster einzelliger Lebewesen bis zum Hochkommen des homo sapiens sapiens – und dazwischen das Erscheinen und Verschwinden zahlloser biologischer Formen und Lebewesen. So führt kein Weg an der Einsicht vorbei: Geburt und Tod der Individuen und selbstverständlich auch Deformationen und Krankheiten gehören unabdingbar zur Evolution.
Ja, selbstverständlich auch die Krankheiten! Ohne Mikroben, ohne mutierende Bakterien und Viren wäre Leben auf unserem Planeten undenkbar. Viren zum Beispiel verursachen zwar bei Pflanzen, bei Tieren und beim Menschen viele hochgefährliche Krankheiten. Aber indem sie sich immer wieder in die Zellen eingeschlichen haben, brachten sie auch neues DNA-Material in überkommenes Erbgut hinein und haben so die Evolution in einem außerordentlichen Maß vorangetrieben und beschleunigt.
Ein anderes Beispiel: Ohne die vielfältige Bakterienflora in unserem Dickdarm würden wir schnell sterben. Der Mensch ist ein hochkompliziertes Ökosystem, in dem Bakterien eine lebenswichtige Rolle spielen. Allerdings: Eine schlecht zusammengesetzte Darmflora kann krank machen. Und Zellen können mutieren und Krebs verursachen. Könnten sie freilich nicht mutieren, hätte es keine Evolution, hätte es keine Säugetiere und hätte es niemals einen Menschen gegeben.
Ich fasse zusammen: Wirkliche Liebe setzt Freiheit voraus – und Freiheit kann sich nur in einer Freiheitsgeschichte entfalten. Ein wirkliche Freiheitsgeschichte aber setzt die Generationenfolge der Naturgeschichte und der Evolution voraus. Und Evolution ist nicht denkbar ohne ständigen Wandel, nicht ohne Katastrophen, nicht ohne Krankheiten und nicht ohne Tod. Ich sehe keine Möglichkeit, dieses Bedingungsgefüge an irgendeiner Stelle aufzubrechen und Schöpfung anders zu denken.
Ist Liebe aber das Ziel aller Schöpfung und bedarf die Liebe als Bedingung ihrer Freiheit der Evolution mit all ihren Schattierungen von Neuwerden und Untergang, so ist die Schöpfung gut. Und damit sind wir nun endlich bei der Heiligen Schrift selbst angelangt. Denn auch sie sagt klar, eindeutig und mit größtem Nachdruck: Alles, was Gott erschaffen hat, ist gut. Die Schöpfung lebt von seiner unendlichen Zuwendung und spiegelt sie wider.
Das Spiel der Schöpfungsweisheit
Besonders in den Weisheitsschriften Israels wird immer wieder von der Schönheit, der Ordnung und der Sachgerechtheit der Schöpfung gesprochen. Dies geschieht zum Beispiel mithilfe der Figur der »Weisheit«, die eine Personifikation der Schöpfungsweisheit Gottes ist. Im 8. Kapitel des »Buches der Sprichwörter« tritt die »Weisheit« wahrscheinlich als »spielendes Kind« auf. Ich sage: »wahrscheinlich«, weil die Deutung des entsprechenden hebräischen Wortes in Spr 8,30 auch noch andere Möglichkeiten zulässt, nämlich statt »geliebtes Kind« auch »Werkmeister« oder einfach »beständig«.
Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges,
vor seinen Werken in der Urzeit.
In frühester Zeit wurde ich gebildet,
am Anfang, beim Ursprung der Erde.
Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren,
als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen.
Ehe die Berge eingesenkt wurden,
vor den Hügeln wurde ich geboren.
Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren,
und alle Schollen des Festlands.
Als er den Himmel baute, war ich dabei,
als er den Erdkreis abmaß über den Wassern,
als er droben die Wolken befestigte
und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer,
als er dem Meer sein Gesetz gab,
und die Wasser seinen Befehl nicht übertreten durften,
als er die Fundamente der Erde abmaß,
da war ich als geliebtes Kind bei ihm.
Ich war seine Freude Tag für Tag
und spielte vor ihm allezeit.
Ich spielte auf seinem Erdenrund,
und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein.
(Spr 8,22–31)
Die »Weisheit« begleitet in diesem herrlichen Gedicht also Gott bei seiner Schöpfung. Sie wurde zwar selbst erschaffen – aber dann war sie bei dem gesamten Schöpfungsprozess auf geheimnisvolle Weise dabei. Wie sich diese Schöpfung vollzog, wird in Bildern des damaligen orientalischen Weltwissens geschildert. Entscheidend ist: Gott, der Schöpfer, arbeitet souverän, überlegt und planvoll, Schritt für Schritt, meisterlich und sinngebend. Offenbar hat Gott für die Ausführung seiner Schöpfung einen Plan vor Augen, und der Gedanke liegt nahe, dass »die Weisheit« selbst dieser Architekturplan sei. Gerade deshalb würde dann so stark betont, dass sie von Anfang an dabei war. Aber selbst wenn sie hier nicht als eine Art Architekturplan fungieren sollte – sie kennt durch ihre unablässige Präsenz auf jeden Fall das Planvolle der Schöpfung und somit deren Weisheit. Und weil sie von Anfang an dabei war, kann sie die Ordnungen des Kosmos auch den Menschen vermitteln.
Ein besonders anrührender Zug des Gedichtes könnte – wenn die hier gewählte Übersetzung von Spr 8,30 richtig ist – darin liegen, dass die Weisheit auf dem Erdenrund wie ein Kind spielt. Sie spielt aber nicht nur auf dem gesamten Erdenrund. Sie spielt zugleich vor Gott. Sie ist die Freude Gottes, sein »geliebtes Kind«, und sie hat selbst Freude und Lust an dem, was Gott schafft.
Besser als in dem Bild des frohen und gelösten Spiels könnten das Leichte, das Spielerische, die Schönheit und die Wohlbeschaffenheit der Schöpfung kaum ausgedrückt werden. Und selbstverständlich wird mithilfe der Metapher vom »Spiel der Schöpfungsweisheit« auch gesagt: Gott selbst freut sich an seiner Schöpfung. Sie war keine schwere Geburt, sie war erst recht keine Fehlgeburt, sondern ein leichtes und herrliches Spiel – und das könnte sie auch für immer bleiben, falls die Menschen auf die Weisheit der Schöpfung achten würden und mitspielten. Deshalb mahnt die personifizierte Weisheit auch unmittelbar im Anschluss an unser Gedicht:
Nun, ihr Kinder, hört auf mich!
Selig, die auf meine Wege achten!
Hört die Mahnung und werdet weise,
lehnt sie nicht ab!
Selig der Mensch, der auf mich hört,
der Tag für Tag an meinen Toren wacht
und meine Türpfosten hütet!
Wer mich findet, findet das Leben
und erlangt das Gefallen des HERRN.
Doch wer mich verfehlt, der schadet sich selbst;
alle die mich hassen, lieben den Tod. (Spr 8,32–36)
Mit anderen Worten: Wer sich nicht an die Strukturen der Schöpfung hält, wer den Bauplan der Natur und damit die Schöpfungsordnung Gottes zerstört, schadet sich selbst aufs Schwerste. Nicht Gott »bestraft« ihn, sondern er bestraft, er verfehlt, ja er zerstört sich selbst. Und nicht nur Einzelne zerstören sich selbst. Wir dürfen heute hinzufügen: Die Weltgesellschaft könnte sich selbst zerstören. Die heute in Bereitschaft stehenden Atomwaffen genügen, die gesamte Menschheit mehrfach auszulöschen.
Eine wachsende Unheilsgeschichte
Wenn auch in völlig anderer Form – der Schöpfungsbericht der sogenannten »Priesterschrift« in Gen 1,1–2,4a sagt letztlich dasselbe wie der zitierte Text aus dem Buch der Sprichwörter. Auch am Anfang der Genesis haben wir eine Schilderung der Erschaffung der Welt, die teilweise mit demselben Schöpfungsinventar arbeitet wie Spr 8,22–31. Identisch ist aber vor allem die Zielrichtung, denn bereits der Schöpfungsbericht der Genesis will sagen, dass die Schöpfung Gottes gut war. Nicht weniger als sechsmal hebt der Text refrainartig hervor: »Gott sah, dass es gut war« (Gen 1,4.10.12.18.21.25). Am sechsten Tag schließlich wird diese Formel erweitert:
Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe:
Es war sehr gut. (Gen 1,31)
Damit zeigt auch dieser Text, worauf es ihm ankommt, wenn er von der Schöpfung spricht: Sie ist gelungen und gut, sie ist sogar »sehr gut«. Gott kann seine Schöpfung mit Wohlgefallen betrachten.
Allerdings: Liest man die sich anschließenden Kapitel der Genesis, so sieht man schnell, dass von der guten Schöpfung Gottes nur deshalb erzählt wurde und erzählt werden musste, weil nun sofort eine erschreckende Unheilsgeschichte beginnt:
Bereits die ersten Menschen lassen sich verführen, misstrauen Gott und übertreten sein Gebot (Gen 3,1–24).
Die Folgen ihrer Sünde zeigen sich schon in der nächsten Generation. Es kommt zur Rivalität zwischen zwei Brüdern: Am Ende erschlägt Kain aus purem Neid seinen Bruder Abel (4,1–16). Selbstverständlich wird da nicht historisierend einfach eine Begebenheit vom Anfang der Menschheitsgeschichte erzählt. Erzählt wird vielmehr zuerst und vor allem, was in der Geschichte nach dem Einbruch des Bösen in die Welt immer wieder von neuem geschieht: Die Rivalität zwischen Brüdern, von denen der eine den anderen vernichten will.
Dann taucht in der Geschlechterfolge nach Kain ein Mann namens Lamech auf. Lamech hält sich nicht an das Gesetz der Blutrache, das größere Gewaltausbrüche begrenzen will: Er prahlt vor seinen Frauen, sich nicht nur siebenfach, sondern siebenundsiebzigfach zu rächen (Gen 4,15.23 –24). Auch das geschieht in der Geschichte immer wieder: Herrschsucht, Stolz und Machtgier von Einzelnen schaffen unsägliches Elend und stürzen die Welt ins Chaos.
Als die Zahl der Menschen auf der Erde immer größer wird, so erzählt die Bibel weiter, wächst auch das Unheil. Der Erzähler konstatiert: »Der HERR sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen auf der Erde zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war« (Gen 6,5). Im weiteren Verlauf der Erzählung wird diese Bosheit des Herzens genauerhin als Hang zur Gewalt beschrieben: »Die Erde war voller Gewalttat« (Gen 6,13).
Der Schöpfungsbericht in Gen 1,1–2,4a will also zeigen, dass die Welt von Gott grundsätzlich gut geschaffen ist. Doch in diese gute Schöpfung bricht die Sünde ein, und es beginnt eine Unheilsgeschichte, die vor allem aus immer weiter wuchernder Gewalt besteht. Somit wird in der Erzählfolge der ersten Kapitel der Genesis zwischen Schöpfung und Geschichte klar unterschieden. Das Böse steckt nicht in der Schöpfung Gottes, sondern entfaltet sich in der Geschichte, die schnell zu einer Unheilsgeschichte wird. Allerdings belässt es Gott nicht dabei: In Gen 12 beginnt er eine »Gegengeschichte«, indem er sich Abraham beruft. Von dieser Gegengeschichte erzählt dann die gesamte Bibel.
Nun könnte man natürlich einwenden: Wenn schon sofort die ersten Menschen gesündigt haben, wenn verbrecherische Gewalt in Gestalt des Brudermordes bereits am Anfang der Menschheitsgeschichte da war, wenn »das Trachten des menschlichen Herzens immer nur böse ist«, so dass Gott eine »Gegengeschichte« in Gang setzen musste – beweist dies alles dann nicht, dass seine Schöpfung keineswegs gut war? Sollte Gott das, was er erschuf, nicht eben doch gründlich misslungen sein?
Aber auch hier müssen wir Schöpfung als Evolution denken. Der Mensch kommt aus dem Tierreich – und zum Tierreich gehört die Gewalt, gehören Fressen und Gefressenwerden, gehören die unendlich vernetzten Nahrungsketten. Aber nicht nur die Nahrungsketten! Es ist ja keineswegs so, dass die Tiere ihre eigenen Artgenossen schonen. Wehe, eine Ratte, gerät durch Zufall in das Revier einer anderen Rattensippe. Sobald die »einheimischen« Ratten den Geruch der fremden Ratte wittern, ist deren Schicksal besiegelt: Sie wird zerfleischt.
Natürlich saßen dem Menschen Aggressionsstrukturen dieser Art noch lange im Leib. Die eigene Horde gegen die fremde Horde! Der eigene Stamm gegen den fremden Stamm! Wer anders riecht als wir, ist unser Feind! Wer eine andere Hautfarbe hat als wir, ist minderwertig. Man übertreibt nicht, wenn man sagt: Verhaltensmuster dieser Art sitzen uns noch immer im Leib.
Irgendwann aber in der langen Geschichte der Menschwerdung des Menschen tauchte zum ersten Mal die Möglichkeit von Freiheit und Vernunft auf. Von da an musste der Mensch, folgte er diesen neuen Möglichkeiten, nicht mehr brutale Gewalt gegen seine Mitmenschen einsetzen. Seitdem musste er nicht mehr seinem Gruppenegoismus freien Lauf lassen. Seitdem konnte er »menschlich« mit Fremden umgehen. Verweigerte er sich jedoch diesen sich neu eröffnenden Möglichkeiten, dann wurde er »tierischer als jedes Tier«, denn er hatte nun durch seine Intelligenz unendlich mehr Möglichkeiten, die eigenen Artgenossen zu vernichten.
Die nicht abreißende Gewalt, von der die Genesis erzählt, setzt also – modern gesprochen – das Sich-Verweigern angesichts neuer Möglichkeiten voraus, die erst im Verlauf einer langen Kultur- und Freiheitsgeschichte errungen wurden. Erst dieses Sich-Verweigern angesichts neuer Möglichkeiten der Mitmenschlichkeit schuf das Böse. Und da das Böse (genau wie das Gute) nachgeahmt wird und sich auf diese Weise fortzeugt, begann eine Geschichte des sich fortzeugenden Bösen. Potentiale des Bösen bildeten sich, in die Menschen ohne eigene Schuld hineingeboren wurden, so dass genau das geschah, was die kirchliche Dogmatik mit einem leider missverständlichen Begriff als »Erbsünde« bezeichnet.
Die Folgen dieser Ketten des Bösen, dieser sich anhäufenden Schuldpotentiale waren und sind enorm. Was an neuen Möglichkeiten der Freiheit und der Güte auf den Menschen zukam, hätte ja den Blick auf die Sinnhaftigkeit der Schöpfung schärfen können. Wo sich aber Schuld ausbreitet, wird dieser Blick verstellt, das Gute wird unkenntlich, Sinnstrukturen werden als Sinnlosigkeiten wahrgenommen.
Ein Beispiel: Der Beginn einer schweren Krankheit müsste ja nicht unbedingt tiefes Erschrecken sein, nackte Not, Erfahrung von Isolation und Einsamkeit. Krankheit könnte auch die Erfahrung menschlicher Zuwendung sein, ja sogar Sinnerfahrung aus dem Glauben an die Geborgenheit in Gott. Das Gleiche gilt für den Tod. Er könnte Abbruch sein und dennoch Hingabe und hoffnungsvolles Vertrauen auf Gott. So hätte Welterfahrung immer mehr zu Sinnerfahrung werden können. Doch es ist anders gekommen. Ein riesiges Potential an selbstgeschaffenem Elend trübt unseren Blick auf die Sinnstrukturen der Schöpfung.
*
Es ist wohl deutlich geworden: Wer Gott prinzipiell ankreidet, dass er Stechmücken, Fäulnis, mutierende Viren, gefährliche Bakterien und entgleisende Zellen geschaffen und darüber hinaus das Böse in der Geschichte zugelassen habe, hat nicht begriffen, was Evolution ist. Er wünscht sich letzten Endes eine von Anfang an fertige, sterile Glashauswelt, ein Schlaraffenland, in dem das Glück vorfabriziert ist und dem Menschen der Honig in den offenen Mund tropft.
In einer solchen Welt gäbe es keine Freiheit und deshalb auch keine wirkliche Liebe. In einer solchen Welt wären wir bloße Marionetten, infantile, euphorisierte, auf Glücksgefühl programmierte Bio-Maschinen, wie sie Aldous Huxley in seinem Roman »Schöne neue Welt« meisterhaft karikiert hat. In der sterilen, künstlich erzeugten und auf unablässige Lust konditionierten Gesellschaft, die Huxley uns schildert, gibt es kein Scheitern, keine Krankheit, und keinerlei Elend mehr. Es gibt zwar irgendwann den Tod – aber der vollzieht sich im Drogenhalbschlaf und »verblödeter Seligkeit« in eigens dafür eingerichteten Sterbeanstalten.
Gott wollte eine andere Welt. Er wollte eine Welt, in der es Liebe gibt, die aus Freiheit kommt – in der es Leid gibt, das den Menschen reifen lässt – in der es Unglück gibt, das ihn erprobt. Mehr noch: Gott wollte eine Welt, die noch nicht fertig ist – eine Welt, an welcher der Mensch mitarbeiten darf – voll Sehnsucht, die Wunden der Geschichte zu heilen und im Vollsinn Mensch zu werden – ausgespannt zwischen Erde und Himmel.
Wie eine heutige Schuldgeschichte entsteht
Das alles ist nun auf COVID-19 anzuwenden. Wir haben ja gesehen: Die Welt, in der wir leben, ist nicht einfach die reine Schöpfung Gottes. Sie hat bereits eine lange Geschichte hinter sich, ja sie ist wesenhaft Geschichte. Diese Geschichte aber kann durch die Anhäufung menschlicher Schuld eingetrübt und verdunkelt, ja sogar verdorben werden. Dann wird sie zur Unheilsgeschichte.
Gehen wir ruhig einmal davon aus, das neue Virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) sei nicht aus menschlicher Planung entstanden, also etwa in einem Labor, das den staatlichen Auftrag hatte, biologische Waffen herzustellen. Sollte das nämlich der Fall gewesen sein, so wäre allein schon dieser Vorgang zutiefst schuldhaft.
Die Virologen sagen uns jedoch, dass SARS-CoV-2 in diesem Fall anders konstruiert wäre. Das Virus sei nicht menschengemacht, sondern höchstwahrscheinlich durch unbeabsichtigte Übertragung von Tier zu Mensch entstanden. Möglicherweise auf dem Weg über den riesigen Wildtiermarkt der chinesischen Millionenstadt Wuhan, wo neben dem Fleisch von Zuchttieren auch das Fleisch von Schlangen, Ratten, Salamandern, Kröten und vielerlei Vögeln angeboten wurde, daneben auch gemahlene Knochen und der getrocknete Kot von Fledermäusen – wohl nicht als Delikatessen, sondern als Heilmittel. Selbstverständlich darf man sich fragen, ob im 21. Jahrhundert solch primitive Heilmittel-Magie nicht schon selber schuldhaft ist.
Auf jeden Fall aber hat sich danach menschliche Schuld sofort und geradezu erschreckend mit der Geschichte des neuen Virus verbunden: Die Existenz der hochgefährlichen Corona-Variante wurde in der Volksrepublik China zunächst für eine zwar kurze, aber für die Ausbreitung des Virus enorm wichtige Zeit im Dunkeln belassen – die uralte Verschweigetaktik der Diktaturen. Auf der gleichen Linie lag, dass eine Reihe westlicher Politiker das Virus aus leicht durchschaubaren Gründen zuerst einmal verniedlicht, heruntergespielt und für die eigenen Machtspiele instrumentalisiert hat. Bei einigen von ihnen geschieht das noch immer.
Die Corona-Krise entlarvte aber nicht nur die Verantwortungslosigkeit bestimmter Politiker und zeigte deren wahres Gesicht. Sie zeigte leider auch, dass die Forschung auf die Möglichkeit einer Corona-Mutante zu wenig vorbereitet war, obwohl die schweren Atemwegssyndrome, verursacht durch das SARS-CoV (seit 2002) und das MERS-CoV (seit 2012), ein warnendes Signal hätten sein müssen. Bereits hier war ziemlich klar, dass die genannten Corona-Viren einem tierischen Erreger-Reservoir entstammten.
Noch weniger vorbereitet war in vielen Ländern der Katastrophenschutz. In brutaler Deutlichkeit offenbarte dort die Krise desolate Gesundheitssysteme, das Fehlen von Beatmungsgeräten und Intensivbetten, den Mangel an geschultem Personal und die Unfähigkeit staatlicher Stellen, Atemschutzmasken für Katastrophenfälle bereitzuhalten.
Aber nicht nur Politiker und Machthaber versagten. Als die erste Welle der Pandemie am Abklingen war und Lockerungen des Lockdown begannen, agitierten gerade in freiheitlichen Ländern des Westens immer mehr Uneinsichtige gegen die Anordnungen ihrer Regierungen in Sachen Corona. Aus allen Ecken und Lagern gingen nun Maskenverweigerer, Impfskeptiker, Impfablehner, Corona-Verharmloser, Pandemieleugner, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker und Querdenker auf die Straße. Sie wollten vorführen, dass sie behördliche Restriktionen wie Abstandsregeln, Atemschutzmasken und Kontaktbeschränkungen geradezu verachteten. Die Sorge um andere, vor allem um Alte und Kranke lag ihnen völlig fern. Mit Polizeiaufsicht und Polizeigewalt ist derartiger Ignoranz, ja Rücksichtslosigkeit kaum beizukommen.
Das wirkliche Problem – jedenfalls in den freiheitlichen Gesellschaften europäischer Art – waren aber nicht diese gesellschaftskritisch orientierten Demonstranten. Das eigentliche Problem waren die Vielen, die einfach nicht begreifen konnten, dass der hochgefährlichen Pandemie COVID 19 nur mit Rücksichtnahme und äußerster Disziplin zu begegnen ist. In den Geschäften und dort, wo es vorgeschrieben war, trugen sie brav ihre Atemschutzmaske. Aber sobald sie draußen waren – und das konnte man auf jeder Straße und an jeder Straßenecke beobachten, kam ihnen gar nicht in den Sinn, Abstand zu halten. Zuhause, in den Häusern, war es nicht anders. Viele dachten gar nicht daran, auf die üblichen Besuche und Zusammenkünfte zu verzichten. Solche Disziplinlosigkeit war die eigentliche Ursache der sogenannten 2. Welle der Pandemie im Spätherbst und im Winter 2020.
Hinter derartiger Uneinsichtigkeit stand nicht Bosheit. Es war eher die völlige Unfähigkeit, eine gänzlich neue Situation zu begreifen und größere Zusammenhänge (etwa den drohenden Zusammenbruch der Krankenversorgung) zu sehen und – wenigstens für eine bestimmte Zeit – den eigenen Lebensstil zu ändern. Gegenüber solcher Unfähigkeit, sich in eine ungewohnte gesellschaftliche Situation einzufühlen, ist ein freiheitlicher Staat hilflos. Hier stößt er an seine Grenzen. Er kann nur warnen, mahnen, appellieren, bitten – aber er kann nicht zur Einsicht zwingen.
Hinter der beschriebenen Unfähigkeit vieler stand also nicht Bosheit – und doch erhebt sich die Frage, ob man nicht auch hier von Schuld sprechen muss. Nämlich von einer Schuld, die aus einer anerzogenen oder selbst erworbenen Unfähigkeit besteht, die eigenen Gewohnheiten, die eigenen Rituale, die eigenen Bequemlichkeiten, die eigene Komfortzone zu verlassen und an andere Menschen und überhaupt an größere Zusammenhänge auch nur zu denken. Eine solch individuelle, aber auch kollektive Erstarrung kann durchaus mit Schuld verbunden sein.
Diese ganze Liste könnte leicht verlängert und vertieft werden. Sie zeigt: Ein Geschehen, dass zunächst einmal rein biologischer Natur ist, dann aber tiefgreifende gesellschaftliche Prozesse auslöst, wird durch menschliches Versagen, durch Unbeweglichkeit, Ignoranz, Besserwisserei, Arroganz und verbrecherische Manipulation gleichsam umstrickt mit Bösem, löst eine Schuldgeschichte aus und schafft so erst das eigentliche, das wirkliche Leid.
Signale einer Gegengeschichte
Jeder, der die Pandemie mit wachen Augen miterlebt hat und sie immer noch miterlebt, weiß freilich auch von ganz anderen Dingen zu berichten: von vielen Forschungseinrichtungen, in denen jetzt Tag und Nacht an der Analyse des Virus, an der Art seiner Übertragung und an Gegenmitteln gearbeitet wird – er weiß von dem bewundernswerten Einsatz von Ärzten, Krankenhauspersonal und vielen anderen Helfern – von unzähligen Männern und Frauen, die sich spontan anboten, älteren Menschen zu helfen – von Lehrern, die mit größter Sorgfalt digitalen Unterricht vorbereiteten – kurz: von einer Welle der Hilfsbereitschaft, der Solidarität und des Miteinanders. An dieser Stelle sind auch weltweite medizinische Kooperationsprojekte zu nennen, die – angestoßen durch die Corona-Krise – entstanden sind. Die Geschichte dieses großen humanen Einsatzes, die sofort einsetzte, muss erst noch geschrieben werden.
Damit entsteht nun freilich eine weitere theologische Frage, die mir fast die wichtigste zu sein scheint: Wie verhält sich eigentlich dieser positive Teil der Wirkungsgeschichte des Virus, diese Welle der Solidarität und Mitmenschlichkeit zu dem Begriff des »Reiches Gottes«? Auch Jesus geht ja an gegen Krankheit, gegen Not, gegen die Isolation Einzelner, überhaupt gegen menschliches Leid in jeder Form – und in dieser Offensive zeigt sich für ihn bereits das Kommen der Gottesherrschaft (Lk 11,20). Darf man den unglaublichen Einsatz vieler Helferinnen und Helfer in den Zeiten der Corona-Krise hier einordnen und mit dem Kommen des Reiches Gottes in Verbindung bringen? Ich hätte keine Schwierigkeit, dies zu tun.
Denn das Reich Gottes, das Jesus verkündet, zeigt sich ja nicht nur in Jesu Handeln und im Handeln seiner Jünger, und es ist auch nicht nur in Israel verortet, sondern es will auf dem Weg über Jesus und seine Nachfolger die ganze Welt erfassen. Es will möglichst viele Sympathisanten, und es braucht sogar Menschen, die gar nicht wissen, dass sie im Sinne Jesu handeln, es aber eben doch tun – oft sogar zur Beschämung von Christen, die ihre Aufgaben nicht nur nicht machen, sondern sie sogar vergessen haben.
Deshalb wage ich zu sagen: Der selbstlose Einsatz vieler Frauen und Männer bei dieser Pandemie hat durchaus etwas mit dem Kommen des Reiches Gottes zu tun. Der Kampf gegen die Krankheit und das Kommen des Reiches sind nicht voneinander zu trennen. Sie gehören zusammen.
Selbstverständlich ist alles, was ich gerade gesagt habe, noch nicht das »letzte Wort« über das Reich Gottes. Das letzte Wort über das Kommen der Gottesherrschaft ist die Lebenshingabe Jesu, ist sein stellvertretender Tod, ist seine Auferweckung von den Toten. Aber das Reich Gottes hat eben auch seine »vorletzten Worte«, hat seinen »Vorhof«, hat ein weites Feld, auf dem Hindernisse für das Kommen des Reiches beseitigt werden.