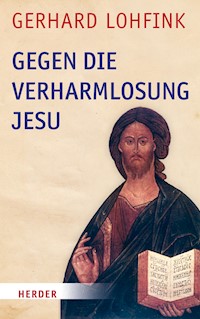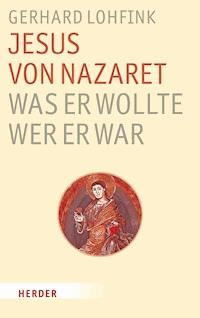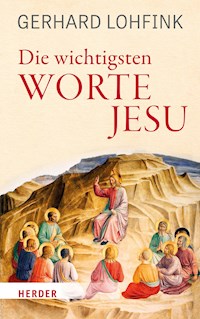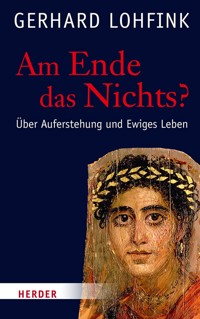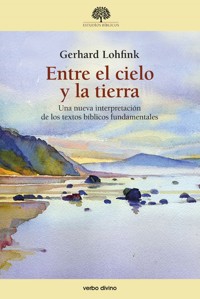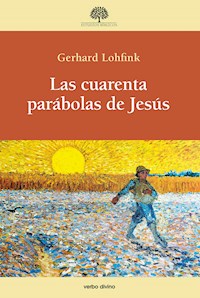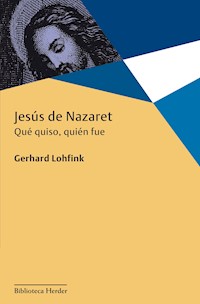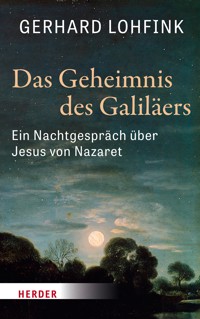Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt eine Lebensgeschichte. Der Neutestamentler Gerhard Lohfink berichtet von seiner Kindheit in der Nazi-Zeit und im 2. Weltkrieg, von seinem Theologiestudium in Frankfurt am Main und München, von seinen Erfahrungen als Priester und Seelsorger, von seinem Weiterstudium in Würzburg, seiner Zeit als Professor in Tübingen und den Jahren danach bis heute. Doch verwoben mit dieser Geschichte seines Lebens behandelt er in der ihm eigenen spannenden und anschaulichen Art und Weise Fragen, die in jedem christlichen Leben eine entscheidende Rolle spielen: die Frage nach der Wahrheit in der Bibel, nach der Rolle der Vernunft im christlichen Glauben, nach dem Umgang mit Gott, wenn es zu den wirklichen Lebensentscheidungen kommt. Im letzten Teil seines Buches stellt er sich der immer drängender und herausfordernden Frage, wie der christliche Glaube in einer Welt bestehen kann, die voll Hass, Krieg und Vernichtung ist. Kann man in einer solchen Welt noch an Gott glauben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Satz: Barbara Herrmann, Freiburg im Breisgau
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN (Print) 978-3-451-39905-3
ISBN (EPUB) 978-3-451-84105-7
ISBN (PDF) 978-3-451-83505-6
Rudolf Schnackenburg zum Gedächtnis
Inhalt
Vorwort
1. Elternhaus
2. Schulzeit
3. Jugendbewegung
4. Entscheidungen
5. Philosophie
6. Kunstpause
7. Theologie
8. Endlich im Beruf
9. Weiterstudium
10. Tübingen
11. Gemeinde
12. Gottesverteidigung
13. Warum ich an Gott glaube
14. Alles gesagt?
Danksagung
Bücher von Gerhard Lohfink
Anmerkungen
Schriftstellenverzeichnis
Vorwort
Ich liebe Autobiografien. In meinen Bücherregalen stehen sie zuhauf. Zugleich hasse ich sie. Ich liebe sie, weil viele Autoren von den ersten zwanzig bis dreißig Jahren ihres Lebens eindringlich, ja aufregend erzählen. Doch dann verformt sich die Autobiografie langsam in ihren zweiten Teil. Dort berichtet der inzwischen berühmte Verfasser hauptsächlich, wie vielen berühmten Leuten er in seinem weiteren Leben begegnet ist.
Dieses Buch hier ist keine Autobiografie im üblichen Sinn. Ich bin nicht daran interessiert, bedeutende öffentliche Ereignisse aus meinem Leben zu erzählen. Es gibt sie gar nicht. Mein Thema ist vielmehr, wie ein Durchschnittsmensch zum Glauben kommen kann. Dazu greife ich auf mein eigenes Leben zurück, aber nur in Ausschnitten und oft sogar mit Zeitsprüngen. Es geht mir nicht um ein Gemälde meines Lebens, sondern um eine sachgerechte Theologie. Genauer gesagt: Es geht mir darum, wie der christliche Glaube in einer Welt bestehen kann, die voller Hass, Krieg und Vernichtung ist. Kann man in einer solchen Welt noch an Gott glauben?
Der Titel dieses Buches greift bewusst auf den Anfang des Apostolischen Glaubensbekenntnisses zurück, das mit den Worten beginnt:
Ich glaube an Gott
Die Grundgestalt dieses Bekenntnisses ist bereits für das 2. Jahrhundert nach Christus bezeugt.1 Aber zu welchem Zweck war es geschaffen worden? Sein ›Sitz im Leben‹ war ursprünglich nicht der sonntägliche Gottesdienst. Sein ursprünglicher Ort war die Taufliturgie in der Osternacht.
Die getauft wurden – es waren zunächst vor allem Erwachsene – sprachen das Glaubensbekenntnis nicht einfach als durchlaufenden Text. Ihr Glaubensbekenntnis war vielmehr Teil eines Dialogs2. Genauer: Jedem Einzelnen wurden die drei Teile des Bekenntnisses als Frage gestellt:
Glaubst du an Gott […]?
Glaubst du an Jesus Christus […]?
Glaubst du an den Heiligen Geist […]?
Meine Auslassungszeichen wollen deutlich machen: Das gesamte Glaubensbekenntnis wurde dem Täufling in dieser Dreiteilung vorgelegt. Jeder Einzelne antwortete dreimal »Ich glaube«. Und nach jedem »Ich glaube« wurde der Täufling, der dabei in einem Fluss oder im Bassin einer Taufkapelle stand, untergetaucht oder doch wenigstens mit Wasser besprengt.3
Diese dialogische Struktur des Glaubensbekenntnisses ist noch heute in vielen christlichen Taufritualen und vor allem in der jährlichen Erneuerung des Taufversprechens innerhalb der Osternacht erhalten geblieben. Und erhalten geblieben ist dabei auch das »Ich glaube«. In der katholischen Feier der Osternacht zum Beispiel fragt der Priester die versammelte Gemeinde:
Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde […]?
Jetzt erwartet man natürlich ein »Wir glauben«. Die Antwort lautet dann jedoch bemerkenswerterweise: »Ich glaube«. Genauso bei den beiden nächsten Fragen! Es war also jeder wie einst bei der frühchristlichen Tauffeier als Einzelner angesprochen worden. Und jeder Einzelne legt dann mit dem »Ich glaube« sein persönliches Bekenntnis ab.
Vor allem aber – und darauf kommt es mir hier an: Indem das Ganze in der Kirche stattfindet und als Dialog zwischen dem Priester und der Gemeinde geschieht, wird deutlich: Wir können den Glauben nicht aus uns selbst hervorbringen. Wir empfangen ihn von Gott – vermittelt durch Jesus Christus und die Kirche4. Allerdings muss ihn der Einzelne dann auch mit seiner ganzen Existenz annehmen und sich zu ihm bekennen.
Dem folgt die Grundstruktur dieses Buches. Ich möchte von meinem persönlichen Glauben an Gott sprechen. Deshalb die bisweilen längeren, bisweilen kürzeren biografischen Einsprengsel. Aber ich spreche nicht von etwas, das ich mir selbst zurechtgelegt und zusammengebastelt habe. Ich spreche vielmehr über etwas, das ich »empfangen« habe5 – über das ich mir dann freilich während meines Lebens immer wieder Rechenschaft geben musste.
Anders formuliert: Ich berichte von dem Licht des Glaubens, das mir Gott – vermittelt durch die Kirche – geschenkt hat, das ich aber stets von neuem mit dem Licht meiner Vernunft und der Vernunft der Welt zusammenbringen musste.
Warum glaube ich an Gott? Ich gebe die Antwort in vierzehn Schritten bzw. vierzehn Kapiteln. Sie stehen mit meiner eigenen Lebensgeschichte in einem festen Zusammenhang. Bei anderen Christen wird diese »Glaubens-Biographie« wahrscheinlich in Vielem anders aussehen. Im Grunde ist sie bei jedem Christen verschieden. Jeder hat seine eigene Glaubensgeschichte – oder auch seine eigene Geschichte des Nicht-glauben-Könnens.
Noch eine Nebenbemerkung: Dieses Buch hat als Basis einen Vortrag, den ich im Jahre 2017 in Wangen im Allgäu gehalten habe. Der damalige Vortrag ist dokumentiert in meinem Buch »Im Ringen um die Vernunft. Reden über Israel, die Kirche und die Europäische Aufklärung«6. Der damalige Text wurde hier aber nicht nur an vielen Stellen überarbeitet und ergänzt. Er wurde auch um wesentliche Teile erweitert – bis in unsere so bedrängende Gegenwart hinein, die vielen Christen den Glauben an einen Gott, der Herr der Geschichte ist und bleibt, immer schwerer macht.
Ich widme dieses Buch in tiefer Dankbarkeit meinem Lehrer und Doktorvater Professor Rudolf Schnackenburg (1914–2002).
Gerhard Lohfink
1. Elternhaus
Warum also glaube ich an Gott? Die erste Antwort lautet ganz schlicht: Weil meine Eltern an Gott geglaubt haben. Das heißt: Ich bin, ohne dass ich dazu irgendetwas hätte tun können, in einer christlichen Familie aufgewachsen, in der es einfach selbstverständlich war, dass ich eine Woche nach meiner Geburt getauft und dann christlich erzogen wurde.
Wäre ich in Jordanien geboren, wäre ich wohl ein Moslem geworden. Wäre ich in Thailand oder Kambodscha geboren, wäre ich heute mit ziemlicher Sicherheit Buddhist. Wäre ich in Japan geboren, würde ich wahrscheinlich ab und zu einen Shin-to-Schrein besuchen und mich dort mit meinen Ahnen und meinem japanischen Vaterland geistig verbinden.7 Ich hatte nun aber katholische Eltern, und deshalb bin ich katholischer Christ geworden. Ein Statistiker würde es einen demografischen Zufall nennen. Ich nenne es Gnade.
Reine Gnade war auch, dass meine Mutter und mein Vater nicht nur getaufte Christen waren, sondern dass sie ihren Glauben gelebt haben. Das Morgengebet, das Abendgebet, das Gebet vor und nach dem Essen, der Gottesdienstbesuch am Sonntag, gelegentliche Hausandachten, die Feier der Festtage und der liturgischen Zeiten, die festliche Begehung der Erstkommunion: all das war in unserer Familie – zumindest aus der Sicht der Kinder – eine Selbstverständlichkeit.
Unvergesslich leben die Weihnachtsabende in meiner Erinnerung. Vor 1944, als wir noch nicht ausgebombt waren und noch eine geräumige Mietwohnung hatten, blieb die Tür zu dem so-genannten ›Guten Zimmer‹, wo nur an Festtagen gegessen wurde, verschlossen. In diesem Zimmer hatte die Mutter für den Heiligen Abend alles vorbereitet und tat nun die letzten Handgriffe. Wir Kinder saßen mit dem Vater im Wohnzimmer und warteten. Irgendwann öffnete sich dann die Tür – und der geschmückte Weihnachtsbaum zog alle Blicke auf sich. Aber nicht nur die Augen wurden gesättigt. Die Luft war erfüllt von Tannen- und Kerzenduft.
Natürlich suchten unsere Augen dann auch die Geschenke. Aber die steckten unter einer weißen Tischdecke. Nur geheimnisvolle Konturen zeigten sich unseren verstohlenen Blicken. Bevor diese Decke entfernt wurde, las mein Bruder noch einmal das Weihnachtsevangelium vor, ich selbst hatte die Aufgabe, vor der Krippe ein Gedicht zum Jesuskind zu sprechen, und selbstverständlich wurden dazwischen die alten Weihnachtslieder gesungen.
Weihnachten war die bedeutendste Familienfeier des ganzen Jahres – doch zugleich hatte diese Feier ihr festes Fundament in der kirchlichen Weihnachtsliturgie: Vor der häuslichen Zusammenkunft war die ganze Familie in der Christmette gewesen.
Das Kirchenjahr mit seinen Festen und Festzeiten, seinen Bräuchen und seiner Vergegenwärtigung der biblischen Erzählungen war mir wie selbstverständlich vorgegeben. Ich bin in das Christliche bzw. in das Katholische hineingewachsen wie in die Hosen und Jacken, die mir meine Mutter genäht hat. »Hineinwachsen« – das möchte ich erklären: Meine Eltern waren einfache Leute. Sie kämpften darum, wie sie finanziell zurechtkamen. Für Obst, Gemüse, Salat und Küchenkräuter wurde kein Geld ausgegeben – das lieferte der eigene Garten. Mein Vater hat im Keller sogar unsere Schuhe besohlt und uns im Wohnzimmer regelmäßig die Haare geschnitten. Und die Mutter hat fast alle Kleider der vier Kinder selbst genäht. Sie wurden immer ein wenig größer geschneidert, damit man »hineinwachsen« konnte.
Später habe ich gelernt, dass dies auch für die Taufe gilt. In ihr wird dem Täufling schon alles geschenkt: die Liebe Gottes des Vaters – das verborgene Leben in Christus – die bergende Gemeinschaft mit der Kirche. Symbol dafür ist das weiße Taufkleid, welches über das kleine Kind gebreitet wird. Es muss in all das noch lebenslang hineinwachsen, auch in das Wagnis des Glaubens.
Um diese großen Wörter ein wenig auf die Erde zu bringen: Der Glaube meiner Eltern war kein naiver, kein lediglich übernommener, kein Gewohnheits-Glaube, der sich einfach nur einem katholischen Milieu verdankt hätte. Meine Mutter hatte zwei Brüder, die in der liberalen Luft der Großstadt Frankfurt am Main ihren Glauben mehr oder weniger verloren hatten. Sie war ihrem Gerede und ihren Spötteleien ausgesetzt. Sie musste sich für ihren Glauben und für die gläubige Form ihres Lebens selbst entscheiden.
Genauso mein Vater. Er kam zwar aus einem katholischen Dorf in der Rhön. Aber es verschlug ihn eben nach Frankfurt, und sein Arbeitsplatz war, bevor er Lokführer wurde, ein großes Ausbesserungswerk der Reichsbahn. Das Milieu dort war rot, und einer, von dem man wusste, dass er noch in die Kirche ging, wurde verhöhnt. Als mein Vater eines Morgens an seinen Arbeitsplatz kam, hatte man ihm dort ein Altärchen mit brennenden Kerzen aufgebaut.
Auch das kirchliche Milieu in Frankfurt war nicht das volkskirchlich Übliche. Wir gehörten regulär zur Pfarrei St. Gallus. Und das Pfarrgebiet erstreckte sich zum größeren Teil in einem ausgesprochenen Industrieviertel. Dort brummten Tag und Nacht die Werkzeugmaschinen der sich weit ausdehnenden Adler-Werke. »Kamerun« nannte man in Frankfurt dieses schnell wachsende Industriegebiet im Westen der Stadt, weil dort die Häuser schwarz waren vom Rauch der Lokomotiven und von den unzähligen Schornsteinen der Fabriken. Es war eine Arbeiterpfarrei mit einem Pfarrer, der ein wirklicher Seelsorger war. Er hieß Albert Perabo. Nach den Zerstörungen des Krieges fanden wir dann dort, mitten im Gallusviertel, nahe der alten, ebenfalls zerbombten Pfarrkirche, eine winzige Wohnung.
Vorher allerdings hatten wir in der von dem berühmten Architekten Ernst Georg Mai (1886–1970) nach den Prinzipien der ›Gartenstadtbewegung‹ gebauten ›Kuhwaldsiedlung‹ gewohnt. Weil zwischen dieser Eisenbahner-Siedlung und der Pfarrei, zu der wir gehörten, ein Güterbahnhof mit einem kilometer-breiten Gleisnetz lag, gingen wir meistens nach St. Elisabeth im Stadtteil Bockenheim zur Kirche. Die Elisabethenkirche war bequemer zu erreichen. Und auch dort gab es auffallend gute Seelsorger. Für eine der damals noch üblichen ›Volksmissionen‹ holte sich der Pfarrer nicht die Kapuziner, die neben vielem anderen auch deftig über Himmel und Hölle predigten, sondern Benediktiner, die eine Woche lang in die Liturgie der Eucharistiefeier einführten – damals während der Anfänge der ›Liturgischen Bewegung‹ etwas ganz Neues.
Dies war der katholische Biotop, in dem ich aufwuchs: Ein bewusst gläubiges Milieu, das sich in einer schon längst liberalen und in vielem gottvergessenden Großstadt zu behaupten hatte; ein christliches Milieu, das den Schikanen der Nazis ausgesetzt war (ich werde darauf noch zurückkommen); ein katholischer Lebensraum, der durchaus ökumenisch dachte. Das alles: reine Gnade!
Mir ist erst viel später klar geworden, wie wenig selbstverständlich meine christliche Sozialisation damals war. Für viele meiner späteren Mitbrüder, die im Westerwald oder etwa in unterfränkischen Dörfern aufgewachsen waren, war das alles ganz anders. Wir mussten uns zu unserem Glauben bekennen. Wenn wir am Sonntag durch die vielen Straßen zum Gottesdienst gingen, trugen wir unsere Gesangbücher stolz in der Hand. Jeder, der uns begegnete, durfte sehen: Wir gehen am Sonntagmorgen nicht irgendwohin, sondern zur Kirche. Heute ist ein schlichtes Bekenntnis dieser Art nicht mehr üblich: Die Gesangbücher befinden sich nicht mehr zuhause, sondern in einer großen Kiste, die hinter der letzten Kirchenbank steht. Man will es den Gläubigen leicht machen. Warum noch ein Gesangbuch mit in die Kirche bringen?
Eines muss ich an dieser Stelle noch erwähnen: Ich war schon als Siebenjähriger, genau wie meine beiden älteren Geschwister, eine Leseratte. Ich las alles, was mir in die Finger kam. Spannende Bücher habe ich oft mehrere Male gelesen. Manchmal fing ich, sobald ich bei einem Buch hinten angekommen war, sofort vorne wieder von neuem an.
Meine Mutter wusste das natürlich. Sie sorgte, obwohl so etwas in der Nazi-Zeit gar nicht leicht war, ständig für Bücher, die nach Möglichkeit in einer christlichen Umgebung spielten und deren Hauptfiguren oft junge Menschen waren, die bewusst ihren Glauben lebten. Ich verdankte diesen Büchern in dieser Phase meines Lebens viel. Und ich bin meiner Mutter noch heute für ihre Umsicht dankbar. Sie hat mir viele Jahre später einmal gestanden, dass sie das meiste von dem, was ich las, auch selbst las, damit sie wusste, was mich jeweils bewegte. Wie sie das bei ihrer Schneiderei und der Aufzucht von vier Kindern geschafft hat, habe ich bis heute nicht begriffen. Mit Sicherheit mussten dafür Nachtstunden herhalten.
Noch etwas anderes muss an dieser Stelle gesagt werden: Ich bin nicht in einer »heiligen Familie« aufgewachsen, in der nur leiser Engelsgesang zu hören war. In unserer Familie konnte es, genau wie anderswo, zwischen den Geschwistern Reibereien und Streit geben. Die Eltern allerdings stritten sich in unserer Anwesenheit nicht. Später wurde mir aber klar, dass es auch zwischen ihnen ein manchmal bis in die Tiefe gehendes ›Einander-nicht-Verstehen‹ gab. Aber es gab eben nach den vor uns verborgen gehaltenen Konflikten immer wieder Versöhnung – und zwischen den beiden eine stille Treue und ein selbstverständliches Füreinander-Dasein, das seine Wurzel in dem gemeinsamen Glauben hatte.
2. Schulzeit
Warum glaube ich an Gott? Die zweite Antwort lautet: Weil ich das Glück hatte, über meine Familie hinaus im richtigen Augenblick immer wieder gläubigen Christen zu begegnen. Das begann schon mit den Freunden, die in der gleichen Eisenbahnersiedlung wohnten, die mit mir an den Rändern des riesigen Güterbahnhofs Versteck spielten und mit mir zusammen die Erstkommunion empfingen.
Diese Erstkommunion feierte ich im Jahre 1942. Nach den Vorschriften der Nationalsozialisten hatten sich alle religiösen Veranstaltungen auf kirchliche Räume zu beschränken. Wir hatten aber, wie schon berichtet, zur Galluskirche, also zu dem Zentrum unserer Heimatpfarrei, ziemlich weit. Deshalb stellte eine gläubige Familie, die in unserer Siedlung wohnte, für den Kommunion-Unterricht der jeweiligen Erstkommunikanten ihren Keller zur Verfügung. Sie hatten dort eigens einen wohnlichen Raum geschaffen. Dorthin kam dann jede Woche einer der Kapläne zum Unterrichten. Und den betreffenden Jungen und Mädchen wurde eingeschärft: »Ihr dürft auf keinen Fall alle gleichzeitig eintreffen.« So wählten wir leicht unterschiedliche Zeiten, spielten nicht vor dem betreffenden Haus, sondern gingen sofort durch die nur angelehnte Haustür hinein; einige kamen auch durch die Gartentür hinter dem Haus. Wie riskant das alles war, wussten nur die Eltern. Wir selbst betrachteten es als eine Art Indianerspiel mit Kriegern eines feindlichen Stammes – ein Spiel mit Anschleichen und Sich-Verstecken.
Das Glück, immer im richtigen Augenblick mit gläubigen Christen zu tun zu haben, setzte sich fort mit den Kaplänen, die damals zu jeder Großstadtpfarrei gehörten. Meine Mutter lud gelegentlich den einen oder anderen von ihnen zum Kaffee oder zum Abendessen ein. Für die Eltern war das wichtig: Sie erfuhren aus dem Mund der eingeladenen Geistlichen, wie der klügere Teil der Katholiken über Hitler und den Nationalsozialismus dachte. Es wurden dann Gespräche geführt, bei denen wir Kinder nicht dabei sein durften. Wir bekamen aber selbstverständlich mit, dass wir nichts mitbekommen sollten. Und einmal hörte ich durch die geschlossene Tür, als das Gespräch der Erwachsenen erregter wurde, wie ständig von einem »Verbrecher« die Rede war. Ich wusste: Der Mann hieß Hitler.
Natürlich bekamen wir ebenfalls mit, wie sehr unsere Eltern ihre Seelsorger schätzten und achteten. Ich habe von ihnen nie ein niederziehendes Wort über Pfarrer oder Bischöfe gehört. Im Übrigen hätte es auch gar keinen Anlass dazu gegeben: Die Geistlichen, mit denen wir zu tun hatten, waren höfliche, zurückhaltende und liebenswürdige Menschen.
Die Predigten eines dieser Kapläne wurden regelmäßig von einem Spitzel der Gestapo, also der ›Geheimen Staatspolizei‹, kontrolliert. Der saß in einer der hinteren Kirchenbänke, gab genau acht und schrieb mit. Natürlich hütete sich der betreffende Seelsorger, die Verbrechen der Nazis unmittelbar beim Namen zu nennen. Das hätte ihn sofort in das Konzentrationslager Dachau gebracht (wo in der Gesamtzeit dieses Lagers 2.720 europäische Geistliche inhaftiert waren, davon 447 aus Deutschland und Österreich. Vor allem viele polnische Priester wurden dort ermordet. Von den deutschen und österreichischen Geistlichen kamen im KZ Dachau 94 zu Tode). Aber zurück zu unserem Kaplan! Er machte es geschickt: Er predigte zum Beispiel ausführlich über das 5. Gebot: »Du sollst nicht töten!« und erklärte, dass die Bibel damit den Mord an Unschuldigen meine. Die Gläubigen wussten natürlich genau, was er damit sagen wollte und welche Verbrechen er dabei vor Augen hatte. Und auch die Gestapo wusste es. So kam es, dass er mehrfach in die Verhörräume der Frankfurter Gestapo geholt und dort vernommen und bedroht wurde. Allerdings wusste ich damals von diesen Vorgängen noch nichts. Ich habe erst nach dem Krieg davon erfahren. Was ich aber unmittelbar am eigenen Leib erfahren habe, war Folgendes:
Die Grundschule (damals »Volksschule« genannt), in die unsere Eltern uns schickten, war ursprünglich eine katholische Schule gewesen. Man sah es bereits an ihrem Namen. Sie hieß »Bonifatius-Schule«. Nach der ›Machtergreifung‹ Hitlers wurde ihre Kirchlichkeit allerdings schnell beendet. Lehrer, die nicht der NSDAP, der ›Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei‹, angehörten oder nicht linientreu waren, wurden irgendwohin aufs flache Land versetzt oder bekamen Berufsverbot. An ihre Stelle traten in der Bonifatius-Schule parteitreue Nazis. Fast in jeder Stunde, ob es nun um Schreiben, Lesen, Rechnen oder Heimatkunde ging, verbreiteten sie ihre Partei-Ideologie. Dazu gehörte, dass wir immer wieder den Lebenslauf Hitlers auswendig hersagen mussten:
Unser Führer Adolf Hitler ist geboren am 20. April des Jahres 1889 in Braunau am Inn. Schon in seiner frühesten Jugend… usw.
Ich konnte den langen Text nie korrekt aufsagen, wenn ich dazu von unserem Lehrer aufgerufen wurde. Und ich wurde oft dazu aufgerufen. Zur Strafe musste ich dann vor die Klasse treten, die linke Hand vorstrecken, und der Lehrer schlug mir mit einem langen Lineal mit Wucht auf die Fingerspitzen. Schlimmer als die Schmerzen war die damit verbundene soziale Ausgrenzung. Ich wachte nachts oft schweißgebadet und unter Albträumen auf. Meinen Eltern wagte ich nichts von diesen Dingen zu erzählen. Sie wunderten sich nur über meine miserablen Zeugnisnoten.
Dieser traumatische Spuk fand aber ein gutes Ende. Seit dem Jahre 1940 wurde der Schulunterricht in den deutschen Großstädten wegen der von da an immer intensiver werdenden englischen Bombenangriffe nach und nach beendet. Die Nazis nahmen das zum Anlass, nicht nur die Schüler, sondern auch die jüngeren Kinder aus den Großstädten in nationalsozialistische Heime auf dem Land, oft weit weg im Osten Deutschlands, zu »verschicken« (›Kinderlandverschickung‹ hieß das). Freilich wollten viele Eltern das nicht und schickten ihre Kinder lieber zu Verwandten, die nicht so weit entfernt auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt wohnten. Auch unsere Eltern brachten meinen Bruder, meine ältere Schwester und mich 1942 bei Verwandten unter: meinen Bruder in Limburg an der Lahn, meine Schwester in der Rhön und mich in Heppenheim an der Bergstraße.
Das Ganze war für mich die reine Erlösung. Ich hatte plötzlich einen gerechten und freundlichen Klassenlehrer, der Lebenslauf des Führers oder ähnliches Zeug wurde bei ihm grundsätzlich nicht aufgesagt, ich konnte nachts wieder ruhig schlafen, und meine Noten waren endlich vorzeigbar. Die Verwandten, unter deren Obhut ich lebte, waren gute und fromme Christen. Ich fühlte mich wie gerettet und war einfach glücklich. Auch diese Erfahrungen haben meinen Glauben geprägt.
Meine Begegnung mit dem Nationalsozialismus hatte allerdings schon viel früher begonnen. Diese ›Begegnung‹ war ähnlicher Art. Selbst kann ich mich freilich nicht mehr an sie erinnern. Ich war damals noch zu klein. Aber es wurde mir später immer wieder davon erzählt.
Der Frankfurter Flughafen lag damals noch unmittelbar am Rande der Stadt. Es war der Flughafen »Am Rebstock«. Er lag nahe an der schon genannten Eisenbahner-Siedlung, in der wir damals wohnten. Wenn Hitler dort landete, konnte es geschehen, dass er anschließend in einem offenen Mercedes stehend und mit zum ›Deutschen Gruß‹ erhobener Hand durch unsere Siedlung zur nahen Festhalle gefahren wurde. Lange Menschen-ketten säumten dann die Straßen und brüllten ihr »Heil Hitler«.
Einmal geschah es, dass meine Eltern inmitten der Menge standen und mich hochhoben, damit ich den Führer sehen konnte. Ich hätte aber, wie man mir später erzählt hat, keineswegs auf den Führer geblickt, sondern in die Gesichter der Menge, die sich um uns drängte. Und offenbar hatte ich noch niemals in meiner Kindheit Frauen gesehen, deren Gesichter so fanatisch verzerrt waren wie bei dieser Gelegenheit. Ich hätte, sagte man mir, bitterlich zu weinen begonnen und mein Gesicht an der Schulter meiner Mutter versteckt.
Und jetzt muss ich noch ein Wort zu unserem Religionsunterricht in der Nazi-Zeit sagen. Beim Erstkommunion-Unterricht habe ich das Thema schon gestreift. Die Nationalsozialisten hatten den Religionsunterricht in den Schulen abgeschafft. Er musste deshalb im Rahmen und in den Räumen der Pfarreien selbst stattfinden. Das war freilich kein Unglück. Auf diese Weise wurde der Unterricht zu einer echten Glaubensunterweisung.
1945, unmittelbar nach dem Krieg, gab es in Frankfurt zunächst noch keinen Schulunterricht. Die Schulen lagen alle in Trümmern. Wie schon in der Nazi-Zeit erfolgte der Religionsunterricht deshalb weiter im Rahmen der jeweiligen Pfarrei. ›Pfarrstunde‹ hieß das damals bei uns. Ich habe auf diese Weise in den Kriegsjahren und dann vor allem unmittelbar nach dem Krieg einen außerordentlich gründlichen Religionsunterricht erhalten. Viele Texte des Katechismus wurden auswendig gelernt. Und ich habe sie nicht nur auswendig gelernt. Was im Katechismus stand, wurde uns sorgfältig und vernünftig erklärt. Das Entscheidende dabei war: Wir kamen alle freiwillig. Und der Hintergrund für diesen Unterricht war das gemeinsame kirchliche Leben. Wir sahen uns ja auch alle im sonntäglichen Gottesdienst.
Selbstverständlich gehörte zu meiner kirchlichen Sozialisation noch vieles andere. Ich wurde mit acht Jahren Ministrant. Mein Bruder Norbert, sechs Jahre älter als ich, der mir in allem nicht nur ein großes Vorbild, sondern auch ein wirklicher Helfer war, hatte mich die lateinischen Messgebete gelehrt. Schon allein weil ich Ministrant war, ging ich jeden Sonntag, aber oft auch an Werktagen, in die hl. Messe. Es war nichts Besonderes. Es war selbstverständlich.
Ich kann nicht behaupten, dass ich als Kind oder als Jugendlicher von der hl. Messe ergriffen gewesen wäre. Die Eucharistiefeier war für mich eher auf einer sportlichen Ebene angesiedelt: pünktlich da sein, beim Ministrieren die richtigen Antworten geben und Haltung zeigen; keine wackeligen Kniebeugen, kein Herumzappeln, keine Fehler machen.
Natürlich war der Gottesdienst ein Stück Heimat: die farbigen Kirchenfenster der Elisabethenkirche, die bei den abendlichen Andachten langsam ihre vielen Farben verloren und sich in ein geheimnisvolles dunkles Rot verwandelten – der Weihrauch – die liturgischen Gewänder – die tiefe Stille beim Segen mit der Monstranz – das leise Licht der vielen Kerzen – die Lieder mit ihrem oft altertümlichen Deutsch und ihren vertrauten Melodien. Da muss sich mir etwas Unauslöschliches ins Herz gesenkt haben.
Manchmal gelang es mir sogar, nach der Kommunion, wenn ich wieder an meinem Platz angekommen war und die Hände, wie das damals üblich war, vor das Gesicht hielt, wirklich andächtig zu beten. Doch vieles war reiner Ablauf. Die Predigt war für mich lange Zeit völlig uninteressant. Ich hörte gar nicht hin, sondern ließ die Augen spazieren gehen. Daran haben auch die sogenannten Kindergottesdienste kaum etwas geändert.
Das wurde erst anders, als ich etwa 17 oder 18 Jahre alt geworden war. Der Krieg war längst vorbei. Da meldeten sich, langsam und noch verhalten, die ersten wirklichen Glaubensfragen. Wenn ich mich recht erinnere, ging es vor allem um Fragen der Kirchengeschichte. Ich wurde am Gymnasium im Geschichtsunterricht zum ersten Mal mit den dunklen Seiten der Christenheitsgeschichte konfrontiert: Ketzerbekämpfung, Judenverfolgung, Glaubensspaltung, Religionskriege, Missachtung, ja Hass zwischen den Konfessionen – das gesamte Spektrum.
Meine Perspektive war dabei noch ganz apologetisch. Ich meldete mich in meiner vorwiegend protestantischen Klasse zu einem Referat über die Reformation, um den katholischen Standpunkt vortragen zu können. Ich wollte dazu mehr wissen und besorgte mir in einer Bibliothek Spezialliteratur – aber nur, um die katholische Kirche zu verteidigen.
Damals begann ich auch, während der sonntäglichen Predigt hinzuhören. Ich brauchte ja Material für die Rechtfertigung des eigenen Glaubens. Doch da zeigte sich bald: Die in der Pfarrei übliche Predigt bot dazu wenig Hilfe. Sie reichte nicht aus. Und genau zu diesem Zeitpunkt hatte ich erneut Glück.
Unsere Wohnung, wieder in der Kuhwaldsiedlung, lag nämlich nicht allzu weit von der Frankfurter Universität entfernt. Zu Fuß war es eine gute halbe Stunde. Und nahe der Universität gab es die Räume der Katholischen Studentengemeinde. Dort hielt jeden Sonntag der Studentenpfarrer Ottmar Dessauer, der Sohn des bekannten Naturwissenschaftlers, Unternehmers und Publizisten Friedrich Dessauer8, einen Gottesdienst für die katholischen Studentinnen und Studenten. Ich ging nun sonntags so oft wie nur möglich dorthin, obwohl ich gar kein Student war und noch zwei Jahre Gymnasium vor mir hatte.
Ottmar Dessauer war für mich ein Phänomen. Seine Predigten waren bis ins Detail ausgearbeitet. Er las sie vom Manuskript ab und schaute dabei seine Zuhörer kaum an. Doch das störte mich in keiner Weise. Denn alles, was er sagte, war vernünftig, war erhellend und beantwortete exakt die Fragen, die damals in meinem Kopf rumorten.
Man merkte Dessauer an, dass er einen Vater hatte, für den Naturwissenschaft und Glaube keinen Gegensatz bildeten und für den es selbstverständlich war, dass der christliche Glaube Öffentlichkeitscharakter hat: er muss bezeugt werden. Ottmar Dessauer lebte zudem mit anderen bekannten Seelsorgern zusammen in einer Priestergemeinschaft: in dem Frankfurter »Oratorium des hl. Philipp Neri«.
Ich bin schon bald jeden Sonntag in seinen Gottesdienst gegangen. Ich lernte von ihm, dass sich die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft und der biblische Schöpfungsbericht nicht widersprechen, weil beide auf ganz verschiedenen Ebenen reden. Ich lernte von ihm, dass die sich über endlos lange Zeiträume hinziehende Evolution des Organischen mit ihrem Versuch und Irrtum, mit unablässiger Reproduktion, Mutation und Selektion dem einen, unablässigen Schöpfungsakt Gottes entspringt.
Das alles war so einleuchtend, dass mir noch heute die christlichen Fundamentalisten leid tun, die gegen die Evolution kämpfen. Für mich ist die phantastische Evolutionsgeschichte – auch mit ihren Sackgassen und Fehlversuchen – ein Zeichen für die Größe des Schöpfers, vor allem aber Zeichen der Freiheit, die er für seine Schöpfung will.
Ich begegnete in Ottmar Dessauer auch zum ersten Mal einem Prediger, der die Evangelien wirklich ›auslegte‹, der den Text hin- und herwendete, ja ihn geradezu knetete. Die hl. Messe wurde so zu einem intellektuellen Abenteuer, auf das ich gerne zuging und auf das ich mich sogar freute. Ottmar Dessauer kam für mich genau zur richtigen Zeit. Auch das war Gnade.
Natürlich müsste ich an dieser Stelle noch vieler anderer Menschen gedenken, die mir begegnet sind, die mir geholfen haben und die mich geführt haben. Die besten und interessantesten von ihnen waren Männer und Frauen, die tief im Leben der Kirche verwurzelt waren. Von daher habe ich das unablässige Kritisieren und Schlechtreden der Kirche, das dann seit den 1960er Jahren üblich wurde, zunächst einmal überhaupt nicht verstehen können.
3. Jugendbewegung
Es gehört in der westlichen Zivilisation normalerweise zum Lebenslauf eines Jugendlichen, dass er im Laufe seiner Pubertät die ›Umzäunungen‹ der eigenen Familie durchbricht. Sie waren notwendig. Sie gaben dem heranwachsenden Kind Geborgenheit und Sicherheit. Aber irgendwann müssen sie durchbrochen werden. Freilich hat dieser Ablösungsprozess vom Elternhaus zu allen Zeiten sehr verschieden ausgesehen. Und es gab ihn nicht einmal überall. In manchen Kulturen ist er noch heute verpönt oder kaum wahrnehmbar9. In Europa geschah er, wenigstens in bestimmten Epochen, geradezu stürmisch. So jedenfalls war es in Deutschland bei der sogenannten ›Jugendbewegung‹. Sie hat in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Deshalb muss sie an dieser Stelle vorkommen.
Ich kann im Folgenden freilich nur holzschnittartig auf das Phänomen ›Jugendbewegung‹ eingehen. Sie bereitete sich schon in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts vor und ergriff dann spätestens vor und nach dem 1. Weltkrieg immer mehr Jugendliche – ob sie nun in Sportvereinen, in den Parteien oder in den Kirchen ihre Heimat hatten.
Ideale dieser immer mehr um sich greifenden Bewegung waren Einfachheit, Natürlichkeit, innere Wahrhaftigkeit, Selbstverantwortung, Selbsterziehung (»Jugend führt Jugend«), Sehnsucht nach einer eigenen unantastbaren Jugendwelt, Protest gegen verbürgerlichtes Leben und Distanzierung von der »Spießerwelt« der Erwachsenen. Damit diese programmatischen Begriffe etwas anschaulicher werden, im Folgenden ein Zitat aus dem 1. Band der Autobiografie des Philosophen Josef Pieper (1904–1997)10. Er war während seiner Schulzeit Mitglied in einem Abstinenzverein für Jugendliche gewesen, in dem irgendwann plötzlich alles anders wurde:
Von einem Tag zum anderen spielt jeder Fünfte unter uns die Laute oder die Gitarre; wir werfen unsere kleinbürgerlichen Zelluloidkragen mit den dazugehörigen Einsteck-Schlipsen weg und tragen statt dessen Schillerkragen oder Fahrtenkittel; das Haar lassen wir uns auf ärgerniserregende Weise wachsen; lange Hosen und Westen sind auf einmal verpönt; und über die eleganten Stöckchen mit Silber- oder Elfenbeinknauf, mit denen wir damals, als Sechzehnjährige, bereits einherzustolzieren begonnen haben, können wir nur noch mitleidig lächeln. Draußen vor der Stadt machen wir, buchstäblich im Schweiße des Angesichts, aus einem verwahrlosten barocken Schloß-Pavillon ein »Heim« und halten dort Sing-Abende; wir lernen (bei wem eigentlich?) die alten Volkstänze, studieren Spiele von Hans Sachs und Andreas Gryphius ein und führen sie im Freien auf. Vor allemaber hebt die Zeit des Wanderns an: wir ziehen auf »Fahrt«.
Innerhalb der katholischen Kirche spielten drei Jugendbünde eine besondere Rolle: Ab 1913 entstand in mehreren Schritten der Verein der »Quickborn-Freunde«. Sein Zentrum wurde die Burg Rothenfels am östlichen Rand des Spessarts hoch über dem Maintal. Dieser Jugendbund bildete eine wichtige Basis für das Wirken Romano Guardinis, über den die Liturgische Bewegung in der katholischen Kirche weite Kreise erreichte. – In das Jahr 1919 fällt die Gründung eines Verbands katholischer Schüler an höheren Lehranstalten mit dem Namen »Neudeutschland«. Der Verband wurde von Jesuiten geistlich geformt und später auf die Universität ausgedehnt. Einer seiner wichtigsten Programmpunkte lautete: »Neue Lebensgestaltung in Christus«. – Ebenfalls in die Zeit nach dem 1. Weltkrieg fällt die Gründung des »Heliand«, eines Bundes katholischer Mädchen an Höheren Schulen.
Die drei genannten Bünde (es gab noch andere) standen ganz auf dem Boden der Kirche – und zwar einer Kirche, die sich als jung und verheißungsvoll erlebte. Romano Guardini prägte damals das Wort: »Die Kirche erwacht in den Seelen«. Das galt zwar nicht nur für die Jugendbewegung, war aber gerade für sie besonders zutreffend. Die überwiegend lateinische Messe wurde von ›Gemeinschaftsmessen‹ mit ›Vorbetern‹ abgelöst, die bestimmte Teile der Messgebete auf Deutsch vortrugen. Es gab nun ›Jugendmessen‹, ›Jugendpredigten‹, ›Jugendwallfahrten‹, viele neue Lieder und eigene Jugendzeitschriften.
Ich nenne die Namen einiger dieser Zeitschriften. Sie stammen aus sämtlichen Lagern der Jugendbewegung und verraten das neue Lebensgefühl: »Der Neue Anfang« – »Der Aufbruch« – »Der Bund« – »Eisbrecher« – »Der Falke« – »Deutsche Freischar« – »Kameradschaft« – »Michael« – »Das Lagerfeuer« – »Der weiße Ritter« – »Der Pfad zum Reich«. – Gerade die Beliebtheit des Wortes »Reich« zeigt freilich die Ambivalenz und Vagheit der damaligen Jugendsprache. »Das Reich«: damit konnte das »Reich Christi« gemeint sein, aber auch das »Jugendreich«, mit ziemlicher Sicherheit das »Deutsche Reich« oder alle drei Bedeutungen schillernd ineinanderfließend.
Die Nationalsozialisten konnten zahlreiche Begriffe und Rituale der Jugendbewegung aufgreifen. Sie färbten sie aber ein in ihre eigene Ideologie, usurpierten sie für die ›Hitlerjugend‹ und verboten nach ihrer Machtergreifung 1933 den ›Bündischen‹, sie weiter zu gebrauchen.
Was die katholische Kirche betraf, untersagten die neuen Machthaber unter Missachtung des mit dem Vatikan abgeschlossenen Konkordats schon sehr bald jede Art von Öffentlichkeitsarbeit der katholischen Verbände. Der Kirche blieben nur Versammlungen in den eigenen Räumen. Wie reagierten die Bischöfe auf dieses Verbot?
Besonders kennzeichnend dafür ist die Geschichte des ›Bekenntnistags der Katholischen Jugend‹. Schon bald nach dem Ende des 1. Weltkriegs hatten die Bischöfe den Dreifaltigkeitssonntag, also den 1. Sonntag nach Pfingsten, zu einem Bekenntnistag der Jugend gemacht. Man feierte ihn vor allem in den Domen und großen Kirchen mit einem gewaltigen Aufgebot an Jugendlichen; man beging ihn mit Prozessionen und Fackelzügen.
Die Nazis hassten diese Feiern und suchten sie zu verhindern. Sie legten deshalb ihr ›Reichssportfest‹ genau auf diesen Sonntag. Das war eine durchaus wirksame Maßnahme, denn viele Jugendliche wollten oder mussten am Reichssportfest teilnehmen. Deshalb verschoben die Bischöfe den Bekenntnistag der Jugend auf das Christkönigsfest, das erst im Jahre 1925 von Papst Pius XI. neu eingeführt worden war. Und so wurde der letzte Sonntag im Kirchenjahr zu dem großen Protesttag der katholischen Jugend. Das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem König der Welt, wurde dabei dem Hitler-Kult bewusst entgegengesetzt. Neu geschaffene Christkönigs-Lieder spielten an diesem Sonntag eine wichtige Rolle. Zum Beispiel das folgende Lied:
Uns rufet die Stunde, uns dränget die Zeit.
Zu Wächtern, zu Rittern hat Gott uns geweiht.
Zum Trotzen und Tragen, zum Ringen und Wagen,
So stehn unsre Scharen bereit.
Es wehen die Banner, wir schreiten voran.
Es lodern die Fackeln, wir streben bergan.
Kein Rasten, kein Stehen im Sturm zu den Höhen:
Hier gilt nur der mutige Mann.
Christkönig, dein Jungvolk steht treu auf der Wacht.
Wir tragen dein Licht gegen Nebel und Nacht.
Herr, segne die Reihen, die freudig sich weihen
dir König der ewigen Macht!
Das Lied stammt aus dem Jahre 1934, die Melodie von Adolf Lohmann, der Text von dem Pfarrer Franz Morthorst. Es war in den damaligen Bekenntnisfeiern und in zahllosen ›Singe-Abenden‹ eines der beliebtesten Lieder. Es war ein Kampflied mit einem Marschrhythmus, der jeden erfasste, der es damals sang. Allerdings war es in seiner sprachlichen und musikalischen Form extrem zeitgebunden. Heute könnte man in diesem Stil nicht mehr singen. Die Ritter-Romantik und die militärisch-mystische Sprache wären unerträglich. »Kein Rasten, kein Stehen, im Sturm zu den Höhen …« – was war damit gemeint? Offener Aufstand gegen den Nationalsozialismus? Wohl kaum! Der Text bleibt veredelt vage. Damals, in den Jahren der SS, der Gestapo und der Hitlerjungend war freilich für viele katholische Jugendliche klar: Dieses Lied richtet sich gegen die Nazi-Diktatur. »Nebel und Nacht« zum Beispiel – damit war die verlogene NS-Ideologie gemeint. Und Christus, der König, war der wahre Führer, nicht Hitler.
Natürlich wundert man sich heute über das Wort »Jungvolk« in der 3. Strophe. Denn die Nazis nannten ja die 10–14jährigen HJ-Mitglieder »Jungvolk«. Aber eben diesen Begriff hatten sie, wie vieles andere, der Jugendbewegung gestohlen11.