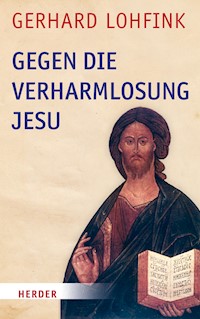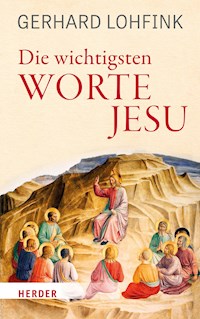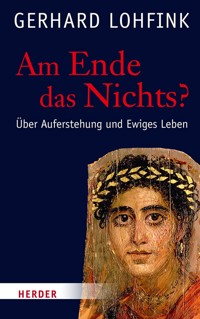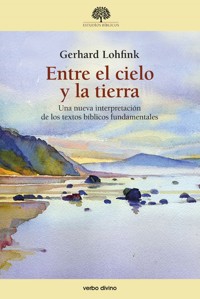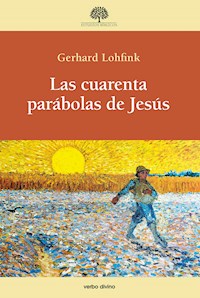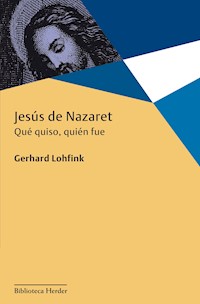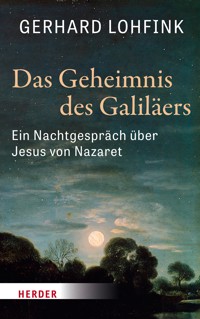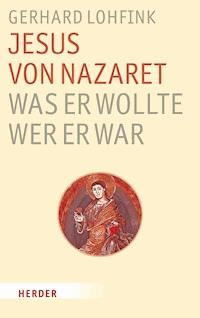
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wer war Jesus? Ein Prophet? Davon gab es viele. Ein Wunderheiler? Ein Sozialrevolutionär? Ein Weisheitslehrer? Auch davon gab und gibt es viele. Gerhard Lohfink fragt, was das Einmalige des Jesus von Nazaret ausmacht, er fragt nach dem Mehr, konkret nach dem Selbstbewusstsein Jesu, nach dem Anspruch, mit dem Jesus auftrat, nach dem, was er wirklich wollte. Das Ergebnis ist ein neues Bild des Jesus von Nazaret, überzeugend, vertiefend und in ausnehmend gut lesbarer Sprache geschrieben. Eine Bereicherung für alle, denen Christsein etwas bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Lohfink
Jesus von Nazaret - Was er wollte. Wer er war
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
ISBN (Buch): 978-3-451-34095-6
ISBN (E-Book): 978-3-451-33888-5
Inhaltsübersicht
Vorwort
1. Der sogenannte historische Jesus
2. Die Ausrufung der Gottesherrschaft
3. Gottesherrschaft und Gottesvolk
4. Die Sammlung Israels
5. Der Ruf in die Nachfolge
6. Die Vielgestalt der Berufung
7. Die Gleichnisse Jesu
8. Jesus und die Welt der Zeichen
9. Die Wunder Jesu
10. Die Warnung vor dem Gericht
11. Jesus und das Alte Testament
12. Jesus und die Tora
13. Die Unbedingtheit im Leben Jesu
14. Die Faszination der Gottesherrschaft
15. Entscheidung in Jerusalem
16. Sterben für Israel
17. Sein letzter Tag
18. Die Osterereignisse
19. Der Hoheitsanspruch Jesu
20. Die Antwort der Kirche
21. Die Gottesherrschaft – eine Utopie?
Anmerkungen
Verzeichnis der Bibelstellen
Danksagung
|5|P.Heinrich Bacht SJ
zum Gedächtnis
|9|Vorwort
Es gibt zahllose Bücher über Jesus. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Wir kommen mit ihm nie an ein Ende, und jede Zeit muss ihm neu begegnen. Manche der vielen Jesusbücher sind sehr gut. Manche sehr schlecht. Die schlechten sind schlecht, weil sie weit weg sind von der Einsicht, dass der wirkliche Jesus nicht unabhängig vom Glauben an ihn zu haben ist. Von welchem Glauben? Vom Glauben der ersten Zeugen und Überlieferer, die das, was ihnen in Jesus begegnete, „sachgerecht“ oder besser „persongerecht“ beschreiben mussten.
Historische Kritik ist in der Jesusforschung unverzichtbar. Sie informiert uns über die Welt, in der Jesus lebte. Mehr noch: Sie arbeitet die Quellenverhältnisse der Evangelien heraus, beleuchtet die verschiedenen Überlieferungsschichten und schärft gerade so den Blick für das, was die Evangelisten in ihrem „Endtext“ über Jesus sagen wollten. Historische Kritik fragt hartnäckig nach dem, was gewesen ist, und zeigt so, dass es im Christentum um reale Geschichte geht und nicht um Mythen oder Ideologien. Wenn Bibelausleger Jesus allerdings nur noch an ihrem eigenen Vorverständnis messen, indem sie von vornherein wissen, was „historisch möglich“ und was „historisch nicht möglich“ ist, überschreiten sie ihre Grenzen.
Jesus wird heute nur allzu oft zu einem bloßen Propheten gemacht, zu einem begabten Charismatiker, einem radikalen Sozialrevolutionär, einem erfolgreichen Heiler, einem menschenfreundlichen Sozialarbeiter oder gar nur zu einem gescheiten Rabbi. Der wirkliche Anspruch dessen, was sich bei ihm zeigt und ausspricht, bleibt dann ausgeklammert, und die Konsequenz ist zwangsläufig die Behauptung, die frühchristlichen Gemeinden hätten ihn „vergöttlicht“.
|10|Das vorliegende Buch weigert sich, solche Verkürzungen mitzumachen, weil sie gegen die Erkenntnis schon der ersten Zeugen und Überlieferer vorgenommen werden. Es arbeitet durchaus historisch und kritisch – historische Forschung muss immer kritisch sein–, hält es dabei aber mit dem Satz von Karl Barth in seinem „Römerbrief“ (2.Auflage): „Kritischer müssten mir die Historisch-Kritischen sein!“
Ich möchte damit ernst machen, dass Jesus Jude war und ganz aus den Glaubenserfahrungen Israels gelebt hat – diese Glaubenserfahrungen aber zugleich zu ihrem Ziel und zu ihrer Vollendung geführt hat. Wer Jesus und das, was er war, wirklich erfassen will, kommt nicht daran vorbei, sich in diesen Glauben mithineinziehen zu lassen.
Ich wünsche mir nichts mehr, als dass dieses Buch vielen heutigen Menschen hilft, kritisch-unterscheidend und zugleich vertrauensvoll-offen dem wirklichen Jesus näherzukommen.
Bad Tölz, im September 2011
Gerhard Lohfink
|11|Sinne täglich nach über Tod und Leben,
ob Du es finden möchtest,
und habe einen freudigen Mut.
Und gehe nicht aus der Welt,
ohne Deine Liebe und Ehrfurcht
für den Stifter des Christentums
durch irgendetwas öffentlich
bezeuget zu haben.
(Matthias Claudius, Aus dem Brief
„An meinen Sohn Johannes“, 1799)
|13|1.Kapitel
Der sogenannte historische Jesus
Warum erscheinen fast jährlich neue Bücher über den historischen Jesus? Weshalb genügen den Christen nicht einfach die Evangelien? Es muss mit der Begierde des westlichen Menschen zusammenhängen, die „Fakten“ zu kennen. Er will wissen, wie es wirklich gewesen ist. Er möchte die Vergangenheit bis ins Letzte ausleuchten. Er steht Schlange, um in eine Ausstellung hineinzukommen, die ihm die Welt der Pharaonen, der Kelten oder des höfischen Mittelalters vor Augen führt. Ist er endlich in die Ausstellungsräume gelangt, glaubt er sich an den Ursprüngen: Er sieht die Zeit und die Menschen, um die es der Ausstellung geht, unmittelbar dokumentiert.
Ähnlich sucht er dann auch in den Evangelien Zugang zu Jesus. Doch die Evangelien verschließen sich seiner Wissbegierde. Sie schweigen über viele Details des Lebens Jesu, die den faktenhungrigen Jesusneugierigen gerade interessieren würden. Und so greift er zum neuesten Jesusbuch…
Es kommt aber noch etwas anderes hinzu: Seit der europäischen Aufklärung werden die Evangelien seziert wie kein anderer Text der Weltliteratur. Was sie erzählen, gilt den Aufgeklärten als dogmatisch überhöht. Die wahre Gestalt Jesu sei mit immer prachtvolleren Farben übermalt, und seine Konturen seien ins Göttliche gesteigert worden. Deshalb gelte es, die vielen Übermalungen abzutragen und endlich den wahren Jesus freizulegen, der dann in seinen wirklichen Farben und Umrissen hervortreten werde.
Also auch hier – und hier ganz besonders – die Gier nach den Fakten. Was können wir von Jesus wirklich wissen? Wer war der „historische“ Jesus? Wie weit lässt sich sein Leben rekonstruieren? |14|Welche seiner Aussprüche in den Evangelien sind authentisch? Was sind seine „ureigenen Worte“, was seine „ureigenen Taten“? Verkündeten Jesus und die Apostel das Gleiche oder wurde nach Ostern aus der Gottesbotschaft Jesu eine Jesusbotschaft der Apostel?
An sich wäre es ja völlig in Ordnung, dass sich die Begierde nach den Fakten, die den westlichen Menschen seit den Vorsokratikern und den ersten griechischen Historikern ergriffen hat, auch auf Jesus erstreckt. Man muss sogar sagen: Im Falle Jesu wäre diese Begierde erst recht statthaft. Wenn es wahr ist, dass in Jesus das ewige Wort Gottes Fleisch wurde, also radikal in die Geschichte eintrat, dann muss Jesus allen Techniken der Geschichtsforschung offenstehen. Dann sollte er geradezu Objekt der Geschichtswissenschaft sein. Dann muss es erlaubt sein, alle Texte über ihn zu analysieren, zu durchleuchten, ihre Gattung zu bestimmen und mit ihnen Traditionsgeschichte zu betreiben.
Allerdings: Mit dem berechtigten Hunger nach geschichtlicher Rekonstruktion hat sich seit langem eine radikale Evangelienkritik verbunden, die den wahren Jesus nicht mit den Evangelien, sondern gegen sie zu finden sucht. Gerade in diesem Zusammenhang ist dann immer wieder von den Übermalungen und Überhöhungen der Person Jesu durch die urchristliche Tradition die Rede. Damit werden jedoch zwei Dinge verwechselt: Was die Evangelienkritiker als dogmatische Überhöhungen bezeichnen, sind nichts anderes als „Deutungen“ Jesu. Und Deutung ist nicht dasselbe wie Überhöhung. Gegen Wörter wie Überhöhung, Übermalung, Überzeichnung, Mythologisierung, Vergöttlichung wehren sich viele Christen zu Recht. Gegen das Wort „Deutung“ sollten sie sich nicht wehren.
Denn man darf die Evangelien nicht als bloße Sammlung von „Fakten“ über Jesus ansehen. Sie sind keine Zusammenstellung von Dokumenten aus einem Jesus-Archiv der Jerusalemer Urgemeinde. Selbstverständlich standen den Verfassern der Evangelien vielfältige Überlieferungen über Jesus zur Verfügung. |15|Aber mithilfe dieser Überlieferungen deuten sie Jesus. Sie deuten seine Worte, sie deuten seine Taten, sie deuten sein ganzes Leben. Sie deuten Jesus in jeder Zeile, in jedem Satz.
Darf man Texte, die vom Anfang bis zum Ende Deutung sind, durch das Sieb der Kritik rütteln in der Hoffnung, dass dann die „Fakten“ zurückbleiben? Darf man – wie die Goldwäscher mit ihren Waschrinnen – den wertlosen Sand der Deutungen wegschwemmen, um das schwere Gold der Fakten zurückzubehalten? Darf man von Erzählungen, die ganz auf Deutung angelegt sind, Schichten abtragen, um zum „Ursprünglichen“ zu gelangen? Käme man am Ende, nach Abtragung aller sekundären Schichten, dann bei den reinen Fakten an? Wie fragwürdig eine solche Auslegungstechnik in Wirklichkeit ist, entlarvt eine schlichte Frage: Wo liegt überhaupt die Wahrheit: In den Fakten oder in ihrer Deutung? Oder noch einmal im Bild der Goldwäscher: Sind die Fakten das Gold oder ist es die richtige Deutung der Fakten?1
Faktum und Deutung
Was ist überhaupt ein „Faktum“? Das Wort wird meist überaus vertrauensvoll verwendet. Es wird nicht durchdacht. Es wird benutzt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Aber so simpel ist es mit den sogenannten Fakten nun einmal nicht.
Natürlich ist die Welt voller Fakten, und oft kann man auch wie selbstverständlich von ihnen reden. Wenn zum Beispiel irgendwo ein Erdbeben stattfand, lässt sich durchaus von einem Faktum sprechen. Aber selbst in einem solchen Faktum steckt schon Deutung. Zwar wird das Erdbeben durch Seismographen festgestellt, seine Stärke anhand der Richter-Skala gemessen, und die Erdbebenwarten vergleichen ihre Messwerte. Doch dann untersuchen Geophysiker, um welche Art von Beben es sich handelte. Sie unterscheiden zwischen „Einsturzbeben“ (beim Zusammenbruch unterirdischer Hohlräume), „Ausbruchsbeben“ (im Zusammenhang mit Vulkanausbrüchen) und |16|schließlich „tektonischen Beben“ (bei Verschiebungen innerhalb der Erdkruste). Das „Faktum“ eines Erdbebens ist also eine ziemlich klare Sache. Es kann eindeutig beschrieben werden. Und doch enthält auch diese Beschreibung schon ein gerütteltes Maß an Deutung. Wir dürfen davon ausgehen: korrekter Deutung.
Aber nicht alle Fakten sitzen auf dieser Ebene. Was ist, wenn sich in der Politik so etwas wie ein „Erdbeben“ ereignet? Wenn zum Beispiel ein gesellschaftlicher Erdrutsch stattfindet oder ein politischer Skandal an die Öffentlichkeit kommt? Wenn ein Politiker gestürzt wird – und keiner will es gewesen sein? Was ist hier Faktum? Was geschah wirklich, und was waren nur Scheinmanöver, inszeniert für die Öffentlichkeit? Was war bloße Meinungsmache, was gezielte Desinformation?
Politische Ereignisse erfordern Deutung, noch erheblich mehr Deutung als rein physische Abläufe. Was wirklich geschah, muss mühsam recherchiert, analysiert und interpretiert werden. Das Herausarbeiten der Abläufe ist dabei aber schon ständig mit Deutung verknüpft. Über all diese Schwierigkeiten hinaus stellt sich schließlich auch noch die Frage: Wer hat die Deutungshoheit? Und welche Deutung wird sich am Ende durchsetzen?
Deshalb die Frage: Gibt es auf einer Ebene, auf der die eigentlichen Akteure Menschen mit ihren Wünschen, Interessen und Leidenschaften sind, überhaupt reine Fakten? Ist hier nicht jedes aufscheinende Faktum schon von Anfang an eingetaucht in Deutung, ja von Deutung geradezu durchsetzt?
Jesus ist offensichtlich vom ersten Augenblick seines Auftretens an völlig verschieden gedeutet worden. Da war die zunächst tastende, aber eben doch gläubige Deutung derer, die ihm nachfolgten. Sie lief am Ende auf das Bekenntnis hinaus: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Mt 16,16). Dann war da die in vielem hilflose Deutung der Menschen, die ihm nicht nachfolgten, aber nachliefen, und von denen offenbar viele annahmen, er sei der wiedergekommene Täufer oder einer der früheren Propheten (Mt 16,14). Und da war |17|schließlich die gereizte Reaktion seiner Gegner, die sich sicher waren, dass er mithilfe des Anführers der Dämonen die Dämonen austriebe (Mk 3,22). Deutungen also von Anfang an. Welche war die richtige? Es ist zu Beginn dieses Buches unumgänglich, über das Verhältnis „Faktum– Deutung“ genauer nachzudenken.
Die sogenannte Nachricht
Beginnen wir mit einer anscheinend äußerst simplen Frage: Wie steht es eigentlich mit den Fakten, die uns in den Medien vermittelt werden? Wenn man als junger Mensch ernsthaft beginnt, Zeitung zu lesen, oder anfängt, sich durch Nachrichtensendungen informieren zu lassen, lebt man unter Umständen noch in dem Glauben, das gesamte Weltgeschehen ließe sich in den täglichen Nachrichten einfangen. Vielleicht lebt man sogar noch in der naiven Unschuld von Graf Bobby, von dem erzählt wird, dass er eines Tages voll Staunen gesagt habe: „Was für ein Glück: In der Welt passiert jeden Tag immer gerade so viel, dass es eine ganze Zeitung füllt.“
Aber eines Tages erwacht man aus dem Kinderglauben, das Weltgeschehen ließe sich in den täglichen Nachrichten adäquat fassen. Irgendwann wird jedem kritischen Zeitungsleser, Radiohörer, Fernsehzuschauer oder Internetbenutzer klar, dass die Medien nur einen winzigen Ausschnitt von dem wiedergeben können, was in der Welt wirklich geschieht.
Die „Nachrichten“ etwa, die den deutschen Zeitungsleser oder den täglichen Gläubigen der Tagesschau erreichen, sind – schon rein geographisch gesehen – äußerst begrenzt. Länder wie Burma oder Burundi, Togo oder Tansania kommen in unseren Medien nur gelegentlich vor. Dass wir hauptsächlich Nachrichten aus Deutschland vorgesetzt bekommen, ist bereits eine tiefgreifende Auswahl.
Und was hören wir aus Deutschland? Fast bis zum Überdruss Nachrichten, die den Parteienstreit, das Sozialsystem |18|oder die Wirtschaft betreffen. Vieles davon in Form von Verlautbarungen, die in Ministerien, Parteizentralen oder den Büros von Interessenverbänden verfasst wurden. Dann kommt der Sektor „Kultur“, wo fast jeder Beitrag in extremer Weise die subjektive Meinung des Berichterstatters spiegelt. Dann der Sektor „Sport“, der in Deutschland unter Sport vor allem Fußball versteht. Dann die üblichen Sensationsmeldungen, die zu den Medien wie das Salz in der Suppe gehören: Meldungen von Terrorakten; von Mord, Raub, Vergewaltigung, Veruntreuung; von Explosionen, Grubenunglücken, Bränden, Unwettern, Flugzeugabstürzen. Schließlich jene immer auch etwas abartigen Meldungen nach dem Muster „Mann beißt Hund“.
Sämtliche Nachrichten dieser Art sind ein unvorstellbar kleiner, oft subjektiv wahrgenommener Ausschnitt der Wirklichkeit. Denn das, was das wirkliche Weltgeschehen ausmacht, sind ja nicht in erster Linie skurrile Ereignisse, Weltmeisterschaften, Unglücksfälle und politische Auseinandersetzungen, sind auch nicht nur Bewegungen im Sozialgefüge und in der Wirtschaft.
Wo in der Welt geschehen die wirklichen Veränderungen? Das, was Völker bis in die Tiefe hinein bewegt. Was sie erstarren lässt oder was sie vorantreibt. Was irgendwann Revolutionen auslösen oder sie verhindern wird. Was Hoffnung zerstört oder neue Hoffnung schenkt. Taucht dieses Eigentliche in den Nachrichten auf? Kann es überhaupt adäquat auftauchen?
Ein britischer Computerwissenschaftler hat eine von ihm programmierte Suchmaschine, die den schönen Namen „True Knowledge“ (Wahres Wissen) trägt, mit angeblich 300Millionen sogenannter Fakten gefüttert. Er wollte herausbekommen, welcher Tag der langweiligste Tag des 20.Jahrhunderts gewesen sei. Die Maschine fand heraus: Es sei der 11.April des Jahres 1954 gewesen. An diesem Tag sei einfach nichts Wichtiges passiert: Keine Berühmtheit sei geboren worden, keine Berühmtheit sei gestorben, nichts sei explodiert, kein Krieg sei ausgebrochen, kein Haus zusammengekracht2.
Man erkennt an dieser absurden Computerspielerei sehr gut |19|die Denkweise der Medien: Ein Ereignis ist nur, was schreit, stinkt oder kracht. Übrigens war der 11.April 1954 ein Palmsonntag. Falls sich damals auch nur einige Tausend Gläubige den Beginn der Karwoche und den Einzug Jesu in seine Stadt so zu Herzen nahmen, dass sich in ihrem Leben etwas änderte, so ist an diesem Tag sehr viel und sehr Wichtiges geschehen.
Das sogenannte Faktum
So stellt sich nun endgültig die bereits angedeutete Frage: Was ist überhaupt ein historisches Faktum? Wir sind allzu schnell bereit, von Fakten, von Realitäten, von der realen Wirklichkeit, von tatsächlichem Geschehen, von unleugbaren Tatsachen zu sprechen. Seit einiger Zeit pflegen Politiker zu sagen: „Fakt ist, dass…“
Aber was ist eine „Tatsache“? Auf welche Weise wird etwas zum „Faktum“? Wer behauptet: Das und das ist ein Faktum, hat es bereits aus dem unendlichen Strom der Geschehnisse selektiert, hat es aus dem Chaos verworrener und ineinander verfilzter Abläufe isoliert, hat es scharf abgegrenzt und ihm so bereits eine begriffliche Bestimmung und Deutung gegeben. Mit anderen Worten: Selbst das sogenannte „reine Faktum“, selbst die „nackte Tatsache“ ist immer schon entstanden aus deutendem Zugriff auf die Wirklichkeit.
Jedes „Faktum“ muss sprachlich erfasst und vermittelt werden (wobei Gemälde oder Filme durchaus noch Randphänomene von Sprache sind). In dem Maß aber, in dem das „Faktum“ Sprache wird, tritt es schon ein in einen ganz bestimmten Verständnishorizont, tritt es ein in das weite Feld der Vorverständnisse. Die Deutung setzt sogar noch eine Stufe früher ein. Sie beginnt bereits bei der Rezeption der äußeren Sinneseindrücke durch unser Gehirn. Schon da wird in einem kaum vorstellbaren Ausmaß ausgewählt, geschieden, sortiert, geordnet, katalogisiert – und zwar mithilfe von Erfahrungsmustern, die unser Gehirn seit unserem Embryonalzustand ständig gespeichert hat.
|20|Ein Tag in Kafarnaum
Aber damit ich mich jetzt nicht in Erkenntnistheorie verliere, soll das Gesagte anhand der Evangelien verdeutlicht werden – genauer gesprochen: anhand von Markus 1,21–39.In diesem Textabschnitt, ziemlich zu Beginn des Markusevangeliums, wird Folgendes erzählt:
Sie kamen nach Kafarnaum. Und gleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Sie waren bestürzt über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der souveräne Macht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.
Und gleich war da in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Der begann zu schreien: „Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? Du bist gekommen, uns zugrunde zu richten. Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.“ Da herrschte ihn Jesus an: „Schweig und fahr aus ihm heraus!“ Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschauderten alle und einer fragte den andern: „Was ist das? Eine neue Lehre aus souveräner Macht! Sogar den unreinen Geistern gebietet er, sodass sie ihm gehorchen.“ Und die Kunde von ihm verbreitete sich sogleich überall im ganzen Gebiet von Galiläa.
Und gleich, nachdem sie aus der Synagoge hinausgegangen waren, kamen sie in das Haus des Simon und des Andreas – mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter des Simon aber lag mit Fieber darnieder. Und gleich redeten sie ihretwegen mit ihm. Er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie bediente sie.
Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten.
|21|In der Frühe aber, noch tief in der Nacht, stand er auf, ging hinaus und ging weg an einen abgelegenen Ort. Dort betete er. Simon und seine Begleiter spürten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: „Alle suchen dich.“ Da sagte er zu ihnen: „Gehen wir anderswohin, in die benachbarten Dörfer, dass ich auch dort verkündige; denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündigte in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. (Mk 1,21–39)
Man sieht sofort: Es handelt sich um eine sorgfältig durchgeführte Komposition: Alles, was erzählt wird, spielt in Kafarnaum. Erst im letzten Satz greift das Geschehen über Kafarnaum hinaus.
Gewahrt wird aber nicht nur die Einheit des Ortes, sondern auch die der Zeit: Die Handlung beginnt an einem Sabbatmorgen mit dem Synagogengottesdienst. Jesus heilt – noch in der Synagoge – einen Besessenen und geht dann anschließend mit mehreren Jüngern zum Haus des Petrus. Dort heilt er dessen Schwiegermutter. Am Abend des Sabbats, sobald es gestattet ist, Kranke herbeizutragen, versammelt sich eine große Menschenmenge vor der Haustür. Jesus heilt viele und bleibt dann im Haus des Petrus zum Übernachten. Am frühen Morgen verlässt er das Haus und betet an einem abgelegenen Ort. Die Komposition reicht also vom Morgen des Sabbats bis zum Morgen des folgenden Tages. Die einzelnen Geschehnisse sind sorgfältig miteinander verknüpft, vor allem durch das für Markus typische „sogleich“.
Eine innere Einheit bildet auch das, was innerhalb dieses einen Tages geschieht: Machttaten Jesu füllen den Tag aus. Zuerst befreit er von Besessenheit, dann von einer fiebrigen Krankheit. Zuerst wird ein Mann, dann eine Frau geheilt. Am Abend wird das Ganze erweitert. Nun werden viele geheilt: teils von ihrer Besessenheit, teils von anderen Krankheiten.
Ein weiteres Motiv, das die gesamte Komposition beherrscht, ist die vollmächtige „Lehre“ Jesu. Die Gottesdienstteilnehmer staunen über seine Art, die Schrift auszulegen. Diese Souveränität |22|Jesu wird dann unmittelbar verknüpft mit seiner Macht über den Dämon. Die Leute von Kafarnaum sagen ja nach der Heilung des Besessenen:
Was ist das? Eine neue Lehre aus souveräner Macht! Sogar den unreinen Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm.
Am Ende, in den Schlussversen der Komposition, taucht dann die Kombination von machtvoller Lehre und Herrschaft über die Dämonen erneut auf, nun unter dem Stichwort „verkündigen“.
Man sollte aber nicht nur die Strukturlinien der Komposition betrachten. Man muss auch die Stimmung wahrnehmen, die über dem Ganzen liegt: Markus schildert einen erfüllten Tag, der in sich ruht und voll Heil ist. Es ist bewusst ein Tag am Anfang des Wirkens Jesu. Er steht beispielhaft für viele weitere Tage. Dass es gerade ein Sabbat ist, kann kein Zufall sein. Denn damit ist es jener Tag, an dem die Schöpfung nach biblischer Vorstellung zu ihrer Vollendung kommt.
Natürlich darf man nicht ausschließen, dass es innerhalb der öffentlichen Wirksamkeit Jesu diesen einen Tag mit all den geschilderten Geschehnissen tatsächlich gegeben hat. Möglich wäre das durchaus. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Markus hier verschiedene Traditionsstücke kunstvoll über einen Tag hin verteilt hat. Er hat disparaten Erinnerungsstoff so angeordnet, dass ein voller Tagesablauf entstand – samt der dazugehörenden Nacht. Er wollte so den Anfang des Auftretens Jesu schildern. Er schildert einen Tag, an dem die Menschen und die Verhältnisse heil werden, an dem sie zur Ruhe kommen und ihr Gleichgewicht wiederfinden. Damit hat er Traditionsstücke, die ihm bereits vorlagen und die selbst schon deutend erzählt hatten, in einen noch umfassenderen Deutungszusammenhang gestellt.
|23|Die Rolle der Liturgie
Aber der Deutungsprozess geht noch weiter. Die Evangelien sind ja keine ortlosen, frei in der Luft schwebenden Texte. Sie sind Texte der Kirche, und ihr eigentlicher „Sitz im Leben“ ist die Liturgie. Dort werden sie als Wort Gottes gefeiert. Dort werden sie als Evangelium proklamiert und authentisch ausgelegt. In der Katholischen Kirche ist an dem Sonntag, an dem der Großteil von Markus 1,21–34 vorgetragen wird, dem Evangelium als alttestamentliche Lesung Ijob 7,1–4. 6–7 zugeordnet3.
Ijob redet dort von dem Elend des menschlichen Lebens. Er sagt: Das Leben ist wie ein harter Frondienst, voll Enttäuschung und Mühsal. Der Mensch verbringt es wie ein Taglöhner, der den ganzen Tag in der Hitze arbeiten muss und sich nach dem Schatten des Abends sehnt. Aber auch der Abend bringt kein Ausruhen. Ijob verbringt seine Nächte als Kranker, der sich auf seinem Lager wälzt und sich den Morgen herbeisehnt, weil die Nacht endlos ist. Seine Nächte und Tage sind leer und ohne Hoffnung. Weil das Leben leer ist, hat es kein Gewicht. Bald ist es dahingeschwunden, und der Faden der Existenz wird abgeschnitten.
Das ist der Inhalt und das ist vor allem der Ton der Lesung, die dem Evangelium vom „Tag in Kafarnaum“ zugeordnet ist. Hat Ijob recht? Natürlich hat er recht. Das quälende Leid, das er schildert, durchzieht die Welt und durchzog sie schon immer. So entsteht in der Liturgie an dem betreffenden Sonntag zwischen der alttestamentlichen Lesung und dem Evangelium ein starker Kontrast. Und offenbar hat es die Liturgie genau auf diesen Kontrast abgesehen.
Ijob sprach davon, wie dunkel, wie leer und ohne jede Hoffnung die Tage des Menschen sind. Markus schildert im Evangelium einen erfüllten Tag, der in sich ruht und voll Heil ist. Damit entsteht aber ein noch tiefgreifenderer Deute-Zusammenhang. Nicht nur von der Macht der Predigt Jesu ist nun die Rede. Nicht nur von seiner Macht über die Dämonen und Krankheiten. Sondern darüber hinaus von seiner Macht über das Chaos der Welt.
|24|Zwar fehlt schon in der Komposition des Markus – wenn man sie für sich betrachtet – das Chaos keineswegs. Es ist den ganzen Tag hindurch gegenwärtig. Es bricht hervor in dem Mann, der mitten im Synagogengottesdienst zu schreien anfängt, weil er von seinen Dämonen geschüttelt wird. Es zeigt sich in der Krankheit der Schwiegermutter des Petrus. Es zeigt sich in den vielen Kranken und den von den Dämonen der Gesellschaft Geplagten, die man am Abend zu Jesus bringt.
Das Chaos der Welt, das Chaos der Gesellschaft, diese ganze Unordnung und Verwirrung, ist also auch in der Komposition des Markus schon da. Aber durch die Komposition der Liturgie – das heißt aber: durch die offizielle Deutung der Kirche – tritt dieses Motiv jetzt mit voller Wucht hervor.
Nun erst begreifen wir den Markustext in seiner ganzen Abgründigkeit. Nun begreifen wir aber auch das Ausmaß des Heils, das sich da ereignet. Die Welt ist tatsächlich sich selbst entfremdet und ohne Hoffnung. Mit Jesus aber geraten die Verhältnisse ins Lot, die Menschen kommen zur Ruhe, das Chaos wird verwandelt, die Dämonen der Gesellschaft, denen der Einzelne hilflos ausgeliefert ist, werden gebannt. Der Abend und der Morgen sind nicht mehr voller Enttäuschung, sondern angefüllt mit messianischem Heil.
Dieses Heil, das die Leere ausfüllt und das Chaos beseitigt, entsteht gerade daraus, dass Jesus mit seinem Evangelium in der Welt eine alles umwälzende Geschichte ausgelöst hat, in deren Dienst sich der Mensch begeben darf. Es ist nicht mehr der Frondienst, von dem in der Klage Ijobs die Rede war, sondern ein Dienst in Freiheit. Die Schwiegermutter des Petrus wird geheilt, weil sie berührt wird von Jesus, dem Erfüller aller Geschichte, und sie steht sofort auf und dient dem Neuen. Es ist eine großartige Komposition, die Markus da geschaffen hat. In ihr spiegelt sich das gesamte Auftreten Jesu. Im Lichte der Liturgie jedoch tritt diese Komposition mit noch größerer Tiefenschärfe hervor.
Es ist wohl klar geworden, worauf es mir hier ankam: Bereits die Markus vorliegenden Traditionsstücke haben die Ereignisse |25|des Lebens Jesu gedeutet. Erst recht hat dann Markus selbst mit seiner Komposition des „Tages von Kafarnaum“ Jesus und sein Auftreten gedeutet. Die kirchliche Liturgie vertieft dann diesen Deute-Prozess immer noch weiter: Sie stellt Jesus vor den Hintergrund des Alten Testaments. Erst damit kann man ihn ganz verstehen.
Wie verhält es sich also mit der Korrelation „Faktum– Deutung“? Wo sind in der Komposition Markus 1,21–39 die reinen Fakten, vorgängig zur Deutungsebene? Und würden uns die reinen Fakten, selbst wenn wir sie von den Deutungen ablösen könnten, auch nur im Geringsten weiterhelfen? Vor allem aber: Worin liegt überhaupt die Wahrheit der Komposition des Markus? Ist sie jenseits der Deutungsebene zu haben? Vielleicht kann uns da das folgende Szenario noch ein Stück weiterhelfen.
Ein Gedankenexperiment
Erlauben wir einmal unserer Phantasie die Vorstellung, die Evangelien wären nie geschrieben worden. Statt dessen hätte man den ersten Tag des Auftretens Jesu mit einer versteckten Kamera gefilmt und alles, was im Zusammenhang seines Auftretens gesprochen wurde, über verborgene Mikrophone mitgeschnitten. Bild und Ton wären dann zu einem Film zusammengestellt worden, und dieser Film würde uns heute ungeschnitten und ohne Kommentar vorgeführt – mit dem Anspruch, reine Tatsachen zu bieten und absolut authentisch zu sein. Was wüssten wir dann?
Einiges schon. Wir erführen auf diese Weise sogar eine Unmenge von Details, die bei Markus überhaupt nicht oder nur fragmentarisch zu finden sind. Wir wüssten dann, wie das Haus des Petrus von außen und von innen aussah. Wir wüssten, auf welche Weise in Kafarnaum der Sabbat-Gottesdienst gefeiert wurde. Wir würden sehen, wie sich Kranke wiederaufrichten und wie schreiende Besessene plötzlich still werden. Wir hätten endlich Originalbelege für das Aramäisch, das im 1.Jahrhundert |26|in Galiläa gesprochen wurde. Vor allem: Wir besäßen dann Jesusworte, die mit absoluter Sicherheit authentisch wären. Allerdings: Würden wir sie auch verstehen? Denn wir hätten ja keine Evangelisten – das war die Voraussetzung unseres Szenarios – die sie uns deuteten. Uns fehlte der gesamte Interpretationszusammenhang, den uns das Neue Testament und die Gemeinden der frühen Kirche zur Verfügung stellen.
Und was nun die Gestalt Jesu selbst betrifft: Was würden wir da eigentlich sehen? Wir würden einen Orientalen sehen, genauer: einen orientalischen Juden, über den wir erführen, dass er Jeschua hieß. Er würde – wahrscheinlich zu unserem tiefen Erschrecken – ganz anders aussehen, als wir ihn uns vorgestellt hatten. Er wäre weder der hoheitliche Christus der byzantinischen Apsiden noch der gefasste Schmerzensmann der Gotik noch der apollinische Held der Renaissance. Seine aramäische Sprache würden nur wenige Fachleute verstehen. Vieles von seinen Gesten und Gebärden wäre uns fremd. Wir würden ahnen: Er lebte in einer anderen Zivilisation und einer anderen Kultur.
Dennoch: Alles, was wir da sehen würden, wäre wichtig, erregend, ja erschütternd. Wir wüssten endlich viele Details, an denen sich die Bibelwissenschaftler seit langem abgearbeitet haben. Aber wüssten wir mit all dem, was damals tatsächlich geschah? Wüssten wir mehr als das, was uns auch die Evangelien bereits sagen? Wüssten wir nun tatsächlich mit Sicherheit, dass Jesus „mit dem Finger Gottes“ die Dämonen austrieb und dass seine Heilungen Zeichen der sich realisierenden Gottesherrschaft waren (Lk 11,20)? Wüssten wir, weil wir nun die äußeren Abläufe sehen könnten, dass hier, in diesem Menschen, der Logos Gottes ganz und für immer Gegenwart geworden war? Ich sage mit Nachdruck: Von dem, worauf es bei Jesus wirklich ankommt, von seiner Sendung, von seinem Auftrag, von dem Geheimnis seiner Person wüssten wir nichts.
Um hierüber wirklich etwas zu erfahren, müsste das gesamte öffentliche Auftreten Jesu vor unseren Augen stehen, müssten wir alles überblicken, was er getan hat, nicht nur an seinem ersten Tag. Vor allem müssten wir den Anspruch kennen, der hinter seiner |27|Predigt und seinen Heilungen stand. Wir sollten auch informiert sein über die Reaktionen seiner Hörer, vor allem über die Reaktionen derer, die er sich zu Todfeinden machte. Schon hier würde also die filmische Dokumentation lediglich der ersten Tage des Auftretens Jesu zu kurz greifen. Wir brauchten eine Dokumentation der gesamten Zeit seines öffentlichen Wirkens.
Gut, auch das machen wir in unserem Szenario. Wir dokumentieren im Film alles, was vom Weggang Jesu aus seinem Elternhaus bis zu seiner Grablegung geschah – nicht nur bei Jesus selbst, sondern auch bei seinen Freunden und Feinden. Es müssten also zahlreiche Filme auf mehreren Leinwänden oder Bildschirmen nebeneinander laufen – und das ungefähr 1 1/2Jahre lang. Eine unheimliche Arbeitslast für die Betrachter! Wir würden nicht durchhalten.
Aber nehmen wir einmal an, wir würden durchhalten. Dann bliebe immer noch die Frage: Wäre uns mit dieser Mega-Dokumentation wirklich geholfen? Könnten wir zum Beispiel den Anspruch Jesu auch nur von ferne erfassen, ohne das Alte Testament zu kennen? Ist Jesus zu begreifen ohne die Tora und die Propheten, ohne die Erfahrungen und Hoffnungen Israels? Sind die Hoffnungen Israels zu verstehen ohne die Glaubensgeschichte dieses Volkes? Und ist Jesus zu verstehen, wenn man sein Leben nicht unter der Rücksicht betrachtet, dass hier die Geschichte zwischen Gott und Israel in ihre letzte, entscheidende Phase getreten ist? Wie aber sollte diese Dimension des Geschehens durch reine Anhäufung, durch bloßes Summieren äußerer Abläufe erkennbar werden? Hier muss jedes Medium versagen, das nur äußere Fakten aneinanderreiht.
Dokumentarfilme
Bleiben wir noch einen Augenblick beim Film, weil man von ihm viel lernen kann: Jeder Dokumentarfilmer, der sein Handwerk versteht, würde aus der enormen Menge von Filmmaterial, das wir in unserem Szenario produziert hatten, eine radikale |28|und einschneidende Auswahl treffen, diese Auswahl in eine sorgsam konstruierte Komposition bringen – und eben so bereits Deutung herstellen.
Vielleicht würde er den chronologischen Ablauf durch Rückblenden unterbrechen. Vielleicht würde er sogar Szenen aus dem Alten Testament oder visuelle Anspielungen an das Alte Testament zur Verdeutlichung des Geschehens einbauen. Jedenfalls würde er mit Sicherheit immer wieder Filmteile bringen, die mithilfe von „Zitaten“ Verbindungen herstellen. Darüber hinaus würde er Hintergründiges andeuten und Einzelvorgängen symbolische Dimensionen verleihen.
Mit anderen Worten: Jeder gute Filmemacher würde aus dem ihm vorliegenden ausufernden Filmmaterial nur Weniges auswählen, dieses Wenige in einen geformten Zusammenhang bringen und vielerlei semantische Beziehungen zwischen den einzelnen Filmabschnitten herstellen. Genau dasselbe würde er mit dem ihm vorliegenden Tonmaterial machen. Und eben auf diese Weise würde er das gesamte Geschehen deuten, ohne vielleicht auch nur einen einzigen Kommentar aus dem Off oder auch nur einen einzigen deutenden Zwischentitel beizugeben. Jedenfalls: Wenn zu einem äußeren Geschehen nicht die Deutung dieses Geschehens hinzuträte, bliebe es nichtssagend.
Und nun die entscheidende Frage: Haben die Verfasser der Evangelien eigentlich etwas anderes getan? Haben nicht auch sie geschnitten, neu zusammengestellt, zitiert, angespielt, kommentiert, gedeutet? Natürlich haben sie das! Und zwar mit allen Mitteln eines sauberen Erzählhandwerks. Denn sie wussten: Ohne Deutung gibt es kein Verstehen. Selbst die genaueste und strengste Geschichtsdarstellung kommt nicht ohne ständige Deutung aus.
Am 25.Februar 2004 lief in der ARD ein hochgelobter Film über Stauffenberg und sein Attentat auf Hitler. Frank Schirrmacher schrieb zu diesem Film in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung4:
|29|Dies ist der genaueste Film über das Attentat des Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der bislang gedreht wurde. Und er ist der unvollständigste. Wer ihn sich heute abend im Fernsehen anschaut, kann sich auf die Korrektheit von Kulisse, Uniform und Chronologie verlassen. Der Regisseur Jo Baier hat nicht nur den bereits von der Gestapo im Minutentakt recherchierten 20.Juli exakt wiedergegeben. Er hat Hitlers Lagebaracke und überhaupt das im ostpreußischen Sumpfgebiet liegende Führerhauptquartier bis hin zu den Mücken sehr genau rekonstruiert. Man kann nicht sagen, dass Baier irgend etwas im strengen Sinn vergessen hätte. […] Wer wissen will, was ein deutscher Offizier namens Stauffenberg am 20.Juli 1944 den ganzen Tag lang tat, wird hier gut bedient.
Wer aber wissen will, was der letzte Tag im Leben des Claus Schenk Graf von Stauffenberg bedeutet, wird sich verloren fühlen. Das hat damit zu tun, dass diesem Film auf merkwürdige Weise jede Mehrdeutigkeit fehlt. Man könnte auch sagen: Er ist eine Erzählung ohne Kontext, ein Geschichtsfilm ohne Geschichte. Und die Geschichte auf die gleiche merkwürdige Weise entdramatisiert, wie heutzutage Dramen enthistorisiert werden. Wer Stauffenberg war oder auch nur gewesen sein könnte, erfährt man nicht.
Genau hier liegt das Problem. Um ein Bild zu gebrauchen: Die bloßen „Fakten“ schwirren chaotisch zu Billiarden durch den Kosmos. Wenn sie niemand ordnet und deutet, bleiben sie Müll, reiner Informationsmüll. Mit „Geschichte“ hat dieser Informationsmüll nicht das Geringste zu tun. Das sogenannte „Faktum“ ist Vorstufe, Teilelement, aber noch keine Geschichte. Selbst Tausende von Fakten sind noch keine Geschichte. Geschichte ist gedeutetes Geschehen. Geschichtliches Erkennen ordnet und deutet das unendliche Chaos der Fakten.
|30|Die Deutegemeinschaft
Wer aber leistet diese Arbeit der Deutung – der Deutung des chaotischen Faktenmaterials, das jeder Tag und jedes Jahr zu uns heranspülen? Natürlich liegt es nahe zu sagen, dies sei eben die Arbeit des einzelnen Historikers, des Fachmanns für Geschichte, der die Archive durchforscht, Zeitzeugen befragt, Material sammelt und dann eines Tages ein Buch herausbringt, in welchem er die von ihm gesammelten Fakten in einen größeren Zusammenhang stellt, sie von den verschiedensten Seiten her beleuchtet und so ein Stück Geschichte erzählt.
Ach, wenn es doch so einfach wäre! In Wirklichkeit arbeitet der einzelne Historiker gar nicht allein. Allein ist er nahezu hilflos. Er setzt die Arbeit vieler anderer voraus. Er greift auf zahlreiche Vorarbeiten zurück, die schon andere vor ihm geleistet haben. Er muss sich auf die Aussagen und Deutungen früherer Historiker stützen. Allein und auf sich gestellt, könnte er das unübersehbare Fakten-Material niemals sichten, auch nicht ordnen und erst recht nicht deuten. Im Übrigen: Die Dokumente, die er in den Archiven findet, sind größtenteils selbst schon wieder Deutungen – aus der Sicht und Absicht der damaligen Zeugen.
Es gibt also – wie bei aller seriösen Forschung – so etwas wie eine Forschungsgemeinschaft der Historiker. Man braucht nur an die vielen Lexika und Handbücher zu denken, die jeder Historiker in seiner Bibliothek stehen hat. Noch zugespitzter gesagt: Es gibt so etwas wie eine Deutegemeinschaft der Historiker. Selbstverständlich suchen sich in dieser Deutegemeinschaft genauso wie in allen Wissenschaften auch Außenseiter, Querdenker, Irrlichter und Knallköpfe zu profilieren. Auch sie sind notwendig.
Und selbstverständlich gibt es Gruppenkämpfe, Extrem-Positionen, Positionskämpfe und Zitationskartelle, also Gruppen von Wissenschaftlern, die sich gegenseitig zitieren, die Arbeitsergebnisse anderer Gruppen jedoch beharrlich totschweigen. Vor allem aber gibt es endlosen Streit. Er ist für jede ernsthafte Forschung unumgänglich.
|31|Doch trotz des nie abreißenden Streits der Historiker bilden sie eine Art Deutegemeinschaft, die bis zu einem gewissen Grade sogar Konsens erzeugt. Anders wären der mainstream der historischen Forschung und die großen wissenschaftlichen Standardwerke, die in der ganzen Welt benutzt werden, überhaupt nicht denkbar.
Das, was in diesem Kapitel immer wieder „Deutung“ genannt wurde, fällt also nicht vom Himmel und ist von Einzelnen allein niemals zu leisten. „Deutung“ setzt Deutegemeinschaft voraus. „Deutung“ setzt die Kommunikation von Menschen voraus. „Deutung“ setzt schließlich, soziologisch gesprochen, eine Großgruppe voraus, die sich ihrer geschichtlichen Identität vergewissern möchte. Und vor allem: „Deutung“ setzt ein „kulturelles Gedächtnis“ innerhalb dieser Großgruppe voraus5.
Das Volk Gottes als Deutegemeinschaft
Alles, was jetzt – ausgehend von der Geschichtswissenschaft – gesagt wurde, gilt selbstverständlich auch von der Theologie. Hier ist die Großgruppe, die geschichtliche Deutung ermöglicht, das Volk Gottes. Das Volk Gottes war von Anfang an Erzählgemeinschaft. Es erzählte, wie Gott immer neu an ihm gehandelt hatte. Und als Erzählgemeinschaft ist das Volk Gottes Deutegemeinschaft gewesen, Gemeinschaft, die ihre Memoria, ihr Gedächtnis, immer wieder erneuert und gereinigt hat.
Übrigens gilt das alles nicht nur von der Vergangenheit. Die Kirche ist auch heute noch Deutegemeinschaft. Es ist für sie lebenswichtig, dass sie in ihre eigene Vergangenheit zurückblickt, sie kritisch überprüft und aus dieser kritischen Rückschau die Gegenwart zu verstehen sucht. Nur so wird der nächste Schritt in die Zukunft möglich. Gegenwärtig ist die Kirche, nachdem sie mit ihrer Israel-Theologie den Juden jahrhundertelang unendliches Leid zugefügt hat, endlich dabei, ihr Verhältnis zum Judentum zu revidieren. Diese ReVision wird das Leben der Kirche tiefgreifend verändern.
|32|Was also ansatzweise schon von jeder profanen Geschichtsdeutung gilt, gilt erst recht von der Deutung aus dem Glauben: Gläubige Deutung von Geschichte setzt das Gottesvolk als Deutegemeinschaft voraus. Es geht ja dabei nicht nur um das Wahrnehmen der eigenen Schuld, sondern auch um das Erkennen der Taten Gottes, die er an seinem Volk und über sein Volk an der Welt getan hat. Solches Erkennen und Erzählen ist unmöglich ohne deutendes Begreifen aus dem Glauben. Es ist nur möglich im Miteinander der Glaubenden, in gläubigen Gemeinden, in der Kirche.
Aber macht sich nicht spätestens an dieser Stelle Unbehagen breit? Muss sich nicht Widerspruch melden? Deutendes Begreifen, deutendes Erkennen, deutendes Wahrnehmen, Deutung und nochmals Deutung – kann Deutung nicht auch schrecklich missglücken? Ist Deutung nicht etwas Vages, Subjektives, Irrationales, Beliebiges, mehr Mutmaßung als Erkenntnis? Der Einwand ist verständlich. Er wird jedoch dem Phänomen der Deutung nicht gerecht. Denn die Interpretation von Welt und Geschichte ist ein fundamentaler Vorgang, ohne den der Mensch Wirklichkeit gar nicht erfassen kann.
Es gibt eben kein Erkennen von Realität ohne Deutungsmuster. Mehr noch: Wenn Menschen ihren Mund auftun und dabei nicht nur tierartige Laute wie Gähnen oder Knurren ausstoßen, sondern Begriffe gebrauchen, deuten sie bereits Wirklichkeit. Jede Sprache setzt schon eine umfassende Weltdeutung voraus, ja, sie ist selbst bereits Deutung von Welt. Wer das Phänomen der Deutung in das Feld der Beliebigkeit verweist, stellt damit jede Wissenschaft, auch die Naturwissenschaften in Frage. Mehr noch: Er würde damit den Wert jeder menschlichen Rede in Frage stellen, denn jedesmal, wenn wir sprechen und Sätze bilden, deuten wir die Realität, die uns umgibt.
Das alles trifft auch für Jesus von Nazaret zu. Für ihn sogar erst recht. Er ist undenkbar ohne das Gottesvolk Israel, in dessen Tradition er gelebt hat, und er kann deshalb auch nur aus dem Glauben und aus dem gläubigen Gedächtnis des Gottesvolkes adäquat begriffen werden. Um Jesus zu verstehen, braucht |33|es den Boden Israels beziehungsweise der Kirche. Wenn wir uns nicht an die deutende Tradition der Kirche halten und nicht immer wieder ihren genuinen Erfahrungsraum suchen, verzerrt sich uns früher oder später das Bild Jesu. Seine Deutung wird dann zur Geschmackssache oder doch wenigstens bestimmt von dem augenblicklichen Horizont seiner Ausleger. Man sieht das deutlich an den vielen Jesusbildern, die in den letzten Jahrzehnten je nach wechselnder Mode produziert wurden. Von dem Jesus der Evangelien zeigen sie wenig, aber sehr viel von dem Geist derer, die sie herstellten.
Da gibt es Jesus als Seelendroge und Jesus als politischen Revolutionär. Da gibt es ihn als Archetyp des Unbewussten oder als Popstar. Es gibt ihn als den ersten Feministen, und es gibt ihn als den getreuen Vertreter bürgerlicher Moral. Jesus wird benutzt von denen, die möchten, dass sich in der Kirche nichts ändert, und er wird benutzt als Waffe gegen die Kirche. Immer wieder wird er instrumentalisiert als Bestätigung der eigenen Wünsche und Träume. Zur Zeit muss er vor allem herhalten für die Legitimation einer universalen Toleranz, der es nicht mehr um die Wahrheit geht und die deshalb in die Beliebigkeit abzugleiten droht. Ein Beispiel:
Das Gleichnis von den zehn Mädchen
Viele Jahrhunderte lang war den Christen klar, wie das Gleichnis von den zehn Mädchen in Matthäus 25,1–13 auszulegen sei: Diese Jungfrauen sollten ja dem Bräutigam entgegengehen und mit ihren Lampen das Hochzeitsfest schmücken. Die Klugen unter ihnen hatten sich mit zusätzlichem Öl für ihre Lampen ausgerüstet und mit dieser Vorsorge überaus vernünftig gehandelt. Sie galt es nachzuahmen. Die Törichten hingegen hatten das, wozu sie bestellt waren, verfehlt. Sie hatten nicht vorgesorgt. Sie hatten die Situation, auf die es ankam, nicht erfasst. Deshalb suchten sie noch nach Öl, als das Fest schon begann. Am Ende standen sie draußen vor der Tür.
|34|Heute hat sich diese alte kirchliche Sicht auf das Gleichnis bei vielen Auslegern und Predigern geradezu umgedreht: Die Törichten, denen die Tür des Hochzeitssaales verschlossen bleibt, werden zu Verkörperungen der Stigmatisierten, der Elenden und Gedemütigten. Ihnen gilt alle Sympathie. Mit ihnen identifiziert man sich. Die Klugen hingegen sind anrüchig geworden. Weshalb haben sie ihr Öl nicht geteilt?
In einer Auslegung des Gleichnisses, die mir vor einiger Zeit in die Hände fiel6, wird das „Ich kenne euch nicht“ des Bräutigams gegenüber den törichten Jungfrauen zur „verletzenden Reaktion“ und zum „darwinistischen Auslesemechanismus“ erklärt. Und die klugen Mädchen des Gleichnisses, die ihr Öl nicht hergeben können, weil sonst das messianische Fest der Gottesherrschaft seinen Glanz verlieren würde, werden als ungerecht, unsolidarisch und heilsegoistisch disqualifiziert. Mehr noch: Die Sorge der Klugen um das Fest der Gottesherrschaft wird als „versteckte Gewalt“ deklariert gegen diejenigen, die sich auf das Fest nicht vorbereitet haben. Mit anderen Worten: Die sich aufgemacht haben, dem Bräutigam entgegenzugehen, verfehlen sich gegenüber denen, die unvorbereitet sind.
Damit ist dem Jesusgleichnis die Spitze abgebrochen und das Ganze pervertiert. In der Parabel von den zehn Mädchen geht es nicht um Fragen der Solidarität, der Hilfsbereitschaft und der Toleranz, sondern um etwas ganz anderes: um den versäumten Kairos, um die nicht ergriffene Stunde.
Die Kirchengeschichte zeigt, wie oft die Christen ihre Stunde nicht erkannt haben. Dann schloss sich eine Tür, die sich so schnell nicht wieder öffnete. Genau die gleiche Erfahrung musste schon Jesus machen: Der größere Teil des Gottesvolkes hatte damals die entscheidende Stunde des Handelns Gottes nicht erkannt. Die Konsequenzen waren schrecklich. Zeloten und Fanatiker wurden die Programmgestalter der nächsten Jahrzehnte jüdischer Geschichte. Jerusalem wurde zerstört. Ein nicht ergriffener geschichtlicher Augenblick, der von dem damaligen Gottesvolk Klugheit und höchste Bereitschaft gefordert hätte!
|35|Durfte Jesus von solcher Gefahr, den eigenen Auftrag zu verfehlen, nicht sprechen? Durfte er nicht davor warnen? Dass Hilfe und Toleranz wichtig sind, schließt nicht aus, dass es ein Gericht gibt. Ein Gericht, das wir uns selbst schaffen. Wer in die Nachfolge Jesu berufen ist, kann nicht wegen der anderen, die nicht mitwollen, zurückbleiben. Er muss sich aufmachen – gerade damit in der Welt das neue Miteinander unter der Gottesherrschaft entstehen kann.
Es gibt in den Evangelien zahlreiche Texte, an denen sich die Geister scheiden. Sie werden einer ganzen Generation von Kirchgängern zum Ärgernis und entlarven die Kirchenvergessenheit vieler Theologen. Oder aber sie erschließen das Unterscheidend-Christliche und rufen neu in die Nachfolge. Ein solcher Text ist das Gleichnis von den törichten und den klugen Mädchen. Es ist wie ein scharfes Schwert. Man wird dieses Gleichnis niemals verstehen, wenn man nicht von der Geschichte des Gottesvolkes her denkt, von seinen Krisen, seinen Gefahren, seinen Entscheidungen.
Romano Guardini stellte einst in einer seiner Universitätspredigten7 die Frage: Wie geht das eigentlich – auf Jesus blicken? Wie werde ich seiner ansichtig? Wie kann ich ihm begegnen? Und Guardini fährt fort: Seltsamerweise wiederholt sich hier in fast gleicher Weise noch einmal das, was schon für die Suche der Religionen nach dem verborgenen Gott gegolten hatte: So, wie es viele Gottesbilder gab, gibt es auch viele Jesusbilder. Und so, wie sich die Menschen Gottes zu bemächtigen suchten, suchen sie sich auch Jesu zu bemächtigen.
Deshalb, sagt Guardini, erhebt sich mit größter Dringlichkeit gerade heute die Frage: Wer schützt Jesus vor uns selbst? Wer hält ihn frei von der List und Gewalttätigkeit unseres eigenen Ichs, das alles tut, um der wirklichen Nachfolge Jesu auszuweichen? Und er gibt zur Antwort: Die Begegnung mit Jesus darf nicht dem subjektiven religiösen Erleben überlassen bleiben, „sondern Ihm ist ein Raum zugeordnet, der richtig gebaut ist, so dass Er darin recht gesehen und vernommen werden kann, und das ist die Kirche“.
|36|Damit ist Entscheidendes gesagt. Wir brauchen nur noch hinzuzufügen: Der „Raum“ der Kirche, der Jesus vor unseren eigenen Interessen schützt, ist ihm nicht nachträglich zugeordnet worden, sondern umgibt ihn von Anfang an. Er umgibt ihn von Anfang an als der Raum des Volkes Gottes, in das Jesus hineingeboren wurde, in dem er aufgewachsen ist und in dem er eines Tages dem Täufer an den Jordan folgte, um sich von ihm taufen zu lassen. Jesus kommt aus Israel, und er ist ohne die Traditionen Israels undenkbar und nicht verstehbar.
Der Raum des Gottesvolkes, nämlich des neu gesammelten, endzeitlichen Gottesvolkes, umgibt aber auch die christlichen Aussagen über Jesus seit Ostern und Pfingsten. Schon die ersten Jesusworte, die weitergesagt wurden, und schon die ersten Berichte und Erzählungen, die überlieferten, was Jesus getan hatte, wurden im „Raum“ der Kirche geformt. Die Jesus-Tradition hat ihren Boden in der Deutegemeinschaft „Kirche“.
Es konnte nicht anders sein. Denn wir haben ja gesehen: Reine Fakten gibt es nicht. Jedes erzählte Faktum ist bereits Deutung. Ohne Deutung kann kein Geschehen unserer Welt begriffen werden. Und wenn es nun erst um die Geschichte zwischen Gott und der Welt geht, mehr noch: wenn es um den Gipfelpunkt dieser Geschichte geht, um die Treue Jesu zu seiner Sendung, die bis in den Tod reichte und eine alles umwälzende Freiheitsgeschichte auslöste – wie sollte ein solches Geschehen ohne Deutung begriffen und erzählt werden können? Man könnte auch sagen: Wie sollte es ohne Glauben ergriffen und begriffen werden können?
Ein radikaler Scheideprozess
Doch genau an dieser Stelle erhebt sich noch einmal ein Einwand, an dem wir nicht vorbeisteuern dürfen: Ich hatte Romano Guardini zitiert mit seiner Frage: Wer schützt Jesus vor uns selbst? Wer hält ihn frei von der „List unseres eigenen Ichs“, das alles tut, um der wirklichen Nachfolge Jesu auszuweichen? |37|Und er hatte zur Antwort gegeben: Die Begegnung mit Jesus darf nicht dem subjektiven religiösen Erleben überlassen bleiben, sondern Jesus ist ein Raum zugeordnet, der richtig gebaut ist, so dass er darin recht gesehen und vernommen werden kann – und dieser Raum ist die Kirche.
Schön und richtig! Aber ist das mit der Kirche so einfach? Hat es nicht in der Kirche selbst ganz verschiedene Jesusdeutungen gegeben? Jesusdeutungen, die sich gegenseitig ausschlossen? Man braucht ja nur an die großen christologischen Streitigkeiten zu denken, die zu den Konzilien von Nizäa (325) und Chalkedon (451) geführt haben.
Allerdings wäre der Blick auf die langwierige christologische Deutungsgeschichte, die in den großen Konzilien der Alten Kirche vorgenommen wurde, in unserem Zusammenhang zeitraubend und viel zu komplex. Ich will die Dinge vereinfachen. Blicken wir statt auf die großen christologischen Auseinandersetzungen des dritten, vierten und fünften Jahrhunderts auf die Jesusbilder der sogenannten Kindheitsevangelien.
In der „Kindheitserzählung des Thomas“8 zum Beispiel wird geschildert, wie der Jesusknabe an der Furt eines Baches spielt, das vorbeifließende Wasser in kleine Gruben ableitet und die lehmige Brühe dann durch sein bloßes Wort „rein macht“. Jesus übt sozusagen schon für sein späteres Auftreten. Der Sohn eines Schriftgelehrten steht dabei, nimmt einen Ast und bringt das von Jesus gestaute Wasser zum Abfließen. Wie reagiert der kleine Jesus?
Als Jesus sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach zu ihm: „Du Frecher, du Gottloser, du Dummkopf, was haben dir die Gruben und das Wasser zuleide getan? Siehe, jetzt sollst du wie ein Baum verdorren und weder Blätter noch Wurzeln noch Frucht tragen.“ Und alsbald verdorrte jener Knabe ganz und gar. Da machte Jesus sich davon und ging in das Haus Josefs. Die Eltern des Verdorrten aber trugen diesen, sein Jugendalter beklagend, hinweg, brachten ihn zu Josef und machten ihm Vorwürfe: „Solch einen Knaben hast du, der so etwas tut.“ (3)
|38|Auf dem selben Niveau geht es in dieser Schrift, die im 2.Jahrhundert nach Christus entstanden ist, dann weiter. Es mangelt ihr nicht nur an erzählerischer Gestaltungskraft und gutem Geschmack, sie ist auch in ihrer Christologie kläglich. Ein Wunderkind macht, was ihm gerade einfällt, und erweist sich so als Götterknabe.
Keine Frage: Dieses Evangelium hat sein eigenes Jesusbild, und zwar ein ziemlich miserables. Dabei verfolgte es gewiss gute Absichten. Es wollte die Göttlichkeit Jesu illustrieren, seine Weisheit und seine Wunderkraft. Es war deshalb in der Alten Kirche auch weit verbreitet. Es gab Übersetzungen der griechischen Urfassung ins Lateinische, Syrische, Georgische, Äthiopische und Kirchen-Slawische. Offenbar wurde es von vielen Christen gern gelesen oder man erzählte die Legenden, aus denen es zusammengesetzt ist, mit Behagen.
Und es war nur Teil einer viel größeren Evangelien- und Herrenworte-Produktion. Noch eine große Zahl weiterer Evangelien und Offenbarungsschriften ist uns ganz oder wenigstens in Fragmenten erhalten – zum Beispiel ein Evangelium des Petrus, ein Evangelium des Thomas, ein Evangelium des Philippus, ein Kindheitsevangelium des Jakobus, diverse Apostelgeschichten wie etwa die Andreas- und Johannesakten, ferner eine Apokalypse des Petrus, des Paulus, des Thomas und viele andere apokalyptische Schriften.
Gewiss, manche von ihnen waren abstruse und Geheimwissen verheißende Gebilde, die schnell beiseitegeschoben werden konnten. Andere enthielten doketische und gnostische Irrlehren, gegen welche die Kirche sowieso in einem harten Abwehrkampf stand. Aber viele dieser Schriften sprachen das Denken und Fühlen damaliger Christen und vor allem ihre religiöse Neugier durchaus an. Erst vor dem Hintergrund all dieser sogenannten Apokryphen zeigt sich die wahre Qualität des Neuen Testaments, vor allem aber auch die Unterscheidungskraft derer, die es schufen. Sie hatten einen untrüglichen Instinkt für die authentische, auf die Apostel zurückgehende Jesusüberlieferung.
|39|Genau hier liegt der entscheidende Punkt: Die Kindheitserzählung des Thomas und ähnliche Machwerke mögen in der Alten Kirche weitverbreitet und beliebt gewesen sein, sie mögen sogar die Namen von Aposteln getragen haben – sie wurden nicht als apostolische Schriften anerkannt. Und das heißt: Sie wurden nicht in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen. Die theologische Tragweite dieser Nichtaufnahme darf nicht unterschätzt werden. Im Grunde geschah hier ein radikaler Scheideprozess – durchaus vergleichbar dem Scheideprozess, der in den großen christologischen Diskursen der ersten Konzilien stattfand.
Dieser immense Prozess des Sichtens und Auswählens, des Unterscheidens und des Scheidens, vor allem aber auch der bewussten Komposition der schließlich zum Kanon des Neuen Testaments ausgewählten Schriften war ein „kirchlicher“ Vorgang. Man könnte ihn sogar als „Verfassertätigkeit“ bezeichnen. Denn „verfasst“ wurde dabei das eine Buch des Neuen Testaments, das mehr ist als ein Bündel zufällig zusammengehörender Schriften9.
Selbstverständlich waren die Träger dieses Prozesses konkrete Personen. Oft waren sie sogar Amtsträger oder in sonst irgendeiner Weise kirchlich Beauftragte. Sie waren aber getragen von all denen, die innerhalb des Gottesvolkes mit ihrer ganzen Existenz glaubten und die gerade deshalb die Gabe der Unterscheidung besaßen. Ohne den Glaubensinstinkt der Vielen, ohne den sensus fidelium, wäre der Prozess der Entstehung des Neuen Testaments als des letzten, abschließenden Buches der Bibel unmöglich gewesen. Was ohne diesen äußerst kritischen Unterscheidungsprozess herausgekommen wäre, sieht man an den Apokryphen. Sie sind über weite Strecken abwegig, wirr und geschichtslos. Die immer neue Lektüre der immensen apokryphen altkirchlichen Jesusliteratur ist dringend notwendig. Sie zeigt erst, wie einmalig und kostbar die Evangelien des neutestamentlichen Kanons sind.
|40|Glaube als Erkennen
Was bedeutet das alles nun für ein Jesusbuch? Es bedeutet, dass es für einen theologisch arbeitenden Forscher nicht angehen kann, einen „historischen Jesus“ gegen das Neue Testament und seine Deutung der Gestalt Jesu zu rekonstruieren. Wer dies als Theologe tut, erhebt sich über die ersten Zeugen und über die Kirche. Und damit verliert er jede Chance, Jesus zu verstehen.
Das heißt selbstverständlich nicht, ein rein religionswissenschaftlich arbeitender Forscher dürfe sich nicht mit Jesus beschäftigen. Und es heißt auch nicht, dass er nicht eine Menge Erhellendes über Jesus sagen könnte. Nur wird er, wenn er seine Methoden sauber handhabt, irgendwann erkennen, dass er an eine Grenze stößt. Diese Grenze verläuft genau dort, wo die Deutung Jesu aus dem Glauben anfängt. Weshalb?
Glaube umschließt immer auch Erkenntnis. Freilich nicht jene Art von Erkenntnis, die ihren Gegenstand zum „Objekt“ machen kann, die ihm distanziert gegenüber treten und ihn unbeteiligt analysieren kann. In den Naturwissenschaften ist solche Art von Erkenntnis grundlegend, und sie ist sogar unabdingbar. Es gibt aber noch eine andere Art menschlichen Erkennens. Sie entsteht nur in personaler Begegnung. Sie lässt sich auf den anderen ein, verlässt sich auf ihn und übernimmt des anderen Sicht der Wirklichkeit. In der Theologie heißt diese Art von Erkenntnis „Glaube“.
Glaube ist wirkliches Erkennen. Aber eben ein Erkennen anderer Art, als wenn ein Gegenstand analysiert, das heißt wörtlich: „aufgelöst“ wird. Einem anderen als Person zu begegnen, heißt gerade nicht, ihn „aufzulösen“, ihn also psychisch zu zergliedern und sich seiner so zu bemächtigen, sondern ihn in seiner Andersartigkeit, ja Fremdheit zu sehen. Wer einen anderen als Person wirklich wahrnehmen will, muss damit rechnen, dass er Unerwartetem begegnet und in eine neue Welt geführt wird, von der er vorher keine Ahnung hatte – in eine Welt, die in ihrer Fremdheit fasziniert, aber auch erschrecken lässt.
|41|Der Religionswissenschaftler, der methodisch sauber und eben darin „kritisch“ an Jesus herangeht, kommt irgendwann an einen Punkt, an dem er „kritisch“ erkennt, dass er die üblichen Maßstäbe der Kritik verlassen und sich auf die Andersartigkeit dieses so ganz anderen einlassen muss, um ihm gerecht zu werden.
Genau an dieser Stelle ist der Punkt, beziehungsweise genau dort liegt die Grenze, wo die historische Kritik von sich selbst aus dazu führt, ihre normalen Maßstäbe aufzugeben. Sie ist eben nur ein sehr begrenzter Sektor menschlicher Erkenntnismöglichkeit. Den wichtigsten Dingen im menschlichen Leben wie zum Beispiel der Zuneigung, der Liebe, der Treue und der Hingabe liegt eine andere Art von Erkennen zugrunde. Sobald die historische Kritik an dieser Grenze angekommen ist und sie redlich anerkennt, weist sie über sich hinaus. Und das ist dann sogar ihre größte und schönste Möglichkeit. Genau an dieser Stelle ist sie am sachgerechtesten.
Ein rein historischer, rein religionswissenschaftlicher Zugang zu Jesus ist also möglich. Aber er hat seine Grenzen. Dieses Buch benutzt voll Dankbarkeit die vorwiegend historischen Forschungen vieler Bibelwissenschaftler. Es hat zudem nicht die geringsten Hemmungen, den ursprünglichen Sinn von Jesusworten und Jesusgleichnissen kritisch zu rekonstruieren. Vieles in diesem Buch wird Rekonstruktion sein.
Aber ich bin überzeugt, dass ich damit nicht gegen das Jesus-Erkennen der ersten Zeugen und auch nicht gegen den Christus-Glauben der frühen Gemeinden anzugehen brauche.
Spannungen innerhalb der Jesustradition
Ich weiß sehr wohl, dass die Theologen der frühen Kirche die Jesustradition aktualisiert und auf ihre eigene geschichtliche Situation hin ausgelegt haben. Ich weiß natürlich auch, dass die Evangelien (und auch schon die ihnen vorausliegende Tradition) über Jesus aus ganz verschiedenen Blickwinkeln gesprochen haben. |42|Doch damit haben sie Jesus nicht verfälscht, sondern das unfassbare Geheimnis seines Lebens nur immer noch tiefer formuliert. Gerade die fruchtbare Spannung zwischen den ältesten Deute-Schichten der Evangelientradition und jüngeren Deute-Schichten, die erst später hinzukamen, ermöglicht das wirkliche Verstehen Jesu.
Um neben der Auslegung des „Tages in Kafarnaum“ noch ein anderes Beispiel zu nennen: Im Johannesevangelium, also dem eindeutig jüngsten der vier Evangelien, sagt Jesus zu Philippus:
Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: „Zeig uns den Vater.“ Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin, und dass der Vater in mir ist? (Joh 14,9–10)
So hat Jesus mit Sicherheit nie gesprochen. Es ist meditierendes Nachsprechen eines Anspruchs, der bei Jesus ständig und überall da ist, der von ihm aber in anderen Redegattungen und in einer anderen Sprechhaltung, nämlich sehr viel zurückhaltender, formuliert wird. Dennoch trifft die Sprache des johanneischen Jesus präzise das, was Jesus gewesen ist. Beide Traditionsschichten, die synoptische wie die johanneische, dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Nicht die älteste Deutung darf monopolisiert werden, sondern sämtliche Interpretationsschichten lassen erst in ihrer Einheit das Bild des wahren Jesus entstehen.
In diesem Buch wird freilich das Schwergewicht auf den ältesten Texten liegen, das heißt auf den ältesten Sinnschichten, die uns noch erreichbar sind. Ich werde nicht die Christologie des Johannesevangeliums auslegen, sondern versuchen, den Anspruch und (bis zu einem gewissen Grad) das Selbstverständnis Jesu aus möglichst frühen Texten zu erheben. Aber gerade nicht gegen spätere Christologien, sondern mit ihnen und unter ihrer Richtschnur. Ich schreibe nicht als Religionswissenschaftler, sondern als Theologe.
|43|Und ich errichte auch nicht einen „Eisernen Vorhang“ mit Wachtürmen und Stacheldraht zwischen mit Sicherheit echten Jesusworten und Jesusworten, bei denen sich die Authentizität nicht mit derselben Sicherheit nachweisen lässt. Solche Grenzziehungen, die in der Bibelwissenschaft noch immer mit einem hohen Aufwand an Intelligenz und Scharfsinn betrieben werden, haben einen kleinen Hauch von Lächerlichkeit. Jeder, der einmal über das Oszillieren zwischen „Faktum und Deutung“ nachgedacht hat, wird verstehen, wenn ich in diesem Buch nicht unablässig und bis zur Ermüdung nachfrage, ob Jesus ein bestimmtes Wort auch wirklich und genau in dieser Form gesprochen habe.
Benedikt XVI. hat das, worum es mir in diesem 1.Kapitel ging, einmal zugespitzt folgendermaßen formuliert: Der Jesus der Evangelien ist „der einzig wirkliche historische Jesus“10.
|44|2.Kapitel
Die Ausrufung der Gottesherrschaft
Wenn man von Jesus reden will – von dem, was er wollte, und von dem, was er war – muss zuerst und vor allem über die Gottesherrschaft gesprochen werden. Allerdings: Das Wort „Gottesherrschaft“ ist ungewohnt. „Reich Gottes“ ist geläufiger. Die „Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift“ für den deutschen Sprachraum spricht immer vom „Reich Gottes“. Schon Martin Luther übersetzte in seiner epochalen Bibelübersetzung von 1545 die entsprechende griechische Wendung mit „Reich Gottes“. Diese Übersetzung blieb im Deutschen das Übliche.
Man sollte aber – ohne daraus ein starres Prinzip zu machen – lieber die Übersetzung „Gottesherrschaft“ gebrauchen. Nicht nur deshalb, weil die Nationalsozialisten bei jeder sich bietenden Gelegenheit vom „Reich“ gesprochen haben, und dieses Wort im deutschsprachigen Raum immer noch bei vielen einen leichten Ekel aufsteigen lässt. Sondern vor allem auch deshalb, weil „Herrschaft“ den zugrunde liegenden biblischen Begriff besser wiedergibt.
Eine kleine Portion Philologie
Wo wir von „Reich“ beziehungsweise von „Herrschaft“ sprechen – im Englischen verwenden die Bibelübersetzungen „kingdom“, im Französischen „royaume“ – steht im Griechischen basileia. Basileia ist zunächst einmal die Königswürde, die Königsmacht, die Königsherrschaft – und, davon abgeleitet, dann auch räumlich das Königreich. Im Aramäischen, der Sprache, die Jesus im täglichen Umgang gesprochen hat, liegt dem griechischen |45|Wort basileia das Wort malkuta zugrunde. Und auch malkuta ist zunächst einmal die „Königsherrschaft“ – und erst in zweiter Linie der Bereich der Königsherrschaft oder gar ein bestimmtes Territorium.
Bei Jesus hat der Begriff der „Gottesherrschaft“ etwas äußerst Dynamisches. Die Gottesherrschaft hat Ereignischarakter. Sie ist ein Geschehen. Sie „kommt“, beziehungsweise: sie „ist im Kommen“. Auch deshalb sollte man den Begriff „Gottesherrschaft“ vorziehen. Aber selbstverständlich gibt dann der Begriff „Gottesreich“ ebenfalls einen bestimmten Aspekt dieses Geschehens wieder: nämlich den Bereich, in dem Gott seine Herrschaft errichtet. Man kann ja in die Basileia „hineingehen“ beziehungsweise „hineingelangen“ (vgl. etwa Mk 9,47; 10,15).
Das ist jetzt am Anfang ein wenig Philologie. Wir brauchen sogar noch mehr von ihr. Sie ist einfach nicht zu vermeiden. Denn nach wie vor gilt das schöne Wort, das einmal ein Theologe im Anschluss an Matthäus 19,24 geprägt hat: „Kein Kamel kommt in das Himmelreich der Theologie, wenn es nicht zuvor durch das Nadelöhr der Philologie hindurchgegangen ist.“
Noch eine weitere Vorbemerkung: Vom „Königtum Gottes“ beziehungsweise von der „Königsherrschaft Gottes“ spricht man in Israel frühestens seit der Königszeit, also seit David und Salomo1. Schon damit ist klar, dass der Begriff der Königsherrschaft Gottes von Anfang an eine Beziehung zur realen Gesellschaft hatte: zu einer Gesellschaft, in der Gottes Königtum sichtbar wird. Niemals meint dieser Begriff in der Bibel etwas rein Innerliches oder rein Jenseitiges. Das hat man später oft nicht mehr wahrgenommen. Dabei hätte man doch wissen müssen: Ein König ohne Volk ist kein König, sondern eine Figur fürs Museum.
Dass man den Begriff des Gottesreiches in der Kirche oft rein jenseitig verstand, hatte freilich einen guten Grund: Der Evangelist Matthäus spricht – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – statt vom „Gottesreich“ immer vom „Himmelreich“. Das musste dazu verführen, das Reich Gottes mit dem Himmel, also mit einer rein transzendenten Wirklichkeit gleichzusetzen. |46|Doch das matthäische Himmelreich ist gerade nicht das, was die Bibel „Himmel“ nennt. „Die Himmel“ – das kann im damaligen Judentum eine ehrfürchtige Umschreibung für „Gott“ sein. Man wollte das Wort „Gott“ nicht andauernd in den Mund nehmen. „Himmelreich“ ist also nichts anderes als „Gottesreich“ – und das Gottesreich gehört zunächst und zuerst auf die Erde.
Noch eine letzte Beobachtung: Die Abstraktbildung „Königsherrschaft“ (hebräisch: malkut)
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: