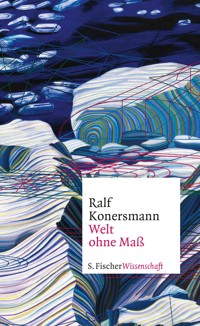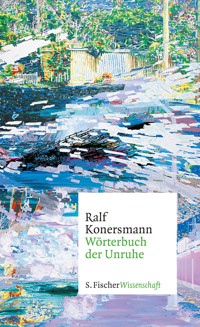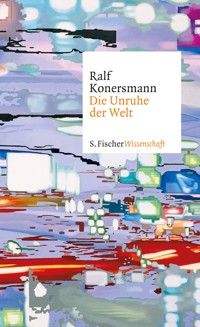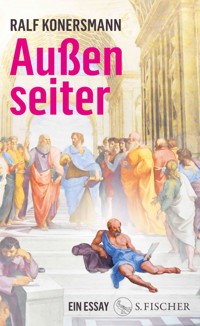
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Funktion, Rolle und Geschichte des Außenseiters von der Antike bis zu den Querdenkern Ursprünglich stammt der Begriff aus der Welt des Sports: »Outsider« sind solche, die ohne Siegchance ins Rennen gehen. In seinem philosophischen Essay geht Ralf Konersmann dieser besonderen sozialen Erscheinung nach. Von der Antike bis zu den Querdenkern von heute untersucht er unterschiedliche Typen des Außenseiters: Wie sie bestimmte, professionell verstetigte Muster lancieren und in das Normalempfinden einfließen lassen – als deren Ergebnis der Außenseiter als exponierte Figur der Moderne heraussticht. Von Diogenes über Cusanus, von Rousseau bis David Bowie, am Beispiel der Außenseiter wird moralisch, politisch, pädagogisch oder geschmacklich über Zugehörigkeit entschieden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ralf Konersmann
Außenseiter
Ein Essay
Über dieses Buch
Ursprünglich stammt der Begriff aus der Welt des Sports: »Outsider« sind solche, die ohne Siegchance ins Rennen gehen. In seinem philosophischen Essay geht Ralf Konersmann dieser besonderen sozialen Erscheinung nach. Von der Antike bis zu den Querdenkern von heute untersucht er unterschiedliche Typen des Außenseiters: Wie sie bestimmte, professionell verstetigte Muster lancieren und in das Normalempfinden einfließen lassen – als deren Ergebnis der Außenseiter als exponierte Figur der Moderne heraussticht. Von Diogenes über Cusanus, von Rousseau bis David Bowie, am Beispiel der Außenseiter wird moralisch, politisch, pädagogisch oder geschmacklich über Zugehörigkeit entschieden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ralf Konersmann, geboren 1955, ist emeritierter Professor für Philosophie und Publizist. Er ist wissenschaftlicher Beirat mehrerer philosophischer Zeitschriften und war Gründungsmitglied der Hamburger Akademie der Wissenschaften sowie Mitherausgeber des »Historischen Wörterbuchs der Philosophie«. Im S. Fischer Verlag hat er zuletzt »Welt ohne Maß« (2021) und das »Wörterbuch der Unruhe« (2017) veröffentlicht, für das er den Tractatus-Essaypreis des Philosophicum Lech verliehen bekommen hat, sowie den großen Erfolg »Die Unruhe der Welt« (2015).
Inhalt
[Motto]
[Außenseiter]
Sagen, wie es ist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Wenigstens anders
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Der Ring der Leere
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Hinter einer Mauer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Die Weisheit auf den Straßen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Von außen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Zum Weiterlesen
Sagen, wie es ist
Wenigstens anders
Der Ring der Leere
Hinter einer Mauer
Die Weisheit auf den Straßen
Von außen
Sind Sie auch Seefahrer? Sie wissen, was ich mit Seefahrer sagen will. Ich meine nicht den Beruf oder die Laufbahn, sondern etwas anderes. Ich glaube, dass Sie Seefahrer sind, vom Festland verstoßen.
Mariette Navarro, Über die See
Das Wort ist an sich schon eine Merkwürdigkeit. Es vertraut den Vorstellungsbildern, aus denen es zusammengesetzt ist: zwei räumlichen Angaben sowie einer Wortendung, die den Sachverhalt personalisiert.
Das Wort Außenseiter überzeugt, ja überwältigt durch Anschaulichkeit. Es sagt, wie es ist.
Sagen, wie es ist
Wir haben es mit einem dieser Begriffe zu tun, die sich empfehlen, indem sie in den Dingen des Lebens für Klarheit sorgen. Es gelingt ihnen, die tausend Eindrücke der umgebenden Welt in eine überschaubare, klar umrissene Szene zu übersetzen. Allein durch ihre Wiederkehr sorgen diese Szenen und Bilder dafür, dass das, was sie zeigen, als unmittelbar wirklich vor uns steht.
Der Außenseiter ist ein Begriff ganz in diesem Sinn.
Scheinbar mühelos nimmt er eine bildstarke Rahmung vor, zoomt die Szene heran und präsentiert sie dem Auge in der Totalen.
1
Im selben Atemzug, allein durch die Nennung des Begriffs, treten die Beteiligten hervor. Sie finden ihre ›Rolle‹. Die Ebenen der spontanen Wahrnehmung und der abstrakten Bestimmung fließen ineinander und bilden einen stabilen Vorstellungszusammenhang, dessen Gültigkeit von nun an als gegeben vorausgesetzt ist.
Es ist diese Prägnanz der mit dem Begriffsnamen aufgerufenen Vorstellungswelt, der das Gedankenbild des Außenseiters sowohl seine Faszination verdankt als auch seine alltägliche, vom Routinehandeln überspielte Dramatik.
In der sozialen Welt ist die Frage elementar, ob man drinnen ist oder draußen, ob man dazugehört oder nicht. Diese Frage ist so unabweislich, so drängend und folgenreich, dass sie nicht dahingestellt bleiben kann.
Dabei sein – der Satz hat eine dunkle Seite – ist alles.
In der Mikropolitik des Sozialen fungiert der Außenseiter als eine Erscheinung im Wortsinn: als eine Auffälligkeit, die restlos in dem aufgeht, als was sie von den Vertretern der Normalität gesehen und eingeschätzt wird.
Die Konstellation ist jedoch asymmetrisch. Denjenigen, die drin sind, fällt mit ebendiesem Drinsein die Position zu, über Drinnen und Draußen zu entscheiden. Obwohl Teil der Situation, beanspruchen sie mit Erfolg, die Draufsicht zu haben. Folgerichtig haben sie ein Interesse daran, dasjenige Bild des Sozialen aufrechtzuerhalten, das ihnen die Entscheidung über die Positionsverteilung zuspielt.
Es ist diese spezielle Modellierung der sozialen Situation, die den Außenseiter möglich macht und ihn überhaupt erst als den, der er sein wird, hervortreten lässt. Im Rahmen dieser Konstellation, dieser Konstellation der Macht, fungiert er als eine Projektion, die aus einer bestimmten, sich selbst als universal verstehenden Sicht der Dinge heraus entworfen ist.
Und eben als solche, als eine von Routinen getragene Projektion, erfüllt der Außenseiter einen doppelten Zweck.
2
Auf der einen Seite erlaubt es die Formelhaftigkeit des Begriffs, das Phänomen der Außenseiterschaft für alle Beteiligten nachvollziehbar als eine Rolle zu bestimmen, die von sich aus eine Reaktion verlangt: den aktiven Umgang mit denen, die abweichen, die sich irgendwie entziehen und nach herrschender Auffassung die Außenseiter sind.
Angeleitet wird dieses Zuweisungsgeschehen von Vorannahmen, die in die Modellierung des Sozialen, in seine Wahrnehmung und sein Erleben eingegangen sind und sich untrennbar mit ihm verbunden haben.
Dazu gehört die im ›Zeitalter der Revolution‹ aufgekommene Vorstellung eines integralen, den Zusammenhalt der Gesellschaft verkörpernden Wir. In der Grammatik des Sozialen ist es dieser deutlich vernehmbaren, aber auch diffusen Instanz gelungen, sich als kollektives Über-Ich geltend zu machen. Macht und Einfluss dieser Instanz beruhen nicht auf formalen Mehrheiten, sondern auf einem zeittypischen Geflecht von Sichtweisen, Sprechweisen und Relevanzbehauptungen. Einmal in dieser Weise zum Kollektiv verdichtet, bildet das Wir, was Theoretiker der Macht einen Block nennen: die Massivität eines geistigen und moralischen Festlandes.
Eines strategischen Zentrums bedarf es nicht. Diesem Wir genügt, um hervorzutreten, eine von Erwartungen und Erzählungen getragene Evidenz. Allerdings muss es, wenn es sich seiner Vorherrschaft sicher sein will, die Situation auch kontrollieren. Es muss dafür sorgen, dass allen Beteiligten klar ist, wer dazu, und das heißt: wer zu ihm gehört und wer nicht – mit anderen Worten: wer es selbst ist und wer die Anderen sind.
Der Zusammenhang mit dem Phänomen der Außenseiterschaft ergibt sich aus dieser Dynamik. Der Kampf um die Masterposition des Wir ist hart, und diejenigen, die sie beanspruchen, haben unterschiedliche Gesichter. Gemeinsam ist ihnen jedoch, ein Allumfassendes zu unterstellen sowie der Anspruch, dieses Allumfassende zu vertreten, ja mehr noch: es zu sein.
Problematisch ist diese Ausrichtung des Sozialen nicht erst aufgrund politisch ›rechter‹ oder ›linker‹ Auslegungen und Realisationen; problematisch ist unmittelbar diese Ausrichtung selbst – ihre Struktur und das, was aus ihr folgt.
Dieses Wir, das in den fraktionierten Gesellschaften der Moderne das Wort ergreift, ist nicht mehr das kleine, das lokal begrenzte Wir der familiären Bindungen, ist nicht das Wir des nachbarschaftlichen Beistandes oder des Teamgeistes im Sport. Dieses Wir ist groß, urteilsfreudig und besitzergreifend. Als informelles Bündnis Ähnlich- und Gleichgesinnter ist es erklärtermaßen politisch und nimmt für sich in Anspruch, die Frage der Zugehörigkeit in seinem Sinn zu entscheiden.
Die Politisierung stellt das Wir konturscharf. Sie weckt das Bedürfnis nach Geschlossenheit und, wie nur folgerichtig, nach Abgrenzung. Unvermittelt meldet sich damit ein illiberales Element: der Zwang, von Augenblick zu Augenblick und von Situation zu Situation zu entscheiden, wer dazugehört und wer nicht.
Die einmal nostrifizierte, im Namen des Wir agierende Politik überträgt die Loyalitäten des Nahbereichs auf die Gesamtgesellschaft. Sie verwischt die Grenzen, ja mehr noch: Sie verleugnet sie. Ihre Sympathien für den Begriff der Gemeinschaft erklären sich aus diesem Ausgriff auf das große Format. Mit der Idee der Gemeinschaft fließen Vorstellungen emphatischer Kollektivität in die Gesellschaft ein – Vorstellungen, die sich über Glaubensgewissheiten und Verhaltensweisen definieren. Gemeinschaften, das unterscheidet sie von der modernen, ungleich anspruchsvolleren Idee der Gesellschaft, sehen die Einzelnen als je schon Gebundene und erwarten, dass sie ihre Bindung bestätigen. Sie fordern sie dazu auf, sich zwischen dem Wir – also ›uns‹ – und denen, die abweichen und außerhalb stehen, zu entscheiden.
Eine Gesellschaft, die sich auf diese Prämissen einlässt, auf die Prämissen der Verschärfung, verfehlt die Ansprüche der Modernität. Statt die von Kant und anderen gezogene Linie der Freimütigkeit zu halten, verfällt sie der Paranoia der Gemeinschaft: der Hermeneutik des Verdachts, die den Unterschied zwischen ›uns‹ und ›ihnen‹ generalisiert und in die Situationen des Lebens hineinträgt.
Der jähe Absturz des Wortes Querdenker, der sich erst kürzlich und gleichsam über Nacht ereignet hat, steht exemplarisch für diese Verschärfung.
Am Verfall dieses einen Wortes lässt sich ablesen, wie leicht und wie schnell inzwischen das Klima der Konzilianz vor der Polarisierung zwischen uns und ihnen, zwischen Drinnen und Draußen kapituliert. Es ist unmittelbar die Abweichung selbst, die Nichtübereinstimmung, die mit einem Mal als befremdlich dasteht und die Ungeduld derer wachruft, die das Miteinander beschwören: die fraglos gestellte Gemeinschaft des Wir.
Der Bedeutungswandel, den das Wort binnen weniger Jahre durchlaufen hat, ist drastisch, und er ist sprechend. Lange Zeit galt als Querdenker, wer den Mut aufbringt, den Diktaten des Zeitgeistes zu trotzen, gegen den Strom zu schwimmen und der Devise Kants zu folgen, sich seines »eigenen Verstandes zu bedienen«. Der aktuelle, krass vereinfachende Sprachgebrauch weiß von dieser Geisteshaltung nichts mehr. Inzwischen fungiert dasselbe Wort als Sammelbegriff für all diejenigen, die, wie es heißt, die gebotene Anpassung schuldig bleiben und mit dem Geist der Gemeinschaft auch diese selbst aufs Spiel setzen.
Wenig genügt, um in einem Meinungsklima wie diesem, das von einem tiefen Verlangen nach Einmütigkeit erfüllt ist, als verstockt zu gelten: als jemand, der sich weigert, seine Sünden zu bekennen, den gemeinsamen Weg mitzugehen und ein Besserer zu werden. Entsprechende Etikettierungen sind in Stellung gebracht und werden, unter reger Beteiligung der für das Soziale zuständigen Wissenschaften, fortlaufend ergänzt und aufgefrischt: egoistisch und egozentrisch, monadisch und subjektivistisch, arrogant und renitent, aversiv und regressiv, autonomistisch und exzeptionalistisch, toxisch und libertär, narzisstisch und pathologisch …
Urteile wie diese, deren Unter- und Nebentöne eine gesonderte Betrachtung wert wären, flankieren den Weg des Wir in den Raum des Politischen. Aber gerade damit, mit diesem unvermerkten und doch entscheidenden Standbeinwechsel vom kleinen zum großen Wir – vom kleinen Kreis auf die Bühne der großen Welt –, erliegt der »soziale Radikalismus«, wie Helmut Plessner diese Machtkonstellation genannt hat, einer bereits in den Tagen der jakobinischen Schreckensherrschaft zutage getretenen Paradoxie. In ihrem Bestreben, allem irgendwie Anstößigen und Querstehenden gewissenhaft nachzuforschen, geht die Politik des Wir dazu über, die soziale Welt nach dem Schema Drinnen oder Draußen zu organisieren. Sie springt um in eine Politik, die ihren Kampf als Kampf der Gesinnungen führt: als Bekämpfung.
Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die sich an dieser Stelle auftut, ist eklatant. Sie ergibt sich daraus, dass dieselbe Politik, die den Menschen zuruft, ihre Einbindung in das große Ganze mit ihrer Haltung zu bestätigen, diejenigen nur umso entschiedener markiert, die von dieser Erzählung nicht überzeugt sind. In Abgrenzung von der rituell geschmähten Egozentrik gewinnt eine von vagen Anthropologismen getragene Nostrozentrik Raum, deren zentrale Botschaft die Fraglosigkeit ihrer selbst ist.
Sich von dieser Mission, die es doch nur gut meint, nicht angesprochen zu fühlen, liegt außerhalb jeder Vorstellung. Entsprechend ratlos und, nach eigenem Bekunden, »verstört« stehen die Sprecher des großen Wir vor der Selbstauskunft derer, die, wie Melvilles Bartleby, unbeirrt in der ersten Person Singular sprechen und, ohne damit etwas Weiteres erreichen zu wollen, aus freien Stücken erklären, dieses Es, das man von ihnen erwartet, lieber nicht zu tun: I would prefer not to …
Es ist diese Unbeschwertheit und das offene Eingeständnis, dass nichts dahintersteckt – kein Auftrag, kein Programm und kein Plan –, das die Sachwalter des gesellschaftlich Erwünschten vor Rätsel stellt. Sie wissen nichts anzufangen mit Leuten, die wie die Bartlebys dieser Welt außerhalb der von ihnen selbst als alternativlos empfundenen Vorstellungswelt stehen: weitab vom Festland und außerhalb der Höhle des Wir.
Am Ende ist es unmittelbar das Inklusionsgebot selbst, das den Einzelnen vor die Entscheidung stellt, entweder die Geborgenheit der Gemeinschaft zu suchen oder sich, um es mit Niklas Luhmann zu sagen, »durch Exklusion zu definieren«.
3
Das ist das eine.
Auf der anderen Seite ist es interessant zu sehen, wie leicht selbst der stärkste Argwohn sich verlieren und in Sympathie, ja grenzenlose Bewunderung umschlagen kann.
Damit fällt ein kurzer Blick auf eine Variante der Außenseiterschaft, der es gelingt, das Stigma der Irregularität aufzugreifen und es, fast möchte ich sagen, triumphal umzuwerten. Um es in der einschlägigen Bildsprache zu sagen: Während der klassische Außenseiter draußen steht, gelingt es diesem artverwandten Typ, das Schema zu durchbrechen und als der, der er ist, im Innenbereich aufzutauchen: da, wo die Zugehörigen sind.
Dieser zweideutige, mal hüben, mal drüben auftauchende Typ des Außenseiters ist nicht einfach ausgeschlossen. Seine Unangepasstheit ist wohlkalkuliert, so dass sie zwar Reibungen erzeugt, im Übrigen aber folgenlos bleibt. Anders als der Fremde, von dem sie nichts weiß, oder als der Einzelgänger, der ein Schattendasein führt, dient er als omnipräsente Reizfigur, deren Performance die Gesellschaft nervt und verunsichert, vor allem aber fasziniert.
Der einst gegen den Egalitarismus der Revolution aufbegehrende Dandy, der diese Rolle als einer der Ersten erprobt hat, ist an dieser Zweideutigkeit ebenso gescheitert wie die Großstadtpoesie der Bohème. Die Demonstration der Eleganz war, wie überhaupt das Auftreten dieser Einzelnen und Verstreuten, kapriziös und verweigerte die Massentauglichkeit.
Als ungleich durchsetzungsstärker haben sich die Bad Boys und Bad Girls der Popkultur erwiesen. Mit ihren wohldosierten Tabubrüchen stellen sie das bestehende Normensystem in Frage, um einen konsumfreudigen und doch zugleich als rebellisch gefeierten Lebensstil zu zelebrieren, der das Bild des Außenseiters auf bezeichnende Weise bereichert.
Der britische Sänger und Songwriter David Bowie hat dieser Figur des gefeierten, zuweilen auch mit den Zügen des Tragischen kokettierenden Außenseiters Gestalt gegeben. In seiner Bibliothek fand sich Camus’ Epochenroman L’Étranger, der in der englischen Ausgabe The Outsider heißt. Die Titelfigur des Romans, hat Bowie rückblickend erzählt, sei ihm eine Inspirationsquelle gewesen. Tatsächlich veröffentlichte er 1974 mit »Rebel, Rebel« einen Song, dessen Refrain die problemlose Verträglichkeit dieses Außenseitertyps auf ebenso schlichte wie überzeugende Weise auf den Punkt bringt: Hot tramp, I love you so!
Coolness, um nur dieses eine Attribut der lizensierten Außenseiterschaft aufzugreifen, ist die denkbar einfache, durch eine bloße Gebärde zum Ausdruck gebrachte Außeralltäglichkeit, die die Betreffenden heraushebt und sie in den Augen des Publikums interessant macht.
Die Popkultur hat die disruptive, mit grandioser Beiläufigkeit vorgetragene Gebärdensprache der Coolness zu einer risikolosen Form des Nonkonformismus ausgebaut. Die damit gefundene Sprache, die Sprache der Subtexte und Anspielungen, der Zitate und Zeichen, hat sich als erfolgreich und vor allem als übertragbar erwiesen. Inzwischen findet sich unter den von den medial Präsenten eine wachsende Zahl von Leuten, die ihre Etablierung dem sorgfältig gepflegten Image verdanken, nicht zu den Etablierten zu gehören.
Der Markt hat den Außenseiter zur Marke gemacht: zu einer Attitüde, die sich nach Belieben zitieren und werbestrategisch einsetzen lässt. Entwicklungen wie diese vollziehen sich zulasten derer, die, an den Emphasen des Wir vorbei, frei und unbeirrt ihren Weg gehen. Mit derlei Wagnissen, deren Ausgang ungewiss ist, hat die professionelle Inszenierung des Ungewöhnlichen nichts im Sinn. Im Universum des Pop zählt nicht die Freiheit der Kunst, zählen nicht die Passionen des Denkens und Sagens, des Zeigens und Gestaltens. Was die Popkultur einmal erfasst hat, unterwirft sie den Gesetzen des Marktes und der medialen Kommunikation.
Für das große Publikum sind denn auch weniger die Werke von Belang – Hervorbringungen, die über den Tag hinaus Bestand hätten –, als das, was sich aus dem grenzwertigen Treiben der Celebrities über das Leben in der modernen Gesellschaft lernen lässt. Was zählt ist das, worauf all die einzelnen, Aufmerksamkeit heischenden Aktionen, Inszenierungen und Events der Popindustrie hindeuten und worin sie exemplarisch sind.
Die Kurzlebigkeit dieser Produkte ist der Garant ihres Erfolgs. Im Mittelpunkt des Spektakels steht der fortlaufend aktualisierte Gossip, steht das Anekdotische und irgendwie Sprechende, an dem das Verhalten der Vielen sich von Augenblick zu Augenblick ausrichten kann. Selbst da, wo sie den Bogen überspannen, erweisen sich die ikonischen Außenseiter des Pop als unentbehrlich. In einer dünnhäutigen, hart und schnell urteilenden Umgebung überleben sie als freischaffende Dienstleister, die stellvertretend für die Vielen auf offener Bühne agieren und sich den Blicken aussetzen. Ihnen fällt die Aufgabe zu, die Spielräume des Verhaltens herauszuspüren und sie vor den Augen einer Öffentlichkeit, die nicht genug davon bekommen kann, mit Leben zu füllen.