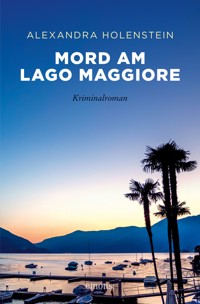9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wenn die Auszeit Nathalie heißt – nach "Das Heinrich-Problem" Alexandra Holensteins nächster Frauenroman mit funkelndem Humor. Sowas kann doch nicht mir passieren, denkt Helene Abendrot. Aber ihr Mann Josef hat sie tatsächlich einfach an einer Autobahnraststätte sitzenlassen. Er bräuchte eine Eheauszeit, sagt er. Blöd nur, dass Josefs Auszeit Nathalie heißt und seine Assistenzärztin ist. Helene ist sauer! Doch dann wagt sie, endlich all das zu unternehmen, wozu Josef nie Lust hatte. Sie bricht auf in die Provence und Toskana, lernt neue Leute kennen und tut Dinge, die sie selbst überraschen. Helenes Welt wird auf einmal ziemlich aufregend. Will sie da die Liebe in der Ehe noch einmal entdecken? "Unterhaltsam und witzig." Tina
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Ähnliche
Alexandra Holenstein
Auszeit bei den Abendrots
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Jan
1
Für einen Moment dachte ich, es wäre Josef.
»La posso aiutare? Can I help you?«, fragte der junge Mann, der sich dem Wagen vom Heck her genähert hatte.
Doch Josef hatte weder eine so klangvolle Stimme, noch sprachen wir Italienisch oder Englisch miteinander. Wie es aussah, gab es gerade überhaupt keine uns verbindende Sprache.
»No, grazie. Va tutto bene.« So unauffällig wie möglich schob ich meine Tasche mit dem linken Fuß unter den Beifahrersitz.
Nichts war in Ordnung, aber was hätte ich sagen sollen? Mein Mann hat mich hier sitzen lassen. Keine Ahnung, was ich jetzt tun soll.
Nach einem Moment des Zögerns hob er grüßend die Hand und ging. Im Rückspiegel sah ich, wie er in einer der Zahlstellenkabinen verschwand.
Seit einer Stunde – vielleicht weniger, vielleicht mehr – saß ich auf dem Beifahrersitz unseres Passat und harrte der Dinge, die nicht kamen: der Rückkehr von Josef, eines Anrufs, einer Erklärung, einer Eingebung.
Zurückgelassene Fracht am Rande einer kleinen, wenig frequentierten Autobahnmautstelle. Bei 29 Grad im Schatten, die Sonne im Zenit. Sechzig Kilometer südöstlich von Mailand.
Es bedurfte nicht viel Vorstellungskraft, mich mit den Augen des jungen Mannes zu sehen: Eine Frau mittleren Alters im Sommerkleid, dessen dünner Stoff wie Frischhaltefolie auf ihrer Haut klebte.
Eine Frau am Rande jener nebligen Altersgruppe, in der die Weiblichkeit von grau-weißen Schwaden verhüllt wurde.
Eine, die ihre Wasserflasche an sich gepresst hielt wie eine Vierjährige ihren Teddybären.
Eine, die an einem Ort allein in einem Auto saß, an dem niemand haltmachte, wenn er nicht unbedingt musste.
Ich klappte die Sonnenblende nach unten, schaute in den kleinen Kosmetikspiegel und erschrak: verstörter Blick, verwischte Wimperntusche, Haarsträhnen, die wie nasse Schnüre ins gerötete Gesicht hingen.
Situationen, in denen es mir völlig egal war, wie ich aussah, hatte es in den, sagen wir mal, letzten dreißig meiner achtundvierzig Lebensjahre nicht viele gegeben. Und so kramte ich denn aus meiner Handtasche ein Päckchen Papiertaschentücher hervor, tupfte mir Stirn und Nase trocken, rieb die Wimperntusche weg und trug ein wenig Lippenstift auf. Was meine schweißnasse Haut betraf, würde nur die kühle Luft der Klimaanlage etwas ausrichten können, und dazu musste ich endlich das tun, zu dem ich mich bisher nicht hatte durchringen können: auf den Fahrersitz rutschen, den Motor starten und auf die Autobahn zurückfahren.
Auch würde ich der besserwisserischen Daniela das Wort verbieten. Ihre so selbstsicher hervorgebrachten Richtungsweisungen konnten mir gestohlen bleiben. Früher hatten wir es auch ohne Navigationssystem geschafft. Den Parkplatz am Porto Marghera zu finden, konnte schließlich keine Hexerei sein.
2
Mailands Autobahnumfahrung hatte es in sich. Entscheidungen für den richtigen Abzweiger mussten im Nu gefällt und Fahrbahnen rechtzeitig gewechselt werden. Zauderer wurden entweder mit einer unfreiwilligen Sightseeing-Tour mitten durch die Stadt oder einer folgenschweren Irrfahrt in eine gänzlich andere Fahrtrichtung bestraft.
Josef begegnete dieser Herausforderung seit Jahren gelassen mit Danielas Hilfe. Das war die Dame, der er gestattete, ihm Anweisungen zu geben. Dies tat sie gleichbleibend freundlich, klar und sachlich. Qualitäten, die mir angeblich abgingen. Dabei hatte Josef meine vorzüglichen Kartenlesefähigkeiten in Vor-Navi-Zeiten durchaus zu schätzen gewusst. Nun saß ich zwar immer noch mit der Straßenkarte auf dem Schoß auf dem Beifahrersitz, war aber in Sachen Richtungsangaben zur Komparsin degradiert worden, was zu einem nicht versiegenden Quell immer neuer Zankereien zwischen mir und meinem Mann geworden war. Ich war so gut wie Daniela, manchmal sogar besser. Warum nur wollte Josef das nicht einsehen?
Und genau damit hatte die ganze Misere begonnen.
Halb links hatte sie angeordnet. Halb rechts ich. Oder umgekehrt, so genau konnte ich mich nicht mehr erinnern, denn es musste schnell gehen.
Jedenfalls war die von Josef gewählte Abzweigung nicht die richtige. Statt nach Venedig fuhren wir Richtung Bologna. Für mich lag die Schuld bei Daniela, für Josef – wie konnte es anders sein – bei mir.
»Warum musstest du dazwischenfunken?«, fragte Josef. Eine Antwort wollte er nicht. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Es waren seine letzten Worte an mich. Für längere Zeit.
»Wir können bei Piacenza nordöstlich hochfahren. Dann kommen wir auf die Serenissima.«
Josef schwieg.
»So schlimm ist das nicht. Mehr als eine Stunde verlieren wir auf keinen Fall.«
Er blieb stumm.
Grollend schaute ich aus dem Seitenfenster auf die an uns vorbeigleitende Po-Ebene. Auch ich konnte schweigen.
Nein, so entschied ich erneut, ich würde Josef keines Blickes mehr würdigen. Mit der Beharrlichkeit eines nach Beute spähenden Mäusebussards richtete ich mein Auge auf alles, was zu meiner Rechten lag. Zum Beispiel auf die Strohballen, die wie in Stücke geschnittene Riesenzigaretten in wahlloser Anordnung auf den bereits abgeernteten Feldern und Wiesen herumlagen. Oder auf Gehöfte vergangener Tage, zerfallen und verlassen. Bei einem wuchs sogar ein Baum durch alle Stockwerke. Mir fiel ein Film ein, den wir vor langer Zeit mal gesehen hatten. Josef und ich. Irgendetwas mit Holzschuhen und dem ärmlichen Leben der lombardischen Bauern Ende des vorletzten Jahrhunderts. Wie hieß der doch gleich? »Josef, wie …« Gerade noch rechtzeitig erinnerte ich mich daran, dass ich mir vorgenommen hatte, meinen zu Eis gefrorenen Ehemann mit der gleichen Nichtachtung zu bestrafen, die er mir entgegenbrachte. Und so blieb es bei dem Satzfragment, das wie ein unangenehmer Geruch im Wageninneren schwaderte. Ein Geruch, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte.
Josef blieb regungslos.
Casalpusterlengo stand auf einem Ortsschild.
Was für ein ulkiger Name, wie von kauderwelschenden Kindern erfunden. Ich suchte auf der Straßenkarte danach.
»Noch achtzehn Kilometer, dann müssen wir abzweigen«, teilte ich Josef mit. Laut und deutlich, wie die keine Widerrede duldende Navigations-Daniela. Dass ich damit mein Schweigegelübde brach, war der übergeordneten Wichtigkeit der Mitteilung geschuldet.
Aber auch dazu sagte Josef nichts. Stattdessen klaubte er ein Pfefferminzbonbon aus der Schachtel in der Mittelkonsole und schob es sich in den Mund. Es war das zwölfte auf dieser Fahrt. Ich hatte mitgezählt.
Casalpusterlengo, Casalpusterlengo, Casalpusterlengo. Das sollte ab sofort mein Mantra sein. Der Klangkörper, mit dem ich meinen Geist beruhigen, mich fokussieren konnte. Ganz so wie es meine Freundin Adrienne mir unlängst für kritische Situationen empfohlen hatte. Zwei Minuten, so hatte ich schon bemessen, würde es dauern, bis Josef das Bonbon mit saugenden Lutschgeräuschen bearbeitet, reduziert und schließlich mit drei heftigen Knackern zerbissen hatte. Ich würde mich beherrschen und die unliebsamen Geräusche nicht kommentieren. Wie ein entspannter Guru konnte ich weltliche Störungen von mir fernhalten.
Casalpusterlengo, Casalpusterlengo.
»Warum hörst du nicht endlich auf damit? Dieses Geschmatze geht mir auf die Nerven.«
Auf den Guru in mir, der sich mit unerwartet giftigem Ton zu Wort meldete, war leider kein Verlass. Oder lag es am Mantra?
Josef nahm die Augen von der Fahrbahn und sah mich flüchtig an. Flüchtig und kühl.
Er trug neuerdings einen Dreitagebart, mit dem er entfernt einer leicht angesilberten Ausgabe von David Beckham glich.
»Bald kommt ein Abzweiger, Richtung Gardasee«, verkündete ich, nun wieder mit beschwingtem Ton, als hätte jemand per Knopfdruck das Programm gewechselt und als handelte es sich bei einem Abzweiger um eine spaßige Kapriole, die wir uns unbedingt gönnen sollten. Ein zugegebenermaßen hilfloser Versuch, den bissigen Gaul wieder einzufangen, den ich so fahrlässig freigelassen hatte.
Aber Josef tat mir nicht den Gefallen, etwas Entgegenkommendes zu sagen oder wie in früheren Zeiten seine rechte Hand auf mein linkes Knie zu legen. Wortloses Zeichen dafür, dass wir trotz allem Verbündete waren, denen ein kleiner Zwist nichts anhaben konnte. Stattdessen betätigte er den Blinker und lenkte den Wagen auf die Ausfahrtspur.
»Doch nicht hier, Josef«, rief ich erschrocken. »Das war zu früh. Jetzt sind wir wieder falsch.« Aber Josef schob unbeirrt die Karte in den Automaten der Mautstation. Vor uns tat sich die Barriere auf.
Gleich darauf fuhr er rechts ran. War ihm nicht gut? Ein Notfall?
»Josef, was ist los?«
Er stieg aus dem Auto, öffnete die Heckklappe und zerrte etwas aus dem Kofferraum. Seine Reisetasche, wie ich wenig später sehen konnte.
»Josef, was soll das? Ist das wegen der falschen Richtung? Oder wegen der Bonbons? Habe ich dich gekränkt? Das täte mir leid. Darüber können wir doch reden!« Auch ich war ausgestiegen und stützte mich auf den oberen Rand der Beifahrertür.
Die letzten zwei Sätze prallten an Josefs Rücken ab. Die Reisetasche in einer Hand, die Jacke – im letzten Moment noch von der Rückbank geangelt – unter den Arm geklemmt, lief er auf der rechten Straßenseite davon. Ein Lastwagen fuhr gefährlich dicht an ihm vorbei. Ein Lieferwagen hupte. Das war keine Straße, auf der man zu Fuß ging.
»Josef. Josef!« Ich stampfte mit dem Fuß auf, was man mit fünf Zentimeter hohen Absätzen nicht tun sollte.
»Jooosef, komm zurück!« Meine Stimme überschlug sich.
Gleich, gleich würde er umkehren. Alles nur ein Scherz, würde er sagen, sobald er wieder am Auto war. Oder: Die Lektion hast du dir verdient. Mit diesem schiefen Lächeln, das ich nicht mochte, weil es gar nicht nett gemeint war.
Ich würde großmütig sein und gnädig nicken. Ja, das würde ich.
Aber er kehrte nicht um, sondern stieg über die Leitplanke, überquerte eine verdorrte Wiese und wurde schließlich von den Silhouetten zweier Lagerhallen verschluckt.
3
Ein vorübergehender Zustand geistiger Verwirrung? Ein emotionaler Ausbruch mit unbedachten Folgen? Ich kannte Josef nur als vernunftgeleiteten Menschen. Natürlich konnte er ärgerlich werden. Wer wusste das besser als ich? Aber zu irrationalen Handlungen oder impulsiven Entscheidungen neigte er nicht. Mich an einer Mautstation stehen zu lassen wie einen ausrangierten Regenschirm, das war doch nicht mein Josef.
Trotz allem hatte er mir aber das Auto gelassen, was mein Schicksal von dem eines Regenschirms unterschied. Mit jedem zurückgelegten Kilometer, nun endlich auf der Serenissima und mit dem stetig näher rückenden Venedig als Stätte der Zuflucht vor Augen, beruhigte ich mich ein wenig. Wahrscheinlich hatte Josef unweit der Zahlstelle ein Taxi zum nächsten Bahnhof – Piacenza? – genommen und sich per Zug auf den Weg nach Venedig gemacht. Dort würde er auf mich warten. Zwar fiel mir partout kein Grund für solch ein unsinniges Tun ein, aber so wie ich mich gerade an das Lenkrad des Passat klammerte, hielt ich mich mit trotziger Beharrlichkeit an jedem noch so dürftigen Erklärungs-Hälmchen fest.
Sollte ich Rüdiger und Susanne anrufen? Die beiden erwarteten uns in der Ferienwohnung im Stadtteil Castello, unserem Domizil während der kommenden zehn Tage.
Immerhin konnte ich damit rechnen, die beiden telefonisch zu erreichen, was mir bei Josef seit seiner Houdini-Verschwinde-Nummer nicht gelungen war.
Mit gleichbleibend distanzierter Freundlichkeit hatte mir die Mobilbox-Dame mitgeteilt, dass der Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar sei. Ihr großzügiges Angebot, nach dem Ton doch eine Nachricht zu hinterlassen, hatte ich genutzt. Und wie! Melde dich, Josef!, war die erste und salonfähigste meiner Mitteilungen gewesen. An die letzte der vielleicht fünfzehn konnte und wollte ich mich nicht mehr erinnern.
Nein, ich würde nicht mit Rüdiger und Susanne telefonieren. Schau einfach, was dich in Venedig erwartet, sagte der kluge Guru in mir, der mich hin und wieder zur Ruhe anhielt und dann unversehens verschwand, wenn ich ihn dringend brauchte.
Penetrantes Lichthupen hinter mir zwang mich sowohl zum Fahrbahnwechsel wie auch dazu, mich nun wirklich ausschließlich auf den Verkehr zu konzentrieren.
Der Schimmer von Zuversicht, alles könne sich auf wundersame Weise aufklären, verblasste bereits wieder. Was, wenn Josef nicht in Venedig einträfe? Vielleicht sollte ich schon jetzt mit der Polizei Kontakt aufnehmen. Aber was könnte ich sagen? Und in welcher Sprache?
Mein Mann ist verschwunden. Mitsamt seinem Gepäck.
Cara signora, würden die Carabinieri antworten und dabei vermutlich feixen. Ihr Mann hatte eben anderes vor. Vielleicht hat er Sie verlassen.
Wieder wurde mir heiß, trotz des kühlen Luftstroms, der mir aus den Belüftungsschlitzen entgegenblies.
Unsinn, schalt ich mich. Warum sollte er mich verlassen? Und wenn überhaupt, dann täte er das nicht auf so eine Art und Weise. Wir waren zivilisierte Leute. Wir sprachen miteinander, beredeten unsere Probleme. Zumindest ich. Ich sprach.
Wie ein zu allem bereiter Ritter hielt ich mich und mein Ross eisern in Zaum. Fahren, Helene, einfach fahren, sprach ich mir selbst Mut zu. Auf der mittleren der drei Fahrbahnen auf dem Weg nach Venedig.
Josef, um den ich mich gerade eben noch gesorgt hatte, schickte ich in einem neuerlichen Anflug von Ärger zum Teufel, oder meinetwegen auch in die Abgründe von Casalpusterlengo.
4
»Warum bist du ihm nicht hinterhergefahren?« Rüdigers Frage war berechtigt.
»Weiß auch nicht«, schniefte ich. Mit dem Nachlassen der Anspannung hatten sich die längst überfälligen Tränen ihren Weg nach draußen gebahnt. »Schockstarre oder irgendetwas in der Art.« Als hätte ich mich das nicht auch schon gefragt.
»Du bist doch sonst nicht so.« Rüdiger schüttelte den Kopf.
Ich wusste nicht, was er mit sonst und so meinte. Für mich gab es in den letzten Jahrzehnten keine Situation, die in irgendeiner Weise mit Josefs Verschwinden vergleichbar gewesen wäre.
»Außerdem hab ich zuerst gedacht, er kommt wieder zurück«, schob ich nach, wie ein trotziges Schulkind.
»Der ist verrückt geworden«, schaltete sich Susanne ein. Wie war denn das gemeint? Auch wenn sie vielleicht recht hatte, trug die Vorstellung von Josefs plötzlicher Geistesstörung nicht unbedingt zu meiner Beruhigung bei. Wer wollte schon einen verrückten Mann?
Ich nippte am Prosecco Superiore Valdobbiadene, den Rüdiger eilig geöffnet hatte, nachdem ich mich, bepackt mit einem Koffer und zwei Taschen, verschwitzt, erschöpft und josef-los in den fünften und obersten Stock des Hauses in der Calle Erizzo geschleppt hatte.
Den hätten wir ohnehin zur Feier eurer Ankunft getrunken. Und jetzt erst recht, hatte Rüdiger gesagt und das perlende Getränk in drei Gläser gegossen, nachdem ich einen Kurzbericht über das Geschehene gegeben hatte.
Krisensituationen verlangten nach Heilmitteln der hochwertigen Sorte. Da ließ Rüdiger nichts anderes gelten. Ein Glas Prosecco hatte ich bereits in einem Zug in mich reingekippt.
»Soeinfiesertyp.« Das plötzliche Hyänengeheule kam von mir.
Susanne und Rüdiger sahen mich erschrocken an.
»Versuch doch noch mal, ihn zu erreichen.« In Männermanier begegnete Rüdiger meinem Ausbruch mit einem Ratschlag zum Handeln.
»Hab ich doch schon tausendmal gemacht.«
»Egal.« Rüdiger schob mein Telefon von der Mitte des Esstischs zu mir hin.
Folgsam griff ich danach und drückte erneut auf die Hörerikone.
Nach wiederholtem Rufzeichen war erneut das mir mittlerweile verhasste Organ der Mobilbox-Dame zu hören.
»Hat sich Josef in letzter Zeit seltsam verhalten? Stimmungsschwankungen? Affektive Störungen irgendwelcher Art?« Rüdiger blieb die Stimme der Vernunft und sachlichen Überlegung. Nebenbei begann er, sorgfältig Basilikumblätter vom Stiel eines Zweiges zu zupfen und zusammen mit frischen Knoblauchzehen und Pinienkernen in den Marmormörser zu befördern, den er zusammen mit seinem sechsteiligen Messerset von zu Hause mit in unsere Ferienwohnung gebracht hatte. Darin kam, wie ich wusste, seine Überzeugung zum Ausdruck, dass man in keiner Lebenssituation auf ein gutes Essen verzichten sollte.
Dass wir uns bereits das zweite Mal in vier Jahren zu gemeinsamen Ferientagen in Venedig entschlossen hatten, war auf Rüdigers ansteckende Begeisterung für das italienische Lebensgefühl zurückzuführen. Auf sein Drängen hin sollten wir dieses Jahr die Lagunenstadt in den letzten Juni- und ersten Julitagen erspüren, auch wenn man uns vor der schwülen Hitze gewarnt hatte, welche die Stadt spätestens ab Juli in ein Dampfbad verwandeln konnte. La vera italianità nannte Rüdiger das.
»Nein, Josef war eigentlich ganz … normal«, beantwortete ich seine Frage. Dass ich kurz vor seinem Verschwinden sehr unfreundlich gewesen war, verschwieg ich genauso wie die Tatsache, dass wir uns öfter mal stritten und keine Turteltäubchen waren wie er und seine Frau.
»Tja, da hilft nur ein gutes Abendessen.« Rüdiger setzte sich zu Susanne und mir an den Tisch und bearbeitete die Zutaten im Mörser rigoros mit dem Stößel.
Obwohl mir die Überleitung etwas willkürlich und auch nicht besonders einleuchtend vorkam, fügte ich mich. Das war nun mal Rüdigers Haltung zum Leben.
»Probier mal die Oliven, Helene! Taggiasche. Entsteint und nur in Salzlake eingelegt. Das bewahrt den typischen Eigengeschmack.«
Mir stand nicht der Sinn nach Oliven, nach keiner Sorte.
Susanne sprang für mich in die Bresche und schob sich gleich zwei hintereinander in den Mund. Nur wenig konnte Rüdiger unglücklicher machen als die mangelnde Würdigung seiner kulinarischen Kreationen und der von ihm mit Bedacht zusammengestellten Leckereien.
»Wenn er doch nur was gesagt hätte, bevor er sich davongemacht hat, dann wüssten wir jetzt mehr.« Susanne kaute mit gekräuselter Stirn vor sich hin.
Dem ließ sich nichts entgegensetzen. Susanne war Meisterin im Hervorheben von Offenkundigem.
Nichtsdestotrotz hatte ich mich inzwischen ein wenig beruhigt und schnäuzte mir lautstark die Nase. Dann schwiegen wir ein paar Minuten lang. Nur das reibende Geräusch des Stößels untermalte unsere Gedanken.
»Man muss die Zutaten einfach mörsern. Bloß kein Mixer. Der zerstört das Aroma«, gab Rüdiger schließlich zum Besten, auch wenn niemand ihn um eine Erläuterung gebeten hatte.
Wie wenig Rüdiger und Susanne doch letztlich, trotz ihrer freundschaftlichen Bekundung der Anteilnahme, von der Ungeheuerlichkeit berührt waren, die mir widerfahren war. Nicht dass ich es ihnen zum Vorwurf machte. Es war nun mal nicht ihr Schicksal, und vielleicht waren sie insgeheim auch einfach froh, dass sie nicht meine Probleme hatten. Womöglich wäre es mir an ihrer Stelle ähnlich ergangen.
Und so sagte ich nicht laut, wie wenig mich dieses Pesto gerade interessierte und dass er die Basilikum-Knoblauch-Mischung meinetwegen mit einer Motorsense zerhackstücken konnte. Mein Mann hatte sich vor sechs Stunden wortlos davongemacht, war nicht erreichbar, meldete sich nicht. Ich hatte andere Sorgen.
Susanne und Rüdiger waren unsere Freunde. Nicht dicke Freunde, wenn man mal von der von Jahr zu Jahr zunehmenden Leibesfülle der beiden absah, aber doch mehr als nur Bekannte.
Seit Josef und ich nicht mehr im südwestdeutschen Freiburg lebten, sondern in Bern, sahen wir die beiden nicht mehr oft, hatten aber die Gewohnheit gelegentlicher gemeinsamer Ferienaufenthalte beibehalten.
Rüdiger, Arzt wie Josef, war Androloge mit eigener Praxis, während Josef seit acht Jahren leitender orthopädischer Chirurg an der Universitätsklinik der Schweizer Bundesstadt war.
Eigentlich beruhte die ganze Freundschaftsgeschichte auf der Verbindung der beiden Männer, die sich seit dem Studium kannten. Susanne, obwohl eine unbedarft nette Person, war mir als Freundin zu langweilig. Unsere Beziehung lebte von der Viererkonstellation, für deren Fortbestand ich Susannes Geschnatter langmütig hinnahm, was ich Josef gerne mal in Erinnerung rief, wenn dieser an meinem generösen Wesen zweifelte.
»Wollen wir nicht hoch auf die Altana gehen, anstatt hier am Esstisch zu sitzen?«, schlug Susanne vor. »Falls Josef klingelt, hören wir das allemal.«
Falls. Aber von allem, was Susanne bisher von sich gegeben hatte, konnte ich mich damit gerade am besten anfreunden.
Die Altana, wie man die hölzernen Dachterrassen in Venedig nannte, war die Attraktion der Wohnung. Sie gab einen wunderbaren Blick über die Dächer der Stadt frei.
Wir griffen nach den Gläsern und den Oliven und kletterten auf der Wendeltreppe vom Wohnraum aus nach oben. Rüdiger hatte dem Kühlschrank vorsichtshalber noch eine weitere Flasche Prosecco entnommen. Bis zum Abendessen – Artischocken-Carpaccio zur Vorspeise, Trofie mit Pesto als Hauptgang – sollten wir nicht auf dem Trockenen sitzen.
Vermutlich hofften wir alle noch, Josefs Eintreffen mit ein wenig Beharrlichkeit herbeiführen zu können.
Neben meinem eigenen Wechselbad aus Bangen und Wut konnten sich wohl auch Susanne und Rüdiger nicht recht vorstellen, wie die nächsten zehn Tage unter den gegebenen Umständen aussehen sollten.
Mit oder ohne Josef.
5
Der Friularo war getrunken, die letzten Pestoreste mit Weißbrot aufgeputzt. Wobei ich nur bei Ersterem einen nennenswerten Beitrag geleistet hatte.
»Ruf Tobi an«, schlug Rüdiger vor. »Vielleicht weiß der mehr.«
»Ja, ruf Tobi an«, echote Susanne.
»Warum sollte der was wissen?« Derwaswissen war zu einem Wort verschmolzen.
Ich fühlte mich behäbig wie ein Elefant. Zu meiner Ratlosigkeit hatte sich bleierne Müdigkeit gesellt, eindeutig Auswirkung des ungewohnten Alkoholquantums und der nervenaufreibenden Ereignisse.
Tobi war unser Sohn, der sich gerade an der St. Galler Business School zum Großverdiener ausbilden ließ.
»Wenn du es nicht machst, tu ich es«, entschied Rüdiger streng. »Mit der Ungewissheit findest du ja keinen Schlaf.«
Damit lag Rüdiger grundsätzlich richtig. Was er nicht wusste: Ich befand mich in einem Zustand derartiger Erschöpfung, dass ich auch auf dem nackten Marmorboden in der Mitte der Piazza San Marco hätte einschlafen können.
Aber dass Rüdiger Tobi anrief, wollte ich auf keinen Fall. Ich griff nach meinem Telefon.
»Mama?« Tobi klang alarmiert. Wir beschränkten uns in der Regel auf Textnachrichten und telefonierten nur selten.
»Hast du was von Papa gehört?«, fragte ich ohne jede Einleitung, was nicht dazu beitrug, Tobi zu beruhigen.
»Warum sollte ich was von ihm gehört haben? Ihr seid doch in Venedig, oder etwa nicht?«
»Doch.«
»Also?«
»Ich bin in Venedig. Papa nicht.«
»Soll das ein Rätsel sein?« Trotz des flapsigen Tons schien Tobi nun tatsächlich besorgt.
»Er hat mich an einer Mautstelle zurückgelassen.«
»Was?«
Die Aussage war tatsächlich missverständlich. Drei Gläser Prosecco und zwei vom Friularo waren meiner Fähigkeit, mich klar auszudrücken, nicht zuträglich.
»Dein Vater ist aus dem Auto gestiegen und verschwunden. Ich bin dann alleine weitergefahren.«
Tobi schwieg.
»Tobi?«
»Ja.«
»Also, bei dir hat er sich nicht gemeldet?«
»Das ist ja ein Ding«, sagte er nur, ohne auf meine Frage zu antworten.
Wir schwiegen noch ein bisschen. Dann versprachen wir, uns auf dem Laufenden zu halten. Ich, indem ich ihn umgehend über eine verspätete Ankunft seines Vaters informieren würde. Er, indem er telefonisch sein Glück versuchen wollte, in der Hoffnung, dass sich Josef einem Anruf seines Sohns nicht entziehen würde.
»Mama?«
»Ja?«
»Ich …« Tobi hielt inne. »Ich vermute, der ist zu Hause, in Bern. Mach dir mal keine Sorgen.«
Das war Tobis letzter Satz. Ich starrte noch eine Weile auf mein Smartphone, als würde dies demnächst zu Leben erwachen und mich an klärenden Erkenntnissen teilhaben lassen.
»Und Tobi weiß auch nichts?«, unterbrach Susanne mein Sinnieren. Jeder andere hätte den Stand der Dinge bereits meinem Gesprächsanteil am Telefonat entnommen.
»Nein, nichts.«
»Ich schneid noch ein paar Pfirsichhäppchen zurecht. Als Betthupferl. Das wird uns allen guttun«, verkündete Rüdiger, der an der Spüle stand und die makellosen Früchte im Licht der Küchenlampe wie Rohdiamanten inspizierte, bevor er sein Fruchtmesser in ihr saftiges Fleisch gleiten ließ. So war Rüdiger.
Anders Susanne. »Wenn Josef doch nur etwas gesagt hätte, bevor er ging.« Auch wenn echte Besorgnis aus ihrem Satz sprach, war ich kurz davor, ihr an die Gurgel zu gehen. Merkte sie denn nicht, dass sie das heute bereits in drei Varianten zum Besten gegeben hatte?
Meine Gedanken schweiften zu Tobi. Was gab er mir da für einen seltsamen Ratschlag? Ich sollte mir keine Sorgen machen, weil Josef vermutlich zu Hause wäre? Wir hatten diese gemeinsame Reise schon vor Monaten geplant und ich sollte die Vorstellung beruhigend finden, dass mein Mann unterwegs einfach kehrtgemacht und zurück nach Hause gefahren war?
Und hatte Tobi nicht überhaupt etwas eigenartig geklungen?
6
Die Sträßchender Bernischen Altstadt, durch die ich ziellos streifte, verwandelten sich in venezianische Gassen. Josef, den ich nur von hinten sah, trug das blau-weiß geringelte Hemd eines Gondoliere. Mein Josef, ein Gondoliere. »Bleib stehen!«, rief ich. »Bleib doch stehen!« Aber das tat er nicht. Er bog um eine Ecke, um noch eine und noch eine. Ich immer hinterher, nie schnell genug.
Eine mit dem Kopf ruckelnde, Gurrlaute ausstoßende Taube versperrte mir den Weg. Sie sah mich an mit ihren schwarzen Knopfaugen. Provozierend. Listig. Mit einem beherzten Sprung setzte ich über sie hinweg, landete erstaunlicherweise auf der anderen Kanalseite, lief weiter, aber … Josef war nicht mehr zu erblicken. »Josef!« Verzweiflung packte mich.
»Helene?« Da, er rief nach mir, aber von wo? Alles, was ich sah, waren die leere Gasse und der Kanal mit dem schmuddeligen Wasser, auf dem ein Strohhut mit rotem Satinband sachte vor sich hin schaukelte.
»Helene?« Etwas stimmte hier nicht. Keine Gasse, kein Kanal. Ein mir nur vage vertrautes Zimmer und jemand, der an der Tür klopfte.
»Ja?«
»Kommst du frühstücken? Es ist schon halb neun.« Das war Rüdiger, nicht Josef.
Ich war tatsächlich in Venedig, im Doppelbett eines der beiden Schlafzimmer der Wohnung in der Calle Erizzo, ohne meinen Mann, der mit größter Wahrscheinlichkeit auch nicht gerade als O-sole-mio-singender Gondoliere auf dem Canale Grande unterwegs war, sondern … Ja, das war die Frage, die mich unversehens unter einer Schwere begrub, als wären die burgunderfarbenen Samtvorhänge meines Zimmerfensters auf mich herabgestürzt.
Erstaunlich, dass ich überhaupt so lange hatte schlafen können.
»Ich komme.« Es half nichts. Der Tag musste angegangen werden. Ich hievte mich aus dem Bett, das mir trotz durchhängender Matratze Schlaf und Traum beschert hatte, zog mir meinen Bademantel über und betrat den Flur.
»Ich hab Kaffee gemacht, mit der Moka.« Rüdiger stand noch immer vor meiner Tür.
»Gut, ich dusche schnell, und dann bin ich gleich bei euch.« Warum trat Rüdiger nicht zur Seite? Und warum sah er mich so an? Flink zog ich den Gürtel des Bademantels enger.
»Guten Morgen, meine Liebe!«, zwitscherte Susanne, die am Frühstückstisch saß wie eine taufrische Sommerblume. Sie gehörte zu den Menschen, die schon am frühen Morgen adrett frisiert und bei penetrant guter Laune waren.
Trotz Dusche und frischer Kleider fühlte ich mich nicht in annähernd solcher Verfassung.
»Ich schlage vor, wir gehen nachher erst mal gemeinsam auf den Markt.« Rüdiger goss dampfenden Espresso in meine Tasse.
Damit war zu rechnen gewesen. Aber wollten die beiden nun wirklich so tun, als wäre alles in Butter?
»Das könnt ihr tun«, sagte ich, nachdem ich einen Schluck vom tatsächlich vorzüglichen Kaffee genommen hatte. »Allerdings werde ich in der Zwischenzeit ein oder zwei Telefonate erledigen. Sollte ich nichts Neues wegen Josef in Erfahrung bringen, dann reise ich heute wieder ab.«
»Abreisen?« Susanne schaute mich erschrocken mit ihren runden, braunen Augen an.
»Heute?« Das war Rüdiger, der gerade das zweite Blech voll frisch gerösteter Crostini aus dem Ofen zog.
»Es tut mir leid. Aber so war das ja nun mal nicht gedacht. Nur wir drei. Und ich wäre ja auch nicht entspannt, mit dieser Ungewissheit.«
Die beiden nickten betreten.
»Vielleicht kommt Josef heute noch und hat eine plausible Erklärung für alles.« Susanne konnte wirklich einen erstaunlichen Optimismus an den Tag legen. Genussvoll biss sie in eines der knusprigen Crostini, die Rüdiger mit Tomatenwürfeln belegt und auf dem Tisch platziert hatte. Sie schob mir den Teller entgegen.
»Nein, danke.«
Was für eine plausible Erklärung Susanne da wohl vorschwebte?
Entschuldigt Leute, aber mir ist ganz plötzlich eingefallen, dass ich noch eine Operation durchführen musste. Habe dann leider in der Eile nicht daran gedacht, Helene darüber aufzuklären.
Daran, dass ich gestern selbst noch auf irgendeine einleuchtende Begründung für Josefs Handeln gehofft hatte, erinnerte ich mich nur kurz und am Rande.
»Wen willst du denn anrufen?« Rüdiger saß nun endlich auch am Tisch.
»Zum Beispiel meine Freundin Adrienne. Selbst wenn sie mal nichts weiß, fällt ihr noch was ein.«
Adrienne, Yogalehrerin in Bern, wusste über alles und jeden Bescheid und war tatsächlich nie um einen Ratschlag verlegen.
Rüdiger nahm sein Smartphone aus der Brusttasche seines karierten Hemdes. »Ich werde es auch noch mal versuchen.« Er wählte Josefs Nummer und stellte auf Lautsprecher. Jedes Rufzeichen war laut und deutlich zu hören.
Josef antwortete nicht.
7
»Helène, das ist eindeutig: Josef hat eine Midlife-Crisis. Dann tun Männer so unerklärliche Dinge.« Adrienne kam aus der französischen Schweiz, aus Lausanne. Meinen Namen sprach sie herrlich französisch aus. Ich liebte es, zu einer Helène zu werden. Überhaupt fühlte ich mich schon ein klein bisschen besser, seit ich mit ihr telefonierte.
»Wenn das etwas mit einer Midlife-Crisis zu tun hätte, dann müsste Josef 104 Jahre alt werden. Und das glaube ich nicht. Dazu ist er nicht entspannt genug.«
»Ja, eigentlich müsste so eine Krise tatsächlich früher stattfinden, aber vermutlich ist er ein Spätzünder.« Adriennes Kenntnisse über Männer waren beträchtlich, was umso erstaunlicher war, als sie selbst keinen an ihrer Seite hatte.
»Ich weiß nicht, Adrienne. Das kommt mir als Erklärung ein bisschen kärglich vor. Eine Krise und dann wortlos verschwinden? Das passt einfach nicht zu Josef.«
»Aber darum geht es ja gerade. Eine Midlife-Crisis ist wie Pubertät. Es passieren die verrücktesten Dinge, die Person verändert sich, tut Unerklärliches, stößt andere vor den Kopf.« Adrienne wollte sich nicht von ihrem Konstrukt abbringen lassen. »Auf jeden Fall solltest du nicht einfach abreisen. Versuche, dir wenigstens ein paar schöne Tage in Venedig zu machen. So gut es eben geht. Stell dir vor, Josef pilgert vielleicht gerade auf dem Jakobsweg oder ist auf Ibiza beim Clubben. Und du grämst dich. Das geht nicht. Denk jetzt an dich!«
»Und wenn ihm was passiert ist?«, fragte ich mit dünner Stimme.
»Dann würdest du es erfahren. Außerdem ist ihm nichts passiert.« Adriennes Bestimmtheit tat wohl.
»Wie geht es Lego?«
»Dem geht es wunderbar. Um ihn musst du dir schon gar keine Sorgen machen.«
Lego war unser Hund. Ein spanischer Streuner mittlerer Statur mit braunem Fell, den wir vor vier Jahren von meiner mit seiner Erziehung überforderten Tante Selma übernommen hatten. Während unserer Abwesenheit weilte er bei Adrienne als Feriengast.
Nach dem Telefonat beschloss ich, mich ein wenig ins Getümmel zu stürzen und auf dem Campo Bandiera e Moro einen Cappuccino zu trinken. Tatsächlich fühlte ich mich besser. Nach Hause fahren konnte ich morgen auch noch. Oder übermorgen.
Ich lief durch die Gassen, in denen sich Touristen drängten, die von den Kreuzfahrtschiffen und Vaporetti morgens ausgespuckt und abends wieder aufgesogen wurden. Sie fotografierten, was das Zeug hielt, sich selbst und alles, was ihnen vors Smartphone kam, blieben vor den Läden mit den billig produzierten venezianischen Masken, dem wertlosen Schmuck, den Taschen und den I love Venice-Shirts stehen, redeten in allen nur erdenklichen Sprachen und versperrten denen, die es eilig hatten, den Weg.
Ja, auch ich liebte Venedig. Mit all seinen Widersprüchen, seiner Dekadenz und natürlich seiner ungewöhnlichen Schönheit.
Auch wenn Josef nirgends zu sehen war, weder als Gondoliere auf einer lackschwarzen Gondel noch als verwirrter Pilger, war mir erstaunlich wohl zumute.
Warum der Stimmungsumschwung? Ich konnte es mir selbst nicht erklären.
Versuch, dir wenigstens ein paar schöne Tage zu machen, hatte Adrienne gesagt.
Susanne und Rüdiger wollten am Nachmittag zum Lido übersetzen. Ich würde sie begleiten, mich für ein paar Stunden mit ihnen unter einen der grün-weißen Sonnenschirme der Spiaggia degli Alberoni legen und nicht daran denken, dass Josef eigentlich mit von der Partie sein müsste.
8
Eine Mail. Von Josef. Warum eine Mail und kein Anruf? Mein Herz bumperte, als wäre der Marmorstößel aus Rüdigers Mörser für sein Schlagen zuständig. Stehend, den Sonnenhut noch nicht abgesetzt, meinen City-Rucksack immer noch auf dem Rücken, öffnete ich mit dem leichten Druck meines zittrigen Zeigefingers die eingegangene Post, die mit Josef Abendrot gekennzeichnet war.
Liebe Helene
Es tut mir leid, dass ich dich im Auto zurückgelassen habe. Das ist kaum entschuldbar und lässt sich auch für mich nur als Kurzschlusshandlung erklären.
Aber du bist eine tatkräftige, starke Frau, die auch mit solchen Momenten umzugehen weiß. Das beruhigt mich und gibt mir das Gefühl, nichts wirklich Schlimmes getan zu haben.
Josef hatte mir noch nie gesagt, dass er mich für eine starke Frau hielt. Sollte ich mich über das Bild, das er von mir hatte, freuen? Wie schön, dass wenigstens er sich beruhigen und sich möglicher Gewissensbisse entledigen konnte. Ich zog mit dem linken Fuß einen Stuhl zu mir heran und ließ mich auf dessen Kante nieder.
Nun wirst du dich fragen, wie es zu dieser Kurzschlusshandlung kam.
Damit lag er verdammt richtig.
Wo soll ich beginnen?
Ja, wenn er das nicht wusste?
Ich will es eine Lebenskrise nennen. Ein Innehalten mit Zweifeln, Ängsten und vielen Fragen.
Nun wurde mir wieder mulmig, nachdem meine Anspannung zwischenzeitlich etwas nachgelassen hatte. War Josef etwa krank? Ein Leiden, von dem er mir nichts hatte sagen wollen? Um mich zu schonen? Ich griff nach dem Glas mit San Pellegrino, das noch vom Frühstück auf dem Küchentisch stand, und nässte meine trockene Kehle. Es half alles nichts, ich musste mutig sein und weiterlesen. Eins war sicher, wenn es Josef nicht gut ging, würde ich an seiner Seite stehen. Hatte er je daran gezweifelt?
Du weißt, dass wir in der letzten Zeit öfter gereizt miteinander umgegangen sind. Nicht liebevoll, wie früher. Das ist nicht allein deine Schuld. Es liegt mir fern, das zu suggerieren. Unsere Ehe ist den Gang vieler Ehen gegangen: Man teilt Tisch und Bett, sieht sich tagtäglich und verliert sich doch aus dem Auge.
Helene, ich muss zu mir kommen, in Ruhe einen Blick auf mein Leben werfen. Und dazu muss ich erst einmal alleine sein. Vorübergehend zumindest. Vielleicht ein paar Monate, vielleicht länger. Ich weiß es nicht. Seit gestern Abend bin ich wieder in unserer Wohnung in Bern, werde aber bald in ein Studio im Haus vom Kollegen Schneider ziehen, das er mir günstig zur Verfügung stellt. Das wird mir die Möglichkeit geben, in mich hineinzuhören, meine Bedürfnisse zu erspüren.
Okay. Eins nach dem anderen. Josef war also nicht krank. Zumindest nicht physisch.
Ich stand auf und ging zum Kühlschrank, wo noch ein Rest Prosecco in seiner schweren Flasche darauf wartete, in ein Glas gegossen zu werden. Eigentlich trank ich am Vormittag nie Alkohol. Aber zum einen fehlten bis zum Mittag nur noch zwei Minuten, und zum anderen war heute nicht irgendein Tag.
Mein Mann wollte in sich hineinhören, seine Bedürfnisse erspüren. Wie tat man das? Er wollte einen Blick auf sein Leben werfen. Auch das konnte ich mir nicht vorstellen. Musste man dazu sitzen oder liegen? Brauchte man meditative Stille oder sphärische Klänge?
Natürlich hatte auch ich mir schon Gedanken über mein Leben gemacht, was meistens recht undramatisch vonstatten ging. Ein Spaziergang mit Lego an der Aare. Blättern in alten Fotoalben. Eine Stunde mit Musik. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, war ich im Reinen mit dem, was mir dabei durch den Kopf ging.
Natürlich hatte Josef nicht unrecht mit der knappen Skizze unserer Ehe. Aber verflixt nochmal, das war doch kein Grund, zu Hause aus- und in irgendjemandes Studio einzuziehen. Wir waren seit sechsundzwanzig Jahren verheiratet, da durfte sich doch mal Gereiztheit einstellen, ohne dass sich einer deswegen in klösterliche Klausur begeben musste.
Bevor ich weiterlas, ging ich nochmals zum Kühlschrank und trank den allerletzten Rest Prosecco gleich aus der Flasche. Nun fühlte ich mich bereit für den verbleibenden Teil von Josefs befremdlicher Mitteilung.
Das Wissen darum, dass du für diesen Schritt Verständnis aufbringen wirst, meine liebe Helene, macht mich zuversichtlich. Wer, wenn nicht du, könnte damit besser umgehen? Uns beiden wird diese Verschnaufpause guttun. Da bin ich mir sicher.
Mach dir mit Susanne und Rüdiger schöne Tage in Venedig! Sag den beiden bitte, dass ich mir diese Auszeit unbedingt nehmen muss.
Und verzeih mir mein so unüberlegtes wie schwer nachvollziehbares Handeln von gestern.
Beste Grüße, natürlich auch an S&R.
Josef
Auszeit? Verständnis?
Ich sprang vom Stuhl auf. Krachend kippte er hinter mir zu Boden und bekam auch gleich noch einen Kick von mir als Zugabe. »Verdammter, elender Scheißkerl!«
»Wer? Was ist los?« Das war Rüdiger, der die Wohnungstür aufgeschlossen hatte und nun von der Diele aus zu mir in die Küche schaute. Susanne stand hinter ihm und lugte erschrocken über seine Schulter. »Helene, um Gottes willen!«, rief sie.
Es musste die zwei überraschen, diese furiose Frau mit Sonnenhut und Rucksack zu sehen, die Scheißkerl rief und nach Stühlen trat. Das war kein alltäglicher Anblick.
Ich selbst musste erst mal mit so einer Zeter-Helene vertraut werden. Insbesondere, weil ich meine Souveränität still und heimlich immer für eine meiner herausragenden Qualitäten gehalten hatte.
»Neues von Josef?« Rüdigers Frage klang eher wie eine Feststellung.
»Ja«, antwortete ich ermattet nach meiner Eruption. Ich war froh, die beiden zu sehen. Wie sie dastanden, beladen mit Tüten und überquellenden Taschen, besorgt und auch ein wenig verlegen, verkörperten sie für mich das, was mir gerade abhandengekommen war: beruhigende Normalität, Verlässlichkeit.
»Lest selbst!« Ich wies auf mein Tablet.
»Gleich, muss nur noch schnell die Frischwaren im Kühlschrank verstauen. Heute Abend gibt es Miesmuscheln. Cozze.« Rüdiger behielt wie immer seinen Sinn fürs Praktische. Miesmuscheln mussten gekühlt werden.
Alsbald beugten sich die beiden über Josefs Mail auf meinem Tablet, während ich zum Fenster ging und auf die rotbraunen Dächer von Castello schaute.
Nun, da auch sie Josefs Zeilen lasen, war der Geist unwiderruflich aus seiner Flasche geschlüpft, stand mannsgroß im Raum und ließ sich nicht mehr zurück in seine Behausung stopfen. Auf seinem weißen Meister-Proper-Hemd stand es geschrieben: Josef zieht aus!
Hätte Josef nicht von Angesicht zu Angesicht mit mir sprechen können? Wenn er bei seinem Kollegen Schneider ein Studio für sich und seine Introspektion gemietet hatte, so war davon auszugehen, dass er das nicht erst gestern Nacht in die Wege geleitet hatte. Dahinter steckte Planung.
Josef hielt mich für stark, was ihm wohl gerade gelegen kam. Gleichzeitig musste er mich aber auch für einfältig halten.
Eine hellgraue Taube mit grünlich-blauer Halskrause hüpfte auf dem Giebel des nächsten Daches herum. Ich mochte sie nicht. Ich mochte überhaupt keine Tauben.
»Ojemine.« Das war Susanne. Ich drehte mich nicht um. »Dass der Josef so ein Schwermütiger ist, das hätte ich nicht gedacht.«
»Ich auch nicht.« Ich schaute weiter zum Fenster raus. Ein Schwermütiger? Ha!
Warum hockte die Taube da alleine rum? Hatte sie keinen Mann, keine Frau oder Freunde? Hatten Tauben Familie?
»Tja.« Rüdiger räusperte sich. »Da müsst ihr euch wohl noch mal zusammensetzen und ordentlich drüber reden. Der kann doch nicht einfach so ausziehen. Was verspricht er sich davon? Eine Ehe wird schließlich nicht besser, wenn man sich verzieht.«
Richtig. Manchmal hatte Rüdiger wirklich sehr vernünftige Ansichten.
»Vielleicht solltest du mal mit ihm reden? Von Mann zu Mann.« Ich ging zum Tisch zurück, entledigte mich endlich meines kleinen Lederrucksacks und des Sonnenhuts und setzte mich wieder hin.
»Das wird schon wieder.« Susanne, die sich ebenfalls an den Tisch gesetzt hatte, legte ihre Hand auf meine. Das war lieb gemeint. Und vielleicht hatte sie sogar recht. Eventuell durchlief Josef wirklich eine Midlife-Crisis, wie Adrienne schon vermutet hatte. In ein paar Wochen würde er wieder klarsehen, und wir könnten gemeinsam über die Geschichte lachen. Zu zweit oder zu viert.
»Ich komme mit zum Lido«, verkündete ich unvermittelt.
»That’s my girl.« Nun tätschelte auch Rüdiger meine Hand. Und tätschelte und tätschelte.
9
»Wie ich’s dir gesagt habe. Identitätskrise in der Lebensmitte. Fragen drängen sich auf: War es das schon? Was hält das Leben noch für mich bereit? Kommt übrigens bei Männern häufiger vor als bei Frauen.«
Was Adrienne alles wusste.
»Warum?«
»Vermutlich, weil die bei der klassischen Rollenverteilung nach wie vor weniger ins familiäre Leben eingebunden sind. Da fehlt das Fallnetz. Existenzielle Fragen können sich ungehindert ihren Weg bahnen.«
Die Erklärung kam mir zwar ein bisschen improvisiert vor, aber irgendwie sagte sie mir auch zu. »Und was meinst du, wie ich damit umgehen soll?«
Ich rieb meine geröteten Füße mit Aloe-Vera-Gel ein. Josefs Eröffnungen hatten mich all meiner Energie beraubt. Am Lido war ich erschöpft auf dem Liegestuhl eingeschlafen. Dass meine Zehen und ein Teil der Füße keinen Schutz mehr unter dem gestreiften Dach des Sonnenschirms gefunden hatten, war mir entgangen.
»Ruhe bewahren. Vor allem darfst du dich nicht von Josefs Entscheidungen abhängig machen. Wenn er glaubt, allein sein zu müssen, dann soll er das tun. Du hingegen wirst ihm bei diesem Selbstfindungsprozess nicht wartend über die Schulter schauen. Sieh zu, dass es dir gut geht!«
Das leuchtete mir ein. Wie es in der Praxis aussehen sollte, war mir weniger klar. Mit dem Deutschunterricht zur Integration von Flüchtlingen, den ich zweimal pro Woche erteilte, und meinen Schreibbeiträgen fürs Hundemagazin Fido konnte ich schwerlich von Eigenständigkeit sprechen. So peinlich es auch war, dies zuzugeben, nicht zuletzt vor mir selbst, seit Tobi nicht mehr zu Hause lebte, war ein nicht geringer Teil meines Tuns darauf ausgerichtet, unser Leben als Paar so angenehm wie möglich zu gestalten, dabei Josefs von Arbeit dominierten Tage mit einer guten Mahlzeit ausklingen zu lassen und auch sonst für Gemütlichkeit und Wohlsein zu sorgen. Über so viel häusliche Dienstleistung würde sich jede Feministin die Haare raufen.
»Eigentlich denke ich«, schob Adrienne noch tröstend nach, »dass er schon bald wieder bei euch im Jägerweg auftauchen wird. Josef wird nicht lange ohne dich sein können. Sonst wäre er ein Dummkopf. Und dafür halte ich ihn nicht.«
Ach, das war es, was mir an Adrienne so gut gefiel. Niemand sonst konnte so fein und sorgsam Balsam auf die wunden Stellen einer verletzten Seele streichen. Ich wollte ihr jedes Wort glauben.
»Mach dir noch ein paar angenehme Tage in Venedig! Und lass dich von diesem Rüdiger bekochen. Der Alltag wird dich früh genug wieder im Griff haben.«
»Danke, Adrienne. Gib Lego noch einen Kuss zwischen die Ohren.«
Ich schob mein Telefon in die Tasche. Mehr gab es heute nicht mehr zu besprechen. Tobi hatte ich bereits das Nötigste mitgeteilt: Papa ist tatsächlich zu Hause. Mehr dazu später. Ich bleibe noch ein paar Tage in Venedig.
In der Küche schrubbte Rüdiger mit Hingabe Miesmuscheln. Er trug eine hellblaue Schürze – auch die musste er von zu Hause mitgebracht haben –, deren auf dem Rücken geknotete Bänder aufs Äußerste ausgereizt waren. Der Chefkoch, wie in roten Lettern auf der Schürze stand, war selbst sein dankbarster Gast, was nicht ohne Folgen blieb.
»Cozze alla marinara«, verkündete er. »Mit Spaghetti. Ihr werdet euch die Finger lecken. Susanne ist oben auf der Altana und liest. Geh nur auch schon hoch! Sobald ich hier fertig bin«, er wies auf die Muscheln, die er mit der Bürste bearbeitete, »komme ich mit Campari Soda und Bruschette nach.«
Susanne saß mit einem Krimi auf dem bequemsten der vier Holzsessel. Als ich die Terrasse betrat, blickte sie auf und sah mich mit gerunzelter Stirn an. »Du siehst schlecht aus. Macht dir die Josef-Geschichte so zu schaffen?«
Susannes Kommentar zu meinem Aussehen, noch dazu in diesem mitleidigen Ton, ärgerte mich. Ich war eine Frau, die Wert auf ihr Aussehen legte. Daran änderten auch Josef und seine Denkpause nichts.
»Natürlich setzt mir das zu. Aber ich bin im Begriff, damit zurechtzukommen. Spätestens morgen werdet ihr mich wieder frisch und schön wie immer sehen.« Ironisch scherzhafte Untertöne waren bei Susanne zwar verschwendet, aber das Schön-wie-immer wollte ich doch noch loswerden.
»Wenn man fast 50 ist, hinterlassen solche Ereignisse Spuren«, pflügte Susanne unbeirrt weiter, als hätte sie mich nicht gehört.
»48«, stellte ich richtig.
»Wie?«
»48 ist nicht fast 50.« Warum ließ ich mich auf diese Albernheiten ein? Und überhaupt, seit wann verschoss die liebe Susanne in Gift getunkte Pfeile?
»Ich bin ja so froh, dass meinem Rüdiger so was nie einfallen würde.« Sie war offensichtlich noch nicht fertig.
»Schön, dass du das weißt.«
Aber auch Sarkasmus ging unerkannt an ihr vorüber.
»Ja, nicht wahr? Rüdiger ist ein Goldstück, nach dem sich manche Frau die Finger schleckt.«
Nach Goldstücken schleckte man sich nicht die Finger. Eher nach Miesmuscheln in Knoblauch-Weißweinsauce mit Spaghetti. Ich verzichtete auf eine Korrektur.
»Ich ahne es.« Rüdigers Stimme eilte ihm von der Wendeltreppe auf die Altane voraus. »Ein Gespräch von Frau zu Frau. Das tut sicher gut«, sagte der nun vollständig Erschienene und stellte ein Tablett mit drei Camparis und einer Platte Bruschette auf den Tisch. »Rucola und Schafskäse.« Er wies auf die aufgetürmten gerösteten Brotscheiben.
»Darf ich dabei sein?« Er zwinkerte erst mir und dann seiner Frau zu.
»Klar«, riefen Susanne und ich fast unisono.
Als hätten wir es einstudiert, griffen wir in perfekter Gleichzeitigkeit nach den Gläsern und prosteten uns mit einem Lächeln zu, das dem künstlichen Rosa des Getränks entsprach.
Josefs Abwesenheit tat uns nicht gut.
10
Er küsste die Sonne. Den von Strahlen umringten Mittelpunkt dieses kultisch verehrten Sterns: ihren Bauchnabel.
Noch nie hatte er ein Tattoo geküsst, was wohl daran lag, dass Helene seit mehr als sechsundzwanzig Jahren die einzige Frau war, die er geküsst hatte. Und die hatte keins.
»Ich muss los.« Nathalie schob Josef zur Seite. Er rollte sich auf den Rücken und verschränkte die Arme im Nacken. Keine ihrer Bewegungen wollte er sich entgehen lassen, keinen Moment verpassen. Er konnte immer noch nicht glauben, dass diese junge, schöne Frau, dieses ranke, antilopengleiche Geschöpf, das mit so federleichtem Schwung aus dem Bett gesprungen war und nun nackt vor ihm stand, ihn meinte. Ihn, Josef Abendrot. Den reifen Mann in der Blüte seiner Jahre.
»Komm zurück«, maunzte er wie ein liebeskranker Kater.
Ja, das war er. Er wollte sich nichts vormachen. So liebeskrank, dass er sich in manchen Momenten elend fühlte. Unruhig, zerstreut, verwirrt. Außer sich und dann doch wieder ganz bei sich.
»Geht nicht, ich treffe mich gleich mit Ivana wegen des Dienstplans. Du kannst dir aber ruhig Zeit lassen.«
Er wollte nicht ohne sie in ihrer Wohnung bleiben. »Nur noch fünf Minuten, komm!« Josef fasste ihre Hand und versuchte, sie zu sich zu ziehen, was Nathalie nicht zuließ. Lachend – und zu seiner Freude – griff sie dahin, wo sich sein ganzes Sehnen zentrierte, an seine Sonne.
»Du hast noch eine wahnsinnig gute Figur für dein Alter«, sagte sie, während sie sich dann doch von ihm zurückzog und nach ihrem BH griff. »Wenn ich da an meinen Vater denke, der ist zwei Jahre jünger als du und hat so einen Bauch.« Ihre Arme umschrieben einen imaginären Leibesumfang, der weit über den ihren, nicht vorhandenen, hinausreichte.
Josef zuckte zusammen. Das paradiesische Konzert, dem er hier beiwohnen durfte, war von einem Misston durchdrungen worden. Nein, von mehr als einem Misston, von zwei schrillen Lauten: Vater und zwei Jahre jünger.
»Na, na!« Er drohte schelmisch mit dem Zeigefinger. »Mit dem wirst du mich ja wohl gar nicht erst vergleichen wollen, auch wenn ich dabei besser wegkomme.« Sein Lachen klang ein wenig heiser und verlor sich auf halber Strecke.
»Nein«, sie beugte sich nun doch noch mal zu ihm und küsste ihn auf die Stirn. »Du bist mein Chef, mein großer Gebieter, mein Lehrmeister.« Mit gerunzelter Stirn und leicht gespitzten Lippen mimte sie Strenge.
Ihr Chef, das war er tatsächlich. Sie war seit drei Monaten Assistentin auf seiner Abteilung und seit bald zwei Monaten seine Geliebte. Die Sache mit dem Lehrmeister und Gebieter, so scherzhaft sie es auch gerade meinen mochte, wollte ihm schon eher gefallen. Dass es seine Reife war, sein Wissen, die Anerkennung, die er in seinem Fachgebiet genoss, die ihr so an ihm gefielen, hatte sie ihm schon mehrmals gesagt.
Nur das?, hatte er in aufgesetzt weinerlichem Ton gejammert und sie an sich gezogen, als sie das erste Mal ganz allein zusammen waren, in ihrer Wohnung mit Blick auf die Aare in Berns Altstadt. Nach einem Spaziergang und anschließendem Abendessen im Emmental, wo er nicht damit hatte rechnen müssen, von Bekannten oder Kollegen gesehen zu werden.
Nur das, hatte sie geantwortet, gurrend gelacht und ihre Worte gleich darauf Lügen gestraft.
Ah, was für eine Karussellfahrt hatte da begonnen. Auf und ab in sinnverwirrendem Tempo, kopfüber und um die eigene Achse gedreht. Nie hätte er gedacht, dass das Leben noch so etwas für ihn in petto hielt.
Unangenehm an diesem Taumel der Sinne war nur eins: das Heimkommen zu Helene.
Nicht, dass er ein schlechtes Gewissen hatte.
Oder vielleicht doch?
Zumindest hatte er in den letzten Monaten recht erfolgreich an der Technik gefeilt, eine solche Regung – wenn sie sich doch einzustellen erlaubte – blitzschnell in das Verlies zurückzubefördern, aus dem sie sich hatte befreien können.
Überhaupt, so befand er, stand ihm dieses Geschenk zu. Ja, es stand ihm zu! Das war die Beteuerung, die er sich selbst gebetsmühlenartig rezitierte. Jeder Mensch sollte solche Empfindungen haben dürfen, ohne sich deswegen schuldig zu fühlen. Es wäre grausam, ihm – nicht nur ihm, jedem! – etwas dieser Art zu verwehren. Selbstverständlich würde er auch Helene eine ähnliche Erfahrung zugestehen, käme sie denn in eine vergleichbare Situation, was er für unwahrscheinlich hielt. So unwahrscheinlich, dass er jeden Gedanken daran ins gleiche Verlies schubste, in das er auch die Störenfriede namens Skrupel beförderte.
Wirklich unangenehm waren die Geschichten, die er sich ausdenken musste, um seine Liaison geheim zu halten. Er hasste es zu lügen. Aber die Wahrheit war nun mal keine Option. Die wollte er Helene nicht zumuten. Die nötige Großmut würde sie, die in solchen Dingen doch eher in kleinbürgerlichen Denkschemata gefangen war, nicht aufbringen können. Und so blieben nur die kleinen Unwahrheiten, die den Nachteil in sich bargen, dass er sich genau daran erinnern musste, was er gesagt hatte. Sein Gedächtnis war, im Gegensatz zu dem von Helene, leider nicht das beste.
Als er nach jenen ersten Liebesstunden mit Nathalie spät in der Nacht, oder besser gesagt: am frühen Morgen, ins Schlafzimmer geschlichen war, hatte sie völlig aufgelöst im Bett gesessen. Josef, hatte sie geheult, ich dachte schon, du bist tot oder schwer verletzt.
Tatsächlich hatte er es in seinem Taumel versäumt gehabt, ihr per Textmitteilung die Geschichte zukommen zu lassen, die er sich zuvor ausgedacht hatte und die er nun nachträglich auftischen musste. Vom Kollegen Schneider, den Helene glücklicherweise nur flüchtig kannte, der in einer tiefen Ehekrise steckte und seine kollegial-freundschaftliche Unterstützung benötigt hatte. Das war nur teilweise gelogen, steckte Schneider doch wegen seiner Frauengeschichten in einer Dauerehekrise, die er allerdings sehr gut ohne Josefs Unterstützung zu meistern wusste.
Neun Stunden lang?, hatte Helene nicht ganz zu Unrecht gefragt, schniefend, mit roter Nase und verstrubbelten Haaren.
Mehr als ein schlichtes Ja war ihm dazu als Antwort nicht eingefallen. Mann, bin ich müde, hatte er noch gemurmelt und sich gleich darauf bis zum Haaransatz unter die Bettdecke geflüchtet, die ihn vor weiteren Fragen und dem sich doch noch aufdrängenden Gefühl beschützte, eigentlich ein Fiesling zu sein.
»Woran denkst du?« Nathalie stand vor dem Spiegel und zupfte an ihren braunen Locken. Ihre Blicke trafen sich.
»An unsere Zukunft. An die viele Zeit, die wir nun endlich zusammen haben werden, sobald ich in Schneiders Studio einziehen kann.«
»Ach, José.« Sie spitzte den Mund und ließ ihm einen gespiegelten Kuss zukommen. »Zukunft. So ein großes Wort. Unsere Gefühle sind im Hier und Jetzt.«
Da mochte sich recht haben, aber einen kleinen Blick ins Morgen wollte er ihr und sich gestatten.
11
»Ich bin dafür, dass wir jetzt mal die nächsten Tage durchplanen.« Spontaneität war Rüdiger zuwider.
»Gute Idee«, hatte Susanne gezwitschert. Sie begegnete den Vorschlägen ihres Mannes fast ausnahmslos mit Wohlwollen. Gereiztheit und Zwist wegen geräuschvoll zerknackten Pfefferminzbonbons oder verfehlten Abzweigern konnte ich mir bei den beiden schlichtweg nicht vorstellen.
War es das, was Josef in die Krise gestürzt hatte? Meine zugegebenermaßen oft recht kleinliche Art? Fühlte er sich nicht genügend geschätzt? Hatte ich das Fass zum Überlaufen gebracht? Oder hatte ich einfach eine weniger solide Sorte Mann, wie von Susanne suggeriert?
»Ihr könnt gerne Pläne machen, aber so wie die Dinge stehen, ist es besser, mich nicht einzubeziehen.« Entgegen Adriennes Rat, es mir eine Weile in Venedig gut gehen zu lassen, wollte ich nun doch nach Hause fahren. Was, wenn Josef litt? Er insgeheim auf meinen Beistand hoffte, aber nach seinem Verschwinden nicht wagte, mich um diesen zu bitten?
»Ach, Helenchen, nun nimm es doch mal entspannt. Der Josef kann jetzt ruhig ein paar Tage alleine vor sich hin grübeln. War ja seine Wahl.« Rüdiger strich über meinen Oberarm, was Susanne, vermutlich zusammen mit dem Helenchen, einen Zug um den Mund bescherte, der sich gemeinhin beim Biss in einen unreifen Apfel einstellte. Tatsächlich verzichtete sie zumindest bei dieser Gelegenheit darauf, einer Anmerkung ihres Mannes Beifall zu spenden.
Hatte Rüdiger recht? Ich war, wie so oft in diesen Tagen, hin und her gerissen. »Gut, morgen könnt ihr noch auf mich zählen, aber für übermorgen klammert ihr mich besser aus der Planung aus.«
Täuschte ich mich, oder hatten sich Susannes Züge gerade entspannt?
»Also, dann schlage ich vor, dass wir morgen nach Sant’Erasmo fahren. Dort können wir direkt vom Bauern die Castraure kaufen, die jungen Artischocken. Wär’ doch auch sonst mal interessant, oder? Also ich meine, nicht nur wegen der Artischocken.« Rüdiger hatte die letzte Miesmuschel aus ihrer schwarzen Ummantelung gepult und sie sich so genüsslich wie die erste in den Mund geschoben.
Der Schlaf hatte mir tatsächlich gutgetan. Ich fühlte mich ausgeruht und bereit für einen Ausflug zur Insel Sant’Erasmo.
»Susanne geht es nicht gut«, teilte mir Rüdiger vom Herd aus mit, wo er mit dem Zuschrauben seiner geliebten Moka zugange war. »Muss eine schlechte Muschel dabei gewesen sein. Dabei habe ich doch alle so genau kontrolliert. Eine nach der andern, mit äußerster Sorgfalt.« Er schien zerknirschter über seine unzureichende Inspektion als über Susannes Zustand.
»Oh, die Arme. Kann ich irgendetwas tun?«, fragte ich, ein bisschen pro forma, aber auch mit besten Absichten. Heute wollte ich gute Stimmung und keine Missklänge. Der Tag sollte im Zeichen der Eintracht stehen, schon allein deshalb, weil Josef es morgen oder übermorgen mit einer hübschen und entspannten Frau zu tun haben sollte, die man nicht für eine mehrwöchige Denkpause verließ.
»Nein, ich habe sie schon mit Medikamenten versorgt. Sie schläft jetzt. Ihre Nacht war anstrengend.« Er kam auf mich zu und legte die Hand auf meinen Rücken. »Setz dich, Helenchen. Kaffee ist gleich so weit.«
»Könntest du mich nicht einfach Helene nennen, Rüdiger? Ein Helenchen war ich für meinen Großvater.«
»Wenn du meinst.« Rüdiger klang gekränkt.
Nichtsdestotrotz war seine Hand von der Rückenmitte weiter nach unten gerutscht. Nur durch einen schnellen Schritt nach vorne und den flinken Griff nach dem erstbesten Stuhl konnte ich Rüdigers außergewöhnlichen Aufmerksamkeiten entkommen.
»Gut, dann bleiben wir eben zu Hause heute«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich lese auch gerne was. Bei mir im Zimmer oder oben auf der Terrasse. Muss ja nicht immer was auf dem Programm stehen.«
»Nein, nein. Natürlich fahren wir nach Sant’Erasmo wie geplant. Das würde Susanne auch gar nicht anders wollen.«
Da war ich mir nicht so sicher.
»Wir können doch nicht hier sitzen und Trübsal blasen.« Er hatte sich neben mich gesetzt und war näher an mich ran gerutscht. »Das Leben ist zu kurz fürs Traurigsein«, fügte er mit einem vieldeutigen Blick hinzu.
»Der Kaffee!«, rief ich, als wäre dieser ein lange verschollener Freund, der zu meiner großen Freude gerade aufgetaucht war. Die blubbernde und spuckende Kanne auf der Gasflamme schien auch Rüdiger wieder zur Besinnung zu bringen.
»Ja, trinken wir ein Tässchen.« Beim Aufrichten strich seine behaarte rechte Wade, unbedeckt vom kurzen Hosenbein der olivgrün-beige karierten Bermudas, wie zufällig an meinem linken Bein entlang.
»Hübsches Kleid«, sagte Rüdiger noch, während er sich der Espressokanne zuwandte. »Sieht gut aus bei deinen Beinen.«
Das war also Susannes Goldstück.
12
Sechs Anrufe von Tobi, die er nicht beantwortet hatte. Länger konnte er sich nicht verleugnen. Tobi war sein Sohn und hatte ein direktes Gespräch verdient. Natürlich hätte auch Helene mehr als nur eine Mail zugestanden, aber Josef scheute eine Auseinandersetzung am Telefon. Er wollte ihr auch Zeit lassen, seinen bevorstehenden – vorübergehenden? – Auszug zu verdauen. Die schriftliche Form, so sagte er sich, würde es Helene ermöglichen, ihre vielleicht überschäumenden Gefühle durch den räumlichen und zeitlichen Abstand in Akzeptanz übergehen zu lassen. Denn auch wenn er sich in seiner Mail an sie in den höchsten Tönen der Zuversicht ergangen hatte, was ihre Reife und Vernunft betraf, so befürchtete er doch, ein wenig an der Realität vorbei appelliert zu haben.
Nun also Tobi.