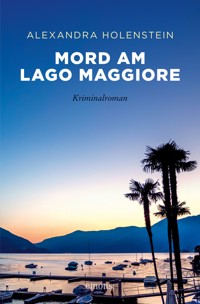8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Rache üben am Mann – was kann schöner sein? Perfekter Humor für Frauen, die das Leben kennen Berti Fischer, Frau in den nicht mehr ganz besten Jahren, traut ihren Ohren kaum, als Ehemann Heinrich ihr mitteilt, er habe nicht die Absicht, mit ihr alt zu werden. Bald findet Berti heraus, dass sie nicht die einzige ist, der Heinrich übel mitspielt. Offenbar hat er gleich mehreren Frauen in seinem privaten und beruflichen Umfeld das Gefühl gegeben, nur sie allein sei ihm wichtig. Berti sinnt auf Rache. Soll sie sich dafür mit den anderen Frauen verbünden? Was, wenn nicht alle dabei mit offenen Karten spielen und plötzlich lange Verheimlichtes an die Oberfläche drängt? Zwischen Zürich und Ascona am Lago Maggiore schmieden die Frauen ihren Plan. Jetzt hat Heinrich wirklich ein Problem…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Ähnliche
Alexandra Holenstein
Das Heinrich-Problem
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Meinem Mann
1
»Kein Croissant, kein Cappuccino! Das nimmt mir jede Freude am Aufstehen.« Bei jedem bekümmerten Kopfschütteln schaukelten Rosa Hallhubers Bernsteinohrgehänge, als nähmen sie regen Anteil an der trostlosen Vision.
Berti bezweifelte, dass der Verzicht auf das Frühstückscroissant bei ihrer Klientin zum gewünschten Gewichtsverlust führen würde. »Und, haben Sie das Ihrem Mann gesagt?«
»Nein. Wenn er mich schlanker haben möchte, dann muss ich mich eben beherrschen.«
Seit einer halben Stunde, und nicht zum ersten Mal, besprachen sie das mangelnde Interesse von Rosas Mann an seiner Ehefrau. Seine jüngste Feststellung, sie sei auch nicht mehr so eine Augenweide wie in früheren Jahren, hatte Rosa völlig entmutigt.
Berti Fischer war Coach für Lebensfragen im Allgemeinen und Beziehungsfragen im Besonderen. Ihre mit Abstand treueste und glücklicherweise auch gutbetuchte Klientin nahm eineinhalb der zwei Plätze des blauen Sofas ein, das sich in therapeutischer Distanz zu Bertis Sessel befand. Noch mehr Klienten von Rosa Hallhubers Kaliber – auf ihr zweimaliges wöchentliches Erscheinen war Verlass – wären für den Coaching-Betrieb in Bertis Studio wünschenswert gewesen
Männer verirrten sich selten in die Räumlichkeiten in der Löwenstraße und wenn, dann meist auf Geheiß ihrer Partnerinnen.
»Rosa, möchten Sie denn schlanker sein? Oder geht es Ihnen nur um die Wünsche Ihres Mannes?«
»Das kommt doch aufs Gleiche raus. Er oder ich. Ein paar von den Kilos müssen runter, fertig.« Das klang fast trotzig. Sie zupfte an ihrem Kaftan, unter dessen lilafarbenem Crepe de Chine sich die mehr schlecht als recht verborgene Masse befand, die Gegenstand des heutigen Gesprächs war.
»Das ist nicht egal. Es geht um Ihre Bedürfnisse, Rosa!« Berti äugte verstohlen auf ihre Armbanduhr. Ob sie es noch schaffte, den Braten fürs Abendessen rechtzeitig in den Ofen zu schieben? Heinrich wollte um halb acht zu Hause sein. Er wartete nicht gerne.
2
Vielleicht doch noch eine Scheibe Brasato? Zwei hatte sie sich schon genehmigt. So beiläufig wie möglich säbelte Berti ein schmales Bratenstück ab, beförderte es auf ihren Teller und träufelte ein wenig von der Weinsauce darüber. Heinrich nahm keine Notiz davon. Er goss sich vom Barolo nach, ohne ihrem leeren Glas Beachtung zu schenken.
»Ups!« Etwas von der tiefroten Kostbarkeit war daneben gegangen und er beeilte sich, die Leinentischdecke aus der Provence, Mitbringsel aus ihren letzten Ferien, mit der Serviette zu bearbeiten. Der Fleck ließ sich nicht wegreiben.
Heinrich rubbelte noch vehementer. »Ich werde ausziehen«, sagte er zur Tischdecke.
Dem Augenschein zum Trotz war die Mitteilung an Berti gerichtet und ließ sich so wenig ignorieren wie der Weinfleck.
»Salz!«
»Wie bitte?«
»Da muss Salz drauf.« Sie griff nach der Mühle mit dem Himalaya-Salz. Den unschönen Fleck ließ sie unter einer Decke zermahlener Kristalle verschwinden.
»Ende dieses Monats.« Heinrich faltete seine Serviette mit Sorgfalt. »Du kannst selbstverständlich hier in der Wohnung bleiben. Vorläufig jedenfalls. Danach müssen wir eine Lösung finden.«
Was redete Heinrich da? Wer war wir und welche Lösung?
Berti schob den Teller mit der Bratenscheibe von sich weg. Ihr war übel. Nacken und Schultern fühlten sich so steif an, als trüge sie eine Rüstung. »Wer ist es?«
»Alberta, wer ist wer?« Heinrich klang gereizt. Er schaute sie nun endlich direkt an. »Unsere Ehe ist doch schon lange nicht mehr das, was sie mal war. Das kann dir nicht entgangen sein.«
»Deshalb willst du ausziehen?« Und überhaupt, hatte sie Heinrich um eine Diagnose ihrer Ehe gebeten?
»Alberta, in den letzten zehn Jahren war unsere Beziehung, unser … Bündnis, wie ein Paar alte Pantoffeln. Bequem meinetwegen, aber ausgetreten und abgenutzt.«
Ihre Ehe zu einem Neutrum reduziert? Zu einem Pantoffel-Bündnis? Berti schluckte, wollte die Hand heben, ihm Einhalt gebieten. Aber Heinrich war nun in Fahrt. »Unattraktiv, ja, unattraktiv«, deklamierte er lauter als nötig. »Ich möchte nicht bis an mein Lebensende in diesen, na ja, Latschen rumlaufen.«
Berti stand auf und trug ihren Teller zur Kücheninsel. Die Fleischscheibe ließ sie in den Mülleimer gleiten. »Und nun hast du ein neues Paar Hausschuhe gefunden?« Sie musste sich am Rand der Spüle abstützen, so weich waren ihre Knie. Wieso Heinrich sie plötzlich Alberta nannte? In den zwanzig Jahren ihrer Ehe war sie immer Berti für ihn gewesen. Fast immer jedenfalls. »Wie sehen sie denn aus, die neuen Pantoffeln? Rosa Plüsch mit Pailletten oder eher Birkenstock?«
Berti wusste, wie sinnlos das war. Sarkasmus ist ein Kommunikationskiller. Das war es, was sie ihren Klientinnen immer sagte.
Aber die alten Latschen, in die Heinrich ihre Ehe gerade verwandelt hatte, waren vor ihrem inneren Auge zu einem gigantischen Paar abgewetzter Filzpantoffeln geworden, grau-braun kariert. Sie verwehrten ihr jede Sicht auf kluge Gedanken. »Oder ist sie eher der Barfußtyp? Und nenn mich nicht Alberta!«
So schrill war ihr der letzte Satz entfahren, dass Nixon, rabenschwarzer Beo und unerwünschtes Erbstück aus dem Haushalt von Heinrichs unlängst verstorbenen Mutter, aufgeregt krächzend auf der Stange seiner Voliere hin und her hüpfte.
Nein, so ging es nicht. Sie musste sich zusammenreißen. Und Ich-Mitteilungen formulieren. Nur wenn Sie in der ersten Person über Ihre Gefühle sprechen, kann der andere Ihre Bedürfnisse erschließen. Hatte sie nicht genau das letzthin in einer ihrer Sitzungen zum Besten gegeben?
»Ich fühle mich elend.« Ihre Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern.
Nixon hörte auf zu hüpfen und legte den Kopf schief. »Scratch«, sagte er und drückte sich gegen die Gitterstäbe. »Scratch!« Bertis Schwiegermutter hatte ihn aus Sri Lanka mitgebracht und Englisch mit ihm gesprochen, wie es schon sein vorheriger Besitzer getan hatte. Aber niemand kam heute seiner Aufforderung nach, ihn zu kratzen.
Heinrich trat zu Berti an die Spüle und legte seine Hand auf ihren Arm. »Das kann ich gut verstehen«, sagte er.
Gegen einen solchen Satz war an sich nichts einzuwenden. Berti hätte zustimmend genickt, hätte sie die letzten zehn Minuten aus ihrer Coach-Rolle heraus verfolgen können.
»Nichts kannst du verstehen«, rief jemand in der Küche mit sich überschlagender Stimme. »Null und nichts!« Der Jemand war sie.
3
»Was ist es, was Sie Ihrem Mann wirklich sagen möchten, Rosa?«
Es fiel Berti schwer sich zu konzentrieren. Ihre Gedanken schweiften unaufhörlich zu Heinrich und seiner unsäglichen Eröffnung beim Abendessen vor drei Tagen.
Für Rosas Dauerbrenner, den abwesenden und auch bei Anwesenheit unaufmerksamen Ehemann, konnte sie heute nicht das geringste Interesse aufbringen. Mehr noch, Rosas Lamentieren ging ihr auf die Nerven.
»Er sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar für ihn geworden.«
Das war unmöglich. Wer sollte ihre vollbusige Klientin in ihrem zeltartigen Gewand, königsblau und zinnoberrot, übersehen können?
»Gut, das sagten Sie bereits. Aber gäbe es eine Möglichkeit, Ihrem Mann Ihren Wunsch mitzuteilen? Direkt mitzuteilen?«
Die Sitzung war fast zu Ende. Berti konnte es kaum abwarten, Rosa aus ihrem Studio hinauszubefördern. Sie wollte etwas gegen ihre immer stärker werdenden Kopfschmerzen einnehmen und dann nach Hause gehen.
»Du siehst mich nicht!«
Berti stutzte. Was hatte es mit dem plötzlichen Du auf sich? Und warum sollte sie Rosa nicht sehen? Es dauerte einen Moment, bis sie in ihre Beratungsstunde zurückgefunden hatte. »Das ist kein Wunsch, Rosa. Das ist eine negative Formulierung. Heinrich wird darauf bestenfalls mit Verteidigung reagieren.« Das kam gereizter als beabsichtigt.
Rosa stand auf und strich sich ihr Gewand glatt. Mit pikierter Miene und klirrenden Armreifen griff sie nach ihrer Handtasche. »Helmut.«
»Wie bitte?«
»Mein Mann heißt Helmut, nicht Heinrich.«
»Natürlich. Entschuldigung.« Sie musste sich wirklich zusammenreißen.
4
Die Kopfschmerztablette hatte zu wirken begonnen. Nur gegen Herzschmerz konnte sie nichts ausrichten.
Nachdem Berti ihr Studio verlassen hatte, war ihr die Aussicht, in die leere Wohnung zurückzukehren, bedrückend erschienen.
Da wäre es doch viel besser, noch ein bisschen ins rege Treiben der Bahnhofstraße einzutauchen und dann an der Limmat die letzten Sonnenstrahlen zu genießen.
Der ungewöhnlich milde Oktobertag hatte die Leute aus den Häusern gelockt.
Am Paradeplatz beschloss sie, noch schnell einen Abstecher zu Sprüngli zu machen. O ja, ein Pappschächtelchen voll mit pastelligen Luxemburgerli! Von jeder Sorte eins.
Im Laden schien es ihr einen kurzen Moment lang so, als sähe sie aus der Menge der wartenden Kundschaft Heinrichs missbilligenden Blick auf sich gerichtet. Aber der Geisterheinrich war schnell verbannt.
»Und geben Sie mir bitte noch fünf von den Champagnertrüffeln dazu!«
Was ist es, was Ihnen die Schokolade geben kann? Ist das angenehme Gefühl von Dauer? Die Kurzlebigkeit des Trostes durch Naschereien war ein wiederkehrendes Thema in ihren Sitzungen. Und im Moment nur graue Theorie. Dann dauerte der Genuss eines Bisses in ein Macaron eben nur drei Sekunden. Sie nahm ein zartgrünes aus der goldenen Schachtel – Pistazie, ihre liebsten – und ließ es auf der Zunge zergehen.
Um sie herum Mütter und Väter mit Kinderwagen, schlendernde Pärchen, Bahnhofstraßen-Shopper, eilige Geschäftsleute mit ihren Handys am Ohr. Berti ließ sich in der Menge treiben. Für einen Moment gehörte sie wieder dazu.
Am Weinplatz wollte sie die Limmat in Richtung Rathaus überqueren, als sie plötzlich Heinrich sah. Diesmal war er nicht imaginär, sondern saß an einem der Tische des Boulevard-Cafés vom »Storchen«. An seiner Seite, ihm zugewandt, eine um einiges jüngere Rothaarige.
Berti trat vor die Auslagen einer der teuren Boutiquen am Weinplatz. Durch die Spiegelung des Schaufensterglases hatte sie die zwei im Visier. Ihr war, als müssten die wenige Schritte von ihr entfernten Amerikanerinnen, die die Auslagen im Gegensatz zu ihr tatsächlich begutachteten, ihr Herz pochen hören wie den einsetzenden Glockenschlag des nahen Fraumünsters.
Heinrich, dieser miese Kerl! Es war mitten am Nachmittag, gerade mal vier Uhr.
Für sie war er nie bereit gewesen, auch nur eine halbe Stunde Arbeitszeit zu opfern. Wie hätte sie sich über seine Begleitung gefreut, als sie sich vor drei Wochen für einen ambulanten Eingriff ins Spital begeben musste! Wirklich keine Zeit, meine Liebe hatte er ihr mitgeteilt. Glaub mir, niemandem tut das mehr leid als mir.
Stattdessen war dann ihre Freundin Lara mitgekommen und hatte den fürsorglichen Part übernommen. Aber klar, mit der schönen Rothaarigen konnte sie es nicht aufnehmen. Wie sie da saß, ihre schwarzbehosten Beine elegant übereinandergeschlagen, mit einem Fuß lässig wippend. Das war also das neue Paar Hausschuhe, das sich Heinrich für die kommenden Lebensjahre ausgesucht hatte!
Die zwei waren in ein angeregtes Gespräch vertieft, wobei sich bei der Rothaarigen zunehmende Aufregung zeigte. Sie gestikulierte und fegte dabei um ein Haar eines der beiden Proseccogläser vom Tisch. Ihre Stimme wurde lauter. Leider nicht laut genug für Berti, um etwas zu verstehen. Aber doch laut genug, um ihr einen kurzen Moment der Genugtuung zu bescheren. Sie stritten sich!
Wenn Heinrich etwas mehr verabscheute als Szenen, so waren es Szenen in der Öffentlichkeit. Die Rothaarige sprang nun heftig auf. Ihr Stuhl kippte nach hinten. Heinrich gelang es gerade noch, ihn aufzufangen.
Mit wehendem Trenchcoat stürmte sie in Richtung Storchengasse davon. Mit den hochhackigen Stiefeletten, die nicht fürs Stürmen auf Pflastersteinen gemacht waren, sah sie dabei einem staksenden Storch überraschend ähnlich.
Passt, dachte Berti und musste trotz allem lächeln. Und hatte sie richtig gesehen? Tränen im Gesicht der Rothaarigen? Nein, das musste eine Täuschung gewesen sein. Oder Wunschdenken. Sie war zu weit weg für solche Feinheiten.
Bei ihrer Heimkehr saß Heinrich bereits in seinem De Sede-Relaxsessel. Er war in die Lektüre der Neuen Zürcher Zeitung vertieft und blickte nicht auf, als Berti das Wohnzimmer betrat. Nach der Episode im Boulevard-Café musste er gleich nach Hause gefahren sein.
»Was gibt’s zum Abendessen?« Er richtete die Frage an die Zeitung. Seit wann schaute er sie eigentlich nicht mehr an, wenn er mit ihr sprach? Und warum war ihr das bisher nie aufgefallen?
Berti schloss die Tür zur Dachterrasse. Die Oktobersonne hatte sich zurückgezogen, jetzt wehte ein kühler Wind.
Sie ging durch den Wohnbereich zurück in die Diele, ohne dass Heinrich auch nur einmal von der Zeitung aufsah. In der Tasche ihres Mantels, sie hatte sich noch nicht mal die Zeit genommen ihn auszuziehen, bemerkte Berti die Sprüngli-Schachtel mit den Resten des Konfekts. In zerdrücktem Zustand.
»Warum bist du nicht in der Kanzlei? Und Abendessen um fünf?«, rief sie ihm zu.
Er kam ihr so fremd vor, dieser Mann, der sich da in ihr Wohnzimmer verirrt hatte, nachdem er sich noch kurz vorher mit einer jungen Frau getroffen hatte. Eine junge Frau, von deren Existenz Berti bis zu diesem Moment keine Ahnung gehabt hatte und die mit größter Wahrscheinlichkeit der Grund für seine Auszugsabsichten war. Aus der schützenden Dunkelheit des Flurs betrachtete sie den seelenruhig im Sessel sitzenden Heinrich.
Sie erinnerte sich, erst schemenhaft, dann mit klareren Konturen. Es musste vor knapp zwanzig Jahren gewesen sein. Oder weniger. Jedenfalls waren sie noch nicht lange verheiratet. Wie heute war sie nach ihm nach Hause gekommen. Nicht in diese Wohnung, eine bescheidenere. Heinrich hatte in einem Sessel gesessen. Nicht De Sede, auch da ein paar Nummern schlichter. Er hatte sie zu sich gerufen und dann an sich gezogen. Sie hatten sich mit einer akrobatischen Gewandtheit geliebt, zu der weder sie noch er heute in der Lage wären. Kurz vor dem Höhepunkt, ihrem oder seinem, hatte Heinrich einen Frauennamen gerufen, der eindeutig nicht der ihre war.
Beide – oder doch eher nur sie? – waren darüber so erschrocken gewesen, dass die Stimmung im Bruchteil einer Sekunde von ganz oben auf Null gesunken war. Heinrich hatte dann behauptet, er hätte sich in einem Augenblick der den Umständen zuzuschreibenden Verwirrung – ach, nur er konnte sich so ausdrücken – in verzerrter Form ihres Namens bedient. Was eine dreiste Lüge war. Das wusste er und das wusste sie.
Berti hatte es dann dabei bewenden lassen, wenn auch nicht sofort. Damals hatten so gut wie handylose Zeiten geherrscht. Da mussten noch Aktentaschen durchwühlt und Hosentascheninhalte nach außen befördert werden. Das Suchen nach Hinweisen zu einer … – verflixt, was war es nur für ein Name gewesen? – hatte sich erheblich aufwendiger gestaltet, als es dies mit den heutigen Möglichkeiten war. Und so war die Recherche denn auch ergebnislos geblieben.
Berti dachte an einen der vielen Wahlsprüche ihrer Großmutter. Appetit dürfen sie sich draußen holen (gemeint waren Ehemänner und sonst in irgendeiner Weise Angetraute), aber gegessen wird zu Hause. Heinrich hatte sich gewiss hin und wieder außer Haus Appetit geholt, den allergröbsten Hunger vielleicht mit, na ja, einem Salamirädchen oder einer Salzmandel gestillt, aber den Hauptgang hatte er bisher, so hatte sie gerne geglaubt, immer bei ihr eingenommen.
»Gnocchi mit Butter und Salbei gab’s schon lange nicht mehr.« Heinrichs Stimme durchdrang Bertis Reminiszenzen. Er hatte es natürlich nicht für nötig gehalten, auf eine ihrer Fragen zu antworten.
Bertis Großmutter war Italienerin gewesen. Aus den Abruzzen. Neben mehr oder weniger verlässlichen Lebensweisheiten und der Freude am Kochen mediterraner Gerichte hatte Berti von ihr die Angewohnheit übernommen, brodelndem Ärger hin und wieder auf pointierte Weise Luft zu verschaffen. Auf Italienisch. Und so mochte es Heinrich zwar erschrecken, aber letztlich doch wenig überraschen, als sie die zerdrückte Pralinenschachtel schwungvoll auf den Beistelltisch neben seinem Thron schmetterte. »Eccoti qua! Comincia con l’antipasto!«, zischte sie ihm ins Ohr.
Versuchen Sie konstruktiv zu bleiben! An ihren Coaching-Wahlspruch erinnerte sich Berti erst, als ihre Zimmertür knallend hinter ihr ins Schloss fiel.
Aber es gab ja auch dies: Ein Wutausbruch kann wie ein Gewitter sein. Es verfügt über eine kurzfristig reinigende Wirkung.
Mehr noch, es leitete in den meisten Fällen einen Wetterumschwung ein.
5
»Und du hast ihm die Gnocchi tatsächlich noch gemacht?« Lara schüttelte den Kopf.
Berti nickte beschämt. »Aber keine selbstgemachten!«
Wem wollte sie eigentlich etwas vorgaukeln?
»Und wann zieht er aus? Hoffentlich bald. Dann bist du diesen Egomanen endlich los!« Ihre Freundin Lara war die Erste gewesen, der Berti von Heinrichs Absicht erzählt hatte.
Sie hatte sie getröstet, schien aber selbst schockiert. Nach Bertis Resümee von der Episode am Weinplatz war sie sogar minutenlang verstummt.
»Komischerweise hat er in den letzten Tagen nichts mehr dazu gesagt. Ende des Monats, das wäre in drei Wochen. Im Moment tut er, als wenn nichts wäre.«
»Dann liegt es nun an dir, die Dinge in die Hand zu nehmen. Stell ihm die Koffer vor die Tür und fertig! Oder willst du der Spielball seiner Launen und Regungen sein?« Lara war wieder in alter Form.
Nein, natürlich wollte Berti das nicht. Aber ihre Freundin hatte gut reden. Sie lebte allein, hatte gelegentlich eine Verabredung und seltener auch mal eine Beziehung, die sich meistens nicht allzu lange hinzog und von der Berti trotz Laras sonstiger Redefreude immer nur wenig erfuhr.
So richtig betrübt schien Lara über ihr Singledasein nicht zu sein. Immer wieder betonte sie die Vorzüge ihrer Unabhängigkeit. Berti beschlich manchmal der Verdacht, ihre beste Freundin verstünde sich einfach in der Kunst, aus der Not eine Tugend zu machen. Aber was wusste sie schon? So wie die Dinge gerade standen, konnte sich Berti nicht mit den Wonnen der Ehe brüsten.
Klar war, Lara hatte kein Gefühl dafür, dass sich eine zwanzigjährige Beziehung nicht einfach so über Bord werfen ließ. Egal, was sich Heinrich gerade leistete.
Andererseits, hätte Berti ihre Klientinnen nicht auch zu mehr Entschlossenheit angeregt? Hätte sie ihnen nicht die mehr als berechtigte Frage gestellt, was sie zu tun beabsichtigten?
»Wir müssen rausfinden, wer die Rothaarige ist.« Lara rutschte von ihrem Hocker am Küchentresen und ging zu Nixons Voliere. Vorsichtig nahm er mit dem Schnabel das Bröckchen Parmesan, das sie ihm hinhielt und ließ sich anschließend den Hals kraulen.
»Com’on, com’on«, knarzte er leise. Es klang wie ein wohliges Seufzen.
Keiner konnte Nixon in so sanfte Stimmung versetzen wie Lara.
»Und dann, wenn ich es weiß? Soll ich sie zur Rede stellen oder am Kragen packen? Was würde es ändern, ihren Namen zu kennen?«
»Tu nicht so abgeklärt, Berti! Das nimmt dir sowieso niemand ab. Es ist immer gut, seinen Gegner zu kennen.« Lara spielte mit dem Ende ihres dicken, fast schwarzen Zopfes, den sie sich über die Schulter herangezogen hatte. Berti, selbst mit feinem, hellbraunem Haar ausgestattet, beneidete sie um ihre dunkle Pracht.
»Und was sagt Juliane zu den Absichten ihres Vaters? Hast du es ihr schon erzählt?«
Juliane war Heinrichs Tochter aus erster Ehe. Seit Berti Heinrich kannte, wurde sie immer wieder Zeugin von Julianes unermüdlichen Versuchen, die Aufmerksamkeit und Zuwendung ihres Vaters zu erringen. Nur selten mit Erfolg.
Am Anfang hatte Berti diese Tatsache mit stiller Genugtuung erfüllt. Als wäre es ein Ausdruck dafür, wie wenig ihm die Vor-Berti-Zeit bedeutete. Als stünde damit eine zusätzliche Portion Liebe für sie zur Verfügung. Liebe wie eine Geldsumme. Wenn man etwas an einer Stelle einsparte, konnte man an anderer Stelle mehr ausgeben. Nein, so funktionierte das mit den großen Gefühlen natürlich nicht.
Zu dieser Erkenntnis hatte sich nun eine neue gesellt: Heinrich hatte vermutlich gar nicht so viel von der Währung Liebe zu verteilen, weder um sie in ein Sparschwein zu stecken noch zur üppigen Verschwendung.
»Noch nicht«, antwortete Berti. »Ich will Juliane nicht beunruhigen, bevor klar ist, was passiert.«
»Wer sagt dir, dass es sie beunruhigen würde? Außer auf dich müsste sie doch auf niemanden verzichten.«
Berti sah Lara erstaunt an, sagte aber nichts zu der unerwarteten Provokation.
Sie hatte ihre Stieftochter Juliane über die Jahre liebgewonnen. Nicht nur, weil sie begriffen hatte, dass diese entgegen ihren ursprünglichen Befürchtungen nichts von Heinrichs Gefühlen abbekam, was in der Folge ihr abhanden gekommen wäre, sondern weil sie ein ganz kleines bisschen zu der Tochter geworden war, die sie selbst nicht hatte.
»Noch ein Limoncino?« Ohne die Antwort der Freundin abzuwarten, goss Berti ihr ein drittes Gläschen vom selbstgemachten Zitronenlikör ein. Auch sich selbst gönnte sie noch einen. »Zum Glück gibt’s dich!« Sie verbannte den nachhallenden Missklang – Lara hatte manchmal eine eigene Art von Humor – und hob ihr Glas. »Mit wem sonst könnte ich das alles besprechen?«
Lara lachte ihr raues Lara-Lachen. »Auf unsere Freundschaft!«
6
Leben Sie nach Ihren Bedürfnissen, nicht nach denen Ihres Mannes! Seine Aufmerksamkeit können Sie sich nicht erkaufen.«
Berti schaute auf ihre neuen Schuhe. Sie hatte sie am Vortag in einem kleinen Laden im Niederdorf erstanden. Der Anblick ihrer Beine, wie sie sich ihr so übereinandergeschlagen präsentierten, mit den schmalen roten Pumps als Krönung, versetzte sie in erstaunlich gute Laune.
Sie saß Rosa Hallhuber gegenüber, die auch heute wieder an ihrem Dauerthema strickte, dem lieblosen Mann. Dies seit einer Dreiviertelstunde.
Im Gegensatz zur vorhergehenden Sitzung war Berti heute in alter Form, einfühlsam und voller Sendungsbewusstsein. Ihre Klientin sollte spüren, wie sehr ihr deren seelisches Wohlbefinden am Herzen lag.
Rosa trug eine weitgeschnittene, vorhangartige Bluse mit Tigermotiv, die durchaus für Aufmerksamkeit sorgte. Nicht zuletzt, weil der Tiger beim Beben ihres üppigen Busens zu nicken schien.
»Nur wenn Sie ganz Sie selbst sind, kann Ihr Mann Sie neu erleben. Als eigenständige, interessante Persönlichkeit. Bleiben Sie bei sich! Und vor allem: Nehmen Sie ihr Leben in die Hand!«
Rosa seufzte. Der Tiger nickte. »Sie sagen das so leicht. Für Sie mag das einfach sein. Eine selbständige Frau, die erhobenen Hauptes und selbstbewusst ihren Weg geht.«
Was war das? Berti schaute ihre Klientin misstrauisch an. Sie fühlte sich durchschaut. Andererseits, Rosa lagen Doppelbödigkeit oder Ironie fern.
»Das Maß aller Dinge sind Sie selbst, Rosa. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen!«
Vielleicht trug sie nun doch ein wenig zu dick auf. Sie klang ja wie eine Wanderpredigerin.
Eine Weile schwiegen sie beide, was ungewöhnlich war. Rosa starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Auch das kam selten vor. Zumindest hatte Berti bisher keine kontemplative Seite an ihr entdecken können.
»Die Karibik!« Rosas Stimme durchschnitt die Stille. Es klang, als hätte sie eine wundersame Erscheinung.
Aber draußen waren weder karibische Kumuluswolken noch sich im Wind wiegende Palmwedel zu erspähen, nur trübes Novembergrau und das nasse Dach des gegenüberliegenden Hauses.
»Hm, wie meinen Sie das?« Berti war ein wenig ratlos.
Rosa blickte nun wieder zu ihr hin. Ihre Augen funkelten. »Eine Kreuzfahrt in die Karibik! Ich werde eine Kreuzfahrt machen. Ohne Helmut! Wie viele Jahre habe ich ihn zum Golf begleitet. Nach Schottland, nach England, nach Bayern. Golf hinten, Golf vorne. Das viele Grün! Immer habe ich das mitgemacht. Habe mich in karierte Hosen gezwängt und hässliche Schnürschuhe mit Fransen getragen.« Ihrer beider Blicke glitten zu Rosas zierlichen Lacklederballerinas, dem Gegenentwurf zu derbem Schuhwerk, die so gar nicht für die Masse bestimmt waren, die sie beherbergen mussten.
»Und wofür?« Rosa sah Berti so empört an, dass sie sich fast mitschuldig fühlte für den derart vergeudeten Einsatz.
Mit Schwung und verblüffender Leichtigkeit erhob sich Rosa Hallhuber und eilte zur Tür, als wenn die karibischen Rumcocktails und Calypsoklänge nun wirklich nicht mehr länger warten dürften.
»Ich werde mich melden«, rief sie noch über die Schulter weg, als sie aus dem Studio rauschte.
»Rosa, Moment!« Berti starrte auf die bereits wieder geschlossene Tür. Wie stellte sich ihre Klientin das vor? Ließ sie hier einfach so sitzen.
Und wofür? Rosas aufgebrachte Frage klang in Berti nach.
Wofür, was jetzt, wohin? Das musste auch sie sich überlegen.
7
Unschlüssig stand sie vor der schweren Eichentür mit den Messingbeschlägen in der Bellerivestraße. Sollte sie tatsächlich hoch in den dritten Stock gehen?
Den langen Weg von der Altstadt bis hierher war Berti zu Fuß gegangen. Das Laufen hatte ihr gut getan an diesem grauen aber milden Nachmittag. Zu grau, um allzu viele Spaziergänger an die Seepromenade zu locken, wo sie sich eine Weile auf einer der grünen Bänke niedergelassen und den Schwänen und den schaukelnden Booten auf dem See zugeschaut hatte. Das rhythmische Gurgeln der gegen die Quaimauern schlagenden Wellen hatte sie schläfrig gemacht. Sie hatte die Augen geschlossen und ihre trüben Gedanken von den Wellen aufsaugen lassen. So war es ihr zumindest für eine kurze Weile erschienen. Aber der Trübsinn war nicht im graublauen Wasser verschwunden, sondern hatte sich zu ihr zurückgeschlichen wie ein aufdringlicher Bekannter.
Früher hatte sie öfter mal bei Heinrich in der Kanzlei vorbeigeschaut. Er hatte sich über ihre Besuche gefreut und, wenn gerade nichts Dringendes anstand, mit ihr einen Kaffee am Konferenztisch getrunken, von dem aus sie ein Stück vom See und dem gegenüberliegenden Ufer erhaschen konnten.
Ist vielleicht doch nicht so gut, hatte er dann irgendwann mal gesagt. Nicht, dass meine Mandanten noch auf die Idee kommen, ich hätte nicht genügend zu tun.
Sie konnte sich nicht erinnern, dass in all der Zeit ein Mandant Zeuge dieser kleinen Pausen geworden war. Trotzdem war sie immer seltener zu ihm in die Bellerivestraße gekommen. Und irgendwann gar nicht mehr.
Aber jetzt war sie hier. Kurz vor den Pforten zu Heinrichs Reich. Unschlüssig und nervös wie eine Bittstellerin. Reiß dich zusammen! Eine Lebensberaterin, die anderen auf die Sprünge helfen sollte und es selbst nicht mal schaffte, ihren Mann um ein klärendes Gespräch zu bitten? Sie drückte auf den Klingelknopf.
Dr. Heinrich Fischer – Rechtsanwalt – Handel- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht
Und gleich noch ein zweites Mal.
Der Türöffner surrte, das Schloss gab nach. Hatte Martha Spiess früher nicht immer durch die Gegensprechanlage nachgefragt, wer um Einlass bat? Mit entschlossenem Schritt stapfte sie in den dritten Stock und verzichtete auf ein erneutes Läuten an der Eingangstür zur Kanzlei.
Heinrichs Sekretärin saß wie gewohnt an ihrem Schreibtisch im Empfangsraum, schaute aber nur kurz auf und machte keine Anstalten, Berti zu begrüßen. Vor ihr stand eine Packung Kleenex, die sich gerade im Großeinsatz befand. Gebrauchte Tücher lagen nachlässig zerknüllt daneben. Martha Spiess betupfte sich schniefend die Nase. Um die Augenpartie hatte sich das Mascara-Schwarz unschön verschmiert. Ob Berti sie darauf hinweisen sollte? Sie hatte Spiesschen, wie Heinrich seine Sekretärin manchmal nannte, noch nie auf irgendetwas hingewiesen.
Sie kannte die Regentin des Vorzimmers nur in Perfektion. Widerspenstige Haare, Knitterfalten oder Flecken gab es bei ihr nicht. Heute jedoch hing die Schleife ihrer perlweißen Seidenbluse schlaff nach unten und ihr blondgesträhnter Pagenschnitt wies kuriose Eigenwilligkeiten auf.
»Guten Tag, Frau Spiess!« Das kam etwas zu beschwingt daher. »Ich wollte zu meinem Mann. Hat er Termine mit Mandanten in der nächsten Stunde?«
Martha Spiess’ Manieren waren für gewöhnlich von der gleichen Untadeligkeit wie ihre äußere Erscheinung. Aber statt Berti zu antworten, stand sie auf, ging zur Kaffeemaschine und machte sich immer noch schniefend an die Zubereitung eines Kaffees. »Auch einen?«
»Gerne, danke.«
Heinrich zeigte sich nicht. Vermutlich hatte er gar nicht mitbekommen, dass sie hier war. Vielleicht konnte sie in Erfahrung bringen, was Martha Spiess so aus der Fassung gebracht hatte.
»So ein gemeiner Kerl!« Martha schob die zweite Tasse unter den Auslauf und drückte auf den Knopf für Café Creme. Zischend wurde der Kaffee in die Tasse gespien.
Hatte sie richtig gehört? »Meinen Sie meinen Mann?« Berti tat ein paar Schritte zu Martha hin.
»Hm, hm.«
Seit fünfzehn Jahren war Heinrichs Sekretärin die Seele der Kanzlei. Auch wenn Berti nicht mehr oft hierher kam, war ihr doch nicht entgangen, mit welcher Loyalität und Effizienz sie sich einbrachte. Seit dem Tod ihres Mannes, vor sieben Jahren, hatte sich noch eine Extraportion Aufopferung hinzugesellt. Heinrich war für Martha, so war es Berti oft vorgekommen, mehr als nur ihr Arbeitgeber. Er war …, ja, er war fast ein Gebieter. Was hatte er sich nur zu Schulden kommen lassen, um nun zu einem gemeinen Kerl zu mutieren?
Martha schaute ratlos auf die zwei gefüllten Tassen in ihren leicht zitternden Händen. Ihr Zorn musste sie ordentlich durchgeschüttelt haben.
»Wie wär’s da drüben am Fenster?«, sprang Berti ein. Sie wies auf die zwei Freischwinger am kleinen Glastisch, die für wartende Mandanten gedacht waren. Martha stellte die Tassen so heftig auf dem Tisch ab, dass ein wenig ihres Inhalts auf die Untertassen schwappte. Es war heute nicht wie immer.
»Er will mich loswerden.«
»Was? Äh … wie bitte?«
»Ich bin altes Eisen.« Martha, die sich auf ihren Stuhl hatte fallen lassen, rührte mechanisch in ihrer Tasse.
»Das müssen Sie mir jetzt aber …« Berti konnte ihren Satz nicht fertig sprechen, denn die Tür von Heinrichs Büro wurde schwungvoll aufgerissen. Fragend blickte Heinrich auf die zwei Frauen am Fenster.
»Was machst du denn hier, Alberta? Waren wir etwa verabredet?« Natürlich wusste er, dass sie nicht verabredet waren. Sein Auflachen, als amüsierte er sich über diese eventuelle Vergesslichkeit, erinnerte Berti für einen Moment an den zu Hause wartenden Nixon, dessen Repertoire auch ein hyänenhaftes Keckern umfasste.
»Nein, Heinrich. Das waren wir nicht.« Berti leerte ihre Tasse zur Hälfte, stand auf und griff nach ihrer Tasche. Sie hatte nicht mehr das Bedürfnis, mit ihrem Mann zu sprechen. Zumindest nicht hier und heute. Zuvor wollte sie herausfinden, was es mit der derangierten Martha und dem fiesen Kerl auf sich hatte, auch wenn sich das nicht jetzt bewerkstelligen ließ. Heinrichs fragenden Blick ignorierend, wandte sie sich Martha zu. »Das mit dem Kaffee müssen wir unbedingt wiederholen. Mal in aller Ruhe.« Sie zwinkerte dabei konspirativ, was zwar nicht zu der Beziehung passte, die sie mit Martha Spiess unterhielt, ihr aber schon deshalb gefiel, weil es Heinrich sichtlich nicht behagte. Sie bedachte ihn mit einem sparsamen Lächeln, bevor sie die Kanzleitür hinter sich schloss.
Im Treppenhaus blieb sie erst mal stehen.
Was in drei Teufels Namen ritt Heinrich eigentlich, dass er sogar Martha gegen sich aufbrachte? Martha, die doch alles für ihn tat oder tun würde. Fast alles, zumindest.
Ein gerittener Heinrich, eine Martha mit schlaffer Blusenschleife und zittrigen Händen? Bring es in Erfahrung, Berti, wies sie sich selbst an.
8
»Dass du ihm tatsächlich noch seine Klamotten bügelst! Unglaublich.« Lara war streng wie immer. Manchmal tat Berti das gut. Heute fand sie die Freundin überheblich. Was wusste Lara schon?
»Der grast auf anderen Weiden und du stehst derweil am Bügelbrett und faltest seine blauen Unterhosen zu schrankfertigen Quadraten.«
Das stimmte. Heinrich hatte vornehmlich hellblaue Boxershorts, die sie ihm tatsächlich bügelte. Da hatte Lara einen Zufallstreffer gelandet, denn drei dieser Exemplare lagen bereits säuberlich gestapelt auf der Ablage.
Berti hatte ihr Telefon neben sich liegen und auf Lautsprecher gestellt. So plauderten sie seit einer Viertelstunde
»Ich bügle gerne. Das ist eine Art Meditation.« Das Bügeleisen spie gar nicht meditativ Dampf aus seinen Düsen, wie ein verärgerter Drache.
»So, so.« Laras Schnauben klang nicht unähnlich. »Du musst dich nicht rechtfertigen. Tu, was du willst.«
Die Wahrheit war, Berti brachte es einfach nicht fertig, seine Wäsche nicht zu waschen, nicht zu bügeln.
»Ich muss jetzt Schluss machen, hab noch eine Klientin. Tschüss, Lara.«
Ein Druck auf die rote Hörerikone und Ruhe herrschte. Das mit der Klientin war gelogen, aber Laras Kritik ging ihr heute auf die Nerven.
Sie griff nach Heinrichs Jeans und legte sie aufs Bügelbrett. Röhrenjeans! Auch nicht irgendeine Wald-und Wiesenmarke, sondern ein Exemplar, das 7 for all Mankind hieß und knapp dreihundert Franken gekostet hatte. Das Preisschild hatte sie aus dem Abfalleimer im Bad gefischt. Der Himmel wusste, warum eine Jeans so viel kosten und einen derart überkandidelten Namen haben musste. Dabei hatte Heinrich einen knochigen Hintern und dürre Beine, was von dem modischen Teil eher ungünstig betont wurde. Ein Tatbestand, der ihm selbst allerdings zu entgehen schien, hatte Berti ihn doch vor zwei Tagen beobachtet, wie er mit der neuen Hose vor dem Spiegel posiert hatte.
Erste Anzeichen von Bauchwölbungen bekämpfte Heinrich rigoros mit Muskeltraining an seiner Kraftstation, mit gutem Ergebnis. Aber vom jugendlichen Verführer, für den er sich selbstgefällig gockelnd zu halten schien, war er nun mal weit entfernt.
Berti griff noch mal nach der fertig gebügelten Jeans und legte sie aufs Brett zurück. Dabei lächelte sie hinterhältig. Wenn schon Bügelfalten, dann überall. Mit Hingabe und Extradruck verpasste sie der Mankind messerscharfe Kanten. Ein modisches Unding. Sie probte schon mal den unschuldigen Gesichtsausdruck, den sie aufsetzen wollte, falls Heinrich sie zur Rechenschaft ziehen würde. Aber du sagst doch immer, du möchtest, dass deine Sachen akkurat gebügelt sind!
Eigentlich war heute ein Rosa-Hallhuber-Tag, aber ihre sonst so unermüdliche Klientin hatte ihren Termin am Vorabend abgesagt. Nicht ganz aus heiterem Himmel, wenn Berti an Rosas energischen Abgang bei der letzten Sitzung dachte, auch wenn sie Zweifel an Rosas Entschlossenheit gehegt hatte.
»Am Sonntag geht’s los in die Karibik. Einschiffung in Genua. Außenkabine, Luxusklasse. Drei Wochen.« Rosa hatte getrillert wie ein Grünfink.
Berti hätte sich mit ihr freuen sollen, aber es gelang ihr nicht recht. Was war los mit ihr?
»Haben Sie nicht Lust mit mir shoppen zu gehen, meine Liebe? Sie haben doch so einen guten Geschmack. Meiner Kreuzfahrtgarderobe fehlen noch ein paar spritzige Teile.« Rosa ließ sich von Bertis Zurückhaltung nicht beirren.
»Nein, dafür bin ich nicht geeignet«, hatte Berti leicht pikiert geantwortet. Schließlich war sie Beziehungscoach und kein Personal Shopper.
»Ich lebe jetzt nach meinem Begehren«, hatte Rosa dann noch resümiert. »Wie Sie es mir geraten haben.«
Berti hatte ihr zu dem Entschluss gratuliert und eine gute Reise gewünscht. Auch das war ein wenig knapp geraten.
Jetzt hatte sie also mehr Zeit, als ihr gerade lieb war. Die gebügelte Wäsche war in den Schränken versorgt, das Bügelbrett verstaut. Nun konnte sie eigentlich mal den Gewürzschrank ausräumen, auswischen und neu sortieren, was sie schon längst hatte tun wollen.
9
Im Flur, auf dem Weg zur Kücheninsel, hielt Berti inne. Jemand war im Begriff, die Haustür aufzuschließen. Heinrich, um diese Zeit? Er kam am Mittag selten nach Hause und wenn, dann nicht vor zwölf Uhr.
Die Tür wurde vorsichtig geöffnet. Nein, Heinrich war das nicht. Berti zog reflexartig einen Regenschirm aus dem Schirmständer. Dummerweise den mit der defekten Automatik, der sich, kaum aus dem Ständer befreit, zu voller Größe aufspannte.
»Was wollen Sie hier?« Berti schaute in das erschrockene Gesicht der Rothaarigen. Den geöffneten Schirm hielt sie in der Hand wie Mary Poppins.
»Ich …, ich dachte … Wieso sind Sie hier?«
»Ma, andiamo proprio bene!« Da war sie wieder, ihre Sprache des Affekts. »Wieso ich in meiner Wohnung bin?« Bertis Furcht, es mit einem Einbrecher zu tun zu haben, war beim Anblick der jungen Frau vom Boulevard-Café am Weinplatz in Ärger übergeschwappt.
»Erklären Sie mir auf der Stelle, weshalb Sie einen Schlüssel haben und was Sie hier suchen!« Das hätte vermutlich souveräner geklungen, hätte sie nicht nebenher einen Kampf mit dem widerspenstigen Regenschirm ausfechten müssen, der sich nicht mehr bändigen ließ. Wütend stopfte sie ihn zurück in den Ständer.
»Heinrich sagte, Sie wären nicht zu Hause.« Es schien nicht viel zu fehlen und die Rothaarige würde die Flucht ergreifen.
Berti begann an der Rolle der unrechtmäßig behelligten Wohnungsbesitzerin Gefallen zu finden. Das war ein Heimspiel! »Ach, und das ist ein Grund, dass Sie sich hier widerrechtlich Zutritt verschaffen? Das ist Hausfriedensbruch.«
Die Wohnung gehörte Heinrich und ihr zusammen, und wenn Heinrich seiner Flamme den Schlüssel gegeben hatte, und danach sah es aus, dann war das nicht widerrechtlich und auch kein Hausfriedensbruch. Aber dreist war es allemal und Berti gerade so richtig in Fahrt.
»Ich sollte seinen Rollkoffer für ihn holen.« Die junge Frau trat auf Berti zu und streckte ihr die Hand entgegen. »Ich heiße übrigens Sylvia. Sylvia Bächthold. Ich vermute, Heinrich hat Ihnen … nichts … von mir erzählt.«
War das nun Flucht nach vorne, Unverschämtheit oder einfach nur Naivität? In Berti fuhren die Gefühle und Gedanken Achterbahn.
Sollte sie nach der ausgestreckten Hand greifen? Gängige Benimmregeln für solche Fälle waren ihr nicht bekannt. Sie entschied sich für eine reduzierte, schlaffe Form des Händeschüttelns, die sie eigentlich hasste. Vorstellen brauchte sie sich natürlich genau so wenig, wie das floskelhafte Freut mich nicht rausrutschen durfte, das sich schon auf ihrer Zungenspitze befunden hatte.
Und ob sie von Sylvia wusste, ob Heinrich ihr von seiner Geliebten erzählt hatte oder nicht, darüber würde sie die junge Dame gewiss nicht aufklären.
Berti beschloss jedoch, sich die eigenartige Situation zunutze zu machen. Warum sollte sie nicht mit einem Gespräch ein wenig Licht in die Angelegenheit bringen? »Wenn Sie schon mal hier sind, dann trinken Sie doch einen Tee mit mir«, knurrte sie.
Ohne eine Antwort abzuwarten, steuerte sie in Richtung Kücheninsel. Sylvia folgte ihr.
»Scratch, scratch«, krächzte Nixon begeistert und drückte sich anbiedernd – Verräter! – gegen das Gitter seines Reichs. Kannte er Sylvia etwa? Normalerweise verfiel er in Schweigen, wenn Fremde in die Nähe kamen.
»Ein Beo?«
»Mmhm. Heinrichs Mitgift. Ohne den kriegen Sie meinen Mann nicht.« Warum machte sie plötzlich dümmliche Witze?
»Sie mögen ihn nicht?«
»Wen, Heinrich?«
»Nein, den Beo.« Sylvia lächelte.
»Vögel sind nicht so mein Ding.« Nun aber fertig mit dem Geplänkel! Auch wenn sie es selbst vom Zaun gebrochen hatte. »Setzen Sie sich, Frau Bächthold.«
Und während sie das Wasser aufsetzte: »Jetzt würde ich doch gerne wissen, weshalb Sie für Heinrich Botengänge machen.«
»Fürs Wochenende, für Mailand.« Das kam leise.
So war das also. Ihr hatte Heinrich erzählt, er wolle für zwei Tage zu seinem Freund Jakob. Stattdessen sollte es also nach Mailand gehen. Mit Sylvia.
Nicht, dass das allzu viel änderte. Wie die Dinge standen, konnten Berti seine Unwahrheiten eigentlich egal sein. Aber das waren sie trotz allem nicht. »Aha, und seinen verdammten Koffer kann er nicht selber holen?«
Heinrich hatte ihr beim Frühstück mitgeteilt, er wolle gleich nach Feierabend direkt von der Kanzlei zu Jakob nach Davos aufbrechen. Offenbar hatte er den Koffer zu Hause vergessen und in alter Heinrich-Manier eine willfährige Dienstbotin fürs Herbeischaffen gefunden.
Seine Frau wähnte er schließlich außer Haus, wie jeden Mittwochvormittag.
Das Wasser kochte, und Berti übergoss die Grünteeblätter, die eigentlich kein siedendes Wasser vertrugen. »Zucker?« Sie stellte die Teegläser und die Kanne auf den Tisch.
Sylvia schüttelte den Kopf. »Nein, danke.« Und dann, fast nahtlos, als habe es was mit dem Zucker zu tun: »Es tut mir leid. Das ist eine schreckliche Situation.«
»Was ist eine schreckliche Situation?« Berti tat, als hätte sie keine Ahnung, was ihr Gegenüber meinen könnte.
Sylvia stand auf und ging zu Nixons Voliere. Wieder drückte sich der Treulose dicht an die Stäbe und ließ sich die aufgeplusterte Stelle unterhalb des gelben Halsstreifens kraulen.
»Heinrich und ich haben eine Aff…, äh, ein Verhält…, also eine Beziehung. Wir …«
»Scratch!«, exklamierte Nixon erneut und Sylvia erfüllte ihm seinen Wunsch. »Das tut mir alles wirklich sehr leid«, sagte sie zu Nixon, dem ihre Schuldgefühle völlig egal waren.
»Das erwähnten Sie bereits.« Dieses Dauer-Bedauern ging Berti auf die Nerven und ihr Ärger kam wieder hoch.
Sylvia setzte sich nochmals an den Tisch und nippte an ihrem Tee. Es hatte den Anschein, als begänne sie, sich hier heimisch zu fühlen, was nun wirklich nicht in Bertis Sinne war.
Aber offenbar wollte sie noch etwas loswerden: »Es ist nicht einfach mit Heinrich«, druckste sie.
Was sollte das? Suchte die Geliebte Trost bei der Ehefrau oder erwartete sie, dass diese dem heimlichen Paar mit Coaching zur Seite stand? Berti verbrannte sich mit einem hastig genommenen Schluck des heißen Getränks die Zunge. »Nicht einfach? Da dürften Sie recht haben. Es gibt da nämlich noch ein kleines Hindernis: meine Wenigkeit.«
Sylvia zuckte zusammen. Die ungewöhnliche Situation – Geliebte trinkt mit Ehefrau Tee, nachdem sie sich zuvor Zutritt zu deren Wohnung verschafft hat – wurde ihr jetzt wohl auch wieder bewusst. »Ja, natürlich. Ich gehe jetzt wohl besser.« Auf einmal hatte sie es eilig.
Berti blieb am Tisch sitzen. Nein, zur Tür brachte sie Sylvia Bächthold nun doch nicht. Ob Freiherr von Knigge Benimmregeln für eine solche Situation vorgesehen hatte?
Sie hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel.
Seinen Koffer musste Heinrich wohl doch selber holen.
10
»Das glaube ich dir nicht!« Juliane hatte ihren strengen Blick aufgesetzt. Das Kinn vorgereckt, die Lippen schmal. Einer der seltenen Momente, in dem sie ihrem Vater ähnelte. Das dir war nicht zufällig gesetzt, denn es war mehr als nur ein Nicht-Glauben. Sie glaubte Berti nicht.
Zürich war im Novembernebel verschwunden. Er hatte sich wie ein Tuch über die Stadt und das Limmattal gelegt und die Welt in oben und unten geteilt. Sie hatten die Sonnenseite für sich und den Ausblick auf die Alpen. Die unten hatten das Grau.
»Und warum nicht?« Im Grunde kannte Berti die Antwort auf ihre Frage: Weil Heinrich ein guter Mensch war und sie Heinrich nicht anschwärzen durfte.
»Du hättest dich mehr um ihn kümmern müssen. Er hat es verdient!«
Hatte sie richtig gehört? Kümmern? Oder war das etwa ironisch gemeint? Dann könnten sie nun gemeinsam lachen. Aber Ironie passte nicht zu Heinrichs Tochter.
Sie saßen schon eine Weile auf einer Bank am Uetliberg. Die Plauderpause im Sonnenschein bei immer noch angenehmen Temperaturen und der gewaltige Ausblick waren die Krönung ihrer zweistündigen Walking-Tour.
Juliane hielt den Kopf gesenkt und flocht Zöpfchen aus den Fransen ihres selbstgestrickten Schals. Ein Vorhang ihrer dunklen, schulterlangen Haare verdeckte jeden Einblick auf das nach unten geneigte Profil, so dass Berti nicht erraten konnte, wie das mit dem Mehr Kümmern nun gemeint war.
An Juliane war alles selbst: selbstgestrickt, selbstgenäht, selbstgefärbt, selbstgeschnitten.
Sie beglückte ihren Vater mit nicht versiegendem Elan mit Produkten ihres kreativen Tuns. Weder die Tatsache, dass sich Heinrich nicht mal die Mühe machte, für die gebatikten Krawatten und gestrickten Wollmützen Freude zu heucheln, noch dass er jemals etwas davon getragen hätte, taten ihrer Schenkfreude Abbruch.
»Du meinst also, ich hätte für deinen Vater nicht genügend getan? Was hätte ich denn deiner Meinung nach mehr oder besser machen sollen?« Berti war nun wirklich neugierig. Was konnte Juliane denn über ihre Ehe wissen? Es war Berti, die Heinrich darauf aufmerksam machte, dass es an der Zeit war, seine Tochter mal wieder einzuladen oder auch nur anzurufen. Wenn jemandem Nachlässigkeiten vorgeworfen werden konnten, dann doch ihm!
»Du zeigst kein Interesse für seine Arbeit und seine Sorgen. Und du gibst ihm nicht genügend zu verstehen, wie sehr du ihn schätzt …«
Wie kam Juliane auf die Idee? Und überhaupt, aus welchem Jahrhundert waren die Vorstellungen dieser jungen Frau? Berti war erschrocken, aber auch verärgert.
»Papa ist ein wunderbarer Mann! Ich weiß nicht, Berti, ob du das begriffen hast.«
Nun war es aber genug! »So, und wo war dieser wunderbare Mann all die Jahre? Wo war er, wenn du am Telefon nach ihm gefragt hast? All die Male, an denen er aus nichtigen Gründen Verabredungen mit dir versäumt hat? Ich musste seine lausigen Ausreden zurechtfeilen.« Berti überschritt rote Linien, aber sie war nicht zu bremsen. »Dieser wunderbare Mann, für dessen Sorgen ich mich deiner Meinung nach nicht genügend interessiere, hat nicht die geringsten Skrupel, seine Frau nach zwanzig Ehejahren mit einer um einige Jahre jüngeren Geliebten zu betrügen. Die Sorgen, die er dir und mir bereitet, scheinen dir aber allem Anschein nach nicht wichtig zu sein.« Berti schnappte nach Luft. »Mehr Bewunderung! Dass ich nicht lache.«
Juliane schaute sie mit zusammengekniffenen Augen an.