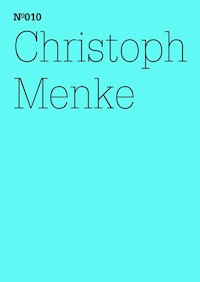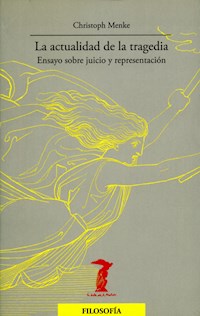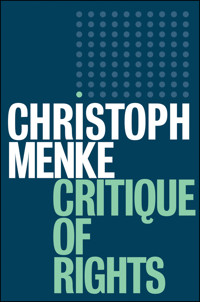17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hegels entscheidender Schritt in der Freiheitstheorie besteht in der Einsicht, dass Freiheit kein Zustand, sondern ein Prozess ist: der Prozess der Befreiung. Das Reich der Freiheit gibt es nicht, Freiheit gibt es nur in ihrem Werden. Hegel begründet diese These durch eine kritische Theorie der Gesellschaft, die deren inneren Widerspruch entfaltet: Er zeigt, dass es Freiheit nur in der sozialen Teilnahme gibt, sich aber in der sozialen Welt zugleich eine »zweite Natur« bildet, die die Freiheit erstickt. In der Entfaltung dieser These lesen Christoph Menkes brillante Studien Hegel nicht als Vollender, sondern als einen Entdecker von Problemen, die die Philosophie bis heute umtreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Christoph Menke
Autonomie und Befreiung
Studien zu Hegel
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
James Conant und Andrea Kern
:
Analytischer Deutscher Idealismus Vorwort zur Buchreihe
Autonomie und Befreiung
Vorwort
I
. Dialektik der Befreiung
1. Autonomie und Befreiung
2. Freiheit und Gesellschaft. Die Dialektik der Bildung
3. Geist und Leben. Von der Phänomenologie zur Genealogie
II
. Kritik und Affirmation
4. Zweite Natur. Der schwerste Punkt
5. Setzen von Sein. Vom Zeichen zum Werk
6. Ja und Nein. Die Negativität der Dialektik
Nachweise
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
10
11
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
7James Conant und Andrea Kern
Analytischer Deutscher IdealismusVorwort zur Buchreihe
Die Philosophie des Deutschen Idealismus – und damit meinen wir die Philosophie von Kant bis Hegel – scheint vielen durch die analytische Philosophie überholt. Nicht selten wird sie als Gegenprojekt zu dieser Tradition der Philosophie verstanden. Mit der Buchreihe »Analytischer Deutscher Idealismus« wollen wir sichtbar machen, daß die Philosophie des Deutschen Idealismus keinen Gegensatz zur analytischen Philosophie darstellt, sondern umgekehrt ihr Maßstab und Fluchtpunkt ist.
Die Reihe antwortet auf eine intellektuelle und gesellschaftliche Herausforderung, die durch die Renaissance des Naturalismus in den Wissenschaften erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Sie liegt in der für uns grundlegenden Frage, wie wir es verstehen können, daß wir geistbegabte Tiere sind, die einerseits das, was sie tun, aus Freiheit tun, deren Leben aber andererseits durch Gesetzmäßigkeiten bestimmt ist, die sie nicht selbst hervorgebracht haben. Es ist offenkundig, daß man diese Frage nicht beantworten kann, indem man ihre eine Seite – die Freiheit des Menschen – leugnet. Eine Naturalisierung des Geistes, die leugnet, daß all das, was das menschliche Leben ausmacht – Denken, Sprechen, Handeln, soziale Institutionen, religiöser Glaube, politische Ordnungen, Kunstwerke etc. –, Gegenstände sind, die, um mit Kant zu sprechen, dem Reich der Freiheit angehören, löst das Problem nicht, sondern kapituliert vor ihm. Doch auch wenn jeder sieht, daß diese Leugnung, die der Szientismus unablässig predigt, nicht das Resultat einer Erkenntnis sein kann, sondern vielmehr Ausdruck einer intellektuellen Hilflosigkeit ist, führt uns diese Reaktion ebenso vor Augen, daß die Frage nach der Einheit von Geist und Natur eine echte Frage ist, bei deren Beantwortung unser Selbstverständnis als geistige Wesen auf dem Spiel steht.
Die beschriebene Situation ist indes nicht neu. Blicken wir ins 18. Jahrhundert zurück, erkennen wir eine ähnliche intellektuelle Lage. Auch damals war es der Fortschritt der modernen Naturwissenschaften, der unser Selbstverständnis als geistbegabte Tiere 8herausgefordert hat. Der Deutsche Idealismus antwortet auf diese Herausforderung, indem er die Philosophie explizit durch die Frage nach der Einheit von Geist und Natur definiert. Im Angesicht der modernen Naturwissenschaft ringt die Philosophie von Kant bis Hegel darum, die zwei Seiten des Menschen zusammenzubringen: daß er ein Tier ist und doch ein geistiges Wesen, daß er Natur ist und doch Gesetzen unterliegt, die von anderer Art sind als die Gesetze der Natur: Gesetzen der Freiheit. Die Philosophie des Deutschen Idealismus ist von dem Bewußtsein durchdrungen, daß das Begreifen dieses Verhältnisses – des Verhältnisses von Geist und Natur, wie Hegel es zu Anfang seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften formuliert – die bestimmende Aufgabe der Philosophie ist. Wenn wir daher mit der Buchreihe »Analytischer Deutscher Idealismus« die Philosophie des Deutschen Idealismus stärken wollen, dann weil wir meinen, daß der Deutsche Idealismus für die intellektuelle Herausforderung, der wir uns gegenübersehen, die maßgebliche Orientierung ist. Der Deutsche Idealismus liegt nicht hinter uns, sondern vor uns. Damit meinen wir, daß die Art und Weise, wie der Deutsche Idealismus seine grundlegenden Begriffe und Ideen, allen voran die Begriffe der Freiheit, der Vernunft und der Selbstbestimmung, entwickelt und artikuliert, dem gegenwärtigen philosophischen Bewußtsein vielfach unbekannt und verstellt ist. Das liegt teilweise daran, wie die Philosophie in Westdeutschland nach 1945 mit diesem philosophischen Erbe umgegangen ist. Sie hat ihre durch den Nationalsozialismus verursachte Verstümmelung viel zu wenig als solche erfaßt und zu heilen gesucht. Damit hat sie sich in eine Lage gebracht, in der sie aus sich heraus nicht mehr die Mittel schöpfen konnte, um die Begriffe und Ideen, in denen sie zu Recht ihre Bedeutung sah, so zu artikulieren, daß sie als Maßstab der systematischen Arbeit erscheinen konnten. Für einen großen Teil der Jüngeren wurde dieser Maßstab statt dessen die analytische Philosophie angloamerikanischer Prägung.
So wichtig diese Erneuerung der Philosophie war, so entstand dadurch doch der falsche Eindruck, die analytische Philosophie und die Philosophie des Deutschen Idealismus seien Gegensätze, nämlich Orientierungen und Vorgehensweisen, die nicht nur nichts miteinander zu tun haben, sondern einander ausschließen. Die Bücher dieser Reihe möchten darum auch sichtbar machen, daß der Deutsche Idealismus von Kant bis Hegel nicht nur kein 9Gegensatz zur analytischen Philosophie ist, sondern eine Form, und zwar eine maßgebliche Form, der analytischen Philosophie. Der Deutsche Idealismus, als analytische Philosophie, ist eine Reflexion auf elementare Formen des Denkens und damit auf die Quelle unserer grundlegenden Begriffe, die diese Begriffe zugleich als notwendig ausweist. Philosophie ist, so sagt es Hegel, der Versuch, das Denken aus sich selbst zu begreifen. Sie ist ein Begreifen des Denkens, das von keinen »Voraussetzungen und Versicherungen« abhängt, wie er sagt, eine radikal voraussetzungslose Untersuchung der Voraussetzungen des Denkens. Darin liegt der gemeinsame Zug der Philosophie des Deutschen Idealismus: daß die Begriffe, die sie durcharbeitet, von nirgendwo her – von keiner Wissenschaft und keinem Common Sense – übernommen werden, sondern diese Begriffe nur so weit verwendet werden, wie sie als notwendig für das Denken erkannt werden. Diese Einsicht, daß die Philosophie ihre Begriffe nur aus dem Denken selbst nehmen kann, macht den radikalen Anspruch des Deutschen Idealismus aus. Und so ist die Idee der analytischen Philosophie, die Idee der Philosophie als logischer Analyse der grundlegenden Formen des Denkens und der Aussage, nirgends so streng durchgeführt worden wie im Deutschen Idealismus.
Unter dem Label »Analytischer Deutscher Idealismus« versammelt die Buchreihe Texte und Bücher, die auf exemplarische Weise Philosophie als analytische Aufklärung verstehen, im Geist und mit den Begriffen des Deutschen Idealismus. Die analytische Philosophie kommt erst da zu sich selbst, wo sie sich nicht von der idealistischen Philosophie abwendet, sondern auf diese ausgerichtet ist: in ihren Grundbegriffen und in der Radikalität ihrer Methode. Das mag manchen als provokante These anmuten, doch es gibt viele Beispiele, die ihr entsprechen. Gottlob Freges Begriffsschrift, die vielen als Gründungsdokument der analytischen Philosophie gilt, ist kein Gegenprojekt zum Deutschen Idealismus, sondern eine Weiterführung der kritischen Philosophie Kants. Und wenn wir uns zwei andere große Werke der analytischen Philosophie vergegenwärtigen, Wilfrid Sellars’ Empiricism and the Philosophy of Mind (dt.: Der Empirismus und die Philosophie des Geistes) und Peter Strawsons The Bounds of Sense (dt.: Die Grenzen des Sinns), sehen wir, daß sich die herausragenden Repräsentanten der analytischen Philosophie niemals vom Deutschen Idealismus abgewendet, 10sondern stets dessen Nähe gesucht haben. Das offizielle Selbstverständnis der analytischen Philosophie, in dem sie sich dem Empirismus verschreibt und sich damit dem Deutschen Idealismus entgegensetzt, ist ein Selbstmißverständnis. Der Empirismus, der sich für aufgeklärt hält, weil er die empirischen Wissenschaften zum Maß der Erkenntnis erklärt, ist in Wahrheit der Widersacher der analytischen Philosophie, nämlich der radikalen, der grundlegenden Analyse der Formen unseres Denkens und Verstehens. Soweit der Empirismus die analytische Philosophie dominiert, verdeckt er deren eigentliche Orientierung, die dieselbe ist wie die des Deutschen Idealismus.
Christoph Menkes Autonomie und Befreiung ist der fünfte Band dieser Buchreihe, die 2015 durch Wiedererinnerter Idealismus von Robert B. Brandom eröffnet wurde. Beide Bände eint dabei auf interessante Weise, wie sie die Philosophie Hegels zur Geltung bringen. Beide sehen den besonderen Beitrag, den die Philosophie Hegels für unser heutiges Verständnis bereitstellt, darin, wie Hegel die Frage nach der Freiheit und der darin gründenden Normativität des menschlichen Daseins stellt: Er stellt sie als eine Frage nach etwas – einem Vermögen, einem Status –, dem es wesentlich ist, daß es geworden ist, und für dessen Verständnis die Art seines Werdens daher zentral ist.
Christoph Menke ist Professor für Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. In dem vorliegenden Band zeigt er, was wir nach Hegel unter Freiheit zu verstehen haben, wenn wir Freiheit, wie Hegel dies tut, von ihrem Werden her verstehen. Freiheit erweist sich in dieser Betrachtung als ein gesellschaftlich gebildetes Vermögen der zweiten Natur des Menschen, das aus einem dialektischen Prozeß der Befreiung hervorgeht. Indem Menke mit Hegel die Freiheitsproblematik aus der Perspektive ihres Werdens in den Blick nimmt, schärft er unser Bewußtsein für die Spannungen, die zum Verständnis der menschlichen Freiheit gehören und die er als unaufhebbar deutet.
Die Buchreihe wird von einem internationalen Forschungszentrum getragen, dem Forschungskolleg Analytic German Idealism (FAGI), das 2012 an der Universität Leipzig gegründet wurde und dessen Arbeit durch ein international besetztes Gremium unterstützt wird (siehe 〈http://www.sozphil.uni-leipzig.de/cm/fagi/〉). Ziel des FAGI ist es auch, die Stimme des Analytischen Deutschen 11Idealismus in die außerakademische Öffentlichkeit hineinzutragen und ihr Gewicht in den Debatten über unser Selbstverständnis zu stärken.
13Autonomie und Befreiung
15Vorwort
In den Kapiteln dieses Bandes möchte ich ausloten, wie weit man mit Hegel kommen kann, um eine grundlegende philosophische Frage zu beantworten. Diese Frage lautet, wie das Werden der Freiheit zu verstehen ist. Darin meint das Werden der Freiheit nicht ihre Vorgeschichte, die sie hinter sich lassen kann, um ihr eigenes Reich – das »Reich der Freiheit« – zu errichten. Das Werden der Freiheit, auf das sich die Frage richtet, bildet ihr Sein. Die Freiheit besteht nur in ihrem Werden. Das Werden der Freiheit ist das Sichhervorbringen der Freiheit: die Befreiung als Selbstbefreiung. Die Frage richtet sich also auf das Verständnis der Freiheit als Befreiung.
Die Frage nach der Befreiung an Hegels Philosophie zu stellen bedeutet nicht, daß dies die Grundfrage ist, die diese Philosophie im ganzen antreibt und begreifbar macht. Ich will in diesem Buch jedoch zeigen, daß die Häufigkeit, mit der Hegel in seiner Philosophie des Geistes von der Befreiung spricht, für sein Verständnis dessen, was der Geist, seine Tätigkeit und seine Freiheit sind, signifikant ist. Dabei geht es nicht darum, bei Hegel eine Antwort auf die Frage nach der Befreiung zu finden. Es geht um die richtige Formulierung des Problems der Befreiung; es geht darum, von Hegel zu lernen, wie die Frage nach der Befreiung auf die richtige Weise gestellt werden muß.
Dem nähere ich mich in zwei Schritten. Der erste Teil des Buches exponiert die Dialektik der Befreiung. Sie hat ihren Grund darin, daß der Selbstbefreiung des Geistes durch die Weise, in der sie sich allein vollziehen kann, von vornherein die Bildung neuer Unfreiheit eingeschrieben ist. Die Befreiung ist durch eine interne, unauflösliche Gegenwendigkeit bestimmt; sie schlägt durch sich selbst in Herrschaft um. Das Feld, in dem sich diese Gegenwendigkeit entfaltet, nennt Hegel »Gesellschaft«. Die Gesellschaft ist zugleich das Medium der Befreiung und das der Unfreiheit. Denn die Gesellschaft bildet eine zweite Natur, in der der Geist sich nur so verwirklichen kann, daß er sich dabei verliert. Der Geist selbst macht seine Wirklichkeit »zu etwas Geistverlassenem« (Hegel).
Der zweite Teil erkundet unter dem Titel Kritik und Affirmation, welche Lehre aus der Erfahrung ihrer Dialektik für den Begriff 16der Befreiung zu ziehen ist. Diese Lehre ist eine doppelte. Einerseits muß die Befreiung eine Haltung der Kritik sein: die Kritik der Gesellschaft als zweiter Natur (die aber, weil die zweite Natur in der Befreiung gründet, nur eine Selbstkritik der Befreiung sein kann). Zugleich jedoch muß die Befreiung eine Haltung der Affirmation sein. Sie muß den Selbstverlust des Geistes in der zweiten Natur zu bejahen lernen: nicht als das Andere gegenüber der Freiheit, sondern als das Andere gegenüber der Freiheit in der Freiheit, durch die die Befreiung allein gelingen kann. Darin führt die Befreiung, die sich nur durch die Gesellschaft vollziehen kann, über die Gesellschaft hinaus. In der Bejahung der zweiten Natur befreit sich der Geist »absolut« oder »unendlich« (Hegel).
Die Abhandlungen rücken in beiden Teilen den Begriff der zweiten Natur ins Zentrum. Damit verfolgen sie Hegels Denken der Befreiung bis zu dem Punkt, an dem jeweils ein materialistisches Motiv hervortritt: eine materialistische Theorie der Gesellschaft, die die Gesellschaft als Einheit von Freiheit und Herrschaft analysiert (Teil I), und eine materialistische Theorie des Gelingens, die das Gelingen als Bejahung der Auswendigkeit des Geistes versteht (Teil II).
*
Bis auf einen sind die hier versammelten Texte während meiner Zeit am Frankfurter Exzellenzcluster »Die Herausbildung normativer Ordnungen« entstanden. Darin haben sich intensive Forschungs- und Diskussionszusammenhänge entwickelt, für deren Ermöglichung ich den Sprechern, Mitgliedern und Mitarbeitern des Clusters danke. Mein herzlicher Dank gilt vor allem den langjährigen Teilnehmern des Forschungsprojekts »Gesetz und Freiheit«: Thomas Khurana, Dirk Quadflieg, Francesca Raimondi, Juliane Rebentisch, Dirk Setton und Tatjana Sheplyakova. Danken möchte ich überdies den Sprechern des Forschungskollegs »Analytic German Idealism«, James Conant und Andrea Kern, für die Aufnahme des Bandes in dessen Reihe; der Leiterin des Wissenschaftslektorats des Suhrkamp Verlags, Eva Gilmer, für ihren umsichtigen Rat und die genaue Bearbeitung des Textes; sowie Simon Gurisch, Marcus Döller und André Möller für ihre Hilfe bei der Endredaktion des Textes.
Frankfurt am Main, im Mai 2018
17I.Dialektik der Befreiung
191. Autonomie und Befreiung
Mit der Einführung des Begriffs der Autonomie beginnt – zeitgleich mit der politischen Revolution – die moderne Philosophie. Die Grundidee des Autonomiebegriffs besteht darin, die Verbindlichkeit von Gesetzen[1] mit der Freiheit des Subjekts zusammen zu denken, das den Gesetzen unterworfen ist. Jerome Schneewind[2] hat gezeigt, wie tief der Bruch ist, den dies nicht nur mit der Tradition des klassischen, sondern auch, ja vor allem mit der des neuzeitlichen Naturrechts bedeutet. Während die neuzeitliche Philosophie Gesetz und Freiheit im Gegensatz sieht – das Gesetz ist auferlegt, die Freiheit gesetzlos –, will das Autonomiekonzept Gesetz und Freiheit wechselseitig durcheinander bestimmen. Autonomietheoretisch zu denken heißt, das Gesetz so zu verstehen (und wenn nötig zu verändern), daß man in der Unterwerfung unter es »nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie zuvor«,[3] und umgekehrt die Freiheit so zu verstehen (und wenn nötig umzubilden), daß man, statt in der »Sklaverei« der »Begierde« zu verbleiben, zum »Herren seiner selbst« wird in »Gehorsam dem Gesetz gegenüber, das man sich selbst gegeben hat«.[4] Frei zu sein heißt, dem Gesetz zu folgen. Umgekehrt ist etwas nur dann ein Gesetz (im normativen, nicht allein kausalen Sinn: ein Grund des Handelns), wenn es zu befolgen heißt, frei zu sein. In der Erläuterung des Verhältnisses von Freiheit und Gesetz durch den Begriff der Autonomie fallen freies Wollen und verpflichtendes Sollen in eins.
20Nimmt man Rousseaus Rede von der Selbstgesetzgebung wörtlich, so führt dies in einen Widerspruch, der als »Paradox der Autonomie« beschrieben worden ist.[5] Wenn Freiheit in Gehorsam gegenüber dem selbstgegebenen Gesetz bestehen soll – wie ist dann der Akt der Gesetzgebung, der Einsetzung des Gesetzes zu verstehen? Ist dies ein Akt des Gehorsams gegenüber einem bereits bestehenden, nicht selbstgegebenen Gesetz, also unfrei, oder ein Akt freier Willkür, also gesetzlos? Beides genügt offensichtlich nicht dem Anspruch der Autonomie, Gesetz und Freiheit zu verbinden. Beides sind Formen der Heteronomie: die äußere Heteronomie auferlegter Gesetze oder die innere Heteronomie bloß willkürlicher Entscheidungen. Ist Autonomie gemäß der Rousseauschen Formel »Gehorsam dem Gesetz gegenüber, das man sich selbst gegeben hat«, dann setzt sie einen Akt der Gesetzgebung voraus, der selbst nicht autonom ist. Übersetzt man sie als »Selbstgesetzgebung«, so ist die Idee der Autonomie paradox, ihr Grund Heteronomie.
Hegels Theorie der Sittlichkeit kann als der Versuch gelesen werden, dieses Paradox aufzulösen. Das soll dadurch geschehen, daß das Subjekt der Autonomie als Teilnehmer sozialer Praktiken verstanden wird: Freiheit und Gesetz sind darin wechselseitig miteinander verbunden, daß sie Momente derjenigen Grundrelation sind, die als Teilnahme des Subjekts an sozialen Praktiken zu beschreiben ist. Der Zusammenhang von Freiheit und Gesetz muß aus dem Zusammenhang von Subjekt und sozialer Praxis verstanden werden. »Theorie der Sittlichkeit« heißt: Subjekt und Praxis als zwei durch einander bestimmte Elemente eines »lebendigen« Zusammenhangs (den Hegel »Geist« nennt) zu begreifen, in dem sich die Freiheit des Subjekts und die Gesetze der Praxis zugleich verwirklichen.
Hegels Theorie der Sittlichkeit so zu verstehen, daß es ihr um eine Erläuterung der Idee der Autonomie geht, die das Paradox ihrer wörtlichen Auffassung als Selbstgesetzgebung aufzulösen vermag, ist die geteilte Grundannahme einer breiten Strömung in der gegenwärtigen angelsächsischen Hegeldeutung. Robert Pippin, auf dessen Synthese dieser Deutungsrichtung ich mich im Folgenden 21vor allem beziehe, hat für sie das Etikett »linkshegelianisch« reklamiert.[6] Linkshegelianisch ist die Auffassung, daß es Hegels Theorie der Sittlichkeit um eine Erläuterung der Idee der Autonomie geht – eine Erläuterung, die ihr Paradox aufzulösen vermag. Der Linkshegelianismus liest Hegel daher in einer entschieden modernen Perspektive: als eine Antwort auf das zentrale Problem der Moderne, wie Freiheit und Gesetz zusammengedacht werden können. Die These der linkshegelianischen Deutung besagt, daß dies nur gelingen kann, wenn die Autonomie als die Form sozialer Teilnahme gedacht wird. Das zu tun aber heißt zugleich, die soziale Teilnahme als wesentlich prozessual und temporal und damit geschichtlich zu denken. Der Gedanke der Geschichtlichkeit, so die linkshegelianische These, ist die Lösung des Paradoxes der Autonomie. Nur indem die moderne Philosophie den Schritt zum Denken der Geschichte macht, kann sie ihr systematisches Grundproblem lösen.
Ich werde zunächst zeigen, an welchen bereits bei Kant entwickelten Gedanken zum Autonomiebegriff Hegel in dieser Perspektive anknüpft (a), und sodann die linkshegelianische Deutung von Hegels Sittlichkeitstheorie rekonstruieren (b). Danach werde ich in thesenhafter Form umreißen, wo die Grenze dieser Deutung liegt – weshalb wir also, noch einmal oder immer noch, über den Linkshegelianismus hinausgehen müssen (c). Die linkshegelianisch gedeutete Sittlichkeitstheorie zeigt überzeugend auf, daß Autonomie in der Form sozialer Teilnahme besteht. Der Schritt über den Linkshegelianismus hinaus besteht darin zu verstehen, weshalb die Teilnahme des Subjekts an sozialen Praktiken so verfaßt ist, daß in ihr die Autonomie niemals gegenwärtig ist, sondern im Werden bleibt. Die soziale Teilnahme des Subjekts ist das Medium und das Andere der Autonomie. Deshalb bleibt die Autonomie angewiesen 22auf eine Tat der Befreiung, die selbst keine autonome Handlung sein kann. Dieser Schritt über den Linkshegelianismus hinaus zu einem (»materialistischen« oder »genealogischen«) Verständnis des Werdens der Autonomie ist der gemeinsame Schritt von Marx, Nietzsche und Freud. Ihr Schritt über den Linkshegelianismus hinaus kann aber auch als eine Rückkehr zu Hegel verstanden werden. Denn Hegels eigene Theorie der »Endlichkeit« des Geistes als »zweiter Natur« enthält bereits den entscheidenden Hinweis auf die Grenze der Autonomie.
a. Sich selbst ein Gesetz sein
Rousseaus Autonomieformel – »Gehorsam dem Gesetz gegenüber, das man sich selbst gegeben hat« – wiederholt Kant fast wörtlich, wenn er beschreibt, was »alle bisherigen Bemühungen, die jemals unternommen worden, um das Prinzip der Sittlichkeit ausfindig zu machen«, verkannt haben:
Man sahe den Menschen durch seine Pflicht an Gesetze gebunden, man ließ sich aber nicht einfallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei, und daß er nur verbunden sei, seinem eigenen, dem Naturzwecke nach aber allgemein gesetzgebenden, Willen gemäß zu handeln.[7]
Die sprachliche Verschiebung, die Kant hier gegenüber Rousseau vornimmt – Kant redet nicht von Selbstgesetzgebung, sondern von der »eigenen Gesetzgebung« –, ist unscheinbar und kann doch als Anzeichen einer grundsätzlichen Neufassung des Autonomiebegriffs gedeutet werden. Sie scheint nur die Art und Weise der Gesetzgebung zu betreffen, sie bedeutet aber in Wahrheit einen Bruch mit der – juridischen oder legislatorischen – Auffassung, daß das Gesetz für das Selbst überhaupt so da und verbindlich ist, daß es gegeben, also (ein-)gesetzt worden ist.
Diesem Bruch liegt die Einsicht zugrunde, daß sich das Paradox der Autonomie nicht schon allein dadurch auflösen läßt, daß man den Akt der Selbstgesetzgebung an den Anspruch vernünftiger Be23gründung bindet. Das erlaubt zwar zu sagen: Autonomes Handeln ist Handeln nach einem Gesetz, das das Subjekt sich aus einem guten Grund gegeben hat. Die Paradoxie, in die sich Rousseaus Idee der Selbstgesetzgebung verstrickte, ist dadurch jedoch nicht vermieden. Denn zwar gilt für die vernünftige oder begründete Selbstgesetzgebung, daß sie weder bloß aus gesetzloser Freiheit noch aus blindem Gehorsam erfolgt. Sie erfolgt vielmehr aus der freien Einsicht in die Verbindlichkeit des Grundes. Aber sobald man danach fragt, woher dieser Grund der Selbstgesetzgebung wiederum seine Verbindlichkeit gewinnt, gerät man entweder in einen unendlichen Regreß, oder dieser Regreß wird durch einen letzten Grund gestoppt, aber dann bricht in dessen Bestimmung das Paradox der Autonomie wieder auf. Denn der letzte Grund kann nur entweder vom Subjekt grundlos eingesetzt oder dem Subjekt grundlos vorgegeben sein. Das ist aber wieder dieselbe äußerliche Entgegensetzung von Freiheit und Gesetz, die der Autonomiegedanke auflösen wollte. Der Schritt, die Selbstgesetzgebung an Gründe zu binden, reicht nicht aus, um das Paradox der Autonomie aufzulösen. Die Revision des Autonomiebegriffs muß tiefer ansetzen: bei der Idee der Selbstgesetzgebung.
Das bedeutet, daß die beiden Elemente der Autonomie, das Selbst und das Gesetz, anders verknüpft werden müssen als so, daß das Selbst die Instanz ist, die sich das Gesetz gibt. Nach Christine Korsgaards entscheidender Beobachtung macht Kant bereits selbst diesen Schritt über die Rousseausche Figur der Selbstgesetzgebung hinaus.[8] Kant ergänzt nicht nur die Idee der Selbstgesetzgebung durch den Anspruch, daß sie aus einem guten Grund erfolgen muß; er stellt vielmehr die Definition von Autonomie als Selbstgesetzgebung als solche in Frage.
Diese Infragestellung will selbstverständlich nicht bestreiten, daß Subjekte die Freiheit besitzen, sich aus Gründen diese oder jene Regel zu geben, und daß sich für die Gründe, die sie dabei an24führen, wiederum die Frage stellen läßt, wie überzeugend sie sind. Die Infragestellung des Paradigmas der Selbstgesetzgebung besteht vielmehr darin, auf eine Voraussetzung hinzuweisen, die in diesem Bild der Freiheit als begründeter Wahl zwischen diesem oder jenem Gesetz zugleich gemacht und verborgen ist. Denn um überhaupt die Wahl zwischen verschiedenen Gesetzen haben zu können, muß das Subjekt bereits irgendwelche Gesetze haben. Das heißt: Es muß seine Triebe, Neigungen, Impulse usf. in die Form des Gesetzes gebracht haben. Antriebe in die Form des Gesetzes zu bringen heißt, ihre bloß kausale Wirksamkeit durch die normative Kraft eines Grundes zu ersetzen. Gesetze bewirken ihre Befolgung, so daß sie sie begründen; ein Gesetz ist nicht ein Befehl, auf den man reagiert, sondern eine Regel, der man folgt. Vor der Freiheit der Wahl zwischen diesem oder jenem Gesetz steht also die Freiheit, sich selbst, seinen eigenen Antrieben, die Form des Gesetzes zu geben. Vor der Freiheit der Wahl steht die Freiheit der Selbstformierung – die Freiheit der Selbsttransformierung in ein Wesen, das nicht mehr kausal angetrieben wird, sondern sich durch »Maximen« oder »Imperative« selbst Gründe zum Handeln gibt und darin frei ist. Das ist der erste Schritt heraus aus dem Paradigma der Selbstgesetzgebung. Indem Kant auf die Freiheit der Selbstformung hinweist, die jeder möglichen Wahl, auch der eines Gesetzes, vorausgeht, gewinnt der Begriff der Selbstgesetzgebung einen ganz anderen Sinn: Auf der grundlegenden Ebene heißt »Selbstgesetzgebung« nicht, sich dieses oder jenes Gesetz zu geben, sondern seinen Antrieben die Form des Gesetzes zu geben.
Das Gesetz, dem die Freiheit der Selbstformung folgt, ist das Gesetz des Gesetzes. Dieses Gesetz, sich Gesetze zu geben, kann offensichtlich nicht durch einen Akt der Selbstgesetzgebung hervorgebracht worden sein. Gleichwohl gehorcht das sich selbst formierende Subjekt nur sich selbst und ist darin frei; die Selbstformierung ist der Akt der Autonomie. Kants Erläuterung, weshalb das so ist, und das heißt, wie der Begriff der Autonomie im Akt der Selbstformierung verstanden werden muß, ist der zweite Schritt heraus aus dem Paradigma der Selbstgesetzgebung.
Im (legislatorischen) Paradigma der Selbstgesetzgebung werden Gesetz und Subjekt so zusammengedacht, daß das Gesetz, dem wir gehorchen, eines ist, das wir uns selbst, also frei gegeben haben; die Freiheit im Gesetzesgehorsam wird auf die Freiheit der 25Gesetzgebung zurückgeführt. Kant erläutert die freiheitsverbürgende Verknüpfung von Selbst und Gesetz auf andere Weise. Das Gesetz, in dessen Gehorsam ich frei bin, ist nicht das Gesetz, das ich mir selbst gegeben habe, sondern das ich mir selbst bin. Das ist der antike Sinn von »Autonomie«:[9] Das autonome Gesetz ist das eigene Gesetz. »Autos« heißt hier nicht »selbst«, sondern »eigen«, nicht selbst machen, sondern zu eigen machen (oder gar als eigenes haben); das autonome Gesetz ist dasjenige Gesetz, durch das das Selbst ist, was es ist. Autonom zu sein heißt nicht, daß das Selbst ein Gesetz macht, sondern daß es dem Gesetz folgt, das es, das Subjekt, ausmacht. Das Gesetz, in dessen Befolgung das Selbst frei bleibt (vielmehr: frei wird), ist das Gesetz, das das Selbst konstituiert.[10] Diese Kantische Einsicht bringt Hegel gegen die utilitaristische Gleichsetzung von Wollen und Wählen so auf den Punkt, daß sich die Freiheit des Willens nicht darin verwirklicht, dieses oder jenes, auch nicht: dieses oder jenes Gesetz zu wählen oder vorzuziehen, sondern das Gesetz des Wollens zu wollen: »[D]er abstrakte 26Begriff der Idee des Willens ist überhaupt der freie Wille, der den freien Willen will.«[11]
Nach Hegel und Korsgaard ist Kants Reformulierung des Autonomiegedankens also erst dann richtig verstanden, wenn man sie nicht als eine Ergänzung der Rousseauschen Idee der Selbstgesetzgebung durch die der Begründung versteht; dann wiederholt sich vielmehr das Paradox, daß die autonome Selbstbestimmung auf einen Punkt entweder gesetzloser Freiheit oder vorgegebener Verpflichtung und damit Heteronomie in einer ihrer beiden Gestalten zurückführt. Kant dagegen versteht Autonomie nicht als Selbstgesetzgebung, sondern als Selbstverwirklichung: das Gesetz befolgen, das einen ausmacht. Kant versteht die Selbstgesetzgebung nicht legislatorisch, sondern expressivistisch.[12] Autonomes Urteilen oder Handeln besteht nicht darin, selbst ein Gesetz hervorzubringen, sondern das eigene Gesetz zum Ausdruck zu bringen: zu werden, der man ist.
b. Kritik der Moralität
Kants expressivistische Neufassung des Autonomiebegriffs ist die Grundlage von Hegels Theorie der Sittlichkeit. Der Kantische Gedanke, an den Hegel anknüpft, besagt, daß für das Subjekt allein ein Gesetz verbindlich sein kann, das das Subjekt bereits hat oder das es ausmacht; das autonome Gesetz ist nicht gesetzt. Zugleich lautet Hegels Einwand gegen Kant, daß sich dieser Gedanke nicht begreifen und entfalten läßt, wenn das Subjekt als »moralisches« verstanden wird. Als »moralisches«[13] bezeichnet Hegel ein Subjekt, 27das seine eigenen, es als Subjekt konstituierenden Gesetze als formal bestimmte Rationalitätskriterien begreift, die es auf vorgegebene Bestimmungen reflexiv prüfend anwendet. Dabei versteht sich das »moralische« Subjekt als eine Instanz, die einer irrtumsfreien Anwendung dieser formal definierten Kriterien prinzipiell fähig und dadurch zu einem abschließenden Urteil berechtigt ist. Hegels Einwand gegen dieses »moralisch« genannte Selbstverständnis des Subjekts lautet, daß dieses so, als Anwender formal definierter Rationalitätskriterien, gerade nicht zu einem Urteil oder einer Entscheidung zu kommen vermag. Kants moralischer Subjektbegriff kann also nicht verständlich machen, wie eine autonome Antwort auf die praktische Frage – »die Frage: was ist Pflicht?« (Rph, § 134), die Frage: Was tun? – möglich ist. Jede Bestimmung kann hier nur ein »von außen her« aufgenommener Stoff sein (§ 135), ist also heteronom. Daher, so Hegels Konsequenz, muß man mit Kants »moralischem« Subjektbegriff brechen, um Kants expressivistischer Neubestimmung des Autonomiebegriffs gerecht zu werden. Das geschieht im Schritt von der Moralität zur Sittlichkeit.
Diesen Schritt werde ich im Folgenden skizzenartig als einen Doppelschritt rekonstruieren: Der erste Schritt führt zu Hegels gesellschaftlicher, der zweite zu seiner geschichtlichen Bestimmung der Autonomie. Durch die soziale Bestimmung der Autonomie will Hegel Kants expressivistische Überwindung des Rousseauschen Paradoxes der Selbstgesetzgebung vollenden, indem er das subjektivitätskonstitutive Sich-zu-eigen-Machen – genauer: Sich-zu-eigen-gemacht-Haben – von Gesetzen als soziale Teilhabe erläutert. Die soziale Teilnahme des Subjekts kann aber nur dann als Medium der Autonomie verstanden werden, wenn sie als wesentlich geschichtliche verstanden wird. Mit der Geschichtlichkeit kehrt jedoch das Paradox in die Autonomie zurück.
Praktische Teilnahme
Der Grundzug von Hegels sittlichkeitstheoretischer Neubestimmung besteht darin, das autonome Subjekt als Teil oder »Mitglied« einer »Welt« zu verstehen. Diese »Welt« bestimmt Hegel als das 28eine Moment des »lebendigen Guten«. Das Gute »lebt«, wenn es in Handlungen »wirklich ist« (Rph, § 141 N, S. 290). Die Welt, als deren Mitglied Hegel das autonome Subjekt begreift, ist also eine Welt handelnder Verwirklichungen des Guten. Die sittliche Welt besteht aus Handlungszusammenhängen, die dadurch definiert, strukturiert und voneinander abgegrenzt sind, daß sie jeweils bestimmte Güter verwirklichen. Solche Handlungszusammenhänge, die durch den Bezug auf ein sich in ihnen verwirklichendes Gut bestimmt sind, können »Praktiken« genannt werden.[14] Hegels sittlichkeitstheoretische Grundthese lautet: Nur in einer Welt des sich verwirklichenden Guten oder in einer Welt von Praktiken kann es autonome Subjekte geben.
Praktiken sind die Grundeinheit im Praktischen: Alles Praktische – Zwecke, Mittel, Gründe, Normen, Handlungen, Subjekte, Erfolge und Gelingen – gibt es nur in Praktiken.[15] Die praktische Grundrelation ist daher die des Teilseins in oder des Teilnehmens an einer Praxis. Ein Zweck, ein Mittel, ein Grund, eine Handlung, ein Subjekt, ein Erfolg oder etwas Gutes zu sein heißt, eine Rolle oder einen »Status« in einer Praxis zu haben.[16] In dieser Relation des Teilseins und Teilnehmens gründet die Möglichkeit praktischer Urteile: Etwas ist Gegenstand eines Urteils, sofern es ein Teil in einer Praxis ist. Und jemand ist Autor eines Urteils, sofern er ein Teilnehmer an einer Praxis ist. Praktische Urteile erfolgen mit Bezug auf die Gesetze, die »konstitutiven Regeln«,[17] die eine Praxis ausma29chen; durch die also das jeweilige Gute spezifiziert wird, das eine Praxis definiert und strukturiert. Etwas, das Teil einer Praxis ist, zu beurteilen heißt daher, es an dem Gesetz zu messen, das, weil es die Praxis konstituiert, auch dieses Etwas erst zu einem Teil dieser Praxis macht; etwas zu beurteilen heißt, zu fragen, ob es das, was es (als Teil dieser Praxis) ist, gut oder schlecht, auf vollkommene oder mangelhafte Weise ist: ob es also sein »Wesen« – das nichts anderes als sein Teilsein in der sozialen Praxis ist – angemessen »verwirklicht«. Und jemand, der als Teilnehmer einer Praxis ein solches Urteil fällt, bezieht sich dabei auf eben das Gesetz, das ihn, ebenso wie das Beurteilte, als Teilnehmer an dieser Praxis ausmacht: Indem er etwas nach dessen eigenem Gesetz beurteilt, folgt er seinem eigenen Gesetz; beide sind dasselbe.
Deshalb schließt das eine Moment des »lebendigen Guten«, die »Welt« als Ensemble von Praktiken, das andere Moment bereits ein: das Subjekt als Teilnehmer an Praktiken. Das »lebendige Gute« ist das »zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewußtseins« gewordene Gesetz (Rph, § 142). Es ist »objektiv« oder »äußerlich« da in den sozialen Praktiken, und »subjektiv« oder »innerlich« im Selbstbewußtsein ihrer Teilnehmer. Nur wenn das Subjekt als Moment in der lebendigen »Einheit des Inneren und Äußeren« (§ 141 N, S. 290), die die praktische Grundrelation der Teilnahme stiftet, begriffen wird, hat das Subjekt ein eigenes Gesetz, das ihm Gründe zum Urteilen bereitstellt. Nur als Moment in der lebendigen »Einheit des Inneren und Äußeren« ist es daher ein Subjekt: eine Instanz des Handelns aus Gründen. Hegels Einwand gegen Kants »moralischen« Subjektbegriff besagt: »Niemand, der als ein sich rein rational selbst bestimmender Handelnder begriffen wird, kann als jemand angesehen werden, der irgendeine Art von wirksamem, praktischem Grund hat.« Und: »Nur als Teilnehmer kann ich als jemand angesehen werden, der überhaupt praktische Gründe hat.«[18] Der Zusammenhang von Freiheit und Gesetz, der den Begriff der Autonomie ausmacht, findet seine Begründung in der praktischen Relation der Teilnahme an einer Praxis.
Damit bringt die sittlichkeitstheoretische Erläuterung des Sich-zu-eigen-Machens eines Gesetzes als soziale Teilhabe das Problem 30zum Verschwinden, das Kant nach Hegel nicht zu lösen vermochte: das Problem einer zugleich inhaltlichen und autonomen Bestimmung des Guten. Eine Handlungsbestimmung ist autonom, wenn sie allein in dem eigenen Gesetz des Subjekts begründet ist. Das eigene Gesetz des Subjekts ist jedoch, so Hegels grundlegender Schritt, das Gesetz der Praxis, an der es teilnimmt: Als Teilnehmer einer Praxis wird das Subjekt durch eben die Gesetze konstituiert, die die Praxis konstituieren. Diese Gesetze sind erstens je bestimmte Gesetze, die zusammen das Gute artikulieren, das die jeweilige Praxis definiert. Eine Praxis »überhaupt« gibt es ebenso wenig wie das Gute »als solches«; es gibt nur Praktiken und Güter. Die praxiskonstituierenden Gesetze sind zweitens immer schon verwirklichte, angewandte oder befolgte Gesetze. Im Gegensatz zu regulativen Regeln, die als Forderungen der Wirklichkeit gegenüberstehen, gibt es konstitutive Regeln nur in der Wirklichkeit, die sie hervorbringen. Die Normativität, die sie begründen, ist eine immanente: nicht der Gegensatz zwischen Norm und Realität, sondern zwischen zwei Realitäten – zwischen einer guten und einer schlechten Verwirklichung des Gesetzes, das die jeweilige Praxis ausmacht. Nur dem eigenen Gesetz zu folgen oder autonom zu handeln heißt daher, das zu verwirklichen, was in der sozialen Praxis, an der das Subjekt teilnimmt, schon wirklich ist. Man weiß, wie man handeln soll, wenn man weiß, wie schon gehandelt wird. Das eigene Gesetz des teilnehmenden Subjekts, die innere, also zweite »Natur« seines »Selbstbewußtseins«, ist das Gesetz der »vorhandenen Welt« – der Praktiken, an denen es teilnimmt.
Subjektive Aneignung
Aber bringt Hegel so mit dem bei Kant ungelösten Problem der inhaltlichen Bestimmung des Guten nicht zugleich auch deren Autonomie zum Verschwinden? Denn »Autonomie« heißt nicht bloß, daß der Wille einem eigenen Gesetz, sondern daß der vernünftige Wille seinem Gesetz folgt. »Autonomie« als Selbstverwirklichung heißt nicht, daß das Subjekt in seinem Wollen irgendeine Identität als Teilnehmer an dieser oder jener Praxis, sondern seine Identität als vernünftiges Subjekt zum Ausdruck bringt.
Das ist richtig und zugleich eine falsche Alternative: Das Subjekt bringt seine Identität als vernünftiges Subjekt nur in der (Art 31und Weise seiner) Teilnahme an dieser oder jener Praxis zum Ausdruck; also nicht, indem es seine Identität als Teilnehmer dieser oder jener Praxis dann auch noch, von außen, mit Rationalitätsansprüchen konfrontiert. Vielmehr ist die Teilnahme an einer Praxis selbst schon, intern, von dem Anspruch auf Vernunft bestimmt; die praktische Vernunft ist der praktischen Teilnahme immanent. Denn an einer Praxis teilzunehmen heißt, sich selbst durch Urteile zu regieren, die allein durch eigene Gesetze begründet sind. Die eigenen Gesetze, die die »Natur des Selbstbewußtseins« des an einer praktischen »Welt« teilnehmenden Subjekts ausmachen, sind daher für dieses Subjekt Gründe seines Urteilens. Daß etwas ein Grund ist – diese Einsicht der »Moralität« genannten Konzeption des Praktischen gilt auch für die der Sittlichkeit[19] –, heißt aber, daß es von einem Subjekt als Grund eingesehen werden kann. Die Feststellung, daß etwas ein Grund ist, verweist auf den Akt der Anerkennung von etwas als Grund durch ein Subjekt. Der Begriff des Grundes enthält daher schon den Begriff eines Subjekts, das zur Anerkennung eines Grundes ebenso verpflichtet wie zu der Entscheidung berechtigt ist, ob etwas ein anerkennungswürdiger Grund ist: »Das Recht des subjektiven Willens ist, daß das, was er als gültig anerkennen soll, von ihm als gut eingesehen werde.« (Rph, § 132) Und: »Das Recht, nichts anzuerkennen, was Ich nicht als vernünftig einsehe, ist das höchste Recht des Subjekts.« (§ 132 A, S. 245) Nur darf dieses Recht nicht »moralisch« verstanden werden, also »formell«: als das Recht auf Prüfung nach formal definierten Rationalitätskriterien. Das Recht des Subjekts, »daß Ich eine Verpflichtung aus guten Gründen einsehe und die Überzeugung von derselben habe« (§ 132 A, S. 246), verwirklicht sich vielmehr nur in der Teilnahme an Praktiken. Die (Kantische) Alternative – daß das Subjekt in seinem Wollen nicht irgendeine Identität als Teilnehmer dieser oder jener Praxis, sondern seine Identität als vernünftiges Subjekt zum Ausdruck bringt – ist falsch: Teilnehmer an einer Praxis zu sein heißt schon, seine Identität als vernünftiges Subjekt zu verwirklichen. Denn Teilnehmer an einer Praxis zu sein bedeutet 32nichts anderes, als deren Gesetze als Gründe anzuerkennen. Das ist die »sittliche« Verwirklichung des »moralisch« reklamierten Rechts des Subjekts: Das Recht des Subjekts, »daß Ich eine Verpflichtung aus guten Gründen einsehe« oder sie eben nicht als eine Verpflichtung anerkenne, verwirklicht sich schon und nur in der Teilnahme an einer Praxis.
Deshalb beschreibt Hegel die Teilnahme des Subjekts an einer Praxis zugleich als Aneignung dieser Praxis durch das Subjekt:
Das Recht der Individuen für ihre subjektive Bestimmung zur Freiheit hat darin, daß sie der sittlichen Wirklichkeit angehören, seine Erfüllung, indem […] sie im Sittlichen ihr eigenes Wesen […] wirklich besitzen. (Rph, § 153)
Die konstitutiven Gesetze der Praktiken »sind […] dem Subjekte nicht ein Fremdes, sondern es gibt das Zeugnis des Geistes von ihnen als von seinem eigenen Wesen.« (Rph, § 147)[20] Das Subjekt bezeugt die Gesetze einer Praxis als seine eigenen. Daß sie seine eigenen sind, ist also keine Tatsache, die sich feststellen ließe, und es ist auch nicht das Produkt einer Tathandlung, die das Subjekt grundlos-frei ausführt. Die konstitutiven Gesetze einer Praxis sind die eigenen des Subjekts vielmehr nur, indem sie die eigenen des Subjekts werden – indem sie vom Subjekt angeeignet werden. Oder: Das Subjekt hat nur diejenigen Gesetze zum eigenen »Wesen« oder zur eigenen »Natur«, die es sich durch Teilnahme an Praktiken angeeignet hat.
Dabei bedeutet die Aneignung der Güter und Gesetze einer Praxis durch ein Subjekt nichts anderes als die Anerkennung dieser Güter und Gesetze als Gründe; erst dann ist auch autonomes Handeln, ein Handeln allein aus eigenem Gesetz, möglich. In der Aneignung einer sozialen Praxis reproduziert das Subjekt sie als einen Zusammenhang von Gesetzen, die es als Gründe anerkennen kann. Darauf zielt Hegels Begriff des »Geistes«: In der Theorie der Sittlichkeit bezeichnet »Geist« diejenige Gestalt einer Praxis, die sie annimmt, wenn sie durch die autonome Handlung eines Subjekts als ein vernünftiger Zusammenhang von normativen Begriffen 33reproduziert wird. Ohne die subjektive Aneignung einer sozialen Praxis, durch die ihre Gesetze als Gründe anerkannt werden, gibt es mithin keinen Geist. Geist ist »die durch die Subjektivität als unendliche Form konkrete Substanz« (Rph, § 144).
Weil das Subjekt eigene Gesetze nur durch seine Teilnahme an sozialen Praktiken hat, in der es sich deren Gesetze aneignet, indem es sie als Gründe anerkennt, und weil dies die Bedingung für Autonomie, für das Urteilen und Handeln nur nach eigenem Gesetz ist, hängt die Autonomie des Subjekts davon ab, daß die »vorhandene Welt« eine Welt von Praktiken ist, deren Gesetze als Gründe angeeignet werden können. Praktiken, für die das gilt und in deren Aneignung sich daher die Autonomie des Subjekts verwirklicht, können selbst »autonom« genannt werden:[21] Die Autonomie von Praktiken besteht darin, daß der Handlungszusammenhang, den sie bilden, durch nichts anderes bestimmt ist als durch solche Gesetze, die sich als Gründe anerkennen lassen. Nach der Kantischen Vorstellung sollte die Autonomie des Subjekts das Kriterium dafür liefern. Hegels Sittlichkeitstheorie zeigt dagegen, daß die Autonomie des Subjekts und die Autonomie der Praktiken zwei Momente in ein und demselben Prozeß der aneignenden Teilnahme an Praktiken sind. Das Subjekt kann nur autonom sein, nach eigenen Gesetzen urteilen und handeln, wenn es an Praktiken teilnimmt, die sich darin, im Prozeß aneignender Teilnahme, als autonome Handlungszusammenhänge aus Gründen darstellen lassen. Die Autonomie der Praktiken, ihre Reproduzierbarkeit als vernünftige Zusammenhänge, ist die Bedingung für die Autonomie der Subjekte; die Autonomie der Subjekte, ihre aneignend-reflexive Reproduktion, ist die Bedingung für die Autonomie der Praktiken. Diese Doppel-Autonomie von Subjekt und Praxis ist »Geist«.[22]
34Linkshegelianismus, oder: Die Geschichtlichkeit des Geistes
Robert Pippin hat Hegels sittlichkeitstheoretische Erläuterung des Zusammenhangs von Praxis und Subjekt den »eindeutig neoaristotelischen« Gedanken genannt, durch den Hegel das Kantische Autonomiekonzept grundlegend transformiert.[23] Neoaristotelisch ist das Verständnis des Geistes als »zweiter Natur«. Mit Bezug auf die geistigen Fähigkeiten des Subjekts besagt dies, daß sie Fähigkeiten zur Teilnahme an sozialen Praktiken sind, die durch die Teilnahme an sozialen Praktiken erworben werden. Die geistigen Fähigkeiten des Menschen sind ein »kulturelles Produkt«; daher sind sie seine zweite Natur, die zugleich aber, daher »zweite Natur«, sein »Wesen« ausmachen: die eigene »Natur in ihrer Gewordenheit«.[24] Ebenso wichtig ist aber, daß die sittlichkeitstheoretische Erläuterung des Zusammenhangs von subjektiven Fähigkeiten und sozialer Praxis als Prozeß der Aneignung, in dem beide, das Subjekt wie die Praxis, zugleich ihre Autonomie gewinnen und damit die Struktur hervorbringen, die Hegel »Geist« nennt, auch das (neo)aristotelische Verständnis entscheidend transformiert. Diese Transformation nennt Pippin »linkshegelianisch«. Sie besteht darin, den Geist, also die Autonomie von Praxis und Subjekt, als »eine Art historisch-sozialer Errungenschaft [oder Leistung: achievement]«[25] zu verstehen. Der 35Geist ist nicht das Telos der Natur, seine Ausbildung keine natürliche Entwicklung, sondern ein »Produkt« seiner Selbsthervorbringung. Gegen die Ansicht, der Mensch sei »von Natur frei«, wendet Hegel ein:
Der freie Geist ist eben dieses (§ 21), nicht als der bloße Begriff oder an sich zu sein, sondern diesen Formalismus seiner selbst und damit die unmittelbare natürliche Existenz aufzuheben und sich die Existenz nur als die seinige, als freie Existenz zu geben. (Rph, § 57 A, S. 123)
Hegel linkshegelianisch zu deuten heißt, den ersten Schritt mit dem aristotelischen Begriff der zweiten Natur mitzugehen, aber nicht den zweiten. Der Geist ist zweite Natur, weil er gebildet werden muß (der Geist ist zweite Natur) und als gebildeter das Wesen des Menschen, als Subjekt, ausmacht (er ist zweite Natur). Der Geist ist aber nicht zweite Natur in dem Sinn, daß seine Bildung selbst natürlich ist. Die Bildung des Geistes ist als seine Selbsthervorbringung vielmehr geschichtlich.
»Hervorbringung des Geistes« heißt: Hervorbringung seiner »freien Existenz«, der autonomen Gestalt des Subjekts wie der sozialen Praktiken. Beide gibt es nur als gleichzeitige Momente im Prozeß aneignender Teilnahme. In diesem Prozeß werden Subjekt und Praxis erst autonom, genauer: werden sie erst als autonome hervorgebracht. Weil nun der Prozeß aneignender Teilnahme in der Anerkennung der Gesetze sozialer Praktiken als Gründe besteht, kann er nicht ein natürlicher Prozeß sein – das heißt ein Prozeß, dessen Schritte und Ergebnis an seinem Beginn, durch Natur, vorgezeichnet sind: Es kann keine natürliche Bestimmung dessen ge36ben, was ein Grund und damit ein Akt seiner Anerkennung ist. Was ein Grund und ein Akt seiner Anerkennung ist (oder als solches zählt), ist eine geistige Bestimmung: Der Begriff des Geistes kann nur durch den Geist selbst bestimmt werden. Das Werden des Geistes und das Werden des Begriffs des Geistes fallen in eins. Es gibt keinen Begriff des Geistes, der dem Werden des Geistes vorherginge. Was der Geist ist, was als ein Grund und dessen Anerkennung zählt, wird vielmehr erst und immer wieder im Werden des Geistes selbst bestimmt. Das Werden des Geistes ist seine Selbsthervorbringung, weil es der Prozeß seiner Selbstbestimmung ist: der Bestimmung dessen, was »Geist« heißt.
Der grundlegende Schritt von Hegels sittlichkeitstheoretischer Reformulierung des Autonomiebegriffs besteht darin, das Subjekt als wesentlich soziales