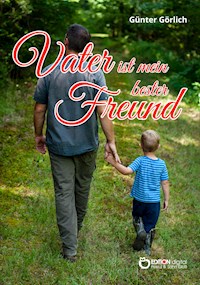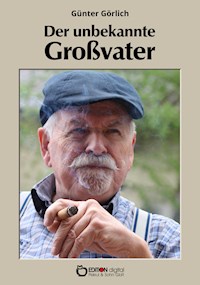7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verdammt, kennen Sie Mökelen, jenes Städtchen, abseits der Straße gelegen, auf der die Hauptstädter ihren Sommerfreuden an Düne und Meer entgegenfahren? Ein ausgedehnter Wald gehört zu Mökelen, Tannen, Buchen und andere Bäume. Dorthin also hat ihn Chefredakteur Nethe geschickt. Er, das ist Georg Bannert, weitgereister Reporter und - das ist für den Fortgang (oder die Fortfahrt) der Handlung nicht ganz unwichtig - Junggeselle. Wieso genau das für diese Geschichte von Görlich wichtig ist, wird man später erfahren. Vorerst aber ist Bannert unterwegs - nach Mökelen und ein bisschen zu schnell, so dass der Rasende Reporter bald einen Nachruf in seiner eigenen Zeitung bekommen hätte, eine Anzeige in der Zeitung. Er hat den Auftrag, mal wieder eine anständige Sache hinzulegen, eine mit Pfiff, und zwar mal was ganz Besonderes über eine Frau zu schreiben. Deshalb also war er unterwegs nach Mökelen. Und Nethe hatte auch irgendwie angedeutet, wie er sich diesen Text seines Reporters vorstellt - jedenfalls so ungefähr: Man muss über die Frauen mehr schreiben, weißt du … Aber eben anders … In so einer Geschichte muss was drin sein, was in den Frauen wirklich drin ist … Die meisten Frauen wissen überhaupt nicht, wie gut sie sind. Sie denken, wie ich’s dort in der Zeitung lese, so bin ich nicht. Das sind ja Fabelgestalten, Wunderfrauen. Also tauge ich nicht viel … Dann erzählte der Chefredakteur, dass es in einer kleinen Stadt mit dem Namen Mökelen eine Frau geben solle, über die man was ganz Tolles schreiben könne und wegen der es sich allein schon gelohnt habe, dass der alte Bebel sein Buch über die Frau und den Sozialismus schrieb. So langsam wurde Bannert neugierig auf Mökelen und auf die Frau dort, die, wie er nun noch hörte, Bürgermeisterin in der Stadt sei. „Weißt du, so was muss man mal richtig aufwickeln. Bürgermeisterin, kleine Stadt, verschiedenartige Probleme. Wie funktioniert das alles? Nicht nur in der Stadt. Auch bei ihr. Sie soll eigenwillig sein, hat dem Bezirk schon anständige Nüsse zu knacken gegeben. Nun wissen die dort noch nicht genau, sollen sie loben oder kritisieren. „Jetzt kannst du mal zeigen, ob du überhaupt was kannst.“ Soweit der Chefredakteur zu seinem Reporter, der da noch nicht ahnt, dass er gleich zwei Pannen hintereinander erleben wird - eine Autopanne und eine journalistische Panne. Denn die viel gelobte und viel gescholtene Bürgermeisterin stellt sich als gestrenge Obrigkeit heraus und als - aber das müssen Sie schon selber lesen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Autopanne
Erzählung
ISBN 978-3-96521-673-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1967 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1
Nethe war schuld, dass ich nach Mökelen fuhr, in jenes Städtchen, abseits der Straße gelegen, auf der die Hauptstädter ihren Sommerfreuden an Düne und Meer entgegenfahren. Ein ausgedehnter Wald gehört zu Mökelen, Tannen, Buchen und andere Bäume; in der Botanik bin ich schlecht bewandert, obwohl ich als Junge davon geträumt habe, Förster zu werden, gekleidet in einen grünen Rock, einen Hund an der Seite, der auf den Namen „Poldi“ hören sollte. Weite, saftige Wiesen gehören auch zu Mökelen – und die Möke, ein Flüsschen, das still zum Haff hinunterfließt, auf diese Weise ist das Städtchen, wenn man so will, mit der großen Welt verbunden. Dorthin also schickte mich Nethe, mein Chefredakteur; ich bin Reporter.
Nach reiflichem Überlegen muss ich meine Geschichte, die sich hauptsächlich, aber nicht nur, in dieser kleinen Stadt zutrug, mit meinem Chefredakteur beginnen – obwohl ich überzeugt bin, der Leser möchte in eine Geschichte hineinspringen, schon auf den ersten Seiten will er Unerhörtes erleben: große Liebe, tiefe Trauer, lautes Lachen, schlimmes Weinen, Mord und Eifersucht, vielleicht finstere oder sehr schöne Gedanken. Und wenn ich verspreche, dass von all dem etwas sein wird in der Geschichte?
Der Name meines Chefredakteurs steht jede Woche klein, aber fett gedruckt an der Spitze eines Impressums, ein paar hunderttausendmal. Und die Zeitschrift liegt in ebenso vielen Exemplaren in den Kiosken des ganzen Landes aus, natürlich auch in den beiden in Mökelen.
Eines Morgens betrat ich wie immer pünktlich um neun Uhr Lillys Zimmer. Sie empfing mich mit den Worten: „Du sollst mal gleich zu Nethe kommen, Georg.“
Ich hielt noch die Klinke in der Hand und fragte, nicht gerade erbaut: „Was will er denn schon wieder?“
„Er wird schon was wollen.“
Lilly ist die Kollegin, die meine Reportagen, Porträts und gelegentlichen journalistischen Mischformen säuberlich und korrekt abschreibt – und eigenschöpferisch auch, was die Grammatik und manchmal den Stil betrifft. Sie hat eine feine, aber zugleich unbekümmerte Art mir mitzuteilen, was ich in meinen Manuskripten in dieser Hinsicht übersehe. „Georg“, pflegt sie zu sagen, „du hast wieder einmal wichtige Satzzeichen vergessen. Und ,im wesentlichen‘ schreibt man klein.“
Ich erwidere dann meistens: „Schönen Dank, Lilly. Man hat eben so verflucht wenig Zeit. Es ist zum Kinderkriegen.“
Diese Bemerkung ist bei Lilly freilich fehl am Platz; sie hat dreimal Gelegenheit gehabt, Kinder zu bekommen. Ihre Antwort fällt entsprechend kühl aus; sie zieht die Augenbrauen hoch und sagt: „Ja, ja, Georg, die Zeit, ich weiß …“
Ich glaube, ohne die Lillys kann überhaupt keine Redaktion arbeiten, ähnliche Einrichtungen übrigens auch nicht. Die gewissenhaften, arbeitsamen Lillys, nüchtern und romantisch zugleich, freuen sich, wenn man ihnen hin und wieder Blumen mitbringt. Ein Strauß Nelken erfreut sie manchmal mehr als eine Prämie. Leider berücksichtigen das die wenigsten, denen die Lillys Kalender, Gewissen und Beichtstuhl sind. Hin und wieder vergesse ich es nicht.
An diesem Morgen meinte Lilly noch: „Georg, du siehst ein wenig müde aus.“
Ja, das traf, wie man so sagt, den Nagel auf den Kopf. Ich war spät in der Nacht nach Hause gekommen. Nicht aus einer Bar, wie man oft annimmt, wenn einer, der Junggeselle ist, am Morgen etwas angegriffen aussieht, sondern von einer Ökonomiekonferenz in Leipzig. Klein-Paris, das ich sonst recht nett finde, war mir trostlos und öde erschienen, und zu allem Überfluss hatte es geregnet, diesen verdammten Leipziger Regen, der den Schmutz aus Böhlen auf die Stadt klatscht. Aber meine Stimmung und der Regen waren für die Redaktion völlig uninteressant: Ich hatte über Handelsmethoden zu berichten. Weil ich manchmal den Grundsatz befolge, Unangenehmes am besten sofort zu erledigen, setzte ich mich noch nachts hinter meine Schreibmaschine und tippte die verlangten 90 Zeilen herunter. Ich fand, das sei unwahrscheinlich viel für einen Artikel über Handelsmethoden.
Und nun sollte ich zum Chef kommen, und Lillys Tonfall verriet mir, dass es keine Arbeit über Handelsmethoden sein würde, die mich erwartete. Mir wäre trotzdem lieber gewesen, am Nachmittag mit Nethe zu plaudern; seine Plaudereien sind anstrengend. Doch was half’s. Ich legte also mein in der Nacht geschaffenes Werk vor Lilly auf den Schreibtisch.
„Hab’s gleich getippt, weißt du, Lilly.“
Sie schaute auf. Und sie kann aufschauen. Man rutscht runter zu ihr und ist auf einmal ganz unten. Ich dachte an Komma und Stil.
„Na, geh schon“, sagte sie überraschend sanft, „Nethe harret deiner in Ungeduld.“
Nethe stand am Fenster und wandte mir den leicht gekrümmten Rücken zu. Auf dem Schreibtisch herrschte wie immer ein ungeheuerliches Durcheinander: Nethes Arbeitsplatz ist ein winziges Tischlein, eine Art Rauchtisch, um den herum drei Sesselchen stehen. Auf dem Tisch die Teekanne, groß und bauchig und mit dem Sprung in der Tülle, der das Eingießen zu einem wahren Kunststück macht. Neben der Teekanne lag die Karo-Packung; wer Nethe kennt, schenkt ihm Karo.
Ich setzte mich auf eines der fürchterlich knarrenden Sesselchen und wartete. Aus Erfahrung wusste ich, dass es völlig sinnlos war, sich zu melden, zu räuspern oder ähnliches zu tun. Denn Nethe überlegte. Die Hände tief in den Taschen, stand er und überlegte, und es sah aus, als blicke er angestrengt aus dem Fenster. Da war ein Kohlenhaufen zu betrachten, ein Bretterstapel und kahle Hauswände. Und wäre hier vor über zwanzig Jahren keine Bombe gefallen, könnte Nethe auch nicht durch die Lücke sehen und damit in den Himmel. Und der war blau, herbstblau. Gestern, der Regen in Leipzig, war nur ein vorübergehender Tiefausläufer gewesen. Im Allgemeinen sah es aus, als wollte der Herbst alles gutmachen, was der Sommer durch seine Eigenwilligkeiten verdorben hatte. Nur mit Wehmut konnte ich an den verregneten Juli denken und an den Urlaub. Einen langwierigen Schnupfen hatte ich mir geholt, weil ich nun mal aus Prinzip baden musste in der kühlen Ostsee.
Wie Nethe übrigens seinen Urlaub verbracht hatte, könnte ich nicht sagen. Es weiß überhaupt keiner so richtig, was er in seinem Urlaub macht. Es gibt eine Menge Vermutungen und Gerüchte. Manche glauben, er sei leidenschaftlicher Angler. Eine lustige Vorstellung: Nethe hockt in Ölkleidung krumm an einem See, die Angel hängt im Wasser, und er hat Zeit nachzudenken. Es kann aber auch sein, dass er im Urlaub zu Hause sitzt, das Telefon auf Kundendienst geschaltet hat, Manuskripte studiert und unwahrscheinliche Knüller vorbereitet. Es ist mir, aber auch anderen, ziemlich unklar, ob er überhaupt ein Privatleben hat. Dass zu seiner Familie eine Frau, eine recht nette und kluge, wie es heißt, und auch zwei Kinder gehören, erscheint mir wie ein Wunder.
Endlich kam Nethe an das Tischchen, setzte sich und sagte: „Hör zu, Kumpel. Es ist an der Zeit, dass du wieder mal eine anständige Sache hinlegst. Eine mit Pfiff.“
Er hatte „Kumpel“ gesagt, nicht Alter oder Schorsch, und ich wusste nun, dass es für mich Ernst wurde.
Noch ahnte ich nicht, wie ernst es für mich werden sollte. Auch Nethe wusste davon nichts. So nickte ich also nur, denn auf Nethes Bemerkung war nichts zu entgegnen, Erklärungen würden folgen.
Allerdings musste man Nethe genau zuhören, seine Gedankensprünge in Kauf nehmen, absonderliche Überlegungen und Abschweifungen, um das Goldkörnchen zu finden in seiner Rede. Mancher lernte das nie, und den rief Nethe dann auch nicht wieder. Ich war also auf eine anstrengende Stunde gefasst.
Aber zunächst trank er Tee, genüsslich und langsam, den schwärzesten Tee, den man sich vorstellen kann. Er bot mir eine Tasse an, aber ich lehnte mit der Bemerkung ab, noch nicht lebensmüde zu sein. Gleichmütig nahm er das zur Kenntnis. Dann blickte er auf, hinter seiner starken Brille lauerten die Augen, und er sagte: „Weißt du, man muss mal was ganz Besonderes über eine Frau schreiben.“
Er rührte eine Weile in seiner Tasse, fischte sorgsam ein Teeblättchen heraus, murmelte: „Ich hab keine festen Vorstellungen, überhaupt nicht … Weißt du, wie findest du den alten Bebel? War doch moderner als mancher, der heute was über Frauen schreibt. Wird da eine Langeweile produziert. Warum lesen die Frauen das Zeug überhaupt? Weil nichts anderes da ist? Oder? Ist auch egal. Hab mal einen Test mit meiner Madam gemacht und ihr so ein Ding zum Lesen gegeben. Interessant, die Wirkung. Das war eine Sache, wo eine fünf Kinder hat, am Abend Fernstudium betreibt, weil sie am Tage was leitet, auch noch in drei oder mehr Organisationen was vorstehen muss – und obendrein soll sie auch noch nachts ihr Ehegespons glücklich machen. Meine Frau also liest die Geschichte und sagt: ‚Heute müssen wir die Kinder baden. Lass Wasser in die Wanne!‘ Da hatte ich ihr Urteil. Sie ging sozusagen zur Tagesordnung über. Nichts gegen das Prachtweib, das dort geschildert wird. Es gibt ja die unwahrscheinlichsten Dinge. Aber so eine Frau kannst du doch nicht mit einem Chlorodont-Lächeln zeigen. Zwei Kinder machen schon allerhand Arbeit. Man muss über die Frauen mehr schreiben, weißt du … Aber eben anders … In so einer Geschichte muss was drin sein, was in den Frauen wirklich drin ist … Die meisten Frauen wissen überhaupt nicht, wie gut sie sind. Sie denken, wie ich’s dort in der Zeitung lese, so bin ich nicht. Das sind ja Fabelgestalten, Wunderfrauen. Also tauge ich nicht viel …“
So redete Nethe, etwas undeutlich und nicht sehr logisch, er nahm einen Schluck Tee, zerpflückte eine Streichholzschachtel, sprang dann auf und lief zum Fenster, drehte aber jetzt der Welt dort draußen den Rücken zu und mir sein Gesicht.
Und begann zu erzählen, dass es in einer kleinen Stadt mit dem Namen Mökelen eine Frau geben solle, über die man was ganz Tolles schreiben könne und wegen der es sich allein schon gelohnt habe, dass der alte Bebel sein Buch über die Frau und den Sozialismus schrieb.
„Mökelen?“, fragte ich, „noch nie von gehört. Wo liegt denn das Kaff?“
„Na, da auf die Küste zu“, sagte er unlustig. Meine Frage war in der Tat unsinnig; Nethe kümmert sich um derartige Dinge nicht, dafür hat er seinen gut eingespielten Apparat. Er sinnierte schon wieder über das Frauenproblem, spottete bissig und kam manchmal zu Überlegungen, die sich für keine Veröffentlichung eigneten. Aber Nethe schreibt ja keine Artikel.
Ich hatte etwas anderes vermutet, auf keinen Fall eine Fahrt in ein abgelegenes Landstädtchen im Norden, aber je länger ich Nethe zuhörte, desto mehr wich meine anfängliche Enttäuschung einer ungeduldigen Neugier auf Mökelen und die Frau dort, die, wie ich nun noch hörte, Bürgermeisterin in der Stadt sei. Nethe hatte sich wieder in den Sessel gesetzt, er hockte da, fast träumerisch vor sich hin blickend, stippte sich eine Zigarette aus der zerknautschten Packung und redete:
„Weißt du, so was muss man mal richtig aufwickeln. Bürgermeisterin, kleine Stadt, verschiedenartige Probleme. Wie funktioniert das alles? Nicht nur in der Stadt. Auch bei ihr. Sie soll eigenwillig sein, hat dem Bezirk schon anständige Nüsse zu knacken gegeben. Nun wissen die dort noch nicht genau, sollen sie loben oder kritisieren.
So wird sie vorläufig vorsichtig gelobt und vorsichtig kritisiert. Bestimmt ist sie ein bisschen naiv, im besten Sinne naiv, weißt du. Na, Schluss jetzt. Ohnehin war’s schon zu viel für dich. Jetzt kannst du mal zeigen, ob du überhaupt was kannst.“
Er betrachtete mich mit schiefgelegtem Kopf wie die Schlange ihr Opfer. Er wusste genau, dass mich seine letzte Bemerkung ziemlich getroffen hatte – und versetzte mir noch einen Hieb, teuflisch lächelnd.
„Attraktionen attraktiv verkaufen, das ist nicht schwer, mein Guter. Das hast du ja schon oft gemacht. Nehmen wir mal folgendes: Überschwemmung, Leute stehen in eiskaltem Wasser, Turbine oder sonst was ist gefährdet, Strom fällt aus, Blinddärme können nicht rausgenommen werden, und wer weiß was sonst noch. Daraus lässt sich was machen, da steckt Dramatik drin, da kannst du ein Wortfeuerwerk abbrennen. Hast ja manche Seite mit solchen Sachen bei uns gefüllt, nicht schlecht, recht passabel, sehr notwendig. Du bist ja schon ein Fuchs. Routine braucht man auch in unserem Beruf. Aber das hier, weißt du, das müsste mal was ganz anderes werden …“
„Ist die Frau hübsch?“ Das war reine Taktik. Ich wollte von der wenig schmeichelhaften Analyse meiner bisherigen Arbeiten ablenken, für die mir doch schon öffentlich Lob gezollt worden war.
„Hoffentlich nicht zu hübsch“, knurrte Nethe, „ich denke aber, du bist der richtige Mann für den Auftrag. Der eingefleischte Skeptizismus des Junggesellen gegen das weibliche Geschlecht wird dir zugute kommen.“
Dann entließ er mich aus seiner Höhle, und ich hatte die fast einmalige Erlaubnis, drei oder vier Tage in Mökelen zu bleiben, und die Gewissheit: Nethe will mit meiner Arbeit über die geheimnisvolle, widersprüchliche Bürgermeisterin in Mökelen einen Knüller starten, einen Knüller für die Frauen.
Und doch wurmte mich seine letzte Bemerkung. Mein eingefleischter Skeptizismus gegenüber Frauen, was war das schon? Mehr eine Panzerhaut. Nach außen hin wirkte sie zwar stabil, aber sie war es nicht, sie war leicht zu durchlöchern. Allerdings nicht einmal der scharf beobachtende Nethe wusste das. Die Panzerhaut oder vielmehr deren Vortäuschung hatte ich mir zugelegt, weil da mal was gewesen war. Aber davon wusste niemand hier. Hier hieß es: Bannert, der eingefleischte, skeptische Junggeselle.
Ich hatte schließlich doch eine Tasse Tee getrunken, was meinem Kreislauf gar nicht bekam, und ich stand auf der Treppe, und das Herz schlug nicht so regelmäßig, wie es sich ein Arzt wünscht.
Trotzdem fiel mir der Satz ein, der berühmte Satz in Nethes langem und manchmal konfusem Gerede, das kostbare Goldkörnchen: „Die Frauen wissen überhaupt nicht, wie gut sie sind.“ Da hatte ich das Motto für meine Arbeit. Und ich dachte: Nethe, alter Knabe, sitzt an seinem wackligen Tischchen, hustet im Qualm der Karos, rennt manchmal ans Fenster und guckt auf den Kohlenhaufen hinunter, auf den Bretterstapel, auf kahle Hauswände, und nur die Lücke lässt ihn ein bisschen Himmel sehen, hier scheint nichts günstig zu sein für gute und produktive Gedanken, aber er hat diese Gedanken. Und ich sagte zu mir: So ein Bruder, wie der das kann, du hörst ihm zu wie ein kleines Kind dem Großvater, und wie es dich packt, unmerklich, du wehrst dich noch, aber dann hat er dich. Was hat er nur für ein Talent, eine Nase für Dinge und Begebenheiten, die eine Bresche schlagen, wo man förmlich riecht, dass dort was passieren muss. In meinem nicht gerade langweiligen Reporterdasein – und ein paar Jährchen betreibe ich den Beruf nun schon – habe ich interessante Menschen kennengelernt, manchmal hab ich auch was Anständiges daraus machen können, hab ein bisschen tiefer reinleuchten können, aber Nethe wird für mich immer wie von einem Geheimnis umwittert sein. Wie macht er das? Er hockt in seiner Bude und sieht bis Mökelen oder sonst wohin – und das merkwürdigste, es stellt sich fast immer heraus, er hat den richtigen Riecher gehabt.
Lilly sah meinem Gesicht wohl an, dass ich etwas durcheinander war, und verschonte mich mit ihrer Grammatiknachhilfe.
Ich nahm meine Tasche und sagte: „Tschüs, Lilly. Gib mir deinen Segen. Ich fahr in ein Städtchen, das liegt hinter den sieben Bergen. Dort wohnt eine Frau, über die soll ich schreiben. Vielleicht ist sie so schön wie Schneewittchen.“
„Komm mir gesund wieder, Georg“, sagte Lilly, „fahr nicht wie ein Verrückter. Im Herbst ist es immer so glitschig auf den Straßen. Im vorigen Jahr hat sich Helmut totgefahren, auch um diese Zeit.“
Im Hof wusch ich meinen Wagen. Der war schon fünf Jahre alt, sein leuchtendes Rot hatte sich im Laufe der Jahre in ein Rostbraun verwandelt, aber immer noch war er auffällig. Der Motor war unverwüstlich. Ich wechselte die Kerzen, zog Schrauben nach, prüfte sogar die Batterie. Und dann überlegte ich. Fahre ich nun gleich ab oder erst morgen früh. Am liebsten fahre ich in aller Frühe: die Straßen liegen leer, die Luft ist sauber und sauerstoffhaltig, es ist ein Genuss zu fahren. Aber es war ja erst Mittag.
Ich schaute zu Nethes Fenster hoch, das geschlossen war. Ich ahnte die Rauchschwaden, in denen er saß und jetzt vielleicht ein Brötchen kaute. Er kannte keine Regelmäßigkeit, obwohl er in seiner Zeitschrift streng darauf achtete, dass die Spalte „Gesunde Lebensweise“ stets zu ihrem Recht kam.
Nethe wartete auf Ergebnisse. Warum sollte ich nicht schon heute fahren? Vor Einbruch der Dunkelheit könnte ich in Mökelen sein. Mich hielt kein heimischer Herd, kein Kind, keine Frau. Ich hatte nur meine Sachen zu holen. Und mein Reisegepäck lag immer griffbereit. In diesen Stunden vor einer Abreise fühlte ich Genugtuung über meine Freiheit. Bannert immer einsatzbereit! Das war ein geflügeltes Wort in unserer Redaktion. Und ich war sogar stolz darauf.
Doch oft, und auch jetzt wieder vor der Fahrt nach Mökelen, war ich versucht mir auszumalen, wie es sein würde, hätte der Bannert einen heimischen Herd, ein Kind oder sogar drei – und eine Frau. Eine schöne, gute Frau. Der Abschied wäre gewürzt mit einem kleinen wehmütigen Gefühl. Vor dem Auto würde ich stehen, und am Fenster sähe ich das Gesicht der Frau und die Köpfe der Kinder. Die Kinderköpfe zappeln hin und her – und ich müsste mir schon Gedanken machen, was ich von meiner Reise für sie mitbringen könnte.
Ich erinnerte mich an Frauen, nicht wenige, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengekommen war. Aber es blieb kein Gesicht so deutlich und klar in meinem Gedächtnis, dass ich es mir hinter der Fensterscheibe einer Wohnung, die mir gehört, vorstellen konnte. Ich hätte weit zurückgehen müssen in meiner Erinnerung, zu weit zurück …
Saß ich dann hinter dem Lenkrad, verflüchtigten sich diese Gedanken.
2
Auf meiner „Rennstrecke“, einem Stück Straße, das so eben und wohlerhalten ist, dass ich mir dort immer wünsche, alle Straßen in unserem Lande sollten sich dieses Stückchen zum Vorbild nehmen, erlebte ich die erste Überraschung meiner Reise. Hier probiere ich hin und wieder aus, was noch in meinem treuen Kasten steckt. Gerade bei diesem Geschwindigkeitsexperiment platzte der rechte Hinterreifen. Mit mehr Glück als Verstand brachte ich den Wagen heil zum Stehen. Ich besah mir den Schaden, insgeheim beleidigt, denn der Reifen war erst vor einer Woche aufgezogen worden. Doch es war nur festzustellen, aus dem Reifen war die Luft raus, ein mächtiger Nagel musste auf der unschuldig glatten Straße gelegen haben.
Eine Autopanne, eine fingierte freilich, gehört sozusagen zu meinem Reporterarsenal. Manche Kollegen meinen, das sei ein Tick von mir. Das lässt mich kalt; mit meinem Tick habe ich recht gute Erfahrungen gemacht. Muss ich in einer Stadt oder einem Dorf Material für eine Reportage oder ein Porträt sammeln, beginne ich meine Arbeit mit einer Panne. Ich schiebe das Auto in die örtliche Reparaturwerkstatt und stelle mich dabei furchtbar ungeschickt an. Ich spiele einen Durchreisenden, am liebsten einen lebensfremden Intellektuellen, der nicht ein noch aus weiß mit der Technik.
Die Panne auf meiner „Rennstrecke“ war nicht eingeplant, das bewies die Schlingerspur auf dem Asphalt. Diese betrachtend, erlebte ich noch einmal die letzten aufregenden hundert Meter. Ich wusste, die Amokfahrt hatte begonnen, als die Tachonadel über der Zahl 100 zitterte.
Ein Pferd schnaubte, und jemand sagte: „Brr!“ Ein alter Mann in einer grünen Lodenjoppe, auf dem Kopf einen Filzhut, der in seiner Form einem abstrakten Kunstwerk ähnelte, kletterte steifbeinig vom Bock, besah den Schaden und dann mich und sagte: „Je, je …, dass Sie noch hier rumstehen.“
Ja, ich stand noch herum, und jetzt erst fing das berühmte Kniezittern an.
Der Alte mit dem Filzhut bemerkte ungerührt: „Ich hab gedacht, da gibt’s bald eine Beerdigung. Und dann hab ich meiner Lisa einen übers Fell gezogen. Vielleicht, so hab ich gedacht, kannst du noch was tun für den da.“
Ich begann mir vorzustellen, wie das gewesen wäre, hätte sich die Annahme des fürsorglichen Alten erfüllt. Es war eine so schöne Straße, stabile Bäume säumten sie, die ganze Szenerie beleuchtet von einer milden Herbstsonne, im Großen und Ganzen also ein stimmungsvolles Bild. Ich betrachtete die Bäume und überlegte, welcher wohl meinem Auto den Garaus gemacht hätte und unter Umständen auch meiner Laufbahn auf dieser von mir so heiß geliebten Erde.
Der Alte stand neben mir und beobachtete mit Kennerblicken, wie ich das Rad wechselte.
„Sehen Sie“, sagte er, „Sie können noch zupacken. Kraft ist noch in Ihren Armen. Ihr Kopf funktioniert auch noch. Aber hätt’s nicht anders kommen können? Sie würden daliegen, stumm und starr. So ist das nun mal in des Menschen Dasein. Sie, wenn ich Sie so sehe, Sie haben sich doch bestimmt noch viel vorgenommen. Stimmt’s? Sie sind ja gerade mal in den besten Jahren.“
„Und ob“, brummte ich, „ich hab mir noch manches vorgenommen. Aber eine Panne dieser Art lässt sich eben nicht voraussehen. Manche Panne lässt sich nicht voraussehen.“
Der Bauer meinte eifrig: „Das sag ich auch immer zu meinem Weib. Pannen passieren sozusagen überall. So eine Panne kann aber eine Bedeutung haben. Ihre zum Beispiel kann ein Fingerzeig gewesen sein. Sei vorsichtig, mein Lieber, soll das heißen, das nächste Mal geht es anders aus.“
„Sind Sie abergläubisch?“, fragte ich boshaft.
Der Alte tat entrüstet. „Was halten Sie von mir. Ich hab meine Erfahrungen. Die deute ich aus. Das macht jeder vernünftige Mensch. Mir ist mal vor ein paar Jahren mein Trabant in den Graben gerutscht. Bei trockenem Wetter. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Seitdem fährt meine Frau. Die denkt nicht soviel wie ich. Sie fährt.“
„Das ist wahr. Wer fährt, soll nicht denken“, sagte ich. „Oder besser: Wer denkt, soll nicht fahren.“ Bei dieser Blödelei fiel mir ein, dass eigentlich Nethe an meinem Tod schuld gewesen wäre. Er hatte mich nach Mökelen geschickt. Er hätte die Rede an meinem Grab halten müssen. Die sonderbarsten Dinge gingen mir durch den Kopf. Nethe steht an meinem Grab und hat die unentbehrliche Teekanne neben sich und natürlich eine Karo zwischen den Fingern. Seine Rede beginnt mit der lakonischen Feststellung, dass ich auf dem Weg nach Mökelen verunglückt sei. Leider, leider, denn dort hätte ich die Arbeit meines Lebens schreiben können … Ich legte den Schraubenschlüssel ins Gras und richtete mich auf. Man sollte solchen Vorstellungen keinen Raum geben. Nethe, der nüchterne Rationalist, wäre erschüttert. Gedanken an einen Hügel aus gelbem Sand, und das alles nur, weil ein Reifen platzte?
Der alte Bauer neben mir philosophierte unentwegt, hin und wieder rief er seinen Gaul zur Ordnung, weil es den zu den Grasbüscheln am Straßenrand zog. Die Arbeit ging mir recht mühselig von der Hand; das Gerede des Alten war mir nicht unangenehm, es verkürzte mir die Zeit, und als ich mich von dem Alten verabschiedete, hatte ich mein seelisches Gleichgewicht einigermaßen wiedergefunden.
Der Bauer sagte zum Schluss: „Was Sie es bloß so eilig haben? Und wenn Sie jetzt da am Baum liegen würden, starr und stumm?“
Ich fuhr nun nicht ganz so schnell dem Städtchen Mökelen und meiner journalistischen Panne entgegen.
3
Die schmale Straße war gut erhalten und die Apfelbäume abgeerntet. Das festzustellen war schon meine Reporterarbeit, denn Straße und Obstbäume gehörten zum Städtchen Mökelen, über dessen Oberhaupt ich schreiben wollte.
Vom Hügel schwang sich die Straße hinunter in die Stadt, die der breite Turm einer Kirche wie üblich überragte. Dann fielen mir Peitschenmastenlampen auf, die gerade aufflammten, als ich das gelbe Ortsschild passierte, wie zu meiner Begrüßung.
Den Wagen ließ ich langsam ausrollen, meinen Autopannentrick einleitend, dabei musste ich an die Schlingerspur auf meiner Rennstrecke denken, und ein leiser Schauer lief mir über den Rücken. Aber nur ein kurzer Schauer. Alles, was ich nun tat, hatte einem Zweck zu dienen: die Bürgermeisterin dieses Ortes, den Netheschen Knüller, einzukreisen, an ihre Geheimnisse heranzukommen. Mökelen war jetzt für mich eine eigene, unbekannte Welt, dieses Städtchen, von drei Seiten eingeschlossen vom Wald, mit seiner alten wuchtigen Kirche, deren Dach stellenweise neu gedeckt war, und den Peitschenmasten an der Einfahrtstraße. Die Peitschenmasten gefielen mir im ersten Augenblick überhaupt nicht, sie störten mich geradezu. Die niedrigen Häuschen schienen sich zu ducken unter den starren Gesellen aus Stahl und Glas. Da war ja kein Mondlicht mehr in der Lage, Schatten in die Gärten zu zaubern. Aber meine romantische Ader ist Privatsache, objektiv gesehen waren die Masten technischer Fortschritt, der mir hier nun im wahrsten Sinne des Wortes sofort ins Auge fiel.
Den Wagen ließ ich also ausrollen, drückte sanft auf das Bremspedal und sah mich müde nach jemandem um, den ich nach einer Autowerkstatt fragen konnte.
Vor einem efeubewachsenen Haus fegte mit Hingabe ein junger Mann den Fußweg. Ich stieg aus und ging auf ihn zu. Er stützte sich auf den Besenstiel und sah mir erwartungsvoll entgegen.
„Panne?“, fragte er.
„Leider“, sagte ich und bemerkte bei ihm ein waches Interesse für mein Auto. Fachmann vielleicht oder sein Hobby, dachte ich.
„So ein Pech. Und was?“
„Zündung anscheinend“, sagte ich vage, denn dabei boten sich die vielfältigsten Möglichkeiten für eine fingierte Panne.
„Aha“, meinte er kennerisch, „und Sie haben nicht viel Ahnung, wie?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Nicht gerade viel. Und die Zündung … Sie wissen …, eine heikle Sache.“
Er lehnte den Besen an die Hauswand und trat an den Wagen heran.
„Der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.“
„Hat er. Gibt es hier eine Werkstatt?“
Er trommelte mit den Fingern einen Marsch auf dem Blech der Kühlerhaube. Mir kam es vor wie „Auf in den Kampf, Torero“, aber da konnte ich mich irren.
„Ja, wir haben eine. Am Markt. Aber heute ist schon Feierabend.“ Er betrachtete mich abwägend. „Haben Sie es eilig?“
„Ich hab Zeit. Urlaubsfahrt …“, sagte ich rasch, wunderte mich aber über den seltsamen Blick des jungen Mannes.