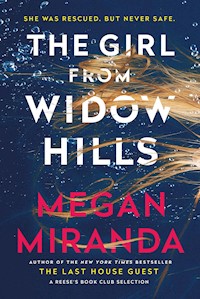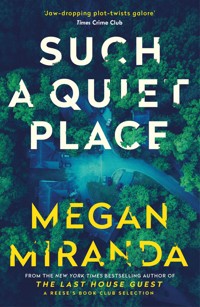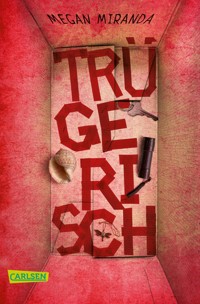9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach den Bestsellererfolgen »Tick Tack«, »Little Lies« und »Perfect Secret« garantiert die internationale Thrillerkönigin Megan Miranda mit ihrem nächsten großen Thriller »Bad Dreams« wieder für einen fesselnden Pageturner mit temporeichem Spannungsplot und atmosphärischem Setting!
Kannst du dir trauen, wenn du schläfst?
Arden Maynor ist sechs Jahre alt, als sie schlafwandelnd das Haus verlässt und in einer Sturmnacht verschwindet. Die Polizei und Feuerwehr, Freunde und Fremde suchen alles nach ihr ab und halten verzweifelte Mahnwachen. Der Fall wird zu einem nationalen Medienspektakel. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit wird Arden Tage später gefunden, in einem unterirdischen Abwasserschacht – und am Leben. Die Rettung grenzt an ein Wunder, die Öffentlichkeit ist wie besessen von Arden.
Viele Jahre später lebt sie unter dem Namen Olivia hunderte Meilen entfernt. Doch nun, wo der zwanzigste Jahrestag ihrer Rettung näher rückt, fühlt sie sich wieder beobachtet. Eines Nachts wacht sie plötzlich außerhalb ihres Bettes auf, wie damals. Und zu ihren Füßen liegt die Leiche eines Mannes, den sie aus ihrem früheren Leben kennt …
»Megan Miranda steht für atemberaubende Twists und überraschende Wendungen.« The New York Times Book Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MEGANMIRANDA hat am Massachusetts Institute of Technology Biologie studiert und ist heute hauptberuflich als Autorin tätig. Sie hat bereits mehrere Jugendromane veröffentlicht und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in North Carolina. Ihr erster Thriller TICK TACK wurde international sofort ein riesiger Erfolg. In Deutschland stiegen nach TICK TACK auch ihre beiden packenden Thriller LITTLE LIES und PERFECT SECRET in die Top 10 der Bestsellerliste ein.
Megan Mirandas Thriller in der Presse:
»Megan Miranda steht für atemberaubende Twists und überraschende Wendungen.« The New York Times Book Review über BAD DREAMS
»Miranda stellt ihr Talent in nervenzerreißenden und glaubwürdigen Twists zur Schau. Sogar geübte Leser sehen das hier nicht kommen. Ein grusliger rasanter Thriller mit einer außergewöhnlichen Heldin. Mirandas bisher bestes Buch!« KirkusReviews über BAD DREAMS
»Der ultimative Thriller! Spannung bis zur letzten Seite.« Reese Witherspoon (»Reese’s Book Club«) über PERFECT SECRET
»Ein brillanter Psychothriller.« Booklist über LITTLE LIES
»Irre spannend und extrem trickreich konstruiert.« Gala über TICK TACK
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Megan Miranda
BAD DREAMS
Deine Träume lügen nicht
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Cathrin Claußen
Die Originalausgabe erschien 2020unter dem Titel The Girl from Widow Hills
bei Simon & Schuster, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Megan Miranda LLC
All rights reserved.
Published by arrangement with the original publisher, Simon & Schuster, Inc.
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: © Des Panteva / Trevillion Images; © Chris Clor / GettyImages; © elegeyda / shutterstock
Redaktion: Barbara Raschig
Umsetzung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-27527-3V003
www.penguin-verlag.de
Für meine Familie
Prolog
Ich war das Mädchen, das überlebt hat.
Das Mädchen, das durchgehalten hat. Das Mädchen, für das du gebetet hast, zumindest hast du so getan – vor allem aber warst du dankbar, dass nicht dein eigenes Kind verschwunden war, dort unten, in der Dunkelheit.
Und danach: War ich ein Wunder. Die Sensation. Die Story.
Die Story war das, was die Leute wollten, und es war eine verdammt gute Story. Ein Beweis für Menschlichkeit, für Hoffnung und Willenskraft. Nachdem die Tragödie schon so nah gewesen war, reagierte die Öffentlichkeit fast euphorisch, als es dann doch keine wurde. Ob aus Freude oder bloßem Schock, das Ergebnis war dasselbe.
Für eine kleine Weile war ich berühmt, man widmete mir Artikel, Interviews, ein Buch. Das Ereignis wurde zu einer Nachrichtenstory, die nach einem Jahr noch einmal aufgewärmt wurde, dann nach fünf, nach zehn.
Und jetzt wusste ich, was passierte, wenn man seine Geschichte jemand anderem übergab. Wie man zu einer anderen Person wurde, zurechtgebogen, um in den vorgegebenen Rahmen zu passen. Zu etwas, das man konsumieren konnte.
Dieses Mädchen ist in der Zeit erstarrt, Anfang, Mitte und Ende: Opfer, Durchhalten, Triumph.
Es war eine gute Story. Ein gutes Gefühl. Ein gutes Ende.
Und Abblende.
Als wäre alles vorbei, wenn die täglichen Nachrichten zu etwas anderem übergingen, keine neuen Artikel mehr erschienen und die Gespräche andere Themen beinhalteten. Als würde es nicht gerade erst beginnen.
Es gab eine Zeit, da wusste ich, worauf sie hinauswollten. Als allen klar war, worum es ging, wenn es hieß: Das Mädchen aus Widow Hills, weißt du noch?
Dieser plötzliche Schwall von Furcht und Hoffnung und Erleichterung, alles auf einmal.
Ein gutes Gefühl.
Dieses Mädchen war ich schon lange nicht mehr.
Kapitel 1
Mittwoch, 19 Uhr
Der Karton stand vor der Verandatreppe auf einem kleinen Flecken Erde, wo das Gras noch immer nicht wachsen wollte. Die Pappseiten waren den Elementen ausgeliefert gewesen, mein voller Name stand in schwarzem Edding darauf, die Umrisse meiner Adresse waren bereits verlaufen. Er passte auf meine Hüfte, wie ein Kind.
Ich wusste, dass sie weg war, bevor ich aufwachte.
Die erste Zeile aus dem Buch meiner Mutter, das Gleiche, was sie angeblich auch der Polizei als Erstes erzählt hatte. Ein Gefühl, das sie in jedem Medieninterview in den Monaten nach dem Unfall wiederholte, mit Direktübertragung in Millionen von Wohnzimmern im ganzen Land.
Fast zwanzig Jahre später war das der Refrain, den ich nun wieder im Kopf hörte, als ich den Karton die Holzstufen hinauftrug. Das Stocken in ihrer Stimme. Der vertraute Tonfall.
Ich machte die Haustür hinter mir zu und schloss ab, trug den Karton durch den Flur mit der gewölbten Decke bis zum Küchentisch. Etwas bewegte sich darin, fast gewichtslos.
Es klapperte, als ich ihn auf den Tisch stellte, mehr Lärm als Gehalt. Ich ging direkt zu der Schublade neben der Spüle, zögerte den Moment nicht länger hinaus, er sollte nicht an Wichtigkeit gewinnen.
Mit dem Teppichmesser fuhr ich durch das dreilagige Klebeband. Die Ecken weich von der Feuchtigkeit, die noch am Boden haftete – am Tag zuvor hatte es geregnet. Der Deckel saß fest oben drauf. Von innen entwich eine dunkle Kühle.
Ich wusste, dass sie weg war –
Ihre Worte waren bestenfalls ein Klischee, schlimmstenfalls gelogen – eine im Nachhinein ausgedachte Story.
Vielleicht hatte sie wirklich daran geglaubt. Ich tat das kaum, außer ich fühlte mich gerade sehr großzügig – was im Moment der Fall war, als ich den traurigen Inhalt dieses halb leeren Kartons anstarrte. Da wollte ich es glauben – wollte glauben, dass es irgendwann einmal eine Verbindung zwischen ihrer und meiner Seele gegeben hatte und dass sie in der Leere etwas hatte fühlen können: ein Prickeln im Nacken, ihr Rufen durch den dämmerigen Flur, der sich immer feucht anfühlte, sogar im Winter; mein Name – Arden? –, der von den Wänden widerhallte, auch wenn sie wusste – siewussteeseinfach –, dass keine Antwort kommen würde; die Vordertür bereits geöffnet – das erste echte Zeichen – und die Fliegengittertür hinter ihr zuknallend, als sie barfuß auf den nassen Rasen rannte, immer noch in ihrer Flanellpyjamahose und einem ausgefransten verblichenen T-Shirt, meinen Namen kreischend, bis ihr Hals rau war. Bis die Nachbarn kamen. Die Polizei. Die Presse.
Es war reine Intuition. Die zweite Zeile ihres Buches. Sie wusste, dass ich weg war. Natürlich wusste sie es.
Jetzt wünschte ich, ich hätte dasselbe sagen können.
Statt der Wahrheit: dass meine Mutter schon seit sieben Monaten weg war, bevor ich es erfuhr. Erfuhr, dass sie nicht einfach zu einer Sauftour verschwunden war oder man ihr das Handy wegen Zahlungsrückstand abgeschaltet oder sie einen Typen gefunden hatte und in sein Leben geschlüpft war, nur ihre Hülle zurückgelassen hatte, während ich einfach dankbar gewesen war, dass ich so lange nichts von ihr gehört hatte.
Da war immer diese lauernde Angst, dass sie, egal wie weit ich fortging, egal wie viele Schichten ich zwischen uns brachte, eines Tages wie eine Erscheinung einfach wieder auftauchen würde: dass ich eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit vor die Tür trat, und da stünde sie, auf der Veranda, unheilvoll, trotz ihrer geringen Größe, mit einem zu breiten Lächeln und zu dünnen Gliedern. Sie würde ihre knochigen Arme um meinen Hals legen und lachen, als hätte ich sie herbeigerufen.
In Wirklichkeit hatte es sieben Monate gedauert, bis mich die Wahrheit erreichte, langsame Mühlen der Bürokratie, und sie geriet immer ganz unten in den Stapel. Eine Überdosis in einem Land, das von Überdosen überrollt wurde, in einem Staat mitten im Hinterland, begraben unter einer wachsenden Epidemie. Kein Ausweis in ihrem Besitz, keine Adresse. Nicht identifiziert, und dann fanden sie doch irgendwie ihren Namen heraus.
Vielleicht hat jemand nach ihr gesucht – ein Mann, das Gesicht austauschbar mit dem jedes anderen Mannes. Vielleicht haben ihre Fingerabdrücke zu etwas Neuem im System gepasst. Ich wusste es nicht, und es spielte keine Rolle.
Was auch immer geschehen war, irgendwann konnten sie ihren Namen zuordnen: Laurel Maynor. Und dann warteten sie noch etwas länger. Bis jemand genauer hinsah, tiefer grub. Vielleicht war sie in den Jahren zuvor einmal in einem Krankenhaus gewesen; vielleicht hatte sie meinen Namen als Kontakt angegeben.
Oder vielleicht gab es auch keine konkrete Verbindung, sondern ihnen fiel nur etwas ein: War das nicht die Mutter dieses Mädchens? Dieses Mädchens von Widow Hills? Sie erinnerten sich an die Titelseiten, die Schlagzeilen. Kramten meinen Namen heraus, verfolgten ihn durch Zeit und Entfernung anhand einer schwachen Spur auf Papier.
Als das Telefon klingelte und sie nach mir unter meinem vorigen Namen fragten, den, den ich nicht mehr benutzte, seit der High School nicht mehr, hatte ich es immer noch nicht begriffen. Ich sah es noch nicht einmal in dem Moment vorher, kurz bevor sie es sagten. Spricht da Arden Maynor, die Tochter von Laurel Maynor?
Ms. Maynor, wir haben leider schlechte Nachrichten.
Sogar da dachte ich an etwas anderes: meine Mutter, in einer Zelle eingesperrt, die wollte, dass ich sie raushaute. Ich hatte mich auf das falsche Gefühl vorbereitet, biss die Zähne zusammen, stählte meine Überzeugung –
Sie sei seit sieben Monaten tot, sagten sie. Die Behörde hätte sich bereits um alles gekümmert, nachdem sich so lange niemand gemeldet habe. Es gäbe nur ein paar persönliche Gegenstände abzuholen, die sie hinterlassen hatte. Für die Zuständigen war es sicher eine Erleichterung, sie von der Liste streichen zu können, als sie meine Adresse oben auf alles kritzelten, was übrig geblieben war, es dreifach mit Klebeband versiegelten und durchs halbe Land schickten, zu mir.
Ein Umschlag lag im Karton, eine unpersönliche Liste des Inhalts: Kleidung; Baumwolltasche; Handy; Schmuck. Aber das einzige Kleidungsstück im Karton war ein grüner Pulli, fleckig und mit Löchern an den Ärmelenden, von dem ich annahm, dass sie ihn wohl getragen hatte. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie schlimm der Zustand ihrer restlichen Kleidung gewesen sein musste, wenn das das Einzige war, das es wert war zu schicken. Dann: eine leere Tasche, die eher ein Stoffbeutel war, der Reißverschluss zu, aber der Haken fehlte. Irgendwann waren einmal Worte darauf gedruckt gewesen, aber nun war alles grau-blau-verwaschen, verblichen und unlesbar. Darunter das Handy. Ich nahm es in die Hand: ein Klapptelefon, alt und zerkratzt. Wahrscheinlich von vor zehn Jahren, ein Prepaid-Handy.
Und am Boden, in einer Plastiktüte, ein Armband. Ich hielt es in meiner Handfläche, ließ den Anhänger los, sodass er an der Kette schwang, die einst gold gewesen, jetzt aber teilweise grünlich-schwarz angelaufen war. Der Anhänger, ein kleiner Ballettschuh, war mit einem winzigen schimmernden Stein in der Mitte der Schleife besetzt.
Ich hielt den Atem an, der Anhänger schwang wie ein Metronom, im Takt der Zeit, obwohl die Welt doch stillstand. Ein Stück unserer Vergangenheit, das irgendwie übrig geblieben war, das sie nie verkauft hatte.
Sogar die Toten konnten einen überraschen.
In diesem Moment, als ich das zarte Armband hielt, fühlte ich in meiner Brust etwas zuschnappen, als würde eine Lücke geschlossen. Die Kluft zwischen dieser Welt und der nächsten.
Das Armband rutschte mir aus der Hand und fiel auf den Tisch, rollte sich zusammen wie eine Schlange. Ich tastete mit der Hand noch einmal den Boden des Kartons ab, suchte mit den Fingern in den Ecken, nach mehr.
Es war nichts mehr da. Das Licht im Zimmer veränderte sich, als hätten sich die Vorhänge bewegt. Vielleicht waren es nur die Bäume draußen, die Schatten warfen. In einem Anfall von Schwindel verdunkelte sich mein Gesichtsfeld. Ich versuchte, wieder klar zu sehen, griff nach der Tischkante, um mich zu stabilisieren. Aber ich hörte ein Rauschen, als würde der Raum sich aushöhlen.
Und da fühlte ich es, genau wie sie gesagt hatte – eine Leere, eine Abwesenheit. Die Dunkelheit, die sich öffnete.
Alles, was sonst noch im Karton war, war ein Geruch, wie Erde. Ich sah kalte Felsen und stehendes Wasser vor mir – vier Wände, die näher kamen – und machte unbewusst einen Schritt Richtung Tür.
Vor zwanzig Jahren war ich das Mädchen gewesen, das in einem Sturm mitgerissen und davongespült worden war: in das Abwassersystem unter dem Waldgebiet von Widow Hills. Aber ich hatte überlebt, aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz, hatte der Kraft der Brandung widerstanden, meinen Kopf über Wasser gehalten bis die gnadenlose Überschwemmung wich, hatte irgendwann den Weg ans Tageslicht gefunden, mich am Gitter eines Gullys festgehalten – wo ich schließlich entdeckt worden war. Es hatte fast drei Tage gedauert, mich zu finden, aber die Erinnerung an diese Zeit war längst verblasst. Verloren gegangen im Dickicht des Heranwachsens, des Traumas oder aus Selbstschutz. Mein Verstand beschützte mich, bis ich die Erinnerung nicht mehr an die Oberfläche holen konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Alles, was blieb, war die Angst. Vor geschlossenen Räumen, vor endloser Dunkelheit, davor, dass es keinen Ausweg gab. Ein Instinkt statt einer Erinnerung.
Meine Mutter hatte uns beide Überlebenskämpferinnen genannt. Lange Zeit hatte ich ihr geglaubt.
Der Geruch war wahrscheinlich einfach der des Kartons selbst, der der feuchten Erde und dem kühlen Abend ausgesetzt gewesen war. Das Außengelände meines neuen Zuhauses, nach drinnen gebracht.
Aber eine Sekunde lang erinnerte ich mich, so klar, wie ich es weder damals noch jemals seitdem getan hatte. Ich erinnerte mich an die Dunkelheit und die Kälte und meine kleine Hand, wie sie sich an einem verrosteten Metallgitter festhielt. Ich erinnerte mich an mein eigenes abgehacktes Atmen in der Stille und an etwas anderes, weit entfernt. Fast ein Geräusch. Als könnte ich das Echo eines Schreis hören, mein Name vom Wind in unfassbare Dunkelheit getragen – meilenweit, unter die Erde, wo ich darauf wartete, gefunden zu werden.
ABSCHRIFT DER PRESSEKONFERENZ 17. OKTOBER 2000
Wir bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der sechsjährigen Arden Maynor, die seit dem späten gestrigen Abend oder dem heutigen frühen Morgen vermisst wird. Braune Haare, braune Augen, zirka einen Meter groß und sechzehn Kilo schwer. Sie wurde zuletzt in ihrem Zimmer in der Warren Street am Stadtrand von Widow Hills gesehen, sie trägt einen blauen Pyjama. Informationen bitte dringend unter der eingeblendeten Nummer mitteilen.
CAPTAIN MORGAN HOWARD
Widow Hills Polizeidienststelle
Kapitel 2
Freitag, 3 Uhr
Ich hörte wieder meinen Namen, aus weiter Ferne schnitt der Ruf durch die Dunkelheit.
»Liv. Hey, Liv.« Er kam näher. »Olivia.« Die Szene wurde scharf, die Stimme weicher. Ich blinzelte zweimal, fixierte die Hecke vor mir, die tief hängenden Zweige, ein Verandalicht, das gespenstisch gelb durch die Blätter schien.
Und dann Ricks Gesicht, das Weiß seines T-Shirts, als er sich zur Seite drehte und durch die Büsche hindurchzwängte, die unsere Grundstücke trennten. »Okay«, sagte er und näherte sich mit ausgestreckten Händen, wie um mich nicht zu erschrecken. »Alles in Ordnung?«
»Was?« Ich konnte mich nicht orientieren. Der kühle Wind, die Dunkelheit, Rick, der in einem T-Shirt und grauer Jogginghose vor mir stand, die Haut um seine Augen faltig, schwielige Hände auf meinem Arm in Ellbogennähe – dann ließ er wieder los.
Ich trat einen Schritt zurück und zuckte zusammen, weil mich etwas in die rechte Fußsohle stach, der Schmerz schoss durch den Nebel. Ich war draußen. Draußen, mitten in der Nacht und –
Nein. Nicht das. Nicht noch einmal.
Meine Reflexe waren noch zu langsam, um in Panik zu geraten, aber ich verstand die Fakten: Ich war nach draußen ins Freie gelaufen, barfuß und mit trockenem, brennenden Hals. Ich machte eine kurze Bestandsaufnahme meiner selbst: ein scharfer Schmerz zwischen zwei meiner Zehen; der Saum meiner Schlafanzughose klamm wegen des feuchten Bodens; die Handflächen bedeckt von Splitt und Erde.
»Okay, ich hab dich.« Hände auf meinen Schultern drehten mich wieder in Richtung meines Hauses. Wie ein Tier, das man zurückgeleiten musste. »Schon in Ordnung. Mein Sohn, der ist auch manchmal geschlafwandelt. Draußen hab ich ihn allerdings nie gefunden.«
Ich versuchte mich auf seinen Mund zu konzentrieren, auf die Worte, die er sagte, aber etwas entglitt mir. Seine Stimme war immer noch zu weit weg, es war wie eine Szene aus einem Traum. Als wäre ich noch nicht ganz wieder zurück, von wo auch immer ich gewesen war.
»Nein, ich nicht«, sagte ich, und die Worte kratzten in meinem Hals. Ich fühlte mich plötzlich ausgetrocknet, war wahnsinnig durstig. »Das mach ich nicht mehr«, sagte ich und hob meine Füße, stieg die Verandastufen hoch, in meinen Gliedern kribbelte es, als würde nach zu langer Zeit das Gefühl zurückkehren.
»Mm«, sagte er.
Es stimmte, was ich ihm gesagt hatte. Die anhaltenden Albträume, ja, besonders um den Jahrestag herum, wenn wieder alles so nah an der Oberfläche zu sein schien. Wenn jedes Türklopfen, jeder unbekannte Anrufer mir Übelkeit verursachte. Aber das Schlafwandeln, nein, das hatte ich hinter mir gelassen. Seit meiner Kindheit. Als ich jünger war, hatte ich Medizin dagegen genommen und als ich damit aufhörte – eine vergessene Dosis, dann zwei, dann ein Rezept, das nicht mehr neu ausgestellt wurde –, war es auch schon vorbei gewesen. Es war etwas, das in der Vergangenheit passiert war. Eine Sache, die wie alles, was davor kam, in einem anderen Leben zurückgelassen worden war, bei einem anderen Mädchen.
»Nun ja«, sagte er, als er da neben mir auf der Veranda stand, »scheint aber doch so, meine Liebe.« Das Verandalicht warf lange Schatten durch den Garten.
Rick legte seine Hand an den Türknauf, aber er ließ sich nicht drehen. Er rüttelte noch einmal daran, seufzte dann. »Wie hast du das denn geschafft?« Er sah meine leeren Hände an, als hätte ich vielleicht einen Schlüssel in meiner Faust versteckt, dann kniff er die Augen zusammen und betrachtete den Dreck unter meinen Fingernägeln, sein Blick wanderte nach unten zu dem Blut an meinen Zehen.
Ich wollte ihm etwas erzählen – darüber, wozu mein Unterbewusstsein fähig war. Von Überleben und Instinkt. Aber plötzlich streifte uns eine kalte Windböe und verursachte uns Gänsehaut. Sommernächte in North Carolina, durch die Höhe war es hier oft frisch. Rick zitterte und blickte zur Seite, als könne er die Kälte nächstes Mal kommen sehen.
»Hast du noch einen Schlüssel?«, fragte ich und verschränkte die Arme vor dem Bauch, ballte die Hände zusammen. Er war der ursprüngliche Besitzer, ich hatte das Haus direkt von ihm gekauft. Rick hatte es selbst entworfen. Früher hatte einmal sein Sohn darin gewohnt, aber der hatte die Stadt vor ein paar Jahren verlassen.
Ricks Gesicht verschloss sich, seine Mundwinkel verzogen sich nach unten. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Schlösser austauschen.«
»Das mach ich noch. Es steht auf meiner Liste. Also, hast du?«
Er schüttelte den Kopf, fast lächelnd. »Ich hab dir alles gegeben, was ich hatte.«
Ich rüttelte selbst an der Tür, stellte mir diese andere Version meiner Selbst vor. Diejenige, die durch diese Tür nach draußen getreten sein musste, es aber geschafft hatte, sie zu verriegeln, bevor sie sie hinter sich zuzog. Muskelgedächtnis. Sicherheit kam zuerst.
Die Verandadielen quietschten, als ich zum Wohnzimmerfenster ging. Ich versuchte, es von unten aufzuschieben, aber es war ebenfalls verschlossen.
»Liv«, sagte Rick, während er mir dabei zusah, wie ich in die dunklen Fenster spähte, die Augen mit den Händen abgeschirmt. Ich hatte drinnen kein einziges Licht angemacht. »Bitte kümmere dich um die Schlösser. Hör zu, die Freunde meines Sohnes, die waren nicht alle gut, nicht alles gute Menschen, und –«
»Rick«, sagte ich und wandte mich zu ihm um. Er sah immer noch etwas anderes in diesem Ort hier, Jahre her, vergangen, lange bevor ich ankam. Bevor das Krankenhaus entstand und die Baufirma und das glatte neue Pflaster und Restaurantketten und Leute kamen. »Wenn mich jemand hätte ausrauben wollen, hätte er bestimmt nicht über ein Jahr damit gewartet.« Er öffnete den Mund, aber ich streckte die Hand aus. »Ich tausche sie aus, okay? In der jetzigen Situation hilft das allerdings leider nicht.«
Er seufzte und sein Atem entwich als Dampfwolke. »Vielleicht bist du auf einem anderen Weg hinausgelangt?«
Ich folgte ihm die Verandastufen hinunter und lief vorsichtig durch das Gras und Unkraut. Gemeinsam gingen wir um das Haus herum, als würden wir meinem Geist folgen. Mein Schlafzimmerfenster war zu hoch, um es vom abschüssigen seitlichen Garten zu erreichen, aber es schien geschlossen zu sein. Wir versuchten es am Hintereingang, kontrollierten dann die Fenster vom Arbeitszimmer und der Küche – alles, was irgendwie in Reichweite war.
Nichts war verändert, nichts ließ sich öffnen. Rick sah hoch zu den schrägen Fenstern des unfertigen Dachbodens und runzelte die Stirn. Sie standen teilweise offen, führten zu einem kleinen Balkon, der ausschließlich dekorativen Zwecken diente.
Ich kämpfte gegen ein Schaudern an. »Das ist aber ganz schön hoch«, sagte ich. Der obere Stock war fast unbenutzt, leer, bis auf den einzelnen hölzernen Schaukelstuhl, der dort zurückgelassen worden war, weil er zu groß war, um ihn die Treppen hinunter zu manövrieren – als wäre er genau da oben gebaut worden und nun dort gefangen. Eine einsame Glühbirne hing von der offenen Balkendecke hinab, an der einzigen Stelle, an der man in dem schrägen Dachvorsprung aufrecht stehen konnte.
Es gab eine schmale Treppe nach oben, versteckt hinter einer Tür im Flur. Der Raum war zu eng, zu dunkel, sämtliche meiner Sinne rebellierten. Da konnte man die Geräusche des Hauses hören: Wie das Wasser durch die Leitungen floss, der Gasbrenner ansprang, der Ventilator sich drehte. Ich ging kaum dorthin, außer um sauber zu machen. Aber ich hatte mir angewöhnt, immer, wenn ich es tat, die Fenster sofort zu öffnen, nachdem ich die Treppen hinaufgestiegen war, um die Aufgabe überhaupt durchzustehen.
Ich habe gehört, dass man sich, wenn man unter Wasser gefangen ist und nicht weiß, wo oben ist, orientieren könne, indem man Luft ausstößt und den Blasen folgt – eine Spur in die Sicherheit. Die offenen Fenster funktionierten ziemlich genau so. Falls es je nötig wäre, würde ich den Luftzug spüren und wüsste, wo es hinausging.
Ich muss vergessen haben, sie nach dem letzten Mal zu schließen.
Aber ein Sprung von da oben hätte viel mehr Schaden angerichtet, als nur Dreck an den Händen und einen Kratzer am Fuß.
Rick trat von einem Bein auf das andere, und erst da bemerkte ich, dass auch er barfuß war. Er hatte mich gehört oder gesehen, mitten in der Nacht, und war hinausgeeilt, um mir zu helfen, ohne sich Schuhe oder eine Jacke anzuziehen. Er ging zum Hintereingang des Hauses, und ich folgte ihm.
»Mein Sohn hat früher immer einen Schlüssel versteckt …« Er bückte sich zu der untersten Verkleidung der Holzstufen. Fischte mit den Fingern in dem splitterigen Hohlraum herum. Zog etwas von Matsch Bedecktes hervor. Er stemmte eine Hand auf sein Knie, um sich wieder aufzurichten, und reichte mir dann mit schiefem Grinsen das metallene Ding. »Schau an, immer noch hier.«
Ich steckte den Schlüssel in das Schloss der Hintertür, und er ließ sich drehen. »Halleluja«, sagte ich. Ich wollte ihn ihm zurückgeben, aber er nahm ihn nicht.
»Nur für alle Fälle«, sagte ich. »Bitte. Ich fühle mich besser, wenn ich weiß, dass du einen hast.«
Er runzelte die Stirn, als ich ihm den Schlüssel in die offene Handfläche legte, aber er steckte ihn in die Tasche seiner Jogginghose. Jetzt in der Nacht sah er wie ein anderer Mensch aus, ohne seine Jeans, sein Flanellhemd und seine gut geschnürten Arbeitsstiefel, die er als ehemaliger Bauunternehmer noch immer trug, trotz der Tatsache, dass er schon lange in Rente war. Anfang des Jahres war er siebzig geworden, sein Haar war grau, tiefe Falten durchfurchten sein Gesicht – alles Zeichen dafür, dass er Jahrzehnte in der Sonne verbracht, sein Leben mit den eigenen Händen aufgebaut hatte. Er bastelte immer noch in seiner Hütte herum, schlug mir regelmäßig vor, dass wir, wenn ich je das obere Stockwerk fertigstellen wollte, es zusammen machen könnten. Aber ohne seine typische Ausrüstung wirke er kleiner. Zerbrechlicher. Der Kontrast war beunruhigend.
Rick ging zuerst ins Haus und schaltete das Licht in der Küche an, sah sich im Zimmer um. Das Weinglas stand noch in der Spüle. Ich hatte den Drang aufzuräumen, zu beweisen, dass ich mich um das Haus kümmerte. Dass ich es wert war. Er war ein Mann der leisen Töne, aber scharfsinnig, und sein Blick wanderte weiter umher, zu dem bogenförmigen Eingang, in den dunklen Flur.
Zu Rick war ich damals gegangen, als ich mal eine Baby-Fledermaus an meiner Veranda hängen sah, mitten am Tag, oder als eine Schlange unten vor der Treppe lag; oder als ich etwas im Gebüsch gehört hatte. Er sagte dann, dass die Fledermaus sich wahrscheinlich verirrt hatte und benutzte einen Besen, um sie zu vertreiben; er erklärte die Schlange für harmlos; riet mir, mit den Füßen zu stampfen und Lärm zu machen, um größer zu wirken als ich war, alles zu verschrecken, was mich möglicherweise beobachtete. Der größte Teil der Wildtiere war durch die Entwicklung der letzten Jahre weiter zurückgedrängt worden, aber nicht alle. Dinge verschwanden. Dinge machten Ansprüche geltend. Setzten sich durch.
Er sah sich nun im Haus um, als könne er dessen Vergangenheit noch sehen. Andere Menschen mit einer anderen Geschichte. Er fummelte an seinem goldenen Ring am Finger herum.
»Ich hab dich schreien gehört«, sagte er. »Ich hab dich gehört.«
Ich schloss die Augen, suchte nach dem Traum. Fragte mich, was ich in die Nacht gerufen hatte. Ob es ein Laut gewesen war oder ein Name – das Wort lag mir auf der Zunge, als mein Blick über den kahlen Küchentisch glitt. Der Karton mit ihren Sachen war jetzt hinten in meinem Schlafzimmerschrank verstaut, da stand er, seit er vor zwei Tagen angekommen war.
»Tut mir leid«, sagte ich.
»Nein, nein, nicht doch.« Seine Hände fingen schwach zu zittern an, was sie anscheinend nun immer häufiger taten. Eine beginnende Krankheit oder vielleicht verlangte sein Körper auch nur nach dem nächsten Drink. Ich fragte nicht, aus Höflichkeit. Genau wie er nicht nach den Spuren an meinem Arm fragte, auch wenn sein scharfer Blick oft an der langen Narbe hängen blieb, den er dann jedes Mal abwandte.
Er hob seine zitternden Finger an mein Haar, zog ein welkes Blatt aus einer Stelle über meinem Ohr. Es musste sich da verfangen haben, als ich unter den tief hängenden Zweigen zwischen unseren Grundstücken hindurchgegangen war. »Bin froh, dass ich dich gefunden habe«, sagte er.
Ich schüttelte den Kopf, trat zurück. »Das war einmal. Früher bin ich geschlafwandelt. Jetzt nicht mehr«, wiederholte ich wie ein Kind, das es nicht wahrhaben wollte.
Er nickte. Die Uhr der Mikrowelle zeigte 3:16 an. »Schlaf noch ein bisschen«, sagte er und öffnete die Hintertür.
Ich musste in weniger als drei Stunden wieder aufstehen. Es war sinnlos. »Du auch.«
»Und schließ ab«, rief er, als die Tür hinter ihm zufiel, die Besteckschublade klirrte. Mit seinen nackten Füßen stieg er fast lautlos die Hintertreppe hinab.
Nun sah auch ich mich im Haus um, wie Rick es getan hatte, suchte nach Zeichen eines Eindringlings. Ich hielt den Atem an, lauschte, ob noch etwas anderes zu hören war. Aber da war nur ich.
Ich fuhr mit den Fingern die Wand des dunklen Flurs entlang, bis ich die weit geöffnete Schlafzimmertür erreichte. Drinnen schaltete ich das Licht an. Die Laken waren heftig zurückgeworfen, von den Ecken der Matratze gerissen. Ein Schauer durchlief mich. Die Szene wirkte vertraut – die Nachwehen eines Albtraums. Auch wenn ich jahrelang keinen mehr gehabt hatte. Meine Kinderärzte hatten die Episoden der Posttraumatischen Belastungsstörung zugeschrieben, ein Resultat der Schrecken dieser drei Tage, die ich unter der Erde gefangen gewesen war.
Es musste an dem Karton auf meinem Kleiderschrankregal liegen. Mein Unterbewusstsein wurde angeregt von dieser Quasi-Erinnerung – an die Kälte und die Dunkelheit – die real hätte sein können oder auch nicht. Der gleiche Albtraum, den ich als Kind gehabt hatte, in den Jahren nach dem Unfall:
Stein, überall, wo auch immer meine Hände hinfassen konnten. Kalt und klamm. Eine endlose Dunkelheit.
Ich war immer von dem Albtraumgefühl aufgewacht, dass sogar die Wände zu nah waren – hatte die Laken weggestrampelt, meine Glieder ausgestreckt, gegen etwas getreten, das nicht mehr da war. Die Angst, die statt der Erinnerung blieb.
Mir fiel ein, was meine Mutter früher dann immer getan hatte: Sie ließ mich zur Beruhigung eine heiße Schokolade trinken, verabreichte mir Tabletten, um mich zu schützen. Nachts verschloss sie meine Tür mit einem Haken. Ein Rütteln als erste Verteidigungslinie, damit sie aufwachte. Damit sie mich diesmal stoppen könnte.
Ich drehte mich wieder zum Flur um, und das Licht aus dem Schlafzimmer beleuchtete den Holzboden. Ein paar Blutstropfen bildeten eine Spur. Ich konnte nicht sagen, ob das passiert war, bevor ich das Haus verlassen hatte oder gerade eben. Ich folgte der Spur, aber am Eingang zur Küche hörten die Tropfen auf. Links teilte sich der Flur zur Küche und einem weiteren Schlafzimmer, das ich als Arbeitszimmer nutzte; rechts führte der überwölbte Wohnzimmereingangsbereich direkt zur Haustür. Es gab sonst nirgends Zeichen von Blut. Nur hier im Flur.
Ich setzte mich aufs Sofa und untersuchte den Schnitt in meinem linken Fuß. Etwas klemmte zwischen zwei meiner Zehen. Ein Holzsplitter, dachte ich erst. Aber es war etwas Glänzendes. Ein kleines Metallstück. Nein, es war Glas. Ich zog es heraus und hielt es ins Licht, kniff die Augen zusammen, um sicherzugehen.
Es war klein und spitz, dreckig und blutig, unmöglich, die ursprüngliche Farbe zu erkennen. Ich sah mich im Zimmer um auf der Suche nach etwas Zerbrochenem. Eine Vase auf dem Couchtisch; ein Spiegel über dem Sofa; eine Lampe auf meinem Nachttisch. Aber nichts schien kaputt oder verschoben worden zu sein.
Ich ging weiter von Zimmer zu Zimmer. Sah sogar oben nach, auch wenn ich dort nichts Zerbrechliches aufbewahrte. An der Treppe gab es keinen Lichtschalter, und ich tastete mich durch die Dunkelheit, fuhr mit den Händen an den schmalen Wänden entlang. Das Mondlicht fiel schräg durch die offenen Fenster, und der Schatten des Schaukelstuhls kam in Sicht. Ich griff nach der Kette, um das Licht anzuschalten, aber als ich daran zog, passierte nichts. Ich tastete in der Luft über meinem Kopf, aber es war gar keine Glühbirne in der Fassung. Nun konnte ich mich nicht mehr erinnern, ob überhaupt je eine drin gewesen war.
Ein Schauer überfiel mich wegen der kalten Luft, die durch das Zimmer strömte. Ich zog die beiden Fensterflügel zu und schloss den Haken dazwischen – es gab kein Fliegengitter, ein Vogel könnte hereingeflogen sein.
Als ich aus dieser Höhe in die Nacht hinaussah, drehte sich mir der Magen um. Ich trat schnell zurück, lief nach unten, bevor die Panik mich ergriff, nahm meine Suche wieder auf. Überprüfte die Regale, die Fenster, zählte die Gläser im Schrank, schaute in den Mülleimer. Wurde rastloser und immer panischer, während die Minuten verstrichen.
Ich suchte nach Zeichen dessen, was ich in der Dunkelheit getan hatte.
ABSCHRIFT LIVE-INTERVIEW 18. OKTOBER 2000
Sie ist ein winziges Ding. Nun ja, Sie haben ja alle inzwischen ein Foto von ihr gesehen. Große braune Augen und dann diese ganzen Haare. Sie stand einfach dort, mitten auf der Straße, in finsterer Nacht, vor meinem Küchenfenster. Das war, bevor sie vermisst wurde. Vielleicht einen oder zwei Monate davor. Meine Tochter war krank, ich wollte ihr gerade ein Glas Wasser holen. Zuerst hab ich mich erschrocken, als ich jemanden da draußen stehen und mich anschauen sah. Bis ich das Verandalicht anmachte und erkannte, dass sie es war. Ich rief von der Tür aus nach ihr, aber sie antwortete nicht. Ich kannte sie, ihre Mutter. Wusste, wo sie wohnten. Nicht weit weg, wahrscheinlich kaum einen Kilometer. Aber sie musste den ganzen Weg gelaufen sein, barfuß, im Dunkeln. Musste drei oder vier Straßen zwischen ihrem Haus und meinem überqueren – ich bin nur froh, dass nachts um die Zeit nicht viele Autos unterwegs sind.
Ich ging zu ihr und sagte noch einmal ihren Namen, aber sie starrte einfach durch mich hindurch. Hinter ihren Augen war nichts.
MARY LONG
Bewohnerin von Widow Hills
Kapitel 3
Freitag, 6 Uhr
Ich konnte nicht mehr einschlafen, mein Adrenalinpegel war zu hoch, und ich versuchte immer noch zu verstehen, was während meines Blackouts passiert war.
Aber im Tageslicht wirkte alles weniger beunruhigend. Das Glasstück konnte von überall her sein. Von draußen vielleicht, von irgendwann früher. Eine vergessene Scherbe, die im Regen aus der Erde hochgespült worden war.
Meine Orientierungslosigkeit und Panik waren sicher ein Nebeneffekt der Tatsache, dass ich draußen aufgewacht war, ohne jede Ahnung, wie ich dorthin gekommen war. Eine simple biologische Reaktion. Ich musste mich beschäftigen, mich ablenken. Meine Gedanken davon abhalten, zu dem Inhalt des Kartons in meinem Schrank zu wandern. Der Pulli. Das Handy. Die Tasche. Das Armband.
Ich duschte lange und konzentrierte mich dabei auf die dringenden Arbeitsthemen: der Quartalsbericht für das Krankenhaus und das nicht dehnbare Budget, das Kürzungen in den Abteilungen erforderte – und es war an mir, eine Meinung dazu zu äußern. Nach zwei Jahren musste ich mich immer noch beweisen.
Mein Wecker klingelte, während ich mich anzog, und als ich ihn abstellte, sah ich eine Nachricht, die spät in der letzten Nacht eingegangen war, kurz nach Mitternacht.
Mein Herz machte einen Satz bei dem Namen Jonah Lowell. Sogar jetzt noch. Jedes Mal. Ich denke an dich.
Natürlich. Unaufgefordert, nach Monaten des Schweigens – er hatte gewartet, bis ich ihn erfolgreich aus meinen Gedanken verbannt hatte. Natürlich auch mitten in der Nacht, sodass ich ihn in seinem Wohnzimmer vor mir sehen konnte, die Haare zerzaust, die Füße hochgelegt, einen Bourbon neben seinem Laptop.
Zuletzt hatte ich vor drei Monaten von ihm gehört, im Mai, da hatte er geschrieben: Bist du zur Abschlussprüfung in der Stadt?
Es war immer wie auf Glatteis mit ihm.
Damals im Mai hatte ich spontan geantwortet, war in eine tiefergehende Unterhaltung geschlittert, einen endlosen Flirt. Er hatte mich zu einem Besuch überredet. Jetzt wusste ich es besser.
Auf die Entfernung war es leicht gewesen zu vergessen, warum es nicht funktioniert hatte.
Zugegebenermaßen hatte ich Jonah meinen jetzigen Job hier in Central Valley zu verdanken. Er war anfangs mein Hochschulprofessor für Gesundheitsmanagement gewesen, kam wegen einer zeitweiligen Beratungsstelle hierher, für mich sei ein Platz in der Gruppe frei, wenn ich ihn wolle. Ich sagte ja, bevor ich die Details kannte: Es war ein neueres Krankenhaus in einer ländlichen Gegend, wichtig für die umliegenden Gemeinden, aber es fehlte an der Basis, die Finanzierung war schwierig. Es war nicht leicht, Ärzte und Pflegepersonal zu gewinnen und zum Bleiben zu bewegen.
Central Valley lag auf halbem Weg zwischen den Orten, aber an keinem nah genug, um zu pendeln. Das College war zu weit im Osten, und außer den Skifahrern, kam niemand so weit in den Westen. Auf der Karte war diese Stadt ein Boxenstopp. Eine Toilettenpause zwischen dem äußeren Rand einer größeren Stadt und den Berghütten.
Ich kam, weil ich damals dachte, ich wäre in Jonah verliebt. Aber ich blieb, weil ich mich stattdessen total in den Ort hier verliebte.
Als mir das Krankenhaus eine Vollzeitstelle anbot, akzeptierte ich. Es war gut für meinen Lebenslauf, eine höhere Position mit mehr Autonomie als ich in einer größeren Einrichtung erlangen würde, und ich hatte bereits einen Großteil des Personals eingestellt.
Die meisten hier waren jung. Nicht an Familien gebunden, sondern offen für Neues, hatten ihre Wurzeln gekappt.
Central Valley war eine Stadt, die sich mit dem Bau des Krankenhauses verändert hatte. Das Zentrum war in sich geschlossen und autark. Es versorgte und befeuerte sich in einem geschlossenen Kreislauf. Die alten viktorianischen Villen bekamen frische Anstriche, renovierte Veranden, neue Gärten. In den Außenbezirken: Apartmentkomplexe mit gläsernen Turnhallen und meist leeren Spielplätzen. Als ich hier ankam, zog ich selbst in ein solches Gebäude, in eine Wohnung, die von der Schule zur Verfügung gestellt wurde.
Es war so anders als dort, wo ich herkam, sieben Stunden in Richtung Westen. Widow Hills, Kentucky, war sehr schön, mit von Bäumen gesäumten Straßen und hübschen Fertighäusern am Waldrand, aber seit mindestens zwei Generationen war in der Gegend nichts Neues entstanden. Als wolle kein Unternehmen einen Standort namens Widow Hills haben.
Dabei rührte der Name nicht von einem Unglück, das hier passiert war. Bis zu meinem Unfall war es ein sehr sicherer Ort zum Leben gewesen. So war es jedenfalls in der Presse zu lesen gewesen.
Das Leben in Central Valley erforderte mehr aktiven Einsatz. Es zog eine bestimmte Art von Menschen an, die gern im Freien waren, wetterfest. Die Bequemlichkeit gegen Abenteuer tauschen wollten. Sicherheit gegen Neugier.
Hier, das sagte ich den potenziellen neuen Angestellten, kannst du Skilaufen und wandern und dich in einem Reifen den Fluss hinuntertreiben lassen. Hier kannst du etwas erfahren – nicht über diesen Ort, sondern auch über dich selbst. Hier kannst du die Person sein, die du immer sein wolltest.
Wenn du es dir oft genug einredest, bist du vielleicht irgendwann davon überzeugt.
Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit war ich an einem Haus vorbeigekommen, in dessen Garten ein Verkaufsschild stand. Jeden Tag erblickte ich dort etwas Neues, während sich die Blätter verfärbten und abfielen. Ein Vogelhäuschen. Einen Balkon vor einem Fenster im zweiten Stock. Eine Reihe von Trittsteinen aus Schiefer im Gras.
Irgendetwas dort rief nach mir. Erinnerte mich an den Geist meines ersten Zuhauses, in dem meine Mutter und ich gelebt hatten. Vor den Kameras und dem Geld. Vor dem Umzug in einen gesichtslosen Vorort, mit einem weißen Zaun vor dem Haus – der erste in einer Reihe von Schritten, die uns mehrere Staaten nach Norden führen, aber schließlich wieder ins Nirgendwo zurückbringen würden.
Als der Beratungsauftrag beendet war und ich den Job annahm, aber die subventionierte Wohnung verlor, war mein erster Gedanke, die Nummer auf diesem Schild anzurufen.
Jonah hatte das Haus einmal gesehen, als ich gerade eingezogen war, hatte leise gelacht und erklärt, ich sei jetzt ein richtiges Landei. Ich sagte, in der Vogelfluglinie sei ich nur ein paar Meilen vom Stadtzentrum entfernt. Er meinte, die Tatsache, dass ich jetzt den Begriff Vogelfluglinie verwende, sei der beste Beweis dafür, dass er recht habe.
Ich hatte so viel Zeit damit verbracht, darüber zu rätseln, was er sagte und meinte. Hatte zu erkennen versucht, ob es als Kritik an mir oder an ihm zu verstehen war. Ob seine Worte überhaupt etwas bedeuteten oder nur ein Zeitvertreib waren.
Ich zog mich früh an. Schlüpfte in meine Schuhe. Band meine Haare zu einem schnellen Knoten. Wischte auf dem Weg nach draußen das Blut von meinem Holzboden.
Ich beschloss, die Nachricht zu ignorieren.
Drei Blocks vom Krankenhaus entfernt gab es einen Gemischtwarenladen, wo ich auf den Rest der Zivilisation traf – einer der wenigen ursprünglichen Läden in der Stadt. Er hieß »Lebensmittel und Mehr« und kein Name könnte passender sein. Hier bekam man Abendessen und Paketband; Zeitschriften und Nägel; Kopfschmerztabletten und Wein. Die Besitzer verstanden, welche Bedeutung ein 24-Stunden-Shop für die Versorgung von Krankenhauspersonal mit unregelmäßigen Arbeitszeiten hatte.
Es war erst kurz vor sieben Uhr morgens, als ich auf den Parkplatz fuhr. Ein paar Autos standen verstreut, aber kein Vergleich zu der Masse am Nachmittag.
Drinnen war leise klassische Musik zu hören. Es war wie in einer Zeitschleife; nicht nur, weil man in dem hellen fluoreszierend beleuchteten Innenraum nie sagen konnte, welche Tageszeit gerade war, sondern auch wegen der Einrichtung. Es gab ein Drehgestell mit Chips, dann ein einfaches Holzregal mit Werkzeugen, daneben Obst und Eis in Kühltruhen. Eine Kaffeestation neben dem Kassenbereich. Ein Angestellter arbeitete in der Frühschicht und sah hinter dem Tresen fern: einen alten Schwarz-Weiß-Western ohne Ton. Er neigte den Kopf zu mir, als sich die Tür geräuschlos schloss und uns drinnen versiegelte.
Ich nahm mir einen von den Körben, die neben dem Eingang standen, und ging geradeaus zum Werkzeug. Das Schlafwandeln war wahrscheinlich eine einmalige Sache gewesen, aber es würde nicht schaden, ein Schloss zu installieren.
Andererseits: Die paar zusätzlichen Sekunden, die benötigt würden, um dieses Schloss bei einem Feuer zu öffnen, könnten tödlich sein. Aber wenn ich den Herd im Schlaf anstellte, hätte es den gleichen Ausgang. Wenn ich auf die Straße lief. Angefahren wurde. Verloren ging. Fiel.
Die Haken-Ösen-Riegel waren unter lauter verschiedenen Schlössern und Scharnieren begraben, aber schließlich hatte ich einen in meinem Korb. Ich trat gerade aus dem Gang, als ich mit einer anderen Kundin kollidierte.
»Oh –«
»Mist, tut mir leid«, sagte die Frau.
Unsere Körbe hatten sich verhakt, und wir stellten sie auf den Boden, um sie voneinander zu lösen.
Sie hatte noch nicht aufgeschaut, aber ich erkannte sie. Fast weißblonde Haare zum Pferdeschwanz zurückgebunden, scharfkantige Wangenknochen. Jemand aus dem Krankenhaus, aber sie war nicht in Uniform, und mein Verstand brauchte noch eine Sekunde, um sie einzuordnen. Ich ging eine Liste von Gesichtern durch, entfernte die Stethoskope, die Dienstausweise, die Kittel. Das hier war Dr. Britton aus der Notaufnahme. Sydney. »Hey. Hallo, Sydney. Entschuldigung.«
Sie kam langsam hoch, den Korb über einen Arm gehängt, sodass sich auf ihrer blassen Haut bereits ein Abdruck gebildet hatte, durch das Gewicht der Mikrowellen-Lasagne und der Flasche Rotwein. »Liv? Gott, tut mir leid. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass du es bist.« Sie hob ihren Arm leicht, der Korb schwankte. »Komme gerade von der Arbeit. Aber das ist kein Grund.«
Sie beäugte meinen Korb – leer, bis auf den Riegel – und rieb sich dann mit ihrer freien Hand die Augen. »Sorry, wenn ich nicht bald hier rauskomme, werde ich betrunken sein, bevor die Mikrowelle fertig ist. Außerdem wartet ein Law-and-Order-Marathon auf mich.«
»Viel Spaß«, sagte ich. Dann bog ich in den nächsten Gang ab, verbrachte ein paar Augenblicke damit, mich an die Schnapssorten in Ricks Schrank zu erinnern. Entschied mich für eine Flasche dunklen Rum, der mir in Form und Farbe bekannt vorkam – als Dankeschön und als Entschuldigung.
Ich holte mir noch einen Kaffee, bevor ich bezahlte.
»Erlesene Auswahl«, sagte der Kassierer. Er war freundlich und irgendwie alterslos, etwas zwischen fünfundzwanzig und vierzig. Aber sein Lächeln war ansteckend, sogar so früh am Morgen.
Er scannte den Riegel, rechnete den Kaffee ab, den ich mir gerade neben dem Tresen eingegossen hatte.
»Hey, es ist Ihr Sortiment«, sagte ich.
Er lachte einmal, laut und schrill, hielt beim Schnaps inne und schaute vom Flaschenetikett zu mir, dann zurück. »Ausweis?«
Ich zog ihn aus meinem Portemonnaie, und er nahm ihn mir aus der Hand, schielte darauf.
Im Gang hinter mir fiel etwas herunter. Ein Geräusch wie von Kisten, die von ihrem Stapel stürzen. Ich drehte mich lächelnd um und erwartete, Sydney zu sehen, vor Müdigkeit etwas ungeschickt. Passierte manchmal bei Schlafmangel. Man verlor die Orientierung. Wurde langsam in seinen Reaktionen. Aber stattdessen sah ich einen Mann in Jeans und einem kurzärmeligen Hemd, mit Baseballkappe, der sich hinter dem Drehgestell mit Chips versteckte.
Mein Lächeln verschwand, ich spannte die Schultern an.
Nach der Art zu urteilen, wie er mich beobachtete, war es vielleicht jemand, den ich kannte. Aber da war noch etwas anderes. Das sagte mir mein lang gepflegter Instinkt.
Es war die Art, wie er stand – halb verdeckt –, die meine Haut prickeln ließ. Wie er sich wieder den Chips zuwandte, den Ständer drehte, aber nichts anschaute. Dieses Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr gehabt: ein Gefühl, das bedeutete, sie suchten nach mir.
Es war logisch: Zum »Jubiläum« zehn Jahre zuvor waren die Journalisten auch aus ihren Löchern gekrochen. Lauerten in Supermarktgängen, vor dem Eingang der High School, lehnten an der Hauswand unserer Nachbarn. Tauchten in der ganzen Stadt plötzlich aus dem Nichts auf wie Figuren aus einem Horrorfilm.
Ich war sechzehn, im ersten Jahr der High School. Sah ein Interview mit meinem Englischlehrer in den Nachrichten, der sagte, ich sei ein nettes Kind, eine gute Schülerin, ein wenig ruhig, aber wer könne mir das verdenken. Meine Mutter ging in eine Talkshow – es sei ein Angebot, das wir nicht zurückweisen könnten, meinte sie, obwohl ich mich weigerte, mitzukommen. Sie zeigten unser neues Haus in den Nachrichten. Die Hausnummer war wegretuschiert, als ob das etwas bringen würde. Verwendeten ein Foto von mir aus dem Jahrbuch.
Ich habe Briefe jeder Art, von allen möglichen Menschen erhalten, sechs Monate lang.
Wir haben für dich gebetet –
Wow, hast du ein schönes Zuhause –
Denkst du, du kannst die Leute, die dir geholfen haben, einfach ignorieren, du undankbare Schlampe –
Das war ein Grund, warum wir wieder umgezogen waren, nach Ohio. Ein Grund, warum ich meinen Namen geändert hatte. So konnte ich als Erwachsene von vorn beginnen. Als eine andere am College anfangen. Es war ein Geschenk, ein Mensch ohne Geschichte zu sein.
In weniger als zwei Monaten werden es zwanzig Jahre sein. Würde es wieder Berichte in den Medien geben, auch wenn sie mich nicht aufgespürt hatten? War das all die Jahre später noch von öffentlichem Interesse?
»Einen schönen Tag noch, Olivia«, sagte der Kassierer und zog meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. Er hielt mir meinen Ausweis entgegen. Ich steckte ihn zurück in mein Portemonnaie und schaute dann wieder über meine Schulter, aber der Mann war weg.
»Danke«, sagte ich und hielt den Kopf unten, als ich auf die Automatiktür zuschritt.
Er war da. Wartete draußen. Lehnte an einem blauen Auto, das neben meinem geparkt war. Auf der Motorhaube seines Wagens wickelte er ein Sandwich aus, das nicht so aussah, als sei es aus dem Laden. »Hey«, sagte er, ganz lässig, bevor er hineinbiss. Er nahm sich Zeit.
Der Parkplatz war ansonsten leer. Ich öffnete die Tür, behielt aber die Schlüssel in der Hand, mein Instinkt regte sich.
Er kaute und schluckte und zeigte mit dem Sandwich auf mich. »Ich kenne Sie«, sagte er.
»Ich glaube nicht«, sagte ich. Er hatte die Ausstrahlung eines Journalisten, wenn nicht gar den Blick. Es war nicht seine Kleidung oder sein Auto, sondern es war diese Art, beiläufig herumzustehen und so zu tun, als hätte er nicht auf mich gewartet.
»Olivia, oder?«
Ich war schon dabei, die Fahrertür zu schließen. Ging mental die Schritte meiner Flucht durch, zählte die Sekunden, bis ich entkommen konnte. Die Zeit, die ich brauchte, um mein Auto zu starten und vom Parkplatz zu fahren, im Vergleich zu der Zeit, die er brauchen würde, um dasselbe zu tun – und mir zu folgen. Ich zweifelte meinen Instinkt nicht an. Ich war mit einer gesunden Dosis Selbsterhaltungstrieb geboren worden und hatte gelernt, meinem Gefühl zu vertrauen.
In meiner Eile wegzukommen, würdigte ich ihn keines Blickes mehr. Hätte, wenn man mich fragte, nicht beschreiben können, wie er aussah, außer: männlich, weiß, durchschnittliche Größe und Statur. Vielleicht hatte er meinen Namen schon gekannt, oder er hatte einfach den Kassierer drinnen gehört.
Was auch immer er wollte, ich musste nicht mit ihm sprechen – das wusste ich inzwischen.
Aber wie leicht konnte er alles, was ich mir aufgebaut hatte, zum Einstürzen bringen. Die Bequemlichkeit der Anonymität. Alles, wovor ich in Widow Hills geflohen war. Hier waren die Narben nur Narben – von einer Operation nach einem Unfall, sagte ich immer, und das war keine Lüge. Mein Name war jetzt mein rechtsgültiger Name. Ich blieb bei der Wahrheit: Aus Ohio für das College hierhergezogen; hab den Kontakt zu meiner Familie verloren; bin zu etwas Geld gekommen, als ich jünger war.
Nichts davon war eine Lüge.
Die Leute neigten dazu, die Lücken auszufüllen, wie es ihnen gefiel. Es war nicht meine Aufgabe, sie zu korrigieren.
ABSCHRIFT LIVE-INTERVIEW 18. OKTOBER 2000
Ja, ich habe sie einmal auf meiner Veranda gefunden. Ich hatte an dem Tag die Sechs-Uhr-Schicht, musste kurz nach Fünf los. Mein Hund bellte, es war noch dunkel, als ich die Tür öffnete und sie dort vorfand.
Ich erinnere mich, dass ich sagte: »Schätzchen? Geht es deiner Mutter gut?« Ich konnte mich nicht an ihren Namen erinnern.
Sie drehte sich um und ging nach Hause. Ich wusste nicht, dass sie schlief.
Ich wünschte, ich hätte es jemandem gesagt, aber ich wusste es nicht.
STUART GOSS
Bewohner von Widow Hills
Kapitel 4
Freitag, 8 Uhr
Es hatte viele Vorteile, in einem Krankenhaus zu arbeiten, theoretisch. Zugang zu Ärzten und Pflegekräften, ein Blick hinter die Kulissen, sodass man sehen konnte, wie die Dinge funktionierten; persönlicher Kontakt erleichterte eine Terminbuchung in letzter Minute.
Aber was man an Zugänglichkeit gewonnen hatte, verlor man an Privatsphäre. Seit ich im Central-Valley-Krankenhaus arbeitete, ging ich seltener zum Arzt, nicht öfter. Und wenn ich krank war, ging ich lieber in die Minute-Klinik. Die Ärzte und Pfleger hier waren Menschen, die mir jeden Tag begegneten. Und ich müsste eine persönliche Krankengeschichte angeben. Mir schauderte bei dem Gedanken daran, dass alte Details irgendwie in ihr System gelangen könnten. Dass sie bemerkten, dass mein Arm rekonstruiert und später während des Heranwachsens noch einmal operiert worden und aufgrund der Anhäufung von Narbengewebe um meine Schulter herum nicht voll beweglich war. Sie würden sich vielleicht fragen, warum.
Nachdem die Geschichte ad acta gelegt worden war, blieben ein paar Dinge übrig: das Trauma der Operationen; der lange Genesungsprozess; die Fragen der Neugierigen; das Gefühl, immerzu beobachtet zu werden.
Wahrscheinlich brauchte ich einfach nur ein Schlafmittel, etwas, das mich tief schlafen ließ. Eine einfache Medizin. Harmlos.
Der Eingang zum Krankenhaus sah aus wie der eines edlen, aber rustikalen Hotels, mit Holzbalken kreuz und quer über dem Eingangsbereich. Auf Bänken entlang eines Weges inmitten einer Grünfläche konnten Personal und Besuch Mittagspause machen oder spazieren gehen.
Ich parkte immer auf dem hinteren Parkplatz, weil ich die Notaufnahme und den entsprechenden Wartebereich vermeiden wollte. Bennett fand, ich hätte eine Keimphobie, aber die wäre auch nicht ganz unbegründet: Als ich hier anfing zu arbeiten, wurde ich sofort krank – ein aggressiver Virus, von dem ich sicher war, dass er mich töten oder mich zumindest zwingen würde, nie wieder etwas zu essen.
Alle sagten, ich würde im Laufe der Zeit immun werden, doch so war es nicht. In diesem ersten Winter bekam ich eine Bronchitis, einen so schlimmen Husten, dass ich mir dadurch eine Rippe prellte. Und danach: Streptokokken, noch einen Virus, einen unerklärlichen Ausschlag.
Ich hatte immer noch Handdesinfektionsmittel in meiner unteren Schublade. Hielt drei Meter Abstand von Besuchern, um Händeschütteln zu vermeiden.
Bennett meinte, ich würde die Leute nervös machen, aber seitdem war ich nicht mehr krank.
Das liegt daran, dass du nun immun bist, hatte er gesagt. Aber ich war nicht bereit, ein Risiko einzugehen.
Vor allem aber nahm ich den Hintereingang, um näher an der Treppe zu sein und den Aufzug zu umgehen, meine am wenigsten bevorzugte technologische Errungenschaft. Schiebetüren, nur ein Ausweg, eine Kiste aus Stahl. Wann immer es ging, vermied ich es, in einen Fahrstuhl zu steigen, so wie ich mich aus naheliegenden Gründen von allen kleinen Räumen fernhielt.
Hier hinten kamen die einzigen Lebenszeichen zu dieser Tageszeit aus dem Geschenkeladen: eine Familie, die sich in der Nähe des Glaseingangs aufhielt, ein Kind hielt einen Luftballon. Ich konnte das Frühstück aus der Cafeteria in der Lobby riechen, aber vor der Rushhour war es dort ruhig.
Als ich die Treppenhaustür zum dritten Stock öffnete, schien der Gang leer zu sein. Der Flügel war für Patienten geschlossen, zugänglich nur über ein Tastenfeld neben zwei Schwingtüren oder mit einem Schlüssel, wenn man über die hintere Treppe kam. Das lag weniger daran, dass hier Büros waren, sondern daran, dass sich hier auch der Aufenthaltsraum für das Pflegepersonal und der Medikamentenraum befanden.
Es war so früh, dass der größte Teil der Verwaltung wahrscheinlich noch nicht eingecheckt hatte, aber es war schwer zu sagen. Die Menschen bewegten sich leise. Jeder trug Turnschuhe mit Gummisohlen oder Crocs, ich hatte das auch so übernommen – weil ich sonst die Einzige war, die man kommen hören konnte, und mich irritierte meine eigene Präsenz.
Mein Büro befand sich auf halber Höhe des Flurs, aber um die Ecke kam man direkt zum Aufenthaltsraum und zum zentralen Medikamentenraum, der strategisch auf der anderen Seite des Ganges platziert war. Ich konnte Schatten vorbeigehen sehen, unter den Doppeltüren am Ende des Flures, wo sich die Patienten befanden.
Ich hielt direkt vorm Aufenthaltsraum an, schaute durch das kleine rechteckige Fenster und lauschte der Stille. Eine Frau mit lockigen kastanienbraunen Haaren las mit dem Rücken zu mir etwas auf ihrem Handy. Der Raum war offen für alle Pflegekräfte egal welcher Station, und diese Schwester kannte ich nicht; sie mich also auch nicht.
Ich ging zurück den Flur entlang zum Medikamentenraum. Hielt den Atem an, als ich meinen Ellbogen auf den Griff drückte und fühlte, dass er nachgab.
Wir hatten nicht die strengsten Sicherheitsvorkehrungen, wie ich sehr wohl wusste. Ich war im ursprünglichen Ausschuss, der Bedarf und Kosteneffizienz bestimmen sollte, und wir hatten nicht viel Geld zur Verfügung. Ein neues Sicherheitssystem stand weit unten auf der Liste. Wir hatten Wachen in der Notaufnahme und die Polizei auf Abruf. Aber im Obergeschoss waren wir viel laxer, vor allem wegen der Tastenfelder, die die Sperrzonen abriegelten. Die Leute waren nicht konsequent darin, die Außentür zum Medikamentenraum abzuschließen, weil ja die Schubladen selbst verriegelt und nur mit einem Code zugänglich waren, und es war nervig, beides zu tun. Ein Teil meiner Aufgaben war es, Redundanzen aufzudecken und abzuschaffen.
Jetzt ließ ich die Lichter aus und überprüfte die Schachteln in den Schränken an den Wänden. Während die Apotheke strenge Vorschriften über die Kontrolle der Bestände hatte, wusste ich, dass die Proben von Pharma-Vertretern unkontrolliert in den oberen Schränken landeten, neben dem nicht-medikamentösen Material – Spritzen, Verbandsmull und Nadeln.
Jedenfalls nahm ich an, die Medikamente, die nicht weggeschlossen waren, seien ungefährlich. Es musste einfach nur ein Schlafmittel in der Mischung enthalten sein. Etwas, das mich anhaltend ausschaltete. Meine innere Uhr zurücksetzte und meine Stabilität wiederherstellte.
Der erste Schrank schien hauptsächlich topische Salben und Cremes zu enthalten. Ich öffnete den zweiten, schob Schachteln herum, auf der Suche nach etwas, das sich passend anhörte. Auf den Etiketten, die ich erkennen konnte, standen Säurehemmer, generische Schmerzmittel, und Allergie-Wirkstoffe drauf. Die Worte waren im Dunkeln schwer zu lesen, und ich beugte mich weiter vor, um die Behälter ganz hinten im Schrank zu durchsuchen.
Ohne Vorwarnung ging die Tür hinter mir auf, und ich wich so schnell zurück, dass ich mir eine Handseite am Holzrahmen des Schrankes aufkratzte.
Es war meine Reaktion, die mich verriet. Mein Herz raste, meine Füße gefroren zu Eis. Bennett stand in der Tür; er ließ sie schwingen und machte das Licht an. Er blinzelte zweimal, und ich schaute nach unten, versuchte, mich an die plötzliche Helligkeit zu gewöhnen.
»Was machst du hier, Liv?«
Bennett Shaw war mein engster Freund im Krankenhaus. Auch wenn ich in meiner Vergangenheit nicht viele langjährige Freundschaften zum Vergleich hatte – nach mehr als zwei Jahren Arbeit auf demselben Flur, regelmäßigen Mittagessen und hin und wieder einem Abendessen, nahm ich an, dass er es wahrscheinlich auch so empfand. Letztes Jahr hatte er mich sogar zu Thanksgiving in sein Elternhaus in Charlotte eingeladen, hatte gemeint, er habe eine große Familie, sie würden den zusätzlich eingenommenen Sitzplatz nicht einmal bemerken.
Er war auch jemand, der sich streng an Regeln hielt, ein Mann mit hohen ethischen Maßstäben. In der Medizin muss man so sein. Es hat Konsequenzen, wenn etwas fehlt, vergessen wird, zu spät kommt. Leben stehen auf dem Spiel. Da meine Aufgabe eher war, genügend Krankenhauspersonal zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass das Geld in die richtige Richtung floss, genoss ich den Luxus der Nachbesserung. Wenn ich zurückfiel, konnte ich aufholen. Wenn ich falsche Informationen verschickt hatte, konnte ich mich entschuldigen und sie erneut senden. Kein Fehler war dauerhaft.
Normalerweise mochte ich es, wie Bennett sich an die Regeln hielt. Wenn man mit einem Mangel an Vorhersehbarkeit aufwächst, ist Struktur wie ein Segen. Ich wusste, was ich von ihm erwarten konnte und was er von mir erwartete.
»Bitte sag mir, dass es nicht so ist, wie es aussieht.« Er kam einen Schritt näher. Ich hörte an seiner Stimme – tiefer, leiser –, dass er verärgert war, das musste ich ändern.
»Ich kann nicht schlafen«, sagte ich. Er würde es verstehen, dachte ich.
Seine Stimme wurde nur noch lauter. »Melatonin. Ein Glas Wein. Ein heißes Bad. Du hast die Wahl. Nur mach verdammt noch mal, dass du hier wegkommst.«
Ich schüttelte den Kopf. »Es ist mehr als das. Und das sind doch nur Proben, oder?« Ich spielte die Naive, aber es wirkte nicht.