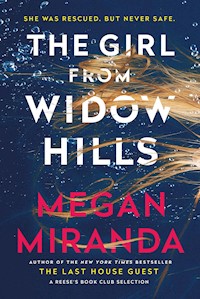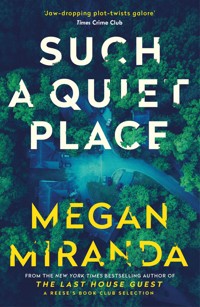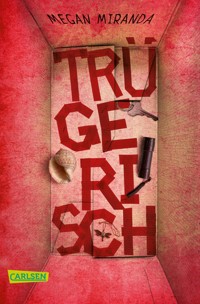
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Seit einem Monat ist Caleb tot. Alle geben Jessa die Schuld an dem Unfall. Und Calebs Mutter verlangt, dass sie seine Sachen wegpackt. Jessa hofft einfach, dass sie so endlich abschließen kann. Doch als sie Calebs Zimmer ausräumt, fallen ihr Dinge in die Hände, die sie ins Grübeln bringen. Die alles infrage stellen, was sie von ihrem Exfreund zu wissen glaubte. Caleb hatte Geheimnisse. Ihre gemeinsame Zeit – und sein Tod – rücken plötzlich in ein neues Licht. Jessa will die Wahrheit wissen. Unbedingt. Und auf eigene Gefahr … Falsche Fährten, unerwartete Wendungen und eine Heldin, die nicht aufgibt. Dieser spannende Psychothriller hat alles, was es für ein atemloses Leseabenteuer braucht. Perfekt für Fans von Tote Mädchen lügen nicht und Solange wir lügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Megan Miranda: Trügerisch
Aus dem Englischen von Birgit Maria Pfaffinger
Seit einem Monat ist Caleb tot. Alle geben Jessa die Schuld an dem Unfall. Und Calebs Mutter verlangt, dass sie seine Sachen wegpackt. Jessa hofft einfach, dass sie so endlich abschließen kann. Doch als sie Calebs Zimmer ausräumt, fallen ihr Dinge in die Hände, die sie ins Grübeln bringen. Die alles infrage stellen, was sie von ihrem Exfreund zu wissen glaubte. Caleb hatte Geheimnisse. Ihre gemeinsame Zeit – und sein Tod – rücken plötzlich in ein neues Licht. Jessa will die Wahrheit wissen. Unbedingt. Und auf eigene Gefahr …
Aufregend, abgründig und voller falscher Fährten – der neue Thriller der New-York-Times-Bestseller-Autorin Megan Miranda.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
FÜR A & J
Eine blaue Tür
In dem schmalen Treppenhaus, das in den zweiten Stock führt, gibt es kein elektrisches Licht. Auch kein Geländer. Nur Holzstufen und verputzte Wände, die vermutlich von einem früheren Dachbodenausbau stammen. Die Tür am oberen Ende ist zu, doch an der Unterseite dringt ein dünner Lichtstreifen durch. Wahrscheinlich hat er die Vorhänge offen gelassen.
Die Tür ist dunkler als die Wände, aber weil es so düster ist, lässt sich von hier aus kaum erkennen, dass sie blau ist. Wir haben sie im Sommer gestrichen, nachdem er in der Garage einen halb vollen Eimer mit einer Farbe namens Stürmische See gefunden hatte.
»Ein komplexer Ton für eine komplexe Tür«, scherzte er. Aber am Ende sah es dann einfach mehr oder weniger jeansblau aus.
Nach dem ersten Pinselstrich trat er einen Schritt zurück, zog die Nase kraus und rieb sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Meine Gefühle in Bezug auf diese Farbe sind auch ganz schön komplex.«
Über seinem linken Auge hatte die Stürmische See einen Fleck hinterlassen. »Ich finde sie toll«, sagte ich.
Jetzt strecke ich die Hand nach der Tür aus. Fast kann ich die frische Farbe riechen und die Sommerbrise spüren, die durchs offene Fenster weht und beim Lüften hilft. Wir haben die Tür komplett gestrichen – vorne, hinten und an den Kanten – und manchmal klebt sie beim Aufmachen noch. Als wäre der Lack zu dick aufgetragen und zu langsam getrocknet.
Auf dem silbernen Türknauf ist ein Farbspritzer, der mir noch nie aufgefallen ist, und ich halte inne. Ich streiche mit dem Daumen über seine raue Oberfläche und frage mich, wie ich ihn übersehen konnte.
Ich atme tief durch und versuche, mir das Zimmer in Erinnerung zu rufen und mich zu wappnen.
Vier Wände, ein Schrank, schräge Decken, die oben in einem schmalen Streifen zusammenlaufen. In der Mitte dieses Streifens hängt ein Ventilator, einer von denen, die scheppern, wenn sie auf Höchststufe laufen. Auf beiden Seiten säumen Regale die Wände, links werden sie von der Schiebetür des eingebauten Kleiderschranks abgelöst. An der hinteren Zimmerseite befindet sich ein Fenster.
Ein Bett mit einer grünen Steppdecke.
Zu meiner Rechten ein Schreibtisch, auf dem ein Computerbildschirm steht, darunter verborgen der Rechner.
Die Wände sind grau und der Teppich ist … der Teppich ist braun. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Die Farbe verschwimmt und verändert sich, wenn ich daran denke.
Es ist nur ein Zimmer. Ein Zimmer wie jedes andere. Vier Wände, eine Decke und ein Ventilator.
Das sage ich mir, bevor ich hineingehe. Das flüstert die Stimme in meinem Kopf, als ich mit der Hand am Knauf auf der obersten Stufe stehe und zögere.
Kurz meine ich, auf der anderen Seite der Tür seine Schritte zu hören, dabei weiß ich, dass das unmöglich ist. Ich stelle mir vor, wie wir einander gegenüber auf dem Boden sitzen. Meine Beine zwischen seinen abgelegt.
Er beugt sich vor. Lächelt.
Dann fällt es mir wieder ein: Der Teppich ist beige. Die Tür wird beim Aufmachen quietschen. Drinnen ist es, je nach Jahreszeit, heißer oder kälter als im Rest des Hauses.
All diese Dinge weiß ich auswendig.
Nichts davon hilft mir, mich zu wappnen.
Samstagvormittag
Seine Mutter hat mich um das hier gebeten, mit der Begründung, eine Mutter sollte so etwas nicht tun müssen. Ich finde, eine Exfreundin sollte so etwas auch nicht tun müssen. Aber Mutter sticht Ex allemal.
»Das Zimmer ist voll von dir«, hat sie gesagt und meinte damit die Fotos. Die hängen überall, ohne viel Umstand direkt an die grauen Wandschrägen geklebt, und auf jedem habe ich die Arme um seinen Hals gelegt oder er hält mich von hinten umschlungen. Ich kann die Bilder nicht richtig ansehen, aber seine Mutter hat recht. Ich bin überall.
Manchmal frage ich mich, ob seine Mutter das mit der »Ex« überhaupt weiß. Ob er es ihr gesagt hat, ob sie es zufällig gehört hat oder ob sie vielleicht von selbst darauf gekommen ist. Aber etwas an der Art und Weise, wie sie mich vom Fuß der Treppe beobachtet, während ich vor der Tür stehe und zögere, etwas an der Art, wie sie mich gebeten hat, das hier zu tun, lässt mich vermuten, dass sie es weiß.
Es ist kühl hier oben, aber das liegt an der schlechten Isolierung. Die Wärme zieht durch die undichten Fenster nach draußen, und die kalte Novemberluft sickert herein.
Seine Klamotten liegen noch auf dem Boden, da, wo er sie an jenem Regentag Mitte September hat fallen lassen. Sein Bett ist nicht gemacht. Sein Computerbildschirm steht ausgeschaltet da, und mein verzerrtes Spiegelbild blickt mir daraus entgegen. Der Schreibtisch ist voll mit abgerissenen Eintrittskarten, alten Hausaufgaben und mehr, genauso der Schrank, das weiß ich. Caleb hätte bestimmt nicht gewollt, dass seine Mutter das hier macht. Unter dem Bett, zwischen den Matratzen versteckt sind Dinge, die eine Mutter nicht sehen sollte. Mein Magen rebelliert, aber ich kann spüren, dass sie mich weiter beobachtet. Also gehe ich hinein.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
Wäre Caleb hier, würde er sagen: Fang einfach an.
Das habe ich immer gehasst, seine Art, über alles hinwegzugehen und Dinge einfach zu erzwingen. Irgendwelche Entscheidungen oder jetzt diesen Moment.
Vergiss es einfach …
Lass es einfach …
Sag es einfach …
Heb einfach das T-Shirt am Fußende des Bettes auf, das, das er anhatte, als du ihn zum letzten Mal berührt hast.
Fang einfach an.
Libellenkette
Das T-Shirt riecht noch nach ihm. Nach Dove-Seife. Nach dem Parfüm, das mir immer verriet, dass er hinter mir stand, und mir ein Lächeln aufs Gesicht zauberte, bevor er mit der Hand meine Hüfte und mit den Lippen meine Wange berührte. Ich halte es mir nicht vors Gesicht. Ich traue mich nicht, daran zu schnuppern. Stattdessen werfe ich es in die Ecke – der Anfang eines Haufens.
Siehst du, Caleb? Ich fange an. Ich habe angefangen.
Unter dem T-Shirt liegt die Jeans. An den Knien abgescheuert, am Saum leicht ausgefranst, weich und vertraut. Als ich bei den Taschen ankomme, halte ich den Atem an, obwohl ich eigentlich weiß, was darin ist. Ich sollte also gewappnet sein. Aber ich bins nicht. Die Kette klirrt, sie fühlt sich kalt an. Und dann fühle ich noch etwas anderes: die Erinnerung an seine warme Haut, als ich ihm die Kette in die Hand gedrückt habe.
Ich sagte: Bitte bewahr sie für mich auf.
Ich sagte: Bitte pass auf.
Er steckte sie in die Tasche, kein Ding. Er machte es auf die Art, weil alle zusahen. Um mir zu zeigen, dass er nicht mehr aufpassen musste. Nicht, wenn es um mich ging.
Der Verschluss der Kette ist kaputt, war schon kaputt, als ich sie ihm gab. Aber nachdem sie in seiner Tasche vergraben war, sind jetzt auch die goldenen Glieder geknickt und verheddert. Ich habe die Kette bei jedem Rennen getragen, obwohl wir das eigentlich nicht tun sollten. Aber ich habe den Libellenanhänger einfach mit Tape an der Innenseite meines Oberteils festgeklebt, damit er beim Laufen nicht verrutscht. Ich habe die Kette getragen, weil sie mir Glück brachte, weil es ein Ritual war, weil es mir schon immer schwergefallen ist, mit Gewohnheiten zu brechen.
Sie riss, als ich beim Dehnen kurz vor dem Start die Hände über den Kopf streckte. Das Schnalzen an meiner Haut war übelkeitserregend. Mein Körper hatte sich bereits gespannt, in Erwartung des Startschusses. Ich suchte schnell die Zuschauerreihen ab, und da war er – vertraut. In dem Moment dachte ich gar nicht daran, dass er eigentlich keinen Grund hatte, hier zu sein. Es kam mir gar nicht in den Sinn. Es gab kein Rätsel, nur den flüchtigen Schrecken über eine gerissene Kette und das bevorstehende Rennen.
Einen Moment noch, bettelte ich und verließ meinen Platz. Während alle anderen ihre Positionen einnahmen, lief ich zu ihm hinüber. Er stand ganz in der Nähe der Startlinie.
Bitte bewahr sie für mich auf.
Bitte pass auf.
Er blickte auf die Libelle in seiner Hand und runzelte die Stirn, machte eine Faust und schob sie in die rechte Vordertasche seiner Lieblingsjeans. Zuckte mit den Schultern.
Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass es das war – das letzte Mal, dass ich ihn sehe. Dann hätte ich sichergestellt, dass mein letztes Bild von ihm nicht dieses ist: diese Gleichgültigkeit; seine blauen Augen, die mich flüchtig ansehen und dann zur Seite blicken; der Windstoß, der ihm das hellbraune Haar vors Gesicht weht und seinen Ausdruck versteckt. Das Bild, das ich ständig vor mir habe, das sich in meinen Geist eingebrannt hat.
Er ging, bevor das Rennen vorbei war. Wahrscheinlich war ihm eingefallen, dass er nicht mehr meinetwegen dort ausharren musste. Vielleicht war auch etwas anderes der Grund. Der Regen. Ein Wort. Eine Erinnerung. Auf jeden Fall ging er. Fuhr nach Hause. Warf seine Jeans auf den Boden, mit meiner Kette in der Tasche. Ließ sie dort liegen. Zog sich was anderes an.
Ließ einfach alles anders werden.
Caleb. Pass auf.
Ohne ihn ist es auf dem Dachboden zu leise und die schrägen Wände stehen zu eng beieinander und ich will raus aus diesem Zimmer. Aber dann höre ich, dass seine Mutter unten mit jemandem streitet. Mit jemand Bestimmtem. Sie streitet mit Max. Manchmal erinnert seine Stimme mich an die von Caleb. Manchmal, wenn ich ihn höre, dauert es einen Moment, bis mir einfällt, dass Caleb nicht mehr da ist.
»Sie hat hier nichts zu suchen«, sagt er. »Ich hab doch gesagt, dass ich das mache.«
»Sie macht das«, entgegnet Calebs Mutter.
Und da weiß ich, dass das hier meine Buße ist.
Zerschlissene Baseballkappe
Ich stecke die Kette in meine Tasche und lasse die Jeans auf dem Boden liegen – der Umriss seines Geists. Ich blicke zu den zusammengefalteten Kartons, die gleich neben der Tür an der Wand lehnen. Seine Mutter hat sie dorthin gestellt. Am Knauf, eingeklemmt zwischen Kartons und offener Tür, hängt seine Baseballkappe. Ansonsten ist das Zimmer unberührt, in genau dem Moment erstarrt, als Caleb es zuletzt verließ.
Ich kann es mir genau vorstellen, sehe es vor mir, als wäre ich an jenem Nachmittag bei ihm gewesen. Der Regen prasselt gegen das Fenster, an der Decke surrt der Ventilator. Caleb zieht sich um und lässt seine Kleider einfach auf den Boden fallen. Er muss es eilig gehabt haben, denn die Sachen liegen immer noch da und normalerweise war er durchaus in der Lage, die drei Schritte vom Bett zum Schrank zu tun, um seine Wäsche dort in den Wäschekorb zu werfen. Und dann geht er. Er stützt sich an den engen Wänden des Treppenhauses ab und schwingt sich drei, vier Stufen auf einmal hinunter.
Bei Caleb hatte man immer das Gefühl, dass er spät dran war.
Wahrscheinlich wäre sein Zimmer bis in alle Ewigkeit so geblieben – die Tür verschlossen, alles in einer Zeitkapsel konserviert, von seiner Mutter versiegelt, damit niemand etwas anrührt. Doch jetzt ziehen sie fort. Verlassen die Stadt, lassen alles hinter sich zurück. Der Gedenkgottesdienst ist einen Monat her, die Flut eineinhalb und dass wir Schluss gemacht haben, zwei.
Aber jetzt, wo ich in seinem Zimmer stehe, ist diese Zeit wie ausgelöscht und ich muss mich daran erinnern, dass er nicht jeden Moment reinkommt und fragt, was ich hier mache. Ich schiebe die Tür ein Stück weit zu, um den ersten Karton auseinanderzufalten, und Calebs zerschlissene Baseballkappe schwingt leicht hin und her. Sie ist knallblau mit einer geschwungenen weißen Linie, die Krempe wölbt sich, die Ränder sind ausgefranst und verblichen von den Sommern voll Salz und Sonne.
Und plötzlich sehe ich, wie er mir am Strand das Gesicht zuwendet, wie damals bei unserer ersten Begegnung, vorletzten Sommer.
Hailey und ich saßen nebeneinander auf unseren Handtüchern und schlürften die letzten kalten Softdrinks aus der Kühlbox, das Eis war geschmolzen und die Nachmittagssonne röstete meine nackte Haut. Sophie Bartows Schatten fiel auf Hailey – die beiden hatten im vergangenen Schuljahr einen gemeinsamen Kurs, aber ich kannte sie nicht besonders gut. Sophie besetzte einen Platz neben Hailey und rief jemandem über die Schulter etwas zu.
Als Ersten sah ich Max, der, soviel ich gehört hatte, seit Anfang des Sommers mit Sophie zusammen war. Er und Caleb suchten sich plaudernd ihren Weg zwischen den ganzen Handtüchern hindurch. Als Max nach Sophie Ausschau hielt, trafen sich unsere Blicke und er winkte mir zu. Ich winkte zurück.
Caleb neigte den Kopf und sagte etwas zu Max. In seiner Version der Geschichte war es das erste Mal, dass er mich sah. Er fragte Max, wer ich sei. Und Max antwortete: »Das? Das ist Jessa Whitworth. Julians Schwester.« Als Dauergast bei Julians Little-League-Spielen kannte ich Max seit Jahren. Für ihn war ich die kleine Schwester ihres Starspielers, Punktezählerin, Statistikerin und gelegentliche Gatorade-Lieferantin, bis ich alt genug war, um die Nase voll von alldem zu haben.
»Hallo, Jessa«, sagte Max, als er seinen Platz neben Sophie einnahm. Caleb dagegen blieb direkt vor mir stehen, und sein Schatten schirmte einen Moment lang die Hitze der Sonne ab.
»Hi, ich bin Caleb.«
Ich wusste, wer er war, kannte ihn, wie man die meisten Leute aus dem eigenen Jahrgang und darüber von den Geschichten und Gerüchten über sie kennt, ohne je mit ihnen gesprochen zu haben. Und wie die Jahrgänge unter einem irgendwo im Hintergrund verschwimmen – so wie ich für Caleb.
Er ließ sich neben mich auf mein Handtuch fallen, als würden wir uns schon ewig kennen, und nahm einen Schluck von meiner Cola. Ich war leicht entsetzt und sagte: »Ich bin nicht die Art von Mädchen, für die du mich zu halten scheinst.«
Das brachte ihn zum Lachen. »Dann müssen wir uns zuerst anfreunden, was?«
Ich nickte.
Er beugte sich näher und flüsterte. »Ich kann Max’ neue Freundin nicht ausstehen.«
Ich wich erschrocken zurück. »Was soll das werden?«
»Ich habe dir gerade etwas erzählt, das ich noch nicht mal meinem besten Freund erzählt habe. Und ich vertraue dir, dass du es für dich behältst. Freunde?«
Ich verdrehte die Augen. »Du bist echt scharf auf meine Cola, was?«
»Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie scharf. Bitte. Ich bin kurz vorm Verdursten.«
Ich blinzelte. »Ich tausche gegen was von deiner Sonnencreme. Meine Nase verbrutzelt gerade. Ich spürs genau.«
»Keine Sonnenanbeterin?«
»Im Gegenteil. Ich liebe die Sonne. Aber durch eine grausame Laune der Natur kann ich es ohne Lichtschutzfaktor 50 keine halbe Stunde mit ihr aushalten. Und meine Sonnencreme ist alle.«
Er lachte, und der Klang überrumpelte mich. Dann nahm er seine Kappe ab, setzte sie mir auf den Kopf, rückte sie zurecht und klopfte einmal darauf, als ich mir die schulterlangen blonden Haare hinter die Ohren klemmte. Mit dem Finger strich er mir eine Strähne aus dem Gesicht.
»Besser?«, fragte er.
Ich schielte unter der Krempe zu ihm auf. Der Wind wuschelte seine Frisur durcheinander und er grinste mich leicht an. Er und die Sonne schienen füreinander gemacht. Sein hellbraunes Haar war an manchen Stellen so ausgebleicht, dass es fast blond war, und seine Haut schimmerte goldbraun.
Ich nahm einen tiefen Schluck, ehe ich ihm die Cola reichte, und damit war es besiegelt: Wir waren Freunde. Unsere Kreise verbanden sich: Hailey und Sophie, Sophie und Max, Max und Caleb. Bevor wir zusammenkamen, hingen wir alle einen Monat miteinander herum, aber er hatte mich schon in diesem Augenblick an der Angel. Mit seiner Lockerheit und seinem Geheimnis.
Samstagnachmittag
Max’ Stimme holt mich zurück in die Gegenwart.
»Jessa?« Es ist ein geflüsterter Ruf, als würde Max gegen eine Regel verstoßen. Er muss wohl am Treppenaufgang stehen, denn seine Stimme schafft es durch den schmalen Gang und über die Stufen nach oben und überbrückt die Distanz zwischen uns.
Ich höre das Wasser in den Rohren und stelle mir vor, dass Calebs Mutter duscht oder den Abwasch macht.
»Alles gut bei dir?«, flüster-ruft er.
Gut? Von gut kann keine Rede sein. Ich berühre die Kappe und traue mich nicht, sie von ihrem Platz zu nehmen, als wäre ich in diesem Zimmer ein Störfaktor. Die Atmosphäre wandelt sich. Das Zimmer wandelt sich. Die Bedeutung hinter Max’ Worten wandelt sich.
»Sag ihr, dass ich Paketband brauche«, rufe ich. Das ist die einzige Erwiderung, die mir einfällt. Ich sehe Caleb auf seinem Bett, wie er versucht, sich ein Lächeln zu verkneifen. Er fand es immer süß, wenn ich das Falsche sagte.
Ich stelle den ersten Karton auf, nehme die Klamotten, die Baseballkappe, all die Dinge, die Caleb geliebt hat, und schichte sie mit einem Seufzen in die Schachtel. Anschließend blicke ich mich in dem Zimmer um, in der Erwartung, dass sich etwas verändert hat, doch es ist alles beim Alten.
Wir sind hier. Caleb ist fort.
Unten ertönt wieder Max’ gedämpfte Stimme, gefolgt von Calebs Mutter. Schließlich ist es Max, der mir das Band bringt. Ich höre seine zögernden Schritte auf der Holztreppe, die knarzende Stufe, über die Caleb auf dem Weg nach unten immer hinweghüpfte. Max zieht die Schuhe über die Fußmatte an der Tür und ich kann beinahe das Pling hören, das immer folgte, wenn Caleb den Lichtschalter betätigte – irgendwie schaffte er es jedes Mal, sich an der Matte elektrisch aufzuladen und beim Reingehen eine gewischt zu bekommen.
Doch Max betätigt den Lichtschalter nicht. Er kommt auch nicht näher. »Ich hab ihr angeboten, es zu machen«, sagt er, ohne mich anzusehen. Max und Caleb sind nicht miteinander verwandt, aber sie haben mir mal erzählt, dass sie es der gesamten sechsten Klasse weismachen konnten. Dabei sehen sie sich nicht einmal ähnlich – Max ist groß und schlank und hat schwarzes Haar, Caleb dagegen war breitschultriger und hatte hellbraunes Haar, das im Sommer noch heller wurde. Aber sie hatten eine ähnliche Art zu sprechen, einen singenden Tonfall, völlig aufeinander abgestimmt. Eine typische Angewohnheit von Menschen, die sich seit Jahren kennen und viel Zeit miteinander verbracht haben.
Ich ignoriere ihn und kippe den gesamten Inhalt einer Schublade in einem Schwung in einen neuen Karton. Sommerklamotten. Eine ganze Jahreszeit. Monate eines Lebens. Einfach weg.
Er lehnt sich hinter mir an die Wand. Ich sehe seine Turnschuhe, bemerke, wie er auf den Fersen wippt, als überlege er, ob er bleiben oder gehen soll. »Wir haben dich beim Wettkampf vermisst.«
Da fällt mir auf, dass seine Haare nass vom Duschen sind und er noch immer die Trainingskleidung des Schulteams trägt. Er muss direkt vom Wettkampf hergekommen sein. Heute war das letzte Rennen der Saison. Ich habe es verpasst, so wie jedes andere seit September.
Einen Moment lang höre ich die Jubelrufe eines frühen Samstagsrennens, rieche den Tau auf dem Gras, spüre das Adrenalin in den Zehen kribbeln. Instinktiv will ich nach der Kette um meinen Hals greifen, doch dann fällt mir ein, dass sie nicht mehr da ist. Sie befindet sich zwar endlich wieder in meinem Besitz, aber ich weiß, dass ich sie nie mehr tragen werde.
Wie alles andere in diesem Zimmer stammt auch sie aus einer anderen Ära. Sogar das Wetter hat umgeschlagen. Calebs Sommersachen werden nie wieder gebraucht werden.
»Jessa …«, sagt Max und streckt die Hand nach dem Karton aus. »Lass mich dir helfen.«
»Sie will, dass ich es mache«, blaffe ich ihn an, falte den Deckel um und strecke die Hand nach dem Klebeband aus. Ich klemme mir den Karton zwischen die Beine und ziehe den Klebestreifen darüber. Das Geräusch durchschneidet das Zimmer. Ich reiße das Band ab und bringe ein zweites in entgegengesetzter Richtung an, ein schiefes X. Ich hebe den Karton hoch und drücke ihn Max in die Arme. »Da. Sag es ihr. Sag ihr, ich mach es.«
Ich schiebe ihn mit der Schachtel weg und er weicht zurück, immer weiter, als hätten seine Füße ein Eigenleben entwickelt. Ich klammere mich an dem Gefühl fest und mache weiter.
Ich nehme mir seine Kleider vor. Den schweren Teil habe ich hinter mir, die Sachen auf dem Boden, die Sachen, in denen ich ihn noch vor mir sehe. Wahrscheinlich werden sie alle gespendet und gehören schon bald jemand anderem. Ich tue das jedes Jahr: meinen Schrank ausmisten, um Platz zu schaffen für die nächste Größe oder den nächsten Trend, oder einfach nur, um die Sachen zu finden, die eingelaufen sind, weil mein Vater sie in den Trockner getan hat. Die Leere des Schranks ist nur vorübergehend, eine Lücke, die früher oder später wieder gefüllt wird. Ein Zeichen für Veränderung – bei den Jahreszeiten und mir.
Die Klamotten in den Schubladen sind der einfache Teil; sie sehen alle gleich aus, zusammengelegt zu flachen Rechtecken. Sie riechen nach Waschmittel und Trocknertüchern, nach dem Kiefernholz des Kleiderschranks. Ich lasse sie zusammengefaltet und versuche, nicht zu genau hinzusehen. In den Schubladen sind vor allem Jeans, kurze Khakihosen und Sportshorts. T-Shirts mit Band- und Markenlogos. Socken und Unterhemden und Boxershorts. Ich mache keinen Unterschied. Es ist mir egal. Sie sagte, dass ich packen soll, also packe ich. Alles wird verstaut, bevor etwas zu mir durchdringt. Ich klebe Kartons zu und staple sie auf dem Boden und dann weiter zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten.
Irgendwann höre ich, wie die Hintertür sich öffnet und schließt, und weiß, dass Max gegangen ist. Das weiß ich, weil ich ans Fenster trete und zusehe, wie er mit gesenktem Kopf den Hof überquert, das Tor am Gartenzaun öffnet und noch einmal aufblickt, ehe er auf die andere Seite schlüpft, wo er lebt. Ich verstecke mich hinter den Vorhängen, doch zu spät.
Dann bemerke ich ihr Spiegelbild im Fenster, sie füllt den Türrahmen aus. Ich wirble herum und stehe mit dem Rücken zur Wand neben Calebs Bett. Sie starrt aus rot geränderten Augen erst zu den Kartons, dann zu mir. Jetzt wird sie mir gleich sagen, dass es reicht, dass ich heimgehen soll. Schließlich hatte sie immer eine Schwäche für mich, hat mich zum Abendessen eingeladen, nach meinen Plänen gefragt – doch sie hält einen schwarzen Edding in der Hand. »Du musst sie beschriften.« Ihre Stimme ist kalt und ausdruckslos.
Und was bleibt mir anderes übrig, als den Stift zu nehmen und zu nicken?
Über mir an der Wand tickt Calebs Uhr. Grausam und gleichmäßig. Immer weiter, ein Zähler der Augenblicke, die ihn in immer größere Entfernung rücken lassen.
Ich möchte ihr sagen, dass ich noch nicht zu Mittag gegessen habe, dass mein Bruder dieses Wochenende vom College auf Besuch ist, dass es mir leidtut.
»Ich bin fast mit den Klamotten fertig«, sage ich, weil sie noch immer dasteht und ich nicht weiß, was ich sonst zu ihr sagen soll, zu dieser Frau, die mir vermutlich insgeheim die Schuld am Tod ihres Sohnes gibt.
Erst als ich mich wieder dem Kleiderschrank zuwende, höre ich, dass sie die Treppe hinuntergeht.
Bunkerschild
Der Wäschekorb in der Ecke ist leer und ich klappe das Holzgestell zusammen, sodass der Stoff flach am Boden liegt. Darunter kommt ein flaches Stück Holz zum Vorschein, mit eingeritzten Wörtern und einer Schnur, die mit Nägeln an den Rändern befestigt ist. Ich streiche mit den Fingern über die Buchstaben – wahrscheinlich hing das Schild früher mal an der Tür.
Der Bunker steht darauf, und selbst hier und jetzt muss ich unweigerlich lächeln.
Letztes Jahr am Labor-Day-Wochenende war ich zum ersten Mal bei Caleb zu Hause. Es war der Tag, an dem wir zusammenkamen. Ein Tag nach meinem sechzehnten Geburtstag.
Am Dienstag ging das neue Schuljahr los und wir fünf genossen den letzten Rest vom Sommer. Hailey musste an diesem Tag schon früher los, um noch Sachen für die Schule zu besorgen, und ihre Mom kam uns abholen, aber Caleb bot an, mich zusammen mit den anderen später heimzufahren. Da lächelte Hailey mich an, als wisse sie Bescheid.
Auf dem Nachhauseweg saßen Max und Sophie auf der Rückbank. Max hatte es eilig – er musste zur Arbeit – und Sophies Auto war bei ihm geparkt. Deshalb setzten wir zunächst die beiden ab. Es war das erste Mal, dass ich sah, wo Caleb und Max wohnten. Sie gingen auf dieselbe Schule wie ich, eine nicht gerade billige Privatschule, aber ihr Viertel schrie nicht unbedingt Ich kann es mir leisten, meine Kinder auf die Privatschule zu schicken.
Die Stadt galt als wohlhabend, doch die Häuser der beiden waren klein und schon älter, mit schmalen, dicht aneinandergereihten Gärten. Max hatte ein inoffizielles Baseball-Stipendium (inoffiziell darum, weil die Schule keine offiziellen Sportstipendien vergab, aber in welcher Verpackung es daherkommt, ist letztendlich auch egal). Das wusste ich, weil mein Bruder ihn darauf gebracht hatte, sich zu bewerben. Aber über Calebs Familie wusste ich im Grunde nichts.
»Unser Haus ist genau hinter dem von Max«, erklärte Caleb, als Max und Sophie mit ihren Strandsachen im Schlepptau aus dem Wagen krabbelten. »Willst du noch kurz mit reinkommen und was essen?«, fragte er, ohne mich anzusehen, und trommelte dabei mit den Händen auf dem Lenker.
»Klar«, sagte ich und bekam Herzklopfen.
Er fuhr einmal um den Block bis vor ein kleines Backsteinhaus und parkte das Auto dann so mühelos zwischen zwei anderen am Straßenrand, als täte er den ganzen Tag nur das. Ich folgte ihm über die Betonstufen nach oben zum Eingang, das eiserne Geländer schepperte in meiner Hand. Er zückte den Schlüssel, einen von mehreren, die an einem Anhänger mit den Initialen seiner Lieblings-Footballmannschaft hingen, sperrte die Tür auf und rief: »Mom?«
Das Wort hallte durch den schmalen Flur. Der Boden war aus Holz, genau wie die Treppe gegenüber vom Eingang. Caleb ließ seine Tasche einfach fallen und führte mich durch einen Raum, der in zwei Bereiche aufgeteilt war – ein Wohnzimmer mit Fernseher und einer riesigen Couch und ein Esszimmer, in dem ein Holztisch mit roten Platzdeckchen stand und Familienfotos an den Wänden hingen –, weiter in die Küche.
Erst sah er in der Speisekammer nach, dann im Kühlschrank. »Okay, ich muss leider gestehen, dass die Ausbeute ausgesprochen mager ist.« Er kniff die Augen zusammen und streckte mir die Hände entgegen. »Aber ich habe was zu essen in meinem Zimmer, und das ist keine billige Anmache, versprochen.«
Ich lachte, und er blinzelte und grinste mich verlegen an.
»Nach dir.«
Ich folgte ihm die enge Treppe nach oben, erst ein Stockwerk und dann das zweite, bis ich schließlich über die Schwelle trat und die Einbauregale an den Seitenwänden sah, in denen Flaschen mit Sportgetränken und verschiedene Snacks standen.
»Willkommen im Bunker«, sagte er mit einer ausladenden Geste.
»Darf ich?«, fragte ich und griff nach einer Packung M & M’s, die im untersten Regalfach an einem Bücherstapel lehnte.
»Aber klar doch.« Er lächelte. Ich riss die Tüte auf, überrascht, wie hell das Zimmer war, obwohl es nur ein einziges Fenster gab, durch das die Sonne hereinfiel. »So bunkermäßig finde ich das hier gar nicht«, sagte ich.
Er legte sich die Hand auf die Brust und tat schockiert. »Beweisstück A: die Regale.«
Ich sah genauer hin. »Die Bücherregale?«
»Nein, das sind keine Bücherregale. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die vor uns hier gewohnt haben, Weltuntergangstheoretiker waren.«
Die M & M’s waren von der Sonne leicht angeschmolzen und färbten meine Finger rot, grün und braun. »Glaubst du etwa nicht, dass die Welt irgendwann untergeht?«, fragte ich.
»Oh doch. Klar wird irgendwann die Sonne explodieren oder irgendein Supervirus löscht uns alle aus, aber nichts, wovor uns ein Dachboden voller Lebensmittel retten könnte. An die Art von Szenario glaube ich nicht.«
»Vielleicht war es auch nur die Bibliothek«, sagte ich.
»Na ja.« Mit zusammengekniffenen Augen musterte er die Regale. »Kann schon sein. Aber als wir hier eingezogen sind, stand in einem der Fächer eine Müslipackung. Eine ungeöffnete, einsame Packung. Als hätte es sich nicht gelohnt, sie mitzunehmen.«
Ich schaute mich noch einmal um und versuchte, mir das Zimmer randvoll mit Lebensmitteln vorzustellen, aber das klappte nicht. »Ich geb mir ja Mühe, Caleb. Aber für mich ist es eine Bibliothek.«
»Bibliothek klingt aber nicht so cool. Ruinier mir nicht meine Street Cred, Jessa Whitworth.«
Dann kam er einen Schritt näher, wie ich es schon erwartet hatte, und legte mir seine Hand um die Hüfte, wie ich es ebenfalls schon erwartet hatte. »Okay, ich gebs zu, es war eine Anmache.«
»Ich weiß«, antwortete ich, und er musste lachen. Dann wurde sein Blick ernst, seine Hand wanderte zu meiner Wange und er kam noch näher, bis unsere Körper sich berührten. Ich spürte seinen Atem und das Zittern seiner Hand. Und als er sich vorbeugte, um mich zu küssen, roch er nach Salz, Sonnencreme und Sommer.
Ich küsste ihn zurück, umfasste seine Taille und dachte dabei, wie sehr mich alles an ihm an das Meer erinnerte und wie perfekt das war. Seine Haut war von der Sonne noch ganz warm, das Salzwasser war in seinen Haaren getrocknet, und so verlor ich mich in dem Gefühl zu schweben, dahinzutreiben. Dann ertönte von unten das Geräusch trappelnder Füße, als habe jemand ein Tier freigelassen.
Caleb ließ mich los und wich zurück. »Meine Mutter ist da«, sagte er. Die vier Worte, die jedes Mädchen unbedingt hören will.
Er schwang sich die Treppe hinunter, auf diese ganz eigene Art, die mir noch so vertraut werden sollte. In jenem Moment war ich allerdings einfach nur damit beschäftigt, mich zu sammeln und mir eine Entschuldigung einfallen zu lassen – Oh, hallo. Ich hatte Hunger und die M & M’s waren oben. Echt jetzt? Wirklich? Ich versuchte hastig, mit ihm Schritt zu halten.
»Hi, Mom«, sagte er, unten angekommen.
Seine Mutter trug eine Papiertüte, aus der ein Salatkopf ragte. Sie hatte langes, dunkles, fast schon tintenschwarzes Haar, ihre grünen Augen waren perfekt geschminkt, ihre Lippen hellrosa. Ihr Blick wanderte von Caleb zu mir. Ich war hinter ihm stehen geblieben und bemühte mich, nicht vor Scham tot umzufallen. Ein kleines Mädchen rannte umher, ohne uns viel Aufmerksamkeit zu schenken, sie war das Ebenbild ihrer Mutter.
»Das ist Jessa«, sagte Caleb und beließ es dabei. Dabei hätte er so vieles sagen können, um Klarheit zu schaffen. Für uns alle.
Das ist Jessa, das Mädchen, das ich gerade geküsst habe.
Meine gute Freundin, Jessa.
Julians Schwester, Jessa.
»Jessamyn Whitworth«, sagte ich, trat hinter Caleb hervor und streckte seiner Mutter die Hand hin, als wollte ich ihr etwas verkaufen.
Ich fühlte, wie Caleb meinen Blick suchte und mich kopfschüttelnd angrinste.
Seine Mutter stützte die Tüte auf der Hüfte ab und nahm meine Hand. »Ah, Jessa«, sagte sie, als hätte sie meinen Namen schon einmal gehört.
Caleb lief rot an. Ich ebenfalls.
»Bleib doch. Wir haben viel zu viel Essen gekauft. Und Sean kommt erst später.«
Ich warf Caleb einen fragenden Blick zu. Bleib, sagte er lautlos.
»Gerne«, erwiderte ich. »Danke, Mrs …« Weiter wusste ich nicht. Caleb hieß mit Nachnamen Evers, aber seine Mutter hatte noch einmal geheiratet. Ich hatte keine Ahnung, wie ich zu ihr sagen sollte.
»Eve«, sagte sie. »Ich heiße Eve. Und das« – sie tippte dem Mädchen, das jetzt um Calebs Hüfte hing, auf den Kopf – »ist Mia.«
Das Haus fühlt sich viel größer an, jetzt, wo nur seine Mutter und ich hier sind. Inzwischen wohnen die beiden – Mia und Eve – alleine hier. Erst ist Calebs Stiefvater Sean gegangen, und jetzt ist auch Caleb fort. Das Haus ist auf vier Personen ausgelegt. Das Elternschlafzimmer befindet sich im Erdgeschoss, gemeinsam mit der Küche und dem Wohn- und Esszimmer. Im ersten Stock gibt es zwei Zimmer, Mias und eins, das ursprünglich wohl für Caleb bestimmt war, außerdem ein Bad. Eine enge, ungeschliffene Holztreppe führt ins Dachgeschoss, das wahrscheinlich gar nicht als Schlafzimmer gedacht war. Der Bunker, flüstere ich.
Ich versuche mir vorzustellen, wie es hier aussah, als Caleb eingezogen ist. Nackte Wände, leerer Boden, eine einzelne Müslipackung im Regal, wie in einer Speisekammer. Doch es gibt einen Schrank. Eine Speisekammer hat keinen Schrank. Das habe ich Caleb auch gesagt.
Ein Bunker schon.
Ich will den Klang seiner Stimme bewahren, sperre mir die Worte fest in den Kopf, denn ich kann bereits fühlen, wie sie mir entgleiten. Im Nebel der Erinnerung verschwinden.
Dieses Haus war immer so lebendig, mit Caleb hier oben, seiner Schwester unten, Musik aus den Lautsprechern und dem Röhren des Fernsehers im Erdgeschoss.
Ich will ihm von der jetzigen Stille erzählen. Wie die Stille ein Zimmer ausfüllen kann, bis in die Ecken dringen, die Macht über einen Ort ergreifen. Wie schwer sie sich anfühlt, schwer genug, um die Erinnerung an seine Stimme zu übertönen. Ich will ihm erzählen, wie ich in der ersten Woche immer wieder auf seinem Handy angerufen habe, bevor es abgestellt wurde, nur um seine Stimme auf der Mailbox zu hören, weil die Stille bereits begonnen hatte, mich niederzudrücken. Alles von ihm gleitet durch die Ritzen davon, und ich mit ihm.
Graue Nadelstreifen
Ich werfe das Schild in einen neuen Karton für Calebs persönliche Sachen, weil er es selbst gebastelt hat und ich das Gefühl habe, dass man es aufbewahren sollte. Seine Mutter will, dass ich seine persönlichen Sachen in eine extra Schachtel packe, also mache ich mit dem Schild den Anfang und wende mich dann wieder den Kleidern zu.
Die gestreiften Rugby-Poloshirts hängen im Schrank, sie waren sein Standard-Schuloutfit. An unserer Schule sind Oberteile mit Kragen Vorschrift, aber diese einheitsstiftende Regel kennt viele Varianten: das Button-down-Hemd, das maßgeschneiderte Poloshirt, das leger geschnittene Rugby-Oberteil, das weiße Oxfordshirt unterm Pullunder. Zusätzlich zu den für Jungs obligatorischen langen Hosen in Khaki, Schwarz oder Marineblau können Mädchen außerdem Kleider, Röcke oder Caprihosen tragen.
Alles an unserer Highschool ist ein paar Grad schicker als die Norm.
Dieser Schrank enthält die Schulversion von Caleb. In den Schubladen steckt sein lockeres Ich, das er nachmittags um drei hervorholte – in seinem Spind warteten immer eine Jeans und ein T-Shirt auf ihren Einsatz nach Schulschluss.
In einer Ecke des Schranks hängt ein schwarzer Kleidersack, darin ist der Anzug, den Caleb letzten Oktober zum Homecoming-Ball anhatte.
Ich lege die Finger auf den kalten Reißverschluss, ziehe ihn jedoch nicht auf. Der Anzug gehörte seinem Dad, das hat er mir an jenem Abend erzählt, als ich ihm anerkennend über die Ärmel strich. Ich kann mich erinnern, wie neu es mir vorkam, die Art, wie er ihn ausfüllte, wie er in diese Abwesenheit hineinwuchs – die eines Menschen mit denselben Ausmaßen. Mir hatte das Herz wehgetan, als er es mir erzählte. Calebs Vater war vor einigen Jahren gestorben, aber weil sein Stiefvater Sean immer da gewesen war, seit ich Caleb kannte, war es einfach, das zu vergessen, war es leicht zu übersehen, dass etwas fehlte.
Es war eine schlichte Aussage, mehr nicht, aber es brachte uns näher zusammen. Es war ein Stück seiner Vergangenheit, das er mich sehen ließ.
Ich werfe den Sack aufs Bett – er ist beinahe so groß wie ein Mensch und das gibt mir ein seltsames Gefühl, als ob sich etwas anderes darin verbirgt. Meine Finger kribbeln. Ich ziehe den Reißverschluss auf. Stärkegeruch schlägt mir entgegen und verrät mir, dass der Anzug in der Reinigung war.
Ich nehme ihn nicht heraus, denn er ist perfekt gebügelt und gefaltet, genau so wie Caleb ihn aufbewahren wollte. Und er hat seine eigene Geschichte, wie ein Familienerbstück. Ich streiche mit der Hand über den Stoff. Dabei schließe ich die Augen und sehe Caleb an jenem Abend vor mir, wie er in der Haustür steht und mir die Arme hinstreckt. Es ist ein grauer Nadelstreifenanzug, ein älteres Modell.
»Du siehst toll aus«, sagte ich, ohne je zu erfahren, was er seinerseits zu meiner Aufmachung sagen wollte, denn er verstummte, sobald er im Hintergrund meinen Bruder erblickte. Julian wartete darauf, dass seine Teamkollegen ihn abholten, da sie alle gemeinsam mit ihren Dates zum Ball gehen wollten.
Meine Mutter machte ein Foto von uns, auf dem Caleb den Arm um mich legt, seine Krawatte passt zu meinem himmelblauen Kleid und seinen Augen. Er und Julian schüttelten sich im Wohnzimmer etwas steif die Hände, als ich sie einander vorstellte, obwohl sie sich bestimmt schon kannten – oder zumindest voneinander wussten.
»Tschüss, Mom, bis später«, rief ich und zog Caleb hinter mir her. Wir strahlten, alles war noch so neu, dass wir es nicht erwarten konnten, endlich allein zu sein.
Als Julian mir »Wir sehen uns dann dort, Jessa« hinterherrief, klang es wie eine Warnung.
Während alle anderen Jungs einfach nur schwarze oder graue Anzüge trugen, mit Jackett oder ohne, stach Caleb hervor. Der Anzug ließ seine Augen noch blauer wirken und seinen Körper noch schlanker. Ich weiß noch genau, wie sich der Stoff anfühlte, als ich mich an ihn schmiegte. Seine Hände lagen auf meinem Rücken und die Musik spielte im Takt zu unseren Bewegungen. Die ganze Nacht, ein Rausch aus Lachen und Farben.
Die Schulkantine hatte sich in eine Tanzfläche verwandelt, durch die hohe Fensterfront war der Vollmond zu sehen und alle hatten sich herausgeputzt. Das war ein anderer Ort als der, an dem wir jeden Tag die Mittagspause verbrachten, und wir waren andere Menschen.
Ich versuche, nicht daran zu denken, wie er anschließend achtlos sein Jackett auf die Rückbank des Autos warf. Oder an seine aufgeschnürte, zu meinem trägerlosen Kleid passende Krawatte. Oder an meine Finger an den Knöpfen seines weißen Hemdes. Oder an seine Hände auf meinen nackten Schultern, als er mich küsste. Oder daran, wie er anschließend sagte: »Sieh an, Jessa Whitworth. Ich glaube, ich mag dich.«
Oder wie er immer so was sagte wie sieh an oder hört, hört, als müsste er alles abschwächen, um es als Witz ausgeben zu können.
Am nächsten Morgen beim Frühstück sagte Julian zu mir: »Pass mit dem Typen auf, Jessa. Er ist älter als du.«
»Nur ein Jahr«, entgegnete ich und Julian schaute mich an, als wäre ihm die Tatsache entgangen, dass ich nicht mehr die Mittelschülerin war, die in ihrem Zimmer Karaoke sang und sich verkleidete. »Außerdem«, fuhr ich fort, »ist er ein Freund von Max.«
Ich kannte Max seit der Grundschule, so wie ich die meisten Baseball-Kumpels meines Bruders kannte: Sie waren einfach da. Und ihnen ging es genauso mit mir. Als ich dann auf die Highschool kam, kannte eine ganze Gruppe von Leuten mich als Julians Schwester, Jessa.
Caleb war eine Ausnahme.
Max und Caleb waren ein Jahr älter als ich. Und Julian war ein Jahr älter als sie. Ich machte seit der Neunten beim Laufteam der Schule mit und war das ganze Jahr über im Gelände und auf der Bahn unterwegs. Max hatte in diesem Jahr auch damit angefangen, um sich für die Baseballsaison fit zu halten. Als ich Caleb kennenlernte, stand Julian gerade vor dem Beginn seines letzten Schuljahres, Max und Caleb waren ein Jahr unter ihm in der elften Klasse und ich ging in die zehnte.
Julian knurrte. »Max würde ich dir auch nicht als Freund aussuchen.«
»Dann ist es ja gut, dass du nicht für mich aussuchst.«
Irgendwann freundete Julian sich doch noch mit Caleb an, aber eher distanziert und leicht ungläubig – wann immer Caleb bei mir auftauchte, schaute Julian ganz überrascht, so als würde er dieses Detail meines Lebens regelmäßig vergessen. Anders konnte er mit der Sache wohl nicht umgehen.
Ich ziehe den Reißverschluss zu, falte den Beutel in der Mitte und lege ihn vorsichtig in den Karton, sodass er die Polohemden bedeckt. Als ich den Deckel zumache, schaue ich weg. Das blaue Kleid vom letzten Jahr hängt noch immer in meinem Schrank, in dem Plastiksack aus der Wäscherei, unberührt. Dieses Jahr habe ich den Ball verpasst. Er war letzten Monat, an einem kalten, klaren Samstagabend. An dem neuen Kleid, das ich Ende des Sommers dafür gekauft habe (Hailey hatte es von der Stange gezogen und mir mit leuchtenden Augen hingehalten. Das musst du nehmen, Jessa. Es ist perfekt. Es ist perfekt für dich), hängt noch das Etikett.
Ich habe es gekauft, weil es ein Sonderangebot war – und ich eine Optimistin.
Aber selbst damals fühlte es sich wie eine Lüge an. Wie der Versuch, etwas zwischen uns wiederherzustellen, das schon lange verschwunden war.
Verstimmte Gitarre
Als ich den Rest von Calebs Kleidern aus dem Schrank ziehe, stößt etwas gegen die Rückwand – ein schwaches Summen, ein blechernes Scheppern ertönt. Ich schiebe die Kleiderbügel zur Seite und entdecke seine Gitarre, die an der Wand lehnt. Sie klemmt zwischen einem luftleeren Football und einer zusammengefalteten, staubigen Decke und es sieht aus, als könnte sie jeden Moment umfallen. Als ich sie am Hals packe, entlocke ich ihr versehentlich einen schrillen Ton, der durch das leere Zimmer hallt. Wie von selbst bewegen sich meine Finger über die verstimmten Saiten.
Es war November und die morgendlichen Klausuren waren gerade vorbei. Alle, die am Nachmittag auch noch welche anstehen hatten, strömten in die Schulbibliothek, alle anderen zum Mittagessen oder zu ihren Lerngruppen. Wir beschlossen, bei Caleb zu Hause zu lernen. »Es ist keiner da, glaube ich«, erklärte er. Mia ging in die dritte Klasse, Eve arbeitete bei einer Immobilienfirma und Sean schob je nach Projekt Tages- oder Nachtschichten.
Aus Calebs Computerlautsprechern drang Musik, was ihm beim Konzentrieren half, auf mich jedoch den entgegengesetzten Effekt hatte. Ich saß mit meinen Matheunterlagen auf dem Schoß am Schreibtisch und drehte mich im Stuhl hin und her. Hauptsächlich beobachtete ich Calebs Spiegelbild im Computerbildschirm, sah dabei zu, wie er auf dem Bett lag und in seinen Physikmitschriften blätterte, bis er sich plötzlich verkrampfte. Er beugte sich über den Bettrand zum Schreibtisch, griff an mir vorbei und drehte stirnrunzelnd die Musik leiser.
»Was ist?«, fragte ich, doch dann hörte ich es auch. Verhaltene Schritte auf der Treppe. Caleb bekam große Augen, fasste mich an den Schultern und schob mich behutsam Richtung Schrank.
»Psst«, flüsterte er, als die Dunkelheit mich schluckte. Seine Hemden drückten gegen mich und sein Gesicht war nur noch ein blasser Strich in der Lücke aus Licht, bis er die Tür ganz schloss.
Ich versuchte, langsamer zu atmen, um den Beweis für meine Existenz zu verbergen.
»Caleb?« Die Zimmertür öffnete sich quietschend und jemand trat ein. »Dachte ich mir doch, dass ich hier oben was gehört habe.« Seans Stimme war tief und reibeisenrau. Sie hörte sich an, als ob er sein Leben lang geraucht hätte, aber im Haus roch es nie nach Zigaretten.
»Ja. Ich bins bloß.«
»Solltest du nicht in der Schule sein?« Ein leicht anklagender Ton.
»Wir haben Prüfungswoche. Ich lerne.« Auch Calebs Stimme wurde lauter, sein Tonfall glich dem von Sean. »Was machst du hier?«
Ich hörte, wie etwas sich bewegte – ein Objekt, das aufgehoben und wieder abgelegt wurde. »Wir haben früher Schluss gemacht. Physik, was?«, sagte Sean. Wahrscheinlich hatte er Calebs Lehrbuch in die Hand genommen. Ein leises Klimpern ertönte, als er näher trat, die Kette seiner Taschenuhr, die er immer, wenn ich ihn sah, an einer Gürtelschnalle befestigt hatte. »Bist du noch länger hier? Du könntest mir helfen, was von dem alten Zeug in der Garage zum Wertstoffhof zu bringen.«
Das Schweigen zog sich in die Länge, die Anspannung war im ganzen Zimmer spürbar. Ich hielt den Atem an, überzeugt, dass er in der Stille fühlen konnte, dass ich da war. So wie man die Anwesenheit von jemandem fühlt, auch wenn man ihn nicht sieht. Ich war ein Rascheln in der Wand, ein Schatten im Schrank. Ich fragte mich, ob Sean gerade zu der Ritze unter der Schranktür blickte.
Endlich machte Caleb den Mund auf. »Ich glaub, ich geh doch in die Bibliothek.«
Sean gab ein Geräusch von sich, das möglicherweise ein Lachen war. Schwer zu sagen, ohne die Gestik und Mimik dazu zu sehen.
Etwas drückte gegen meinen Rücken und ich zuckte zusammen, weil ich es für eine Hand oder einen Arm hielt, bis ich hinter mich fasste. Meine Finger ertasteten Saiten, die ich sofort gegen das Holz presste, damit sie keinen Ton von sich gaben. Ich hatte gar nicht gewusst, dass Caleb ein Instrument spielte.
Ich blieb, wo ich war, umklammerte die Gitarre und lauschte, wie Seans Schritte sich entfernten. Caleb rührte sich erst wieder, als irgendwo unter uns eine Tür zufiel. Als er den Schrank aufmachte, schubste ich ihn verärgert. Er lachte und tat, als würde er sich die Schulter reiben.
»Ich wusste nicht, dass man mich verstecken muss«, sagte ich.
»Vertrau mir, das war die schnellste Art, ihn loszuwerden.«
Ich verdrehte die Augen. »So viele Geheimnisse, Caleb. Du spielst Gitarre?«
Als er das Instrument in meiner Hand sah, lachte er. »Kann ich leider nicht behaupten. Die haben meine Großeltern mir geschenkt. Ich weiß nicht, wie man spielt.«
»Gar nicht?«
»Nö.«
Da sah ich, dass die Gitarre von einer feinen Staubschicht überzogen war und an einem der Wirbel die Überreste eines Spinnennetzes hingen. Ich wischte den Staub und die Fäden beiseite und hängte sie mir um. Dann brachte ich die Finger in Position für den Akkord, den ich am besten beherrschte, weil mein Vater ihn mir vor Jahren beigebracht hatte.
»Sag bloß, du kannst Gitarre spielen.« Sein Gesicht bekam einen Ausdruck, der irgendwo zwischen Staunen und Begeisterung lag.
»Von spielen kann nicht die Rede sein, aber offenbar bin ich immerhin besser als du.« Ich schlug einen weiteren Akkord an, lächelte und versuchte, mich an die grundlegenden Takte zu erinnern, die ich in den paar Gitarrenstunden während der Mittelstufe gelernt hatte. Auch wenn das Instrument verstimmt war, so klangen die Noten doch vertraut.
»Was weiß ich sonst noch nicht über dich, Jessa Whitworth?«, flüsterte er und beugte sich näher. Wir waren in dem Stadium, in dem man glaubt, bereits alles Wesentliche über den anderen zu wissen, und dann passiert so etwas und man merkt, dass es noch so viel zu entdecken gibt.
»Zum einen«, sagte ich und legte die Hand auf die Saiten, um sie zum Verstummen zu bringen. Es wurde leise im Zimmer. »Dass ich es nicht mag, wenn man mich im Schrank versteckt.«
Er legte den Kopf in den Nacken und lachte – wohl lauter, als er erwartet hatte, denn er brach hastig ab und blickte zur Treppe. »Ist vermerkt«, sagte er. »Aber wir sollten verschwinden, bevor Sean wiederkommt. Es sei denn, du willst noch mal da drinnen landen.«
Ich löste den Gurt, reichte ihm die Gitarre und sah zu, wie er sie zurück in den Schrank räumte.
»Wer hat eine Gitarre, die er nicht spielen kann?«, murmelte ich.
»Wenn du willst, darfst du’s mir beibringen.« Er warf mir einen Blick über die Schulter zu und winkte mir, ihm leise zu folgen. Wir schlichen die Stufen hinunter, vorsichtig um die Ecken spähend, bis wir draußen auf der Veranda waren, im Freien, und anschließend in seinem Auto, unterwegs nach ich weiß nicht mehr wohin.
Jetzt halte ich die Gitarre in der Hand. Er hat mich nie gebeten, ihm beizubringen, wie man spielt. Und ich habe es nie getan. Sie stand fast ein Jahr am selben Ort, offenbar unberührt. Die Saiten sind noch heil – ich streiche darüber und lege die Hand über den Hals, um das Geräusch zu ersticken.
Vorsichtig lehne ich die Gitarre neben der Tür an die Wand – sie passt in keinen der Kartons. Aber sie ist etwas wert, falls seine Mutter beschließt, sie zu verkaufen. Wahrscheinlich war das die Idee hinter dieser Packaktion: auseinanderzusortieren, was aufgehoben werden sollte und was gespendet oder verkauft werden kann.
Ich habe Kartons gefüllt und mit Hemden, Hosen, Shorts, Socken beschriftet. Sie türmen sich an der Wand, aber das Zimmer ist immer noch voll. Er ist überall. Es ist Samstagnachmittag und auf der Treppe stehen sechs Schachteln voller Caleb. Und ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis das Zimmer sich in etwas anderes verwandelt. Bis ich aufhöre, ihn in jeder Ecke zu sehen, mit jedem Herzschlag, jedem Ticken dieser dummen Uhr. Bis ich wieder ordentlich atmen kann, ohne dass ich glaube, ersticken zu müssen.
Die Fotos sind schuld, beschließe ich. Sie sind überall.
Ich muss an das letzte Mal denken, als ich die Treppe hinaufgegangen bin und in sein Zimmer gespäht habe, als er noch da war. Ich erinnere mich, wie er in der Tür stand und den ausgestreckten Arm gegen den Pfosten stemmte. Seine Körpersprache sagte alles: Du bist nicht willkommen.
Und jetzt bin ich hier, genau da, wo er mir signalisiert hat, dass ich nicht willkommen bin, und ich kann fühlen, wie er mich beobachtet. Dabei, wie ich seine Sachen durchgehe und Teile seines Lebens wegwerfe.
Die Worte, die er mir an jenem Tag sagte, mit ausdruckslosem Gesicht: »Was willst du hier, Jessa?«
Ich höre sie wieder. Sie kommen aus den Wänden. Sie kommen von überallher.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: