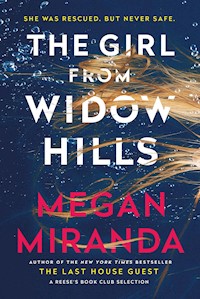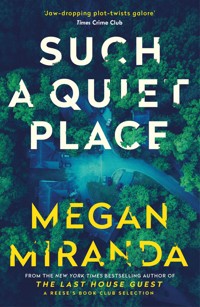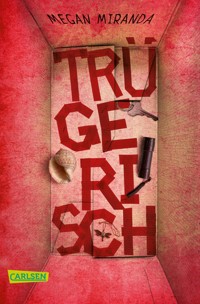12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was, wenn deine Taten von gestern dich bis heute verfolgen?
10 Jahre ist es her, dass in Tennessee zwei Schulbusse in eine Schlucht stürzten. Nur neun Jugendliche konnten sich retten. Als sich eine von ihnen wenig später das Leben nimmt, schließen die übrigen einen Pakt: Jedes Jahr wollen sie sich treffen, um jener schrecklichen Nacht zu gedenken.
Um einander zu schützen.
Um sich gegenseitig in Schach zu halten.
Nun, am zehnten Jahrestag, der Schock: Ein weiterer Überlebender ist tot – seine Leiche wurde in eben dem Strandhaus in den Outer Banks gefunden, das ihnen bei ihren Treffen zum Zufluchtsort geworden ist. Der Rückhalt in der Gruppe bröckelt. Dann droht ein aufkommender Sturm, das Haus von der Außenwelt abzuschneiden. Können sie noch darauf vertrauen, dass sie einander schützen werden?
Ein atemberaubend spannender, beunruhigender Thriller voller unerwarteter Wendungen, die das Markenzeichen der Autorin sind. SIEBEN STUNDEN ist der bisher beste Roman der New-York-Times-Bestsellerautorin Megan Miranda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MEGAN MIRANDA zählt in ihrem Heimatland USA zu den erfolgreichsten Thriller-Autorinnen. Auch in Deutschland erobert sie regelmäßig die Top Ten der SPIEGEL Bestsellerliste – zuletzt mit Der Pfad. Megan Mirandas Markenzeichen sind clevere Plottwists, die selbst ihre größten Fans nicht kommen sehen – bis zur letzten Seite. So garantiert auch ihr neuer großer Thriller Sieben Stunden atemlose Spannung mit Gänsehautfaktor. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in North Carolina.
Megan Miranda
SIEBEN STUNDEN
Wen würdest du retten?
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Melike Karamustafa
Die Originalausgabe erschien 2023
unter dem Titel The Only Survivors
bei Simon & Schuster, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 der Originalausgabe by Megan Miranda
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Marie-Sophie Kasten
Covergestaltung: Favoritbüro
Covermotiv: © Elisabeth Ansley/Trevillion Images; © Piotr Zajda/shutterstock, © Wei Seah/shutterstock
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-31528-3V003
www.penguin-verlag.de
Für Luis
Prolog
Ich hatte einiges unternommen, um dieses Wiedersehen zu vermeiden. Ich hatte eine Liste erstellt. Mir einen Plan zurechtgelegt. Meine Entscheidung damit gerechtfertigt, dass sie nicht wirklich zu meinem Freundeskreis zählten und zehn Jahre genug waren.
Die jährlichen Treffen halfen niemandem weiter. Aber da war dieses Versprechen. Wir waren jung gewesen, als wir uns darauf geeinigt hatten, den Jahrestag immer gemeinsam zu verbringen und aufeinander achtzugeben. Es war ein fehlgeleiteter Impuls gewesen, eine Überreaktion, ein panischer Versuch, mit aller Macht die Kontrolle zu behalten, obwohl wir es längst besser hätten wissen müssen.
In der Hoffnung, mich unerreichbar und unsichtbar machen zu können, hatte ich sechs Monate zuvor damit begonnen, mich aus dem Geflecht zu befreien, das uns zusammenhielt. Drei einfache Schritte, um mein Ziel zu erreichen: Beim Wechsel meines Mobilfunkanbieters ließ ich mir eine neue Nummer geben und übertrug die meisten meiner alten Kontakte in mein neues Telefonbuch. Diejenigen, von denen ich hoffte, sie für immer hinter mir lassen zu können, löschte ich. Ein Neuanfang. Als ich Anfang Januar die Gruppen-E-Mail von Amaya erhielt, markierte ich sie als Spam und löschte sie. Ungeöffnet, ungelesen, damit ich mich auf Unwissenheit berufen konnte. Obwohl die fett gedruckten Worte in der Betreffzeile längst in mein Gehirn eingebrannt waren: 7. Mai –ihrmüsstallekommen!
Stattdessen wollte ich das Wochenende bei Russ verbringen – der dritte und letzte Schritt meiner Vermeidungsstrategie. Ich musste nach vorne blicken. Ich war achtundzwanzig, hatte eine feste Anstellung und führte eine halbwegs ernst zu nehmende Beziehung mit einem Mann, der mir am Wochenende Frühstück machte und einigermaßen vernünftige Bettwäsche besaß.
Doch während ich am Sonntagmorgen den letzten Bissen meines Omeletts aß, vibrierte mein Handy auf der Tischplatte. Russ stand mit dem Rücken zu mir an der Anrichte, um sich einen weiteren Kaffee einzuschenken. Das Display leuchtete auf – eine Nummer mit North-Carolina-Vorwahl, die ich nicht in meinen Kontakten gespeichert hatte, darunter eine Nachricht in Großbuchstaben: HAST DU ES SCHON GEHÖRT?
Meine Gabel schwebte über dem Teller.
»Wer war das?«, erkundigte sich Russ, als er sich mir wieder gegenübersetzte und die Hände um den Kaffeebecher legte. Er musste es an meinem Gesichtsausdruck erkannt haben, meiner plötzlichen Blässe, meinen Schultern, die ich unwillkürlich angespannt hatte.
Bestimmt war die Nachricht von Amaya. Sie kümmerte sich jedes Jahr darum, dass alle informiert waren. Wir, unsere Gemeinschaft, waren ihr wichtig. Alles war ihr wichtig.
»Nur Spam«, sagte ich und legte die Gabel auf den Teller, um meine zitternden Hände unter dem Tisch zwischen die Knie zu schieben. Ich widerstand dem Drang, das Handy umzudrehen, um nicht mehr aufs Display schauen zu müssen.
Das mit der Spamnachricht musste nicht mal eine Lüge sein. Schließlich hätte die SMS durchaus von jemandem sein können, der sich beim Eingeben der Telefonnummer vertippt hatte. Doch sie war von Amaya, die meine neue Nummer herausgefunden hatte und sich vergewissern wollte, dass ich den heutigen Beginn unseres jährlichen Treffens nicht vergessen hatte. Als ob sie geahnt hätte, dass ich in diesem Moment Hunderte von Kilometern entfernt am Küchentisch meines Freundes saß und keineswegs die Absicht hatte, mich auf den Weg zu machen. Dennoch würde ich die Nachricht in einem unbemerkten Moment vorsichtshalber löschen und die Nummer blockieren. Als hätte es die SMS niemals gegeben.
Nachdem wir unser Frühstücksgeschirr abgeräumt hatten, wartete ich ab, bis Russ mir den Rücken zukehrte und das Wasser an der Spüle aufdrehte, bevor ich mein Handy vom Tisch nahm und aufstand. Doch in der Zwischenzeit hatte ich eine weitere Nachricht von der unbekannten Nummer erhalten. Mit einem Link zu einem Zeitungsartikel. Nein, falsch, nicht zu einem Artikel, sondern zu einer Todesanzeige.
Ian Tayler.
Ich ließ mich auf den nächsten Stuhl sinken und las die wenigen Zeilen über seinen unerwarteten Tod, während mir die Buchstaben vor den Augen verschwammen. Geliebter Sohn, Bruder, Onkel und Freund. Anstelle von Blumen wurde um Spenden an das Ridgefield Recovery Center gebeten.
Sie hatten ein älteres Foto verwendet, als sein Gesicht noch jugendlich rund gewesen war, mit gebräuntem Teint, braunen Augen und einem Lächeln, von dem ich mir ziemlich sicher war, es seit zehn Jahren nicht mehr gesehen zu haben. Er hatte die blonden Haare gerade lang genug getragen, dass der Wind hindurchfahren konnte. Ein ganz anderes Bild als das, was er vor einem Jahr bei unserem Treffen auf den Outer Banks abgegeben hatte. Das Gesicht war hager gewesen und das Haar kurz geschoren. Er schien von einer steten Unruhe befallen zu sein, die er nicht abschütteln konnte. Bis nächstes Jahr, hatte er bei unserer Verabschiedung gesagt, während er mich unbeholfen in den Arm genommen hatte.
Wir vermieden es, einander zu nahe zu kommen, weil alles, was ich in diesen Momenten sehen konnte, das war, was ich auch jetzt vor mir sah: ein Aufblitzen seiner dunklen, geweiteten Augen, den Mund im Angesicht des Flusses zu einem erstarrten Schrei aufgerissen …
Ich presste meine Faust gegen die Zähne, stieß ein Keuchen aus, von dem ich hoffte, dass es vom Rauschen des Wassers verschluckt wurde.
Dann ein zweiter Schock: Die Todesanzeige war vor drei Monaten erschienen, ohne dass ich irgendetwas mitbekommen hatte.
Kein Kontakt. Unerreichbar.
Hätte ich es nicht irgendwie spüren müssen? Durch dieses unsichtbare Band, das uns alle über Zeit und Raum hinweg untrennbar miteinander zu verbinden schien? Es tut mir leid, Ian …
Ich verließ die Küche, wo Russ noch immer am Spülbecken stand, und legte mir einen neuen Plan zurecht. Einen Zwischenstopp zu Hause einlegen, um passende Kleidung einzupacken, eine E-Mail an die Arbeit schreiben, dass es einen familiären Notfall gegeben hat, und dann losfahren.
Es war ein Fehler gewesen zu glauben, ich könnte mich einfach in Luft auflösen. Dass ich irgendetwas vergessen könnte, die Erinnerungen, den Pakt. Dass ich all das – und sie alle – ein für alle Mal hinter mir lassen könnte.
Bin unterwegs, antwortete ich mit immer noch zitternden Fingern.
Ich hätte gar nicht erst versuchen sollen, dagegen anzukämpfen. Es gab eine Art Anziehungskraft – zu dieser rituellen Woche, zur Vergangenheit, zu ihnen. Den einzigen Überlebenden.
Am Anfang waren wir neun gewesen. Ihre Namen waren wie ein Trommelwirbel in meinem Kopf und unsere Lebenswege dauerhaft miteinander verbunden. Amaya, Clara, Grace. Oliver, Joshua, Ian. Hollis und Brody. Ich. Es kam mir wie ein Wunder vor, dass überhaupt noch welche von uns übrig waren.
In Wahrheit standen sie für den Teil meines Lebens, den ich um jeden Preis vergessen wollte. Doch dieser Exorzismus meiner Vergangenheit gelang mir nicht wirklich. Denn auch mir waren sie wichtig. Weil wir uns alle dieses Versprechen gegeben hatten: Für immer und ewig würden wir uns in dieser Woche wiedersehen. Um unsere Grenzen geschlossen zu halten, unsere Geheimnisse zu bewahren. Ein Moment, der uns Jahr für Jahr aufs Neue zusammenführte.
Allerdings waren wir jetzt nur noch sieben.
Sonntag
Kapitel 1
Das Haus hatten wir, wie es so oft der Fall war, einer Reihe von glücklichen Zufällen zu verdanken.
Dem glücklichen Zufall, dass es in den letzten zehn Jahren zwei Hurrikans standgehalten hatte, obwohl es auf Pfählen am Rande der Dünen erbaut worden war, geschützt nur durch Sturmfensterläden aus Aluminium und Zedernholzschindeln, die im Laufe der Zeit zu einem verwitterten Grau verblasst waren.
Dem glücklichen Zufall, dass die fünf Schlafzimmer mit Balkonen, die durch eine umlaufende Holzkonstruktion und wacklige Treppen über drei Stockwerke miteinander verbunden waren, ausreichend Platz für uns alle boten.
Dem glücklichen Zufall, dass das Haus am Strand Olivers Familie gehörte und Oliver in jenem ersten Jahr nach Claras Beerdigung, als wir panisch und verzweifelt waren und jenen Pakt schlossen, gesagt hatte: Ich kenne einen Ort.
Das Haus lag abseits vom Trubel der Stadt, am Ende einer Sackgasse. Man konnte das Nachbarhaus sehen – vor allem im Dunkeln, wenn die Fenster wie Leuchtfeuer in der Nacht schimmerten –, und doch war es so abgelegen, dass man sich der Welt entrückt fühlte. Es führte zu Seelenfrieden in doppelter Hinsicht.
Es war für uns der perfekte Zufluchtsort. Für uns, die glücklichen Überlebenden des Unfalls, des reißenden Flusses, des unerbittlichen Unwetters.
Oliver hatte gesagt, dass es The Shallows hieß, die Untiefen. Ein Name wie ein Versprechen. Ein sicheres Refugium, vom Rest der Welt isoliert und zu allen Seiten von den unendlichen Tiefen des Meeres umgeben.
Unser erster Aufenthalt war einfach nur der Bequemlichkeit geschuldet, und dann kamen wir jedes Jahr wieder, weil es uns auf diese Weise erspart blieb, weitere Entscheidungen treffen und andere Pläne machen zu müssen. Außerdem lag das Haus Hunderte von Kilometern von der Unfallstelle entfernt, geschützt vor dem Sog der Vergangenheit.
Ich fuhr fünf Stunden bis zur Küste und anschließend über eine Reihe von Brücken zum südlichen Teil der Inselkette. Dabei war ich in einem Zustand anhaltenden Grauens, von dem ich mich mit einer Reihe von Podcasts abzulenken versuchte. Doch da ich mich nicht konzentrieren konnte, ergab ich mich schließlich der Stille.
Die Abzweigung tauchte auf, bevor ich darauf vorbereitet war, eine Ansammlung von Briefkästen vor einem verblassten Straßenschild, das vom Wind verbogen und von der Sonne ausgebleicht war. Das Haus lag am Ende der unbefestigten Straße, der Parkplatz davor war ein Halbkreis aus Steinen und Unkraut und von einer feinen Sandschicht bedeckt, die ich schon auf den letzten fünfzehn Kilometern unter den Rädern gespürt hatte.
Das Land zwischen dem Meer und der Lagune war auf der Fahrt hierher immer schmaler geworden. Die Dünen rückten näher an die Straße heran, der Sand wirbelte in böigen Spiralen über die Fahrbahn, was von Weitem wie ein Dunstschleier aussah, wie Nebel, der in der Atmosphäre schwebte und sich von der Meerseite her ausbreitete. Ohne regelmäßiges Eingreifen, so stellte ich mir vor, würde all dies hinweggefegt, jeglicher Hinweis auf die Menschheit durch den ständigen Angriff der Natur ausgelöscht werden.
Die Geografie hier draußen unterlag steter Veränderung. Im Marschland schwappte Wasser aus den Sümpfen auf die grasbewachsenen Straßenränder. Nach einem Sturm waren aus manchen Inseln Halbinseln geworden oder umgekehrt. Und auch die Dünen waren immer in Bewegung und wuchsen, als würde alles in Sichtweite nur darauf warten, von ihnen verschlungen zu werden. Aber aus irgendeinem Grund hatte dieses Haus standgehalten.
Vor dem Gebäude parkten vier Autos in einer Reihe, das letzte war Amayas rostrote Limousine, deren Heckscheibe eine Sammlung von Aufklebern zierte. Es war bereits später Nachmittag, und ich nahm an, dass ich die Letzte war. Nicht alle wohnten so nah, dass sie mit dem Wagen anreisen konnten.
Ich hielt neben einem vertrauten dunklen Honda. Der Anblick des Kindersitzes auf der Rückbank erschütterte mich, denn mir wurde dabei bewusst, wie viel sich in einem Jahr verändert hatte.
Ich stieg aus. Die Luft schmeckte salzig, wie in meinen Albträumen. Manchmal, wenn ich nachts alleine war, schreckte ich hoch und hatte noch den Geschmack des Flusses im Mund, von Wasser bei Unwetter, von sandiger Erde tief in meiner Kehle. In anderen Nächten hatte ich stattdessen den Geruch von Salzwasser in der Nase, als wäre ich mir nicht sicher, ob es wirklich ein Albtraum war oder doch Realität.
Mit tiefen, kontrollierten Atemzügen ließ ich den Blick am Haus hinaufwandern. Zur erhöhten Veranda, entlang der vielen Giebel und Fenster, in denen sich die Sonne und der Himmel spiegelten. Das Gebäude war in die Jahre gekommen, aber es war schön, wie es sich unaufdringlich aus der Landschaft erhob wie Treibholz am Strand, sorgfältig auf eine Weise platziert, die die Kräfte der Natur willkommen hieß, anstatt gegen sie anzukämpfen.
Eine breite Holztreppe führte zur Eingangstür hinauf, wo wir in unserem ersten Jahr ein Foto aufgenommen hatten, wie wir acht dicht zusammengedrängt dasaßen, Schulter an Schulter, die Knie an den Körper vor uns gedrückt, wie zum Beweis: Wir sind immer noch da.
Ich drückte den Rücken durch und wappnete mich. Hätte ich eine Liste mit Dingen anlegen sollen, die an meinen Nerven zerrten – diese Situation hätte darauf ganz weit oben gestanden. Nicht ganz so weit oben wie das Erlebnis, auf einer kurvigen dunklen Straße zu fahren oder sich zu verirren. Aber verspätet hier anzukommen, bei diesen Leuten: definitiv weit oben.
Sie waren keine schlechten Menschen. Sie taten mir nur nicht gut.
Als ein Schatten am Wohnzimmerfenster vorbeihuschte, stellte ich mir vor, wie sie auf der taupefarbenen Couchgarnitur saßen und auf mich warteten. Und dann, bevor ich das Bild zurückdrängen konnte, sah ich sie rennen, aus der Haustür drängen, während sich hinter dem Haus eine riesige Welle erhob, den Himmel verdunkelte, einen Schatten warf, der sich beständig ausdehnte. Das Chaos, die Panik und mein Gedanke, wen ich als Erstes retten würde …
Es war eine Gewohnheit, die ich nicht ablegen konnte, eine Frage, die mich immer wieder beschäftigte. In einem Raum voller Menschen, einem Bus voller Fremder: Wen würdest du retten? Ein Gedankenexperiment, das in Echtzeit ablief. Ein Horrorintermezzo in der Monotonie meines Alltags.
Ich schnappte mir mein Gepäck und knallte den Kofferraum zu.
Der erste Tag war immer der schwerste.
Die Haustür quietschte, als ich sie aufstieß, die Scharniere waren im Lauf der Zeit wegen der salzigen Luft verrostet. Ein Schritt hinein, und meine Erinnerung wurde wach: weiß getünchte, holzgetäfelte Wände, ein offener Grundriss, sodass ich vom Eingang aus das gesamte Erdgeschoss überblicken konnte, dessen Bereiche nur durch Möbelstücke voneinander abgegrenzt waren. Zuerst kam der Wohnraum, dahinter der lange Esszimmertisch und die Küche und schließlich die hintere Fensterfront mit einer Schiebetür zum Holzdeck. Doch als ich die Haustür laut genug hinter mir schloss, um Aufmerksamkeit zu erregen und sicherzustellen, dass sie meine Anwesenheit bemerkten, sah ich außer Brody niemanden.
»Da ist sie ja – Cassidy Bent«, sagte er, als befände sich außer uns noch jemand in der Nähe. Während er auf mich zukam, öffnete er sein Bier, das er sich aus dem Kühlschrank genommen hatte. Auf seiner Wange erschien beim Lächeln ein Grübchen. Er hatte die gleiche zerzauste Frisur wie immer, einen braunen Haarschopf, den er sich ständig aus dem Gesicht schob. Brody war der Sportler in unserer Gruppe gewesen, die eine Hälfte des Pärchens Brody und Hollis, und er strahlte noch immer das Selbstvertrauen von jemandem aus, der es gewohnt war, dass ihn jeder in der Schule kannte.
»Anwesend«, sagte ich, als wäre ich eine Schülerin, die sich zum Unterricht meldet, und er lachte. Seine Begrüßung hatte geklungen, als hätten sie auf mich gewartet. Anders als Brody wurde ich häufig übersehen, also hatte ich mir angewöhnt, meine Anwesenheit lautstark kundzutun.
Ich stellte mein Gepäck neben der Couch ab und umarmte ihn. Unsere Begrüßung war wie jedes Jahr vertraut und erschütternd zugleich. Er trug sein übliches Outfit – Sport-Shorts, T-Shirt und Schlappen –, doch auf der Rückbank seines Wagens stand ein Kindersitz. Er war Vater. Seine ganze Identität hatte sich verändert.
»Wie war die Fahrt?« Brody schien sich niemals unwohl in seiner Haut zu fühlen, egal, wo oder in wessen Gegenwart er sich befand. Er nahm das Gespräch mit mir auf, als wäre seit unserem letzten Wiedersehen kaum Zeit vergangen.
»Gut. Tut mir leid, dass ich zu spät komme.«
Er nahm einen tiefen Schluck aus der Bierflasche, schüttelte den Kopf, strich sich eine hartnäckige Strähne aus den Augen. »Dabei bist du nicht mal die Letzte.« Er nickte in Richtung Küche. »Wir sitzen draußen.«
»Ich komme gleich zu euch«, erwiderte ich, dankbar für die Möglichkeit, mich kurz zu orientieren.
Gründe, Brody zu retten: Er war frischgebackener Vater. Es gab Menschen, die ihn vermissen würden.
Er musterte mich lächelnd von der Terrassentür aus. Ich hatte Jeans und ein T-Shirt angezogen, das mir beim Durchwühlen meiner Kommode als Erstes in die Hände gefallen war, und aus meinem Pferdeschwanz hatten sich während der Fahrt einzelne dunkelblonde Strähnen gelöst. Ich war verlegen, fühlte mich entblößt.
»Gut siehst du aus, Cass«, bemerkte er, als könne er meine Unsicherheit spüren. Als er sich umdrehte und nach draußen trat, ließ er die Schiebetür einen Spalt offen stehen – als Angebot oder aus Versehen.
In der darauffolgenden Stille hörte ich die Wellen und den Schrei einer Möwe. Hinter dem Haus schlängelte sich ein Bohlenweg durch die Dünen. Inseln von Strandhafer erhoben sich aus dem Sand. Und dann nichts als Wasser, Wind, Unendlichkeit.
Grace behauptete immer, dass der Ozean etwas Heilsames an sich habe, aber sie gehörte zu den Leuten, die an die Fähigkeit des Geistes glauben, sich selbst zu korrigieren, und an die Fähigkeit der Natur, das Gleiche zu tun. Sie arbeitete inzwischen als Traumatherapeutin, was für mich Grund genug war, sie zu retten, auch wenn sie uns andere eher als Baustellen betrachtete. Grace musste es irgendwie geschafft haben, sich selbst davon zu überzeugen, dass nicht das Wasser der Feind war, sondern die fehlenden Lichter auf einer kurvenreichen Bergstraße. Ein Reh, das im grellen Licht der Scheinwerfer erstarrt war. Eine Reihe von Fehlentscheidungen während eines aufziehenden Unwetters.
Aber ich fand nichts Heilsames an diesem Ort.
Vielleicht waren es die Brücken, über die ich hierher gelangt war, die mich vom Rest meines Lebens trennten, die uns alle von den anderen Menschen trennten. Die einzige Straße, die herführte, und die Art, wie das Licht auf dem Pflaster schimmerte wie Wasser. Das Meer zu beiden Seiten und das Gefühl, dass irgendetwas näher rückte. Vielleicht wäre das Gefühl das gleiche gewesen, wenn wir uns an einem anderen Ort befunden hätten. Vielleicht lag es einzig und allein daran, dass wir zusammen hier waren. Vielleicht verwandelte sich alles, was wir gemeinsam berührten, in Asche.
Mein Zimmer – das Zimmer, in dem ich seit unserem ersten Besuch schlief – war eines von dreien im ersten Stock. Die Tür am Ende des Flurs stand offen, hieß mich willkommen. Im Raum befanden sich zwei Queensize-Betten mit farblich abgestimmten blauen Tagesdecken, dunkle Holzmöbel und ein antiker, deplatziert wirkender Spiegel. Amayas Gepäck stand am Fußende des Bettes, das immer ihres gewesen war. Es war das, was näher an der Tür stand.
Beinahe hätte ich sie übersehen. Das Erste, was ich bemerkte, war der leichte Luftzug, der durch die nur einen Spalt breit geöffnete Balkontür hereinwehte. Erst dann entdeckte ich die Silhouette, die sich hinter den durchscheinenden Vorhängen abzeichnete. Eine Gestalt, die die Dünen und das Meer betrachtete.
»Hallo«, sagte ich leise, nachdem ich die Tür weiter aufgeschoben hatte. Dennoch zuckte sie zusammen.
Ihr lockiges braunes Haar, das zu ihrem typischen hohen Pferdeschwanz gebunden war, wirkte kürzer als im Jahr zuvor. Als sie sich zu mir umdrehte, waren unter ihren haselnussbraunen Augen tiefe Ringe zu erkennen, als ob sie die Nacht durchgefahren wäre oder die Fahrt hierher ebenso an ihren Nerven gezerrt hätte wie an meinen.
»Oh.« Sie klang überrascht, als hätte sie nicht damit gerechnet, mich überhaupt hier zu sehen. In der weiten Jogginghose und dem übergroßen Sweatshirt, die Hände in die Ärmel gesteckt, wirkte sie noch kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte.
Das Wetter auf den Outer Banks war Anfang Mai unberechenbar. Es konnte fünfzehn Grad sein mit einer kühlen Meeresbrise, die Temperaturen konnten aber auch auf über fünfundzwanzig Grad klettern, begleitet von stechendem Sonnenschein und hoher Luftfeuchtigkeit.
»Ich wollte dich nicht erschrecken«, sagte ich und stellte mein Gepäck neben dem Bett ab, das näher am Fenster stand. Wir alle waren Gewohnheitstiere. Der Trost der Routine, die uns aus der Schulzeit geblieben war, die zugewiesenen Positionen, die vorherbestimmten Plätze.
Die Zimmer erinnerten mit ihrem identischen Grundriss ein wenig an Schlafsäle. In jedem Raum befanden sich zwei Betten und auch ansonsten sehr ähnliche Möbel. Nur die Farben variierten, weswegen wir sie nach ihnen benannt hatten: Grace und Hollis im gelben Zimmer, Brody und Joshua im dunkelblauen. Das große Schlafzimmer im Erdgeschoss bewohnte Oliver.
Amaya lehnte sich gegen das hölzerne Geländer des Balkons und spielte mit den silbernen Ringen, die sie an den Fingern zu tragen pflegte. Die Nägel hatte sie in einem stürmischen Blau lackiert, das bereits abblätterte.
»Du hast es geschafft«, sagte sie, als wollte sie mich spüren lassen, dass sie gewartet hatte. Wir umarmten uns nicht. Das taten wir nie. Erst ganz zum Schluss, wenn es eine Erleichterung bedeutete. Eine Befreiung. »Ich hab mir schon Sorgen gemacht.«
Sie schien schon immer eine Art sechsten Sinn besessen zu haben, als hätte sie gewusst, dass ich am Morgen in Russ’ Küche gesessen hatte, mit dem festen Vorsatz, mich nicht von der Stelle zu rühren. Als hätte sie gewusst, was sie mir schreiben musste, damit ich herkam.
Ich fragte mich, worüber sie nachgedacht hatte, während ich mich bei Russ entschuldigt (Tut mir wahnsinnig leid, eine Nachricht von meinem Chef. Eine spontane Dienstreise.) und sein Angebot abgelehnt hatte, mich zum Flughafen zu bringen. Lügen, die mir viel zu leicht über die Lippen gekommen waren.
»Ich wusste es nicht«, sagte ich und fügte hinzu, als sie mich fragend anstarrte: »Das von Ian.«
Der Verlust war zu frisch und unmöglich zu verarbeiten. Ich verspürte das Bedürfnis, nach ihm zu suchen, verzweifelt, wie immer, seinen Verbleib zu klären, in seinem Zimmer nachzusehen, auf seine Schritte zu lauschen oder auf sein Lachen von irgendwo da draußen.
Sie verzog das Gesicht und sah zur Seite. »Ich musste mir die Details von Josh anhören.«
Amaya war, wie ich, wie die meisten Überlebenden, in den Jahren nach dem Unfall weggezogen. Allerdings war die Wahl ihres Wohnorts eher beunruhigend. Joshua war der Einzige, der noch in der Stadt lebte und arbeitete, in der wir alle aufgewachsen waren, und vermutlich durch die örtliche Gerüchteküche von Ians Tod erfahren hatte.
»Ich dachte, es ginge ihm besser«, sagte ich, und meine Augen begannen zu brennen, weil die Fakten durch unsere Unterhaltung plötzlich zur Realität wurden. Doch die Wahrheit war, dass ich keine Ahnung hatte, wie es Ian gegangen war.
Amaya sah mich an. »Sind alle anderen da?«, fragte sie, wohl um das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken.
»Brody meinte, dass sie hinten auf der Terrasse sitzen«, sagte ich, und sie nickte. »Na los«, fügte ich hinzu. »Lass mich nicht alleine rausgehen.«
»Komme gleich nach. Ich brauche nur einen Moment.« Damit wandte sie sich von mir ab.
Sie sah so klein aus, wie sie da stand, eingerahmt von den Dünen, dem Meer, das sich bis zum Horizont erstreckte, dem Wind, der ihr die Haare zerzauste.
Ein Schauer durchlief mich. Ich konnte nicht anders, als mir Clara, die auch etwas gebraucht hatte, an einem anderen Abgrund vorzustellen.
Aber dann warf Amaya mir ein schwaches Lächeln über die Schulter zu. »Schön, dich zu sehen, Cassidy.«
»Gleichfalls.«
Vor langer Zeit hatte sie uns alle in Sicherheit gebracht. Ich versuchte den Schatten der Person von damals in derjenigen zu finden, die in diesem Augenblick vor mir stand.
Gründe, Amaya zu retten: Ich war mir nicht sicher, ob sie es alleine schaffen würde.
Wenn man aus der Hintertür von The Shallows trat, versperrten die Dünen größtenteils den Blick auf den Strand, man konnte nur einen schmalen Streifen Sand vor dem Horizont erkennen. Man konnte sich gut vorstellen, dass man hier draußen ganz allein war, nichts außer Sand, Meer und Himmel um sich herum.
Die Stufen an der Seite führten hinunter zu einer versteckt liegenden Terrasse mit einem Whirlpool und einer Feuerstelle in der Mitte, die von hölzernen Gartenstühlen umgeben war.
Ich sah sie von oben, wie sie in einem Halbkreis dasaßen. Ihre Stimmen drangen zu mir herauf, doch ich konnte nicht verstehen, worüber sie sich unterhielten. Als ich die Stufen hinunterstieg, schien mich nur Joshua zu bemerken. Ich spürte, wie mir sein Blick von der anderen Seite der Feuerstelle folgte.
»Cassidy Bent«, sagte er, so wie er es immer tat. Kein Schön, dich zu sehen oder Wie war die Fahrt oder Setz dich zu uns. Nur mein Name, einfach so, ein Echo durch die Zeit.
Er schien sich tatsächlich nie zu freuen, mich zu sehen, und das aus Gründen, die mir nicht ganz klar waren. Weder konnte ich sie aus einer Interaktion vor dem Unfall ableiten (damals hatte es keine zwischen uns gegeben) noch aus einer danach (auch in den folgenden Jahren hatten wir kaum etwas miteinander zu tun gehabt). Irgendwann hatte ich aufgehört, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Joshua bestand aus scharfen Kanten, scharfen Blicken, scharfen Kommentaren. Eine blasse Narbe auf dem Wangenknochen. Kakifarbene Shorts und ein gestreiftes Polohemd, die Haare nach hinten gegelt. Unter seinem Stuhl standen drei zerdrückte Bierdosen. Er grinste, als er meinen Blick bemerkte.
Gründe, Joshua zu retten: Mir fiel keiner ein.
Brody gab mir im selben Moment ein Zeichen, mich zu ihnen zu setzen, als sich die Frau neben ihm auf ihrem Stuhl herumdrehte, wobei ihr das lange dunkle Haar über die Schulter fiel.
»Hey, Cassidy«, begrüßte sie mich mit einem strahlenden Lächeln – der totale Gegensatz zu Joshuas Empfang. Sie besaß das seltene Talent, anderen ein gutes Gefühl zu vermitteln, auch mir. Über ihrem Maxikleid trug sie eine Jeansjacke, ihre Züge waren weich, und ihre bedächtige Art, sich zu bewegen, passte zu ihrem Namen. Alles an Grace schien dafür geschaffen, einen anzuziehen. »Hast du Amaya gesehen?«, fragte sie und strich sich die Haare zurück.
»Sie kommt gleich«, erwiderte ich und ließ mich auf den freien Stuhl neben ihr sinken.
Als ich erneut Joshuas Blick auf mir spürte, wurde mir jede meiner Bewegungen überdeutlich bewusst: wie ich die Beine übereinanderschlug, wo ich meine Arme ablegte. Meine Jeans war nicht strandtauglich und mein Haar hatte diese seltsame Zwischenlänge. Rasch zog ich das Haargummi heraus und fuhr mit den Händen durch die schulterlangen Strähnen.
In der darauffolgenden Stille glaubte ich, einen Blickwechsel zwischen den dreien zu bemerken, der andeutete, dass ich sie bei etwas unterbrochen hatte. Doch was auch immer sie besprochen hatten, sie griffen das Thema nicht wieder auf.
Brody legte den Kopf in den Nacken, formte mit den Händen einen Trichter vor dem Mund und rief: »Amaya, komm runter!«
Grace warf ihm einen verkniffenen Blick zu. »Lass sie in Ruhe.« In ihrer Stimme schwang ein Hauch von Weisheit oder Autorität mit, so wie ich es mir bei Therapeuten im Allgemeinen vorstellte. Als würde sie über Einblicke verfügen, die uns anderen fehlten. Dann lehnte sie sich zu mir herüber und legte ihre Hände mit den frisch manikürten Fingernägeln auf meinen Arm. »Deine Kette ist toll.« Grace arbeitete mit Komplimenten und Optimismus, eine Vorgehensweise, mit der sie einen sofort entwaffnete und die sie vermutlich bei der Arbeit mit ihren Patienten nutzte.
Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus, als sie eine Hand in meinen Nacken wandern ließ, um die Kette mit den ineinandergreifenden Ringen zwischen ihren Fingern hindurchgleiten zu lassen, wobei sie einen leisen Klang erzeugten.
»Danke«, sagte ich und wartete darauf, dass sie die Kette losließ. Grace glaubte an viele Dinge, doch so etwas wie Intimsphäre schien nicht dazuzugehören.
Russ hatte mir die Kette vor einem Monat zu meinem Geburtstag geschenkt und gesagt, dass er bei ihrem Anblick sofort an mich denken musste. In der Mitte, zwischen den ineinandergreifenden Ringen, befand sich ein C, das man jedoch erst auf den zweiten oder dritten Blick entdeckte, und dann fühlte es sich an, als hätte man ein Geheimnis gelüftet. In diesem Moment verband mich die Kette mit meinem realen Leben. Als ich den Anhänger an dem dünnen Silberband hin und her schob, fühlte ich mich auf einmal in mein Apartment zurückversetzt, zu dem Augenblick, als mir Russ das kleine Schmuckkästchen überreichte. Sein Gesichtsausdruck hatte etwas Unsicheres, Zurückhaltendes gehabt, bis ich ihn anstrahlte und er mein Lächeln erwiderte. Sie ist wunderschön, hatte ich gesagt, als er mir die Kette umlegte, und es aufrichtig gemeint. Sie war eine Erinnerung an den Menschen, zu dem ich abseits von dieser Gruppe geworden war und der ich in sechs Tagen wieder werden würde.
Sekunden später waren Schritte auf dem Holzbalkon über uns zu hören, lauter und nachdrücklicher als die von Amaya, bevor eine Stimme über das Geländer zu uns herunterschallte: »Ihr habt euch also schon häuslich eingerichtet.«
»Aaah, endlich ist der King da«, bemerkte Joshua mit einem schiefen Grinsen.
Oliver King kam die Treppe herunter. Er erweckte stets den Eindruck, als wäre er jederzeit bereit, das Kommando zu übernehmen. In der Stoffhose, den modischen Sneakers und dem Sakko, das an seinem schlanken Körper wie maßgeschneidert wirkte, sah er aus, als käme er gerade von einem Business-Meeting oder einem Geschäftsessen. Er war Amerikaner mit koreanischem Migrationshintergrund und hatte während der gesamten Highschoolzeit in derselben Straße wie ich gewohnt – was uns das Gefühl vermittelte, uns näher zu stehen, als es tatsächlich der Fall war.
»Schön, dass es diesmal jemand geschafft hat, den Weg ins Haus zu finden«, scherzte er. In den vergangenen Jahren hatten wir uns meist am Strand herumgetrieben, bis Oliver mit dem Schlüsselcode gekommen war, der sich offenbar jedes Jahr änderte. Vielleicht hatte sich auch niemand die Mühe gemacht, ihn sich zu notieren.
Gründe, Oliver zu retten: zunächst einmal dieses Haus.
»Es war nicht abgeschlossen«, sagte Brody mit einem Schulterzucken.
Josh reichte Oliver über die Feuerstelle hinweg eine Dose Bier, die in seinen Händen irgendwie fehl am Platz wirkte. Dennoch öffnete er sie und nahm stirnrunzelnd einen Schluck, bevor er sich mit dem Handrücken über den Mund wischte. Eine Geste, von der ich mir nicht vorstellen konnte, dass er sie vor anderen Leuten als uns ausführte.
Nach meinem letzten Kenntnisstand lebte Oliver in New York, wo er irgendeinen prestigeträchtigen Hedgefonds managte. Vielleicht war er es inzwischen gewohnt, dass andere auf ihn warteten. Immerhin nahm er sich jedes Mal Zeit für diese Woche, wie wir alle. Und das war der Grund, aus dem ich trotz unserer Unterschiede und der Tatsache, dass unsere Leben zehn Jahre später eigentlich nicht mehr miteinander verbunden waren, daran glaubte, dass wir mehr füreinander empfanden, als wir jemals zugegeben hätten.
Wir hatten kein Jahr ausgelassen, auch nicht das Jahr 2020, als die meisten Restaurants geschlossen gewesen waren und uns geraten wurde, zu Hause zu bleiben. Nicht einmal letztes Jahr hatten wir darauf verzichtet, als Brodys Freundin im neunten Monat schwanger war und ihn angefleht hatte, nicht wegzufahren. Am letzten Tag unserer Woche in The Shallows hatten bei ihr die Wehen eingesetzt, und als er abreiste – ein seltener Moment des Hochgefühls, in dem er jeden von uns auf die Wange küsste –, spürte ich, wie sich etwas veränderte, und ich glaubte, dass dies vielleicht das Ende war. Dass uns Neuanfänge und die Verheißungen der Zukunft befreien würden. Aber jetzt war Brody wieder da, mit dem Autositz im Schlepptau, als hätte sich überhaupt nichts geändert. Die einzige Person, die noch fehlte, war …
»Da ist jemand am Strand«, rief Amaya vom oberen Ende der Treppe. Sie hatte die Hände auf das hölzerne Geländer gestützt.
»Es ist ein Strand«, bemerkte Josh, ohne auch nur in ihre Richtung zu sehen. »Da laufen eben ab und zu Menschen rum.«
»Das ist bestimmt Hollis«, sagte Grace und ignorierte damit Joshs Bemerkung. Dann signalisierte sie Amaya mit einer Geste, sie solle runterkommen. »Sie war nur ungefähr drei Sekunden im Haus, um auszupacken und sich Sportklamotten anzuziehen.«
»Dann sind wir komplett?« Oliver ließ den Blick langsam von einem zum anderen wandern.
Unwillkürlich fragte ich mich, ob er wie ich eine gedankliche Aufstellung machte, wen er retten würde, und an welcher Stelle ich auf dieser Liste zu finden war.
Amaya ließ sich auf den letzten freien Stuhl fallen und sah sich in der Runde um. Jeder von uns machte eine Bestandsaufnahme vom Rest der Gruppe.
»Alle da, mal abgesehen von der Strandläuferin Hollis«, stellte Brody fest, der die Füße auf den Rand der Feuerstelle gestemmt hatte.
Ich zuckte zusammen. Niemand hatte Ian erwähnt, was sich anfühlte wie ein Schlag in die Magengrube. Wie schnell wir alle vergessen werden konnten: den einen Moment noch da, im nächsten verschwunden – brutal und effizient. Andererseits, passte das nicht gut zu uns? Ich konnte mich nicht erinnern, wann jemand das letzte Mal Clara erwähnt hatte. Nicht einmal Grace, dabei waren sie beste Freundinnen gewesen. Wir erwähnten die Toten nicht, als wäre das eine weitere Ebene unseres Paktes, der ich mir bisher nicht bewusst gewesen war. Ein weiteres Werkzeug, das uns beim Überleben half.
Das Schweigen zwischen uns hielt an. Grace warf einen Blick auf ihr Handy, Josh wippte mit dem Knie.
Schließlich räusperte sich Oliver. »Hat zufällig jemand was zu essen mitgebracht?«
Josh stieß ein hartes Lachen aus. »Entschuldigt, Mr King, dass wir nicht alles für Eure Ankunft vorbereitet haben.« Er verdrehte die Augen. »Übrigens hab ich das Zimmer unterm Dach genommen.«
Grace und Amaya rissen gleichzeitig den Kopf zu ihm herum.
»Nicht dein Ernst«, fuhr Amaya ihn schärfer an, als ich es aus den letzten Jahren von ihr gewohnt war.
Während sich Josh und Amaya wortlos anstarrten, rief ich mir in Erinnerung, dass sie noch auf eine andere Weise als durch unsere jährlichen Treffen miteinander verbunden waren – durch Amayas Familie und Joshs Position in ihrer Anwaltskanzlei.
»Um ehrlich zu sein«, mischte sich Grace in dem Versuch ein, die beiden von einem eventuellen Streit abzuhalten, »dachte ich, dass wir das Zimmer oben vielleicht zum Arbeiten nutzen könnten. Ich habe diese Woche noch ein paar Termine mit Patienten, die ich gerne online …«
»Das Zimmer oben?«, fiel ich ihr ins Wort. Zum ersten Mal sahen alle mich an. »Du meinst Ians Zimmer. Sagen wir doch, wie es ist.«
Sein Name ging wie ein Vibrieren durch die Gruppe. Stille breitete sich aus, bevor Josh mit einem einseitigen Schulterzucken zustimmte.
»Meinetwegen. Also, ich schlafe diesmal in Ians Zimmer, da er es ja offensichtlich nicht mehr braucht.«
»Soll das ein Witz sein?«, rief Amaya. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie sich auf die Tatsache bezog, dass er sich einfach das Zimmer genommen hatte, oder darauf, wie kalt er darüber sprach. »Du kannst dir nicht einfach nehmen, was du willst.«
»Was sollen wir stattdessen machen, Amaya?«, konterte Josh. »Losen?«
Brody stieß ein frustriertes Knurren aus.
Der erste Tag lief immer so ab. Als ob keiner von uns wirklich hier sein wollte, gerieten wir mit unseren scharfen Ecken und Kanten und unseren passiv-aggressiven Kommentaren aneinander. Die Schuld der Überlebenden, würde Grace sagen. Für jedes Gesicht hier fehlte ein anderes. Eine Realität, mit der wir uns jedes Mal aufs Neue arrangieren mussten. Bis wir uns schließlich daran und aneinander gewöhnt hatten und Grace uns überzeugte: Seht ihr, wir müssen das hier tun. Wir brauchen uns gegenseitig.
»Hört auf.« Grace hob beide Hände, um uns zu beruhigen. »Lasst uns darüber reden. Und Josh, bitte.«
»Was ist?« Josh wandte sich ihr zu. »Wir sind eine aussterbende Spezies. Wenn wir keine Witze darüber machen können, wer dann?«
»Komm schon, Josh«, meldete sich endlich auch Oliver zu Wort.
»Ach ja, schon klar.« Josh hob einen Mundwinkel zu einem abfälligen Grinsen. »Das hatte ich ganz vergessen: dein Haus, deine Regeln.«
Wie schnell sich das Blatt wenden konnte. Wie schnell wir das Blatt wenden konnten.
Grace hatte die Augen geschlossen, als würde sie meditieren oder ein stummes Mantra rezitieren. »Möchtest du gar nichts sagen, Brody?« Als würde selbst ihre Fassade Risse bekommen und sie sich verzweifelt vergewissern wollen, dass alle auf ihrer Seite standen.
Als Oliver meinen Blick auffing, fragte ich mich erneut, ob er seine Optionen abwägte, so wie ich es tat.
Schnell, wen rettest du? Amaya. Grace. Brody. Oliver.
Ich stand auf. Wandte mich ab. Drückte das Tor auf, betrat den Bohlenweg, der sich zwischen den Dünen hindurchschlängelte.
Natürlich war es eine Fangfrage. Die Antwort darauf lautete stets: dich selbst.
Kapitel 2
Ich wusste nicht mehr, wie ich in ihrer Gegenwart richtig atmen sollte.
Normalerweise war mir bewusst, wie ich mich verhalten musste, wenn ich mit einem von ihnen allein war – vorsichtig, mit Präzision. Aber in der Gruppe verlor ich die Orientierung. Es gab zu viel Vorgeschichte, zu viel, was ich nicht verstand – was sie alle betraf oder besser gesagt, die Menschen, die sie einmal gewesen waren. Wir waren Schulkameraden und Nachbarn gewesen, Paare und Freunde, Fremde. Aber die Grenzen hatten sich verschoben. Beziehungen waren zerbrochen. Neue Allianzen waren geschmiedet worden. Und es gab zu viele Erinnerungen, die mit The Shallows verbunden waren. Acht Jahre voller Geheimnisse, die in diesen Räumen verborgen lagen.
Hollis hatte es richtig gemacht, indem sie das Haus gleich wieder verlassen, sich einen Freiraum verschafft hatte. Das Haus hatte sich früher größer angefühlt.
Den Strand hatte man in der Regel für sich. Da er nicht in der Nähe der Touristenhochburgen lag, wurde er nur von denjenigen aufgesucht, die an diesem Straßenabschnitt ein Haus besaßen oder gemietet hatten. Ein gutes Dutzend Grundstücke, mit einem Landungssteg am Ende, der sich ins Meer erstreckte. Ich horchte auf meine Schritte über den Bohlenweg, der mich durch die Dünen und zu den Stufen führte, über die man an den Strand gelangte.
Ich sah Hollis ein Stück entfernt in schwarzer Leggings und einem passenden Tanktop. Unnatürlich still stand sie da, in den auslaufenden Wellen der steigenden Flut. Ich war es gewohnt, sie stets in Bewegung zu sehen. Ganz anders als in dieser gespenstischen Pose, in der sie auf den Ozean starrte, als würde sie jeden Moment hineinwaten. Sie war schon immer aufgefallen, aber so wie sie jetzt dastand, vollkommen reglos und vom Meer eingerahmt, verlieh ihr das weißblonde Haar im Schein des Sonnenlichts die Aura von etwas Jenseitigem, leicht Unwirklichem.
Fast hätte ich nach ihr gerufen. Doch dann fiel mir auf, dass sie auf einem Fuß balancierte, als würde sie gerade eine Yogaübung ausführen. Am Oberarm war ihr Handy befestigt und wahrscheinlich hatte sie Ohrstöpsel eingesteckt. Es überraschte mich nicht, dass sie uns ausblendete. Hollis hatte die Tendenz, sich in sich selbst zurückzuziehen, während sie sich darauf konzentrierte, eine bestimmte Anzahl an Kilometern zu laufen oder ein anderes Ziel zu erreichen. Sie arbeitete als Personal Trainerin, was für sie nicht nur ein Beruf, sondern auch ein Lebensstil war.
Gründe, Hollis zu retten: Wenn es so weit kam, konnte sie dabei helfen, alle anderen zu retten. Zumindest glaubte ich das.
Am Fuß der Treppe krempelte ich meine Jeans hoch und schlüpfte aus den Schuhen, bevor ich mich nach rechts wandte und begann, den Strand entlangzulaufen. Weg von ihr. Der Wind peitschte über das Wasser, ein scharfer Kontrast zum heißen Sand unter meinen nackten Füßen.
Als wir das erste Mal hergekommen waren, in jenem ersten Jahr, hatte Grace übers Meer geblickt und auf ihre optimistische Art gesagt: Es ist unmöglich, sich hier gefangen zu fühlen.
Ich wünschte mir, ich könnte es mit ihren Augen sehen und fest in der Gegenwart verankert nur diese idyllische Schönheit spüren. Aber für mich konnte sich jeder Ort wie eine Falle anfühlen. Die Brücken, die sich wie schmale Korridore aneinanderreihten und sich hinter mir schlossen. Die Menschen, mit denen wir hier gestrandet waren. Als ob das Tosen der Wellen die Gedanken an die Schreie übertönen würde. Als ob Ebbe und Flut uns nicht an den Regen, das steigende Wasser und die tief empfundene Angst erinnern würden. Als ob wir uns nicht weiter zurückentsinnen könnten, an die schwindelerregende, kurvenreiche Straße, das Ausscheren vor dem Fall, das Flirren in der Luft vor dem Unfall, der das Vorher und Nachher voneinander trennte.
Die Nacht war auch hier unfassbar dunkel.
Ein Fehler. So hatte es die Schule genannt. Es sei ein Fehler gewesen, dass die Kleinbusse den Highway verlassen hatten. Ein Fehler, dass sie uns verboten hatten, unsere Handys mitzunehmen. Ein Fehler, dass die Fahrer nicht im Sekretariat angerufen hatten, um die Schule über die Verkehrssituation und die Routenänderung zu informieren.
Ein weiterer Fehler war, dass wir den ersten Jahrestag nicht zusammen verbracht hatten. Im Gegensatz zu mir hatte Clara an der Gedenkfeier in der Schule teilgenommen: eine Schweigeminute auf dem Schulhof, gefolgt von zwölf eindringlichen Glockenschlägen in der Kapelle. Es war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde.
Später in jener Nacht hatte uns Clara eine Nachricht geschickt: Ich fahre dorthin zurück. Und dann hatte sie es getan. Sie war dieselbe Strecke in die Berge von Tennessee gefahren, hatte denselben Abstecher zur Stone River Gorge genommen und ihr Auto am Straßenrand stehen lassen, mit einer halb leeren Wodkaflasche auf dem Beifahrersitz. Vermutlich hatte sie sich dort an den Rand des Abgrunds gestellt, angezogen vom Tosen, vom Sog des Flusses, und war gesprungen. Wir alle hatten ihre Nachricht erst am nächsten Morgen gelesen, als es bereits zu spät gewesen war.
Zu jenem Zeitpunkt hatte ich von Beerdigungen die Nase voll gehabt. Der Gedanke an nur eine weitere war mir unerträglich. Nach allem, was wir durchgemacht hatten, konnte ich mich nicht mit der Realität abfinden, noch jemanden aus meinem Jahrgang zu verlieren. Aber Amaya bat uns alle darum, abends nach der Beerdigung zum Schulparkplatz zu kommen, und keiner von uns sagte ab. Als müssten wir uns gegenseitig beweisen, dass wir noch da waren.
Als wir acht uns an jenem Abend im schwachen Schein einer Straßenlaterne aufeinander zubewegten, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass der eigentliche Fehler nicht in den Ereignissen begründet lag, die zu dem Unfall geführt hatten, sondern darin, dass wir ihn überlebt hatten. Seit Claras Tod drängte sich mir die Vorstellung auf, dass wir dem Fluss niemals hätten entkommen sollen, dass er nach wie vor hinter uns her war.
Es war Amayas Idee: Wir sollten nicht mehr allein sein.
Dem Pakt zuzustimmen, war einfach. Und lange Zeit war ich der Überzeugung gewesen, dass es der einzige Weg war, uns zu retten. Dass wir wachsam sein müssten, in höchster Alarmbereitschaft, damit der Fluss uns nach all den Jahren nicht doch noch holte. Aber seit einiger Zeit glaubte ich, dass uns das, wovon wir dachten, es würde uns vor der Vergangenheit bewahren, stattdessen an sie band. Vielleicht war es Ian ja gut gegangen, bis er die E-Mail von Amaya bekommen hatte, die ihn an alles erinnerte. Es musste einen Ausweg geben, für uns alle.
Als kaltes Wasser meine Knöchel umspülte, zuckte ich zurück und ging einige Schritte auf den trockenen Sand zu. Im nächsten Augenblick hatte die Flut meine Fußabdrücke weggespült.
Am Strand waren nur wenige Menschen unterwegs: ein kleines Mädchen, das mit einer Frau, wohl der Mutter, eine Sandburg baute, und ein Mann, der mit einer Angelrute über der Schulter aus der entgegengesetzten Richtung auf mich zulief.
Ich hörte die nächste Welle kommen und wich erneut der Brandung aus. Nur wenige Meter vor mir lag ein Gewirr aus Seetang in den Schaumkronen, an dessen Rand etwas Schwarzes aus dem Sand schaute. Vielleicht ein Portemonnaie oder …
Eine weitere Welle überspülte den Seetang und nahm einen Teil des Sandes mit. Als das Wasser zurückging, war der Gegenstand deutlicher zu erkennen. Ich beeilte mich, in die kalte auslaufende Brandung zu waten und ihn aufzuheben.
Es war ein Handy. Über das Display zog sich ein Riss, nasser Sand klebte an den Rändern, über den Bildschirm liefen Salzwassertropfen. Ein kleines Wunder, dass es vom Sog der Flut nicht sofort zurück ins Meer gezogen worden war.
Auf der Suche nach seinem möglichen Besitzer drehte ich mich langsam im Kreis. »Entschuldigen Sie«, rief ich der Frau mit dem Kind zu.
Sie richtete sich auf, eine Hand an der Krempe ihres Strohhuts, in der anderen hielt sie eine kleine Plastikschaufel. Das Mädchen, das einen langärmeligen lila Badeanzug trug, grub so konzentriert, dass es nicht einmal aufsah.
»Haben Sie Ihr Handy verloren?«, fragte ich.
Die Frau runzelte die Stirn, griff dann in ihre gestreifte Strandtasche und zog ein Smartphone in einem Schmucketui heraus. »Nein.« Die glitzernde Hülle des Telefons reflektierte die Sonne.
Die einzige andere Person in Sichtweite war der Mann, der vom Landungssteg aus in meine Richtung lief, vielleicht suchte er ja sein Handy. Während ich ihm zielstrebig entgegenmarschierte, registrierte ich, dass das untere Ende seiner Shorts nass war. Ich stellte mir vor, wie er zu tief ins Wasser gewatet war und dabei sein Telefon verloren hatte. Sobald ich ihm nahe genug gekommen war, dass er mich hören konnte, rief ich: »Suchen Sie Ihr Handy?« Ich hielt es hoch.
»Was?«, rief er. Oder zumindest kam das bei mir an. Klänge verhielten sich hier draußen seltsam. Einige Stimmen trugen, andere wurden vom Wind mitgerissen und gingen verloren.
»Gehört das Ihnen?«, versuchte ich es erneut.
Er verlangsamte seine Schritte und verlagerte das Gewicht der Angelrute von einer Seite seines Körpers auf die andere. Er war jünger, als ich von Weitem vermutet hatte, trug weite Klamotten und hatte vom Wind zerzaustes Haar, das ihm in alle Richtungen vom Kopf abstand. Vermutlich war er in den Dreißigern, wenn überhaupt. Seine hellen Augen hoben sich funkelnd von seinem tief gebräunten Teint ab.
»Nein«, sagte er. »Ich würde nie mein Handy an den Strand mitnehmen.«
Auf der Suche nach einer anderen Möglichkeit, das Smartphone loszuwerden, sah ich mich um. »Gibt es in der Nähe ein Fundbüro?«, fragte ich in der Hoffnung, die Verantwortung an ihn abtreten zu können. Er schien hier zu leben.
Lachend fuhr er sich mit der freien Hand durchs Haar, um es zu glätten, was allerdings so gut wie keinen Effekt hatte. »Definitiv nicht.«
»Ich kenne hier niemanden«, fügte ich hinzu. »Ich bin nur zu Besuch.«
Aus seinem irritierten Gesichtsausdruck schloss ich, dass man mir diese Tatsache wohl ansah. »Hören Sie«, sagte er dann mit einem Seufzen, »wahrscheinlich hat es nicht mal jemand an diesem Strand verloren.« Er deutete auf den Atlantik hinaus. »Hier wird eine Menge Schrott angespült, einmal lagen sogar Teile eines Schiffswracks von den Bahamas am Strand.«
Es kam mir unwahrscheinlich vor, dass die Brandung ein Handy von der anderen Seite des Meeres bis hierher tragen würde, aber er wich bereits zurück, die eine Hand in einer entschuldigenden Geste erhoben. »Machen Sie’s gut.« Dann wandte er sich der nächsten Holztreppe zu, aber anstatt auf dem Bohlenweg zurück zum Haus zu gehen, bog er in eine Lücke zwischen den Dünen, als würde er eine Abkürzung kennen.
Ich ließ den Blick über die Strandgrundstücke gleiten. Vermutlich gehörte das Handy jemandem, der in einem dieser Häuser wohnte. Dann machte ich mich auf den Rückweg. Wenn ich so darüber nachdachte, würde mir die Suche nach dem Besitzer des Smartphones einen guten Grund liefern, eine Ausrede, um erneut dem Haus zu entkommen. Wenn es nicht zu lange im Wasser gelegen hatte, konnte ich es vielleicht zum Laufen bringen und den Eigentümer auf diese Weise ausfindig machen.
Als ich mich den Stufen näherte, die in die Dünen hinaufführten, war Hollis nicht mehr in Sicht. Ich folgte dem Bohlenweg zum Haus, vorbei an dem Schild mit der Aufschrift The Shallows.
Ich spürte, wie ich automatisch langsamer wurde, kaum dass ich die Terrasse betreten hatte, und versuchte, das Gefühl einzuordnen, das mich befiel. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich lauschte: Wellen, Möwen.
Es lag an der Stille. Wir wohnten zu siebt in diesem Haus und in diesem Moment war kein Lebenszeichen zu hören.
Ich stieg die Stufen zum hinteren Holzdeck hinauf und trat durch die Schiebetür in den Wohnbereich. Im Vergleich zur hellen Maisonne war es drinnen dunkel. Nachdem sich meine Augen an das schummrige Licht gewöhnt hatten, konnte ich einige offenbar leere Flaschen und Getränkedosen auf der Arbeitsplatte in der Küche ausmachen. Im Erdgeschoss schien sich niemand aufzuhalten, aber ich konnte das Knarzen von Schritten auf den Holzdielen über mir hören.
»Hallo?«, rief ich.
Niemand antwortete.
Ich stellte mich ans Fenster neben der Eingangstür und sah nach draußen. Hinter meinem Auto parkte inzwischen ein weiterer Wagen – ein schwarzer Jeep, Olivers Mietwagen, schätzte ich –, doch am anderen Ende der Auffahrt klaffte dort, wo Amayas rostfarbenes Auto gestanden hatte, eine Lücke. Im nächsten Moment hörte ich das Getrappel von Füßen auf der Treppe. Ich wich einen Schritt zurück, als Hollis in mein Blickfeld trat und ihr blondes Haar schwungvoll über die eine Schulter warf.
»Endlich«, sagte sie. »Ich dachte schon, ich wäre von allen verlassen worden.«
Keine von uns beiden erwähnte, dass wir uns seit einem Jahr nicht gesehen hatten. Um ehrlich zu sein, glaubte ich, dass sie mir in gewisser Hinsicht von allen am ähnlichsten war: wider besseres Wissen, aber trotzdem hier. Die Haare rahmten ihr Gesicht ein wie ein Vorhang, der Pony reichte bis zu den Augen und war so exakt geschnitten, dass ich mir unwillkürlich vorstellte, wie sie ihn jeden Morgen trimmte, der Inbegriff von Effizienz. Der einzige Schmuck, den ich sie jemals hatte tragen sehen, war ein Diamantstecker in der Nase. Ihr Blick zuckte hin und her.
In diesem Moment bemerkte ich etwas auf dem Couchtisch. Eine gefaltete Speisekarte zum Mitnehmen, auf der ein dunkler Schriftzug prangte: High Tide.
Ich nahm sie in die Hand und hielt sie Hollis hin. »Rätsel gelöst.«
Das High Tide war ein Restaurant auf der Lagunenseite der Insel, das nächstgelegene Lokal, wo wir im Laufe der Jahre immer wieder mal essen gegangen waren. Es war bequem zu Fuß zu erreichen.
»Oh, Gott sei Dank, ich bin am Verhungern«, sagte Hollis. Sie hatte ihre Yogakleidung gegen ein buntes Top, Shorts und Sandalen getauscht, die ihre langen, vom jahrelangen Marathontraining gestählten Beine zur Geltung brachten. Hollis sah immer aus, als wäre sie gerade ihrem Instagram-Account mit Wellness-Schwerpunkt entstiegen. »Kommst du?«
»Gib mir eine Minute, ich will mich nur schnell umziehen, dann können wir los.«
Ich nahm das gefundene Handy mit nach oben in das aquamarinfarbene Schlafzimmer und trat auf den Balkon. Der Wind wehte ins Zimmer und versetzte die durchscheinenden Vorhänge in Bewegung. Draußen wurden die Schatten allmählich länger, also legte ich das Telefon an die Stelle des Holzgeländers, wo es am längsten der Sonne ausgesetzt sein würde. Einzelne Sandkörner zeichneten den Weg des Risses über das Display nach, aber ich hatte schon mitbekommen, dass Gegenstände schlimmere Schäden überstanden hatten.
Im Zimmer zog ich meine Jeans aus, die am unteren Ende steif und nass war, und tauschte sie gegen den legeren Rock, der es wie durch ein Wunder in mein Gepäck geschafft hatte. Zum Glück herrschte im High Tide eine lockere Atmosphäre, denn ich hatte nicht viel Zeit zum Packen gehabt und meine Tasche hauptsächlich mit Trainingskleidung und ein paar T-Shirts gefüllt.
Nach einem kurzen Blick in den antiken Spiegel kramte ich nach meiner Bürste, bis mir klar wurde, dass ich sie vergessen haben musste. Suchend sah ich mich im Zimmer um. Amaya würde es sicherlich nichts ausmachen, wenn ich ihre Bürste verwendete, aber nichts deutete darauf hin, dass sie schon mit dem Auspacken begonnen hatte. Nirgendwo waren Sachen von ihr zu sehen. Selbst die Tasche, die vorhin auf dem Fußboden neben ihrem Bett gestanden hatte, war verschwunden. Vielleicht hatte sie ihr Gepäck in das Zimmer unterm Dach gebracht, um Joshua zu einem Tausch zu überreden. Aber die letzte Interaktion der beiden hatte mich beunruhigt. Amaya hatte so angespannt geklungen, so eindringlich. Ich trat in den Flur und nahm die schmale Treppe in den zweiten Stock.
Noch bevor ich die letzte Stufe erreicht hatte, hörte ich von oben ein Geräusch.
Es gab dort keine Tür, sondern die Treppe führte direkt auf den ausgebauten Dachboden mit schrägen Decken, in dem ein Doppelbett vor einer Reihe von bodentiefen Fenstern stand.
Ich konnte mir niemand anderen in diesem Raum vorstellen als Ian. Wenn ich mich hier oben aufhielt, sah ich zwangsläufig seine schlanke Gestalt vor mir, wie er zusammengekauert auf der Bettkante saß. Wie sich sein Gesichtsausdruck veränderte, wenn ich die letzte Stufe erklomm, als hätte er bereits gewusst, dass ich es war, die heraufkam.
Das Zimmer war leer, aber es gab eine Balkontür, die auf das obere Holzdeck führte. Es war über eine steile Treppe, von der ich annahm, dass man sie nachträglich hinzugefügt hatte, mit den unteren Etagen verbunden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man dafür eine offizielle Baugenehmigung erhalten hätte.
Die frische Meeresbrise pfiff durch die Ritzen, offenbar war die Balkontür nicht richtig verriegelt. Mit schnellen Schritten durchquerte ich den Raum, drückte sie fest zu und verschloss sie. Die Außentüren neigten dazu, von selbst aufzugehen, wenn man den Riegel nicht ordentlich vorschob, weil die Türrahmen, die dem Meer zugewandt waren, von der Witterung angegriffen und verzogen waren.
Joshuas Sachen lagen im Raum verstreut: geöffnete Taschen auf dem zerwühlten Bett, ausgetretene Turnschuhe auf dem Boden, eine Badeshorts hing über dem Stuhl aus Eichenholz. Auf dem dazugehörigen Schreibtisch lagen ein paar Papiere und ein Laptop. Von Amaya keine Spur.
Auf dem Weg nach unten warf ich einen Blick in das dunkelblaue und das gelbe Schlafzimmer, konnte aber keinerlei Anzeichen entdecken, dass Amaya in eines der beiden umgezogen war. Und auch im Erdgeschoss, wo Hollis vor dem Fenster stand und nach draußen schaute, befand sich kein Gepäck von ihr.
»Hast du Amaya gesehen?«, fragte ich.
»Nein, und auch sonst niemanden. Ich schätze, sie sind alle zusammen zum Restaurant gegangen. Bist du fertig?«
Ich nickte und folgte ihr nach draußen. Doch ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Es lag wohl an der Tatsache, dass Ian hier sein sollte. Seine Abwesenheit hatte alles aus dem Gleichgewicht gebracht. Nichts fühlte sich richtig an, aber das kam hier ohnehin nur selten vor.
Kapitel 3
Zum High Tide gelangte man am einfachsten über ein paar Wege, die sich zwischen den Häusern hindurchschlängelten. Großzügige dreistöckige Ferienhäuser standen neben älteren Strandbungalows und umgebauten Wohnwagen, zwischen den Grundstücksgrenzen gab es Sandflecken und wucherndes Gras. Wir mussten nur eine einzige asphaltierte Straße überqueren, die die Einheimischen als Highway bezeichneten, obwohl sie nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Schnellstraßen aufwies, die man vom Festland gewohnt war. Es gab nicht einmal eine Ampel oder einen Zebrastreifen, nur große Lücken im Verkehr, weshalb man beinahe jederzeit die Straße überqueren konnte.
Das Restaurant lag direkt an der Lagune. Die Brandung war hier ruhiger, nur ein sanftes Plätschern gegen die Unterseite des Stegs, doch darüber hing in der Morgen- und Abenddämmerung oft ein unheimlicher Dunst, der vom Meer aufstieg und Richtung Strand zog. Wir hatten im Laufe der Jahre viele Abende hier verbracht und die Besitzerin war noch dieselbe.
Sie schien uns wiederzuerkennen, denn als wir das Restaurant betraten, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, tiefe Lachfalten gruben sich in die gebräunte Haut und ihr Lächeln wurde strahlender. »Wusste ich doch, dass noch ein paar Gesichter fehlen«, begrüßte sie uns mit rauer Stimme, bevor sie über unsere Schultern schaute, als ob sie noch jemanden erwartete.
Ich konnte mich nicht an ihren Namen erinnern, aber Hollis fiel er sofort ein. »Hi, Joanie«, sagte sie.
Joanie griff nach zwei laminierten Speisekarten und führte uns zu einem langen Tisch. Er stand in der Ecke, wo zwei Fensterfronten aufeinandertrafen, hinter denen sich Meer und Himmel bis in alle Unendlichkeit auszudehnen schienen.
In der Tischmitte standen zwei Pitcher Bier und eine Auswahl an frittierten Vorspeisen, auf die sich die anderen bereits mit einem Appetit stürzten, als wären wir ein Haufen halbwüchsiger Schüler. Ich nahm den leeren Platz neben Grace ein, mit Blick auf die Fensterfront, in der sich das orangefarbene Licht des Sonnenuntergangs spiegelte.
Auf der anderen Seite des Tisches zog Oliver den Stuhl neben sich zurück. »Hey, Hollis«, sagte er, als sie sich setzte. »Ich habe dich vermisst, als ich vorhin angekommen bin.«
Hollis begann sich Shrimps in Kokospanade auf den Teller zu schaufeln, während sie sich mit Oliver unterhielt.
Ich sah mich in der Runde um. »Wo ist Amaya?«
Josh hörte auf zu kauen, schluckte. »Sie meinte, dass sie keinen Hunger hat.«
»Sie ist weg«, bemerkte ich mit einem vielsagenden Blick auf Josh.
Er zuckte mit den Schultern, bevor er sich eine Handvoll Nachos aus einer Schüssel nahm. »Sie wird sich wieder einkriegen, schätze ich.«
»Nein, ich meine, ihre Reisetasche ist weg. Und ihr Auto auch.«
Am Tisch herrschte einen Moment lang Schweigen, bevor Brody einen der Pitcher hob und sich nachschenkte. »Sie kommt bestimmt wieder«, sagte er. Dann griff er nach meinem Glas, um es ebenfalls zu füllen.
Josh verdrehte die Augen. »Muss ein Rekord sein. Wie lange hat sie es diesmal ausgehalten? Drei Stunden?«
Diesmal war ich nicht die Einzige, die ihm einen warnenden Blick zuwarf, doch er schien es nicht einmal zu merken.
Ich legte mein Handy auf den Tisch und überlegte mit gerunzelter Stirn, ob ich versuchen sollte, sie über die Nummer zu erreichen, von der sie mir heute Morgen die Nachricht geschickt hatte.
»Ich schreibe ihr«, sagte Grace, als wollte sie uns beruhigen.
Amaya war schon einmal verschwunden. Was nicht einer gewissen Ironie entbehrte, wenn man bedachte, dass sie diejenige war, die jedes Jahr dafür sorgte, dass wir alle zusammenkamen. Dennoch fiel es ihr schwerer als uns anderen, an einem Ort zu bleiben. Sie ging spazieren und behauptete hinterher, die Zeit vergessen zu haben. Sie fuhr mit dem Auto zum Einkaufen und übernachtete anschließend auf dem Campingplatz am Ende der Straße, bevor sie am nächsten Tag zurückkam und Frühstück für alle mitbrachte. Als ob auch sie spürte, dass jeder Ort zur Falle werden konnte, und sich selbst beweisen müsste, dass sie jederzeit entkommen könne.
Grace presste die Lippen aufeinander, bevor sie den Blick von ihrem Handy hob. »Es geht ihr gut. Sie schreibt, dass sie nur ein bisschen Abstand braucht.«
»Ist sie heute Abend wieder da?«, fragte ich.
Mit einem Schulterzucken steckte Grace das Smartphone weg und legte ihre Hand auf meinen Arm. »Gib ihr etwas Zeit. Du weißt ja, wie es manchmal ist.« Grace und Amaya hatten im Laufe der Jahre eine ganz besondere Bindung zueinander aufgebaut, und so wie Grace über sie sprach, fragte ich mich insgeheim, ob Amaya eventuell auch eine Patientin von ihr war.
»Wollen wir Wetten abschließen, wie schnell sie zurückkommt?«, fragte Josh, als wäre das alles nichts weiter als ein dummer Scherz.
In diesem Moment leuchtete mein eigenes Handy mit einer Nachricht von Russ auf: Gut angekommen?
Ja, ich richte mich gerade ein. Melde mich bald wieder, schrieb ich zurück.
»Du hast einen Freund, oder?«, fragte Brody, der über meine Schulter spähte, um zu sehen, was ich tippte.