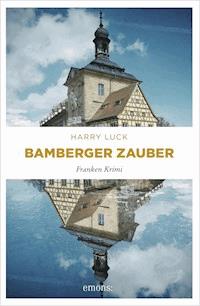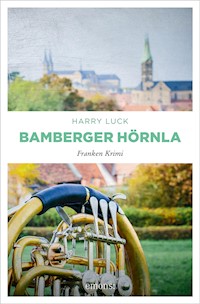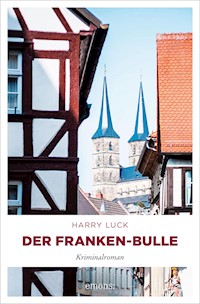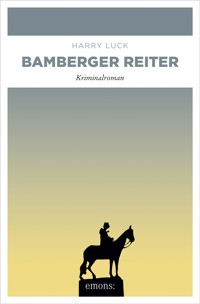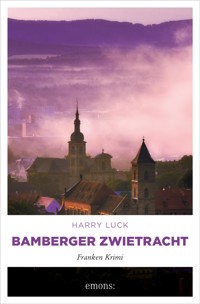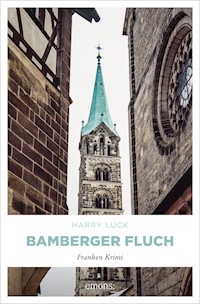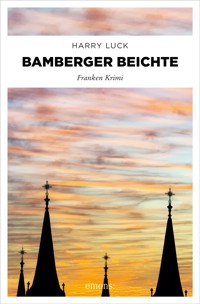
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Intrigen, Mord und Missgunst im beschaulichen Bamberg. Im Bamberger Karmelitenkloster stirbt ein Ordensbruder unter mysteriösen Umständen. Kommissar Horst Müller und seine Kollegin Paulina Kowalska finden heraus, dass der Tote an heimlich durchgeführten Exorzismen beteiligt war und eine falsche Identität angenommen hatte. Wurde dem Ordensmann sein Doppelleben zum Verhängnis? Immer mehr Details kommen ans Licht, und die Ermittler sehen sich wahrhaft teuflischen Abgründen und kommunalpolitischen Intrigen gegenüber ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Harry Luck, 1972 in Remscheid geboren, arbeitete nach einem Studium der Politikwissenschaften in München als Korrespondent und Redakteur für verschiedene Medien und leitete das Landesbüro einer Nachrichtenagentur. Seit 2012 ist er für die Öffentlichkeitsarbeit im Erzbistum Bamberg verantwortlich.
www.harry-luck.de
www.facebook.com/luck.harry
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lookphotos/Bias, Helge
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-117-1
Franken Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kai Gathemann, München.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Das fünfte Gebot verwirft den direkten und willentlichen Mord als schwere Sünde. Der Mörder und seine freiwilligen Helfer begehen eine himmelschreiende Sünde.
Katechismus der katholischen Kirche
Gott, der barmherzige Vater,
hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes
die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt
zur Vergebung der Sünden.
Durch den Dienst der Kirche
schenke er dir Verzeihung und Frieden.
So spreche ich dich los von deinen Sünden
im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Prolog
Bodo Stüllenberg drückte den Hebel für die Hydrauliksteuerung seines HX140AL sanft nach vorne. Auch nach über dreißig Jahren im Job war es für ihn immer noch ein überwältigendes Gefühl, mit dem Bewegen eines kleinen Hebels, der dem Joystick einer Spielekonsole nicht unähnlich war, die vierzehn Tonnen in Bewegung zu setzen, die sein Raupenbagger wog.
Natürlich war es nicht »sein« Bagger, sondern er gehörte dem Baukonzern, für den er seit seiner Ausbildung tätig war. Und natürlich hieß Stüllenberg nicht wirklich Bodo. Diesen Spitznamen hatte er seit seiner Kindheit, in der er jeden, ob gefragt oder ungefragt, wissen ließ, dass er mal Baggerfahrer werden wollte. Dies diente nicht gerade der Erbauung seines Vaters, der in der Stadt ein angesehener Architekt war und seinen einzigen Sohn Andreas gerne als Nachfolger aufgebaut hätte. Deshalb hatte er ihn regelmäßig mit auf die kleinen und großen Baustellen genommen. Der alte Herr ahnte nicht, dass Bodo dort den Lebenstraum entwickelte, Baggerfahrer zu werden, anstatt Architektur zu studieren.
Dass man als Baggerfahrer weder außerordentliche Karrierechancen hatte noch das große Geld verdienen konnte, sah Bodo nicht als Problem. Er war glücklich in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung am Weidendamm, wo die Eigentümerin seit zehn Jahren die Miete nicht mehr erhöht hatte und wo er in der Nähe seiner Stammkneipe wohnte. Was ihn traurig machte, war, dass er im Alter von fast fünfzig Jahren immer noch nicht die Frau fürs Leben gefunden hatte. Seine Kumpel, mit denen er im »Lewinsky« jeden Samstag die Bundesligaspiele schaute, spotteten, er sei doch mit seiner Elsa verheiratet, wie er den großen gelben Bagger nannte. Er teilte sein Leben mit Elsa und verbrachte viel Zeit mit ihr. Romantische Gefühle jedoch konnte er für eine mit Diesel betriebene Baumaschine nun wirklich nicht empfinden.
Bodo baggerte heute auch an keinem Baggerloch, wie es in dem alten Ulksong von Mike Krüger hieß, dem er seinen Spitznamen verdankte, sondern auf einer Baustelle im Herzen der Stadt, wo ein historisches Gebäude entkernt wurde. Seit zwei Tagen lud er Gesteinsbrocken auf die Ladeflächen von Lkws, mit denen die Steine abtransportiert wurden. Es war der letzte Tag hier, bevor er auf die Großbaustelle wechseln sollte, wo die neue ICE-Strecke entstand. Wer wollte behaupten, sein Job sei langweilig und eintönig?
Mit dem Steuerungsmodul bewegte er den Baggerarm nach vorne und dann nach unten. Da bemerkte er, dass die Schaufel auf etwas Metallisches stieß, das nicht hierhergehörte.
EINS
Die Verfolgungsjagd dauerte jetzt schon über eine Stunde. Bislang ohne jede Aussicht, den Flüchtigen zu stellen. Oder war es eine Flüchtige? Oder eine Flüchtende? Ich ging davon aus, dass es sich um ein männliches Wesen handelte, auch wenn das graue Haar keine Rückschlüsse auf das Geschlecht zuließ. Der Schaden, den der Eindringling in meiner Wohnung angerichtet hatte, war vor allem ideeller Natur. Die Pappschachteln, in denen sich die neunzehn DVD-Boxen mit allen zweihunderteinundachtzig »Derrick«-Folgen befanden, waren wohl irreparabel zerstört. Ich war fest entschlossen, den Täter zu stellen. Tot oder lebendig! In der Hand hielt ich einen schweren Gummihammer, mit dem ich bereit gewesen wäre, notfalls zuzuschlagen. Lieber wäre mir natürlich gewesen, das Monster wäre in eine der zahlreichen Fallen getappt, die ich im gesamten Zimmer verteilt hatte.
Eine Maus in der Wohnung mitten in der Stadt, das hatte ich in den fast zwanzig Jahren, die ich in Bamberg lebte, noch nicht erlebt. Sicherheitshalber hatte ich im Sicherungskasten den Strom abgeschaltet für den Fall, dass die Maus das hinter dem Schrank verlegte Kabel für die Beleuchtung der Spirituosenbar annagen und einen Kurzschluss auslösen würde. Ich hörte die Maus rascheln und knabbern hinter dem Schrank, in dem ich meinen geliebten Eierlikör aufbewahrte und der fest mit der Wand verschraubt war. Deshalb ließ er sich nicht einfach vorschieben.
Bei einer polizeilichen Maßnahme hätte ich gewusst, was zu tun wäre. Ringfahndung einleiten, Verstärkung anfordern, notfalls ein Spezialeinsatzkommando. Finaler Rettungsschuss nicht ausgeschlossen, mit Wirkungstreffer im Vitalbereich. Aber in den eigenen vier Wänden war ich völlig hilflos. Ich hatte als Kriminalkommissar schon zahllose Verbrecher hinter Schloss und Riegel gebracht, aber noch nie eine Maus gefangen.
In diesem Moment läutete es an der Haustür. Das musste Andrea sein, meine Tochter. Es war seit Jahren eine schöne Tradition geworden, dass sie mich am Wochenende kurz besuchte und einen selbst gebackenen Kuchen mitbrachte, von dem wir gemeinsam ein Stück aßen. Ich schloss die Wohnzimmertür, damit die Maus nicht in die Küche oder Speisekammer entfliehen konnte, und drückte den Türsummer. Dann öffnete ich die Wohnungstür im ersten Stock.
Die junge Dame, die wenig später mit vorwurfsvollem Gesicht vor mir stand, hätte vom Alter her zwar meine Tochter sein können, es war jedoch Paulina Kowalska, meine Kollegin, mit der ich schon seit vielen Jahren im Kommissariat 1 der Bamberger Kriminalpolizeiinspektion zusammenarbeitete.
»Horst!«, sagte sie in dem gleichermaßen verzweifelten wie verärgerten Tonfall, mit dem man sein Kind mit einer mit Filzstift bemalten Raufasertapete konfrontierte.
»Unverhoffter Besuch am Sonntagmorgen!«, tat ich erfreut, ihre offensichtliche Missstimmung ignorierend. »Ich hatte eigentlich mit Andrea gerechnet.«
»Ich versuche seit einer Stunde, Sie anzurufen. Ihr Handy ist aus, und auf dem Festnetz ist die Leitung tot. Haben Sie vergessen, dass wir Bereitschaft haben?«
Das hatte ich nicht vergessen, ich hatte jedoch nicht bedacht, dass das Ausschalten des Stroms auch Auswirkung auf den Telefonanschluss hatte. Und das Handy lag im Schlafzimmer, zu dem ich die Tür während der Mausjagd verschlossen hatte, um ein Eindringen des Tiers zu verhindern. Es war allerdings sehr selten, dass das K1 am Wochenende wegen eines Verbrechens gegen das Leben, so lautete offiziell unsere Zuständigkeit, gerufen wurde. Daher fragte ich Paulina: »Was ist denn passiert, was nicht der KDD erledigen und bis Montag warten kann?«
»Es gibt einen Toten am Knöcklein.«
Die Adresse sagte mir etwas. Ich überlegte kurz. »Dort ist das Theresianum.« Das war das Spätberufenengymnasium, wo man auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur machen konnte, um dann bestenfalls Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. Das jedenfalls war zu meiner Jugendzeit die von vielen wahrgenommene Hauptfunktion der katholischen Schule, die nach dem Krieg von den Karmeliten gegründet wurde und seit 2018 von der Caritas geführt wurde.
»Knapp daneben«, bemerkte Paulina. »Im Karmelitenkloster wurde eine Leiche gefunden.«
»Großer Gott!«, rief ich aus.
***
Während wir die Treppe hinuntergingen, schrieb ich Andrea eine WhatsApp-Nachricht mit den Worten: »Muss leider weg, Einsatz!«
Paulina hatte den Dienstwagen im Halteverbot auf der anderen Straßenseite geparkt. Die Polizeikelle in der Windschutzscheibe verhinderte, dass die Kollegen vom Parkraumüberwachungsdienst, die ihr Hauptquartier nur einen Steinwurf entfernt in der Hornthalstraße hatten, übereifrig unseren Einsatz behinderten.
Auf der Fahrt erzählte sie mir in knappen Worten, was bisher bekannt war.
»Der Anruf aus dem Kloster kam um zehn Uhr fünfzig. Der Chef des Karmelitenklosters hat nach der Messe seinen Bruder tot aufgefunden.«
»Seinen Bruder?« Ich ahnte das Missverständnis.
»Sein Bruder Martin sei tot, ja. Die herbeigerufene Notärztin hielt die Todesursache für abklärungsbedürftig.«
»Dieser Bruder Martin muss nicht sein leiblicher Bruder gewesen sein. Ich nehme an, er war ein Klosterbruder. Also ein Mitglied des Ordens, das nicht Priester ist. Lateinisch Frater. Im Gegensatz zum Pater, also Vater, der geweihter Priester ist. Aber das werden wir gleich erfahren.«
»Danke, Mister Brockhaus. Ich versuch’s mir zu merken«, sagte Paulina und lenkte den Wagen den Unteren Kaulberg hinauf. Immer wenn ich an der Oberen Pfarre vorbeifuhr, erinnerte ich mich daran, dass hier an einem leeren Grab die Ermittlungen in einem Fall ihren Ausgang nahmen, die uns in das dunkelste Kapitel der Stadt führten, die Hexenverfolgung. Dann bog sie am Karmelitenplatz rechts ab, fuhr links und parkte hinter dem Einsatzwagen des KDD und den Streifenfahrzeugen.
Paulina stieg aus und ging auf ein gelb gestrichenes Wohnhaus zu. »Da müssen wir hin.«
»Nicht ins Kloster?«, fragte ich.
»Das Kloster ist nicht mehr das Kloster. Die Brüder haben ihr Kloster verkauft und wohnen jetzt nebenan. Das Horst-Müller-Lexikon scheint nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Update erforderlich?«
»Jetzt, wo Sie es sagen … Ich las davon in der Zeitung, ja. Luxuswohnungen sollen im Kloster entstehen.«
Das frisch gestrichene einstöckige Haus sah wie vieles aus, aber nicht wie ein Kloster. Den Eingang fanden wir an der von dem Sträßlein abgewandten Seite. Die Haustür stand offen. Wir schritten ebenerdig durch ein Treppenhaus, in dem es nach Putzmittel mit Zitruskraft roch. Der KDD-Kollege Isernhagen kam uns mit seinem Silberkoffer entgegen.
»Guten Tag, auf Wiedertschüss«, sagte er im Vorbeigehen und schaute auf seine Armbanduhr. »Jetzt übernehmt ihr mal schön. Wenn’s Fragen gibt, der Kollege Böhnlein ist noch da und räumt zusammen.«
»Warum so eilig?«, fragte ich den Mann, der beim Kriminaldauerdienst, den wir aufgrund der Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Kollegen intern mit FBI abkürzten, das I bildete. »Gibt’s keinen Bericht?«
»Macht alles der Böhnlein. Ich muss echt los. Meine Ex wartet mit dem Kind zur Übergabe, wissen Sie?«
Ich wusste, wovon er sprach. Meine Scheidung lag schon über fünfzehn Jahre zurück, und die beiden Kinder waren längst aus dem Haus, sodass es keiner Absprachen für Papa-Wochenenden und Wechselmodelle für Betreuungszeiten mehr bedurfte. Isernhagen schien noch nicht so weit zu sein. Ich wusste von einem anderen Kollegen, der kinderlos war, bei dem aber die Wochenendbetreuung des ehemals gemeinsamen Hundes sowie die Kostenübernahme für Futter und Tierarzt zwei Seiten im Scheidungsvertrag füllten.
»Ist Ihre Ex-Frau nicht auch bei der Polizei?«, fragte ich.
»Ja, ebendrum. Ihre Schicht beginnt in einer halben Stunde. Und ich möchte es nicht noch einmal erleben, dass sie die Kleine mit im Streifenwagen spazieren fahren muss, weil ich sie nicht rechtzeitig abholen konnte.«
»Schon gut«, sagte ich. »Machen Sie, dass Sie loskommen.«
»Bis Denver!«, sagte Isernhagen.
»Bis Spätersburg«, antwortete Paulina und verdrehte die Augen.
»Heirate oder heirate nicht. Du wirst es bereuen«, zitierte ich einen weisen Philosophensatz und fügte ungefragt den Urheber hinzu: »Sokrates.«
»Heirate keinen Mann, der sich nach dem ersten Date mit ›Bye, bye, Butterfly‹ oder ›Bis Baltrum‹ verabschiedet«, sagte meine Kollegin und nannte ebenfalls die Quelle: »Paulina Kowalska.«
»Herr Kommissar Müller, kommen Sie!«, hörte ich Böhnleins Stimme. Er stand in seinem weißen Overall in einem Büroraum mit zwei Schreibtischen und einer Schrankwand, wie ich sie auch in meinem Wohnzimmer hatte, nur dass sich hier ausschließlich Aktenordner in den Regalen befanden. »Kollegin Kowalska, schön, Sie zu sehen«, begrüßte er auch Paulina.
»Wie halten Sie es mit Ihrem Kollegen eigentlich aus?«, sagte Paulina.
»Könnte ich Sie auch fragen«, antwortete Böhnlein und warf mir einen lachenden Blick zu. »Das berufliche Schicksal hat es mit uns beiden nicht gut gemeint. Vielleicht sollen wir uns mal zusammentun. Rein dienstlich natürlich.« Er warf ihr einen frivolen Blick zu.
Ich wollte gerade eine empörte Replik loslassen, als uns ein leises Räuspern unterbrach.
»Wenn die Herrschaften dann zu Ende gescherzt hätten …« Auf dem vorderen Schreibtischstuhl saß ein schlanker schwarzhaariger Mann in einem dunkelbraunen Gewand mit einer runden Metallbrille. Er war ein wenig älter als ich, vermutlich Ende fünfzig, und hatte ein auffällig glatt rasiertes Gesicht. Einige wohl vom Rasiermesser verursachte Wunden am Kinn deuteten auf eine besonders empfindliche Haut hin. Er roch nach Old-Spice-Aftershave.
»Entschuldigung, Herr …«, sagte ich und hob beschwichtigend beide Hände.
»Windsheimer. Bruder Antonius Windsheimer. Ich bin der Prior des Klosters.«
»Er hat die Leiche gefunden«, sagte Böhnlein und deutete auf einen Nebenraum, in dem ich zwischen einem Schreibtisch und einem Bürostuhl eine von einem weißen Tuch bedeckte Gestalt und eines der obligatorischen Zifferntäfelchen der Spurensicherung entdecken konnte. Es war die Nummer eins.
»Ist schon gut«, sagte Bruder Windsheimer. »Ich kenne das. Wenn man beruflich viel mit dem Tod zu tun hat, verliert der Umgang damit den Schrecken und wird zum Alltag.« Er atmete einmal durch. »Ich bin trotzdem immer noch völlig außer mir. Wir haben hier schon viele Mitbrüder beerdigt, aber Bruder Martin war gerade mal fünfzig Jahre alt, einer der jüngsten hier im Konvent.« Er schlug beide Hände vor sein Gesicht und schüttelte den Kopf. »Ich kann es immer noch nicht glauben.«
»Böhnlein, was wissen Sie bis jetzt?«
»Der Tote ist identifiziert als Martin Jakubas, fünfzig Jahre alt. Geboren in Wetzlar. Wohnhaft hier im Kloster. Der Todeszeitpunkt kann auf zwischen neun und elf Uhr vormittags eingegrenzt werden. Und weshalb Sie hier sind …« Er zeigte uns einen durchsichtigen Asservatenbeutel, in dem sich eine Packung Merci-Schokolade befand.
»Was ist das?«, fragte Paulina.
»Merci Finest Selection, Helle Vielfalt«, antwortete Böhnlein. »Es fehlen zwei Stücke der Sorte Mandel-Milch-Nuss.«
»Nussallergie?«, mutmaßte ich. »Kann man davon einen tödlichen Schock erleiden?«
Der Prior schüttelte den Kopf. »Von einer Allergie hätten wir gewusst. Bruder Martin liebte Nussschokolade. Er sagte selbst immer, diese Versuchung sei sein größtes Laster.«
»Die Notärztin, die ihn untersucht und den Exitus festgestellt hat, hält eine Vergiftung für möglich. Wir lassen die Schokolade analysieren«, sagte Böhnlein.
»Und was ist damit?« Ich zeigte auf eine leere weiße Tasse mit dem Caritas-Logo und dem roten Schriftzug »Caritasse«.
»Negativ«, sagte Böhnlein. »Unbenutzt und klinisch rein. Daraus hat er jedenfalls nichts getrunken. Das hier wäre noch interessant, lag beides auf seinem Schreibtisch.« Er reichte mir ein Buch mit dem Titel »Dämonen unter uns? Exorzismus heute« sowie ein schwarzes Ledermäppchen mit einem goldenen Kreuz, das mich an das Gotteslob meiner Kindheit erinnerte. Ich zog den Reißverschluss auf und fand kein Gebetbuch.
»Was ist das denn?«, fragte ich und öffnete auf der linken Seite ein kleines Büchlein, in dem sich vor allem lateinische Texte befanden. Rechts war eine leere runde Metalldose mit vergoldetem Deckel, daneben waren ein Kreuz, ein Rosenkranz und ein Utensil befestigt, das wie eine Miniaturklobürste aussah.
»Ein Vademecum für den seelsorglichen Einsatz«, schaltete sich Windsheimer ein. »Das nehmen wir zum Beispiel zur Krankenkommunion mit. In der Dose wird die heilige Hostie transportiert. Das Aspergill dient zum Segnen mit Weihwasser.«
»Verstehe.« Ich nickte. »Herr Windsheimer, können Sie uns noch ein paar Fragen beantworten?«
Der Prior nahm seine runde Brille ab und putzte die Gläser mit den Ärmeln seines Gewandes. Vermutlich eine Übersprungshandlung.
»Selbstverständlich, Herr Kommissar. Könnten wir …«, er räusperte sich, »… ich meine, müssen wir hier reden?«
»Nein, wir können auch hinausgehen, kein Problem.«
»Ich schaue mir inzwischen den Computer des Toten an«, sagte Paulina. »Haben Sie ein Passwort, Herr Prior?«
Er nickte. »Unsere Passwörter sind lateinisch und geheim.«
»Ja?«
»Secretum. In Großbuchstaben. Und dann Ausrufezeichen, Raute, Fragezeichen und die Initialen des Nutzers.«
»Also SECRETUM!#?MJ – einen Datenschutzbeauftragten gibt es hier im Kloster wohl nicht, oder?«
»Kommen Sie, wir gehen nach draußen«, sagte ich zu Windsheimer. Wir traten vor das Haus, von wo aus wir einen freien Blick auf die Altenburg hatten. Der goldene Oktober sorgte für spätsommerliche Temperaturen. Der Prior trug schlichte Ledersandalen ohne Socken. Unter seinen Schritten knirschte der staubige Kies. Es hatte seit Wochen nicht mehr geregnet.
»Alles Baustelle hier«, sagte er und zeigte auf das Nachbargebäude mit Baugerüst. »Wir wohnen in einem Provisorium, müssen Sie wissen. Es wird alles umgebaut. Wir verkleinern uns. Zwangsläufig.«
»Ich las davon, dass die Karmeliten das historische Kloster verkauft haben?«
»So ist es. Wir sind nur noch zehn Brüder, das ist für ein Karmelitenkloster heute noch relativ viel. Als ich hier eingetreten bin, waren wir allerdings noch über vierzig Brüder. Als Sitz der Provinzleitung ist Bamberg für den Orden ein wichtiger Standort. Aber das Kloster wurde einfach zu groß. Und der Nachwuchs … Fachkräftemangel gibt’s auch bei uns. Kommen Sie mit in unseren Klostergarten. Ich liebe die Stimmung dort. Da können wir in Ruhe reden.«
»Verstehe«, sagte ich. Wir verließen das Gebäude und gingen an einer zugemauerten Pforte der Klosterkirche vorbei.
»Die romanische Löwenpforte aus dem elften und zwölften Jahrhundert ist das älteste Kirchenportal Bambergs«, erläuterte der Prior.
»Und warum ist es zugemauert?«
»1658 begann der Umbau der alten Zisterzienserinnenkirche mit dem Zweck, den Menschen den Zugang über einen neuen Eingangsbereich am Kaulberg zu erleichtern. Das bisherige Portal wurde einfach zugemacht.«
»Sie sagten Zisterzienserinnen? War das hier nicht immer ein Karmelitenkloster?«, wollte ich wissen.
»Nein, das erste Karmelitenkloster war seit 1273 in der Au, wo auch ein Priesterseminar untergebracht war. Als es zu klein wurde, kam es 1589 zu einem Tausch: Der Orden überließ das Kloster in der Au dem bischöflichen Seminar und erhielt dafür das leer stehende Frauenkloster mit Garten am Kaulberg.«
Wir gingen am Theresianum vorbei und betraten den Garten, in dem Gemüse, Blumen und Kräuter wuchsen. Einige Bäume spendeten Schatten. Den etwas herben Geruch konnte ich nicht identifizieren.
»Bitte berichten Sie, wie Sie den Toten aufgefunden haben!«
Windsheimer holte Luft und schloss die Augen, um sich das Geschehene wieder zu vergegenwärtigen.
»Ich habe heute um zehn Uhr die Sonntagsmesse in der Kirche zelebriert. Danach bin ich gleich zurück ins Büro, weil ich noch einen Vortrag für das Provinzkapitel in Springiersbach in der Eifel vorbereiten wollte. Ich öffnete mein Büro, die Tür zu Martins Zimmer stand offen, er lag leblos auf dem Boden. Ich dachte an einen Herzinfarkt und wollte den Defibrillator holen. Aber dann fiel mir ein, dass der nach dem Umzug noch nicht installiert wurde. Deshalb wollte ich Erste Hilfe leisten mit Herzdruckmassage. Ich begann also zu singen: ›Highway to hell …‹«
»Wie bitte?«
»Das habe ich bei den Maltesern im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Der Rocksong hat den perfekten Rhythmus für die Wiederbelebung. Aber ich habe schnell gemerkt, dass nichts mehr zu machen war. Männer um die fünfzig sind leider sehr gefährdet, einfach tot umzufallen. Ich kenne einige solch tragischer Schicksale. Können wir uns setzen?«
Windsheimer deutete auf eine Holzbank, die unter einer Buche stand. Ich nickte wortlos, und wir nahmen Platz.
»Als ich mir sicher war, dass Martin tot war, schloss ich seine Augen und sprach das Totengebet. Requiescat in pace.« Dabei blickte er traurig gen Himmel.
Ich wartete einen Moment, weil ich den Eindruck hatte, der Pater betete noch einmal stumm für den Verstorbenen.
»Bruder Martin war nicht in der Messe?«, fragte ich.
»Er war, wenn ich nicht irre, im ersten Gottesdienst um acht Uhr.«
»Wissen Sie, womit er beschäftigt war, als er starb?«
»Als Prokurator des Klosters war er für die Verwaltung, Buchhaltung und die Finanzen zuständig. Er war außerdem für unsere Website und die Social-Media-Auftritte verantwortlich. Ich habe mit ihm jede Woche einen Vlog aufgenommen, den er immer sonntags online gestellt hat.«
»Einen Vlog? Was ist das?«
»Ein Videoblog. Ich habe jede Woche eine maximal zehnminütige Ansprache zum Sonntagsevangelium gehalten, die dann auf YouTube veröffentlicht wurde. Kurzversionen hat er auf Instagram und TikTok gepostet.«
»Ach, TikTok? Ist das nicht diese chinesische App, wo Jugendliche merkwürdige Verrenkungen zu komischer Musik machen und mit der unsere persönlichen Daten an das kommunistische Regime übermittelt werden?«
Windsheimer lachte. »Ja, es ist dort viel zu finden, was die Jugendlichen Trash nennen würden. Aber wir wollen das Wort Gottes dorthin bringen, wo die Menschen sind. Auch wenn uns das Milieu nicht gefällt. Wir missionieren ja zum Beispiel auch im Rotlichtbezirk. Über die Predigt von der Kanzel herab können wir junge Menschen nicht mehr erreichen. Deshalb müssen wir dorthin gehen, wo die jungen Leute sich in ihrer Freizeit aufhalten. Und das sind Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram. Und was unsere Daten angeht, mein Gott … ob die amerikanischen oder chinesischen Geheimdienste uns ausforschen, macht doch letztlich keinen Unterschied. Wir haben ja nichts zu verbergen.«
»Sie halten also virtuelle Predigten?«
»Das würde ich so nicht sagen«, widersprach er. »Virtualität bedeutet, nicht so in der Form in der Wirklichkeit zu existieren, wie es scheint, aber in Wesen und Wirkung einer in dieser Form existierenden Sache zu gleichen. Meine Predigt ist aber real, ich bin ja kein Avatar. Daher kann ich in diesem Zusammenhang mit diesem Begriff wenig anfangen.«
»Das sind ganz schön moderne Ansichten für einen katholischen Priester«, stellte ich fest.
Windsheimer zuckte mit den Schultern. »Ich bin nicht ohne Grund Karmelit geworden und kein Gemeindepfarrer. Aber das würde jetzt zu weit führen.«
»Wie lange war Bruder Martin schon im Orden?«
»Lassen Sie mich überlegen. Ich schätze, dass er vor acht oder neun Jahren gekommen ist. Er war das, was man einen Spätberufenen nennt. Soweit ich weiß, war er für eine Entwicklungshilfeorganisation in Südamerika tätig. Ärzte ohne Grenzen oder etwas in der Art. Als er nach Franken zurückkehrte, wollte er sein Leben ganz Gott widmen. Aber Priester werden mit allem, was dazugehört, das war wohl auch nicht sein Ding.«
»Das Zölibat? Das alte Problem«, sagte Paulina.
Der Zölibat, korrigierte ich in Gedanken.
»Die priesterliche Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen als Problem bei der Gewinnung von geistlichen Berufen wird zuweilen überschätzt«, sagte der Pater. »Glauben Sie, dass unsere protestantischen Mitbrüder, die heiraten dürfen, mehr junge Menschen finden, die Pfarrer werden wollen? Oder Pfarrerin? Das ist keineswegs so. Martin war unverheiratet. Ich meine eher das jahrelange Theologiestudium mit Latein und Altgriechisch, dann der Diakonat. Er war ein Mann der Praxis. Und die Unterscheidung zwischen Priester und Laien spielt bei uns eh keine Rolle.«
»Ach ja?«
»Wir nennen uns alle Bruder, egal ob geweiht oder nicht. Wir tragen den gleichen Habit, und Sie werden an keiner Äußerlichkeit erkennen, wer Priester ist und wer nicht. Das Priestersein wird bei uns in keiner Weise erwähnt. Das Entscheidende ist ausschließlich die persönliche und konsequente Ausrichtung des Lebens auf die Nachfolge Jesu Christi im Geiste des Evangeliums.«
»Das ist eher untypisch für einen katholischen Orden, oder?«, fragte ich. »In der katholischen Kirche ist doch der Klerikalismus zu Hause.«
Windsheimer lächelte milde. »Wenn Sie das so sehen. Seit Kurzem können sogar nicht geweihte Brüder Prior werden. Das war vorher nur mit einer Dispens möglich. Papst Franziskus hat diese Regel geändert. Lediglich die Feier der Eucharistie und das Sakrament der Beichte sind den geweihten Brüdern vorbehalten. Und Sie wissen ja, dass die Karmelitenkirche als Beichtkirche seit jeher sehr bekannt und beliebt ist. Auch wenn die Zeiten vorbei sind, in denen in der Osterzeit Zehntausende Beichten gehört wurden.«
»Sie sprechen vom Mittelalter?«
Windsheimer lachte. »Nein, bis in die achtziger Jahre haben wir täglich sechs Stunden Beichtzeit angeboten.«
»So viel Sünden können doch die Bamberger gar nicht begehen«, entgegnete ich staunend. »Wissen Sie, woran Bruder Martin heute konkret arbeitete?«
»Abgesehen davon, dass er meinen Vlog online stellen sollte, hatte er auf seinem Monitor die Seite infranken.de geöffnet. Irgendwelche lokalpolitischen Dinge. Ansonsten kümmerte er sich um Userkommentare, die beantwortet werden mussten. Manchmal waren auch unflätige Beleidigungen oder Spamkommentare zu löschen. Sehr selten kommt es vor, dass wir beleidigende Hasskommentare der Staatsanwaltschaft melden, wenn wir sie für justiziabel halten.«
»Und war es üblich, dass er vormittags Schokolade aß?«
»Sie meinen die Merci-Packung?«
Ich nickte.
»Ich nehme an, die war in der Post. Gestern war Martin nicht im Büro, er muss also die am Samstag eingegangene Post erst heute geöffnet haben.«
»Jemand hat ihm eine Packung Schokolade geschickt?«, hakte ich nach. »Ist das nicht ungewöhnlich?«
»Er hatte vor Kurzem runden Geburtstag. Wir feiern hier nur unsere Namenstage. Denn Geburtstag hat jeder Esel. Katholiken haben Namenstag.«
»Ich danke Ihnen, Herr Bruder Windsheimer«, sagte ich. »Und falls Sie noch mal in die Lage kommen sollten, Erste Hilfe mit Herzdruckmassage leisten zu müssen: Singen Sie ›Stayin’ Alive‹ von den Bee Gees. Das hat denselben Rhythmus wie ›Highway To Hell‹.«
»Und der Text ist angemessener, da haben Sie recht. Nicht nur aus katholischer Sicht.«
27.Juni 2010, Bamberg
»Vierundfünfzig, vierundsiebzig, neunzig, zweitausendzehn und so stimmen wir alle ein …« Optimistisch ertönte die Liveband auf der Showbühne auf dem Maxplatz und ließ die Hymne des Sommers erklingen, die den Wunsch der Nation nach dem vierten Stern auf dem Trikot der Fußballnationalmannschaft musikalisch zum Ausdruck brachte. Dreitausend Fans auf dem außerhalb von WM-Zeiten und anderen Eintritt-frei-Events des Stadtmarketings eher ausgestorbenen Rathausplatz, der nun zur Fanmeile umfunktioniert worden war, sangen lauthals mit. Viele hatten schwarz-rot-goldene Hawaii-Blümchenketten um den Hals hängen, trugen das schwarz-weiße Nationalmannschaftstrikot oder Deutschlandkäppis auf dem Kopf, um sich vor der prallen Sonne zu schützen, die das Thermometer seit Tagen auf über dreißig Grad hatte steigen lassen.
Für einen Mann Anfang vierzig, der apathisch auf den steinernen Stufen des Maximilianbrunnens zwischen den gusseisernen Statuen von Kaiser Heinrich und seiner Gemahlin Kunigunde mit Blick auf das Kaufhaus HONER saß, schien sich das sportliche Großevent gerade in weiter Ferne zu ereignen. Auf dem Blackberry in seiner Hand hätte Ronny Berger den aktuellen Spielstand des Achtelfinales gegen England ablesen können. Deutschland führte kurz vor der Halbzeit mit zwei zu null. Doch sein Handy, das mit der winzigen Tastatur eine Mischung aus Telefon und Minicomputer war, zeigte die Kurzmitteilung des Nürnberger Rechtsanwaltes Dr. Volkmar Fändrich an, die nur lapidar lautete: »Wie befürchtet. Leider. Sorry. VF.«
Berger war völlig klar, was diese wenigen Worte für ihn bedeuteten. Denn er war ein Fachmann, wenn es um Geld ging. Von der Pike auf hatte er den Beruf des Bankkaufmanns bei der Volksbank in Forchheim gelernt und sich auf den Bereich Immobilien spezialisiert. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre in München, wo er seine inzwischen Ex-Frau Ingeborg kennengelernt hatte, war er mehrere Jahre als Anlageberater bei der Kreissparkasse Starnberg tätig gewesen. Schon bald hatte er sich den für einen erfolgreichen Starnberger obligatorischen Neunhundertelfer-Porsche leisten können, wenn auch gebraucht. Der Herrgott hatte es gut mit ihm gemeint. Davon war Ronny Berger überzeugt, und er hatte regelmäßig zum Dank einen mehr als symbolischen Obolus an eines der kirchlichen Hilfswerke überwiesen, um die Wohltat dann ordnungsgemäß steuerlich geltend machen zu können. Doch dieses Leben war Vergangenheit. Die SMS seines Anwaltes konnte den Ruin für ihn bedeuten.
»›Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein!‹« Die junge Frau mit dem blonden Pferdeschwanz, die den optimistischen Song fröhlich mitsang, traf nur einen Teil der Töne, was sie mit vielen ausgelassenen Menschen beim Public Viewing gemein hatte. Sie trug ein etwas zu enges Fan-T-Shirt mit dem Emblem des DFB und dem Namen Müller auf dem Rücken und hatte die deutschen Farben auf ihre Wangen gemalt. In der Hand hielt sie eine schwarz-rot-gelbe Plastiktröte, wie man sie seit Beginn der WM überall sehen und vor allem hören konnte.
»Es steht zwei zu null. Für uns!«, rief sie Berger zu, führte die Vuvuzela an ihren Mund und blies kräftig hinein. Das ohrenbetäubende Geräusch, das entstand, erinnerte entfernt an das Trompeten eines Elefanten. Berger hatte gelesen, dass diese aus Südafrika stammenden Instrumente in einigen Städten verboten waren, weil sie im Abstand von einem Meter einen Lärmpegel von hundertzwanzig Dezibel erzeugen konnten. Er hielt sich die Ohren zu. In diesem Moment erzielte England den Anschlusstreffer in der siebenunddreißigsten Minute, was ein enttäuschtes Raunen auf dem Maxplatz auslöste.
»Noch zu früh für den Siegestaumel«, sagte Berger nüchtern und deutete auf die vier mal sechs Meter große LED-Leinwand, die vor dem kleinen Edeka-Stadtkauf aufgebaut war und auf der der Name des Torschützen Matthew Upson eingeblendet war. Er hatte den Ball nach einer Ecke überraschend ins Tor gebracht.
»Was ist los mit dir? Schlechte Nachrichten?« Sie deutete mit ihrem südafrikanischen Blasinstrument auf sein Blackberry. Und ohne seine Antwort abzuwarten, setzte sie sich neben ihn mit den Worten: »Also, ich bin die Sarah, und du?«
Berger nahm intuitiv ihre ausgestreckte Hand entgegen und sagte: »Ronny.« Ihre gute Laune wirkte ansteckend. Er steckte sein Telefon in die Gesäßtasche seiner Hilfiger-Jeans und lächelte sie an.
»Bist du allein hier?«, fragte sie. »Wer geht denn allein zum ›Zammguggn‹?« Der Begriff hatte sich in der Lokalpresse für das englische »Public Viewing« eingebürgert, worunter ein Brite allerdings eine öffentliche Leichenschau verstanden hätte, wenn denn einer auf dem Maxplatz gewesen wäre.
»Ehrlich gesagt interessiere ich mich wenig für Fußball«, sagte er. »Ich war in der Stadt unterwegs.«
»Was hat man am Sonntagnachmittag in der Stadt zu tun? Sorry, geht mich ja nichts an.«
Berger fand seine unverhoffte Gesprächspartnerin mit dem offenen Lachen und den Sommersprossen sympathisch und war dankbar für die Ablenkung. Doch er kannte sie nicht gut genug, um ihr zu erzählen, dass er soeben aus der Karmelitenkirche gekommen war, wo ein Bußgottesdienst stattgefunden hatte. Im Anschluss daran hatte er das Sakrament der Beichte empfangen. Nicht dass er eine besonders schwere Schuld mit sich herumgetragen hätte. Die regelmäßige Beichte alle sechs Wochen gehörte für ihn zum Leben wie der sonntägliche Besuch der Messe in der Gaustadter Kirche St. Josef. Dort war er nicht nur ein engagiertes Gemeindemitglied. Im Gottesdienst war er regelmäßig Lektor und trug die Lesung und die Fürbitten vor, und als ehrenamtlicher Kirchenpfleger war er für die Verwaltungsaufgaben der Pfarrei zuständig.
Es war Ehrensache für ihn, als gelernter Banker seine Expertise zur Ehre Gottes einzubringen, zumal der senegalesische Pfarrer Papa Diabang genug damit zu tun hatte, die deutsche Sprache zu lernen, und weder Interesse noch Kompetenz zeigte, sich mit dem deutschen Rechts- und Finanzwesen auseinanderzusetzen. Weil er den Pfarrer persönlich gut kannte, zog Berger es vor, seine regelmäßige Beichte bei den Ordensmännern in der Karmelitenkirche abzulegen, die von vielen Katholiken traditionell als Beichtkirche genutzt wurde. Doch dies alles musste er nicht Sarah erzählen. Nicht jetzt.
»Wollen wir was trinken, Ronny?«, fragte Sarah. »Tucher-Bier ist besser als kein Bier, oder? In der Halbzeit werden alle zum Stand gehen, dann besser jetzt.«
»Warum nicht?«, sagte Berger und lächelte. Es gab viele Bamberger, die »kein Bier« für die bessere Alternative hielten als Bier aus Nürnberg. Er war immer noch froh, auf andere Gedanken gebracht zu werden.
»Heißt du wirklich Ronny?«, fragte sie. »Oder ist das eine Abkürzung?«
Er lachte. »Du bist nicht die Erste, die mich das fragt. Wenn in der Schule ein Lehrer besonders streng sein wollte, sagte er Ronald zu mir. Aber in meinem Ausweis steht wirklich Ronny. Meine Eltern waren große Schlagerfans und liebten den Sänger Ronny. Der hat in meinem Geburtsjahr den Hit ›Little Sweetheart Belinda‹ gesungen. Aber ich kann froh sein, dass meine Eltern mich nicht nach seinem bürgerlichen Namen benannt haben. Er hieß in echt Wolfgang Roloff.«
»Ach, Wolfi wäre doch auch nett.«
»Er hatte noch mehr Pseudonyme: Otto Bänkel, Roger Ford, Maxim Boris. Aber am erfolgreichsten war er als Produzent von Heintje. Der kleine Holländer, der ›Mama‹ gesungen hat, du weißt schon. Ronny ist für mich völlig okay.«
Bis zum Abpfiff hatte Thomas Müller noch zwei Tore geschossen, und Deutschland zog mit vier zu eins ins Viertelfinale ein.
»Beim ersten Mal war’s ein Wunder, beim zweiten Mal war’s Glück, beim dritten Mal der verdiente Lohn, und diesmal wird’s ’ne Sensation«, sangen die Fans. Die Vuvuzelas klangen wie ein Hornissenschwarm. Und Berger hatte für den kommenden Samstag zum Viertelfinale eine Verabredung zum nächsten »Zammguggn«.