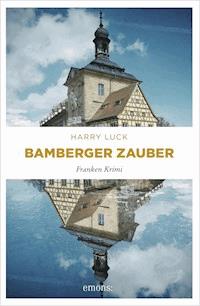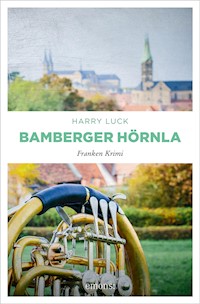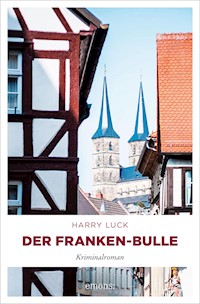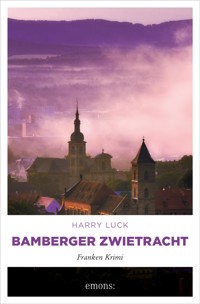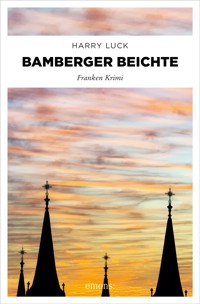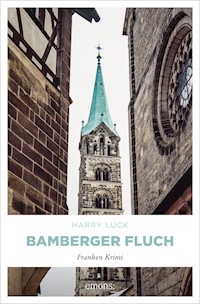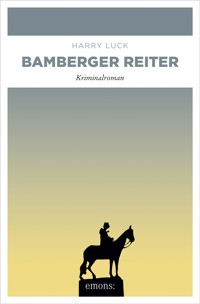
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannend, witzig,unterhaltsam. Etwas Unfassbares ist geschehen: Der Bamberger Reiter wurde gestohlen. Und das ausgerechnet kurz vor dem Besuch des Papstes! Als wenig später ein Kunsthändler ermordet wird, der ein geheimnisvolles mittelalterliches Buch besaß und an einer spektakulären These über die Identität des Reiters forschte, brodelt die Gerüchteküche. Und Kommissar Horst Müller steht vor der unglaublichen Frage: Ist der Heilige Gral in Bamberg verborgen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Harry Luck, 1972 in Remscheid geboren, arbeitete nach einem Studium der Politikwissenschaften in München als Korrespondent und Redakteur für verschiedene Medien und leitete das Landesbüro einer Nachrichtenagentur. Seit 2012 ist er für die Öffentlichkeitsarbeit im Erzbistum Bamberg verantwortlich.
www.harry-luck.de
www.facebook.com/luck.harry
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Im Anhang findet sich ein Glossar.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: picture-alliance/dpa/David Ebener
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-759-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Bamberg, 1907
»Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod.«
DomkapitularPrälat Heinrich Weberling kniete mit geschlossenen Augen auf dem Betschemel vor dem Altar im Ostchor des Domes und beendete den schmerzhaften Rosenkranz mit dem Gebet, das ihm sein Großvater Abend für Abend am Kinderbett vorgebetet hatte.
Ein Geräusch ließ den neunundfünfzigjährigen Priester mit dem schütteren, früh ergrauten Haar und der schwarzen Hornbrille aufhorchen. Es war nur ein leises Rascheln in der Nähe der Adamspforte. War wieder ein Tier in den Dom eingedrungen? So wie vor einigen Monaten, als Leisgang, der Mesner, eine ganze Nacht gebraucht hatte, um eine Riesenratte einzufangen, die sich in den Dom verirrt und sich, nachdem sie gefangen war, als der entlaufene Dackel des Domdekans entpuppt hatte. Weberling versuchte, sich wieder zu sammeln und sich auf sein Abendgebet zu konzentrieren.
»Oh, Jesus, sei gnädig, sei mir barmherzig, führ mich, oh, Jesus, in deine Seligkeit.« Dann bekreuzigte er sich.
Das letzte Tageslicht fiel durch die hohen Fenster im Ostchor. Links und rechts leuchteten auf mannshohen steinernen Säulen zwei Kerzen, deren Flammen leicht flackerten, als ein Luftzug durch den verschlossenen Dom wehte. Außer ihm konnte sich eigentlich niemand hier aufhalten, denn als Summus Custos hatte Prälat Weberling die Schlüsselgewalt über den Dom, den er vor seinem Abendgebet wie immer ordnungsgemäß verschlossen hatte.
Die Strahlen der untergehenden Sonne machten Tausende Staubkörner über dem Baldachin vor dem Hochaltar sichtbar. Wie oft hatte er im Domkapitel schon vorgeschlagen, die farblosen barocken Fenster des Doms durch buntes Glas zu ersetzen. Er war der Überzeugung, dass eine mittelalterliche Kirche farbige Fenster brauche, die das Tageslicht filterten und die Gegenlichteffekte behoben. Doch mit seinem Wunsch fand er bei den anderen Domherren kein Gehör.
Farbig hätte er sich auch den Bamberger Reiter gewünscht, der auf seinem steinernen Sockel in das Längsschiff blickte, wo das Kaisergrab im Mittelpunkt des Domes stand. Der berühmte Reiter, das wussten die Forscher, war wie der gesamte Dom von innen einst bunt bemalt gewesen. Doch König Ludwig I. hatte sich bei einem Besuch in Bamberg 1828 abfällig über die Gestaltung geäußert und sich einen steinfarbenen Innenraum gewünscht. Der Erzbischof und das Domkapitel mussten widerstandslos zusehen, wie auf Geheiß des Königs die weltberühmte Reiterskulptur aus dem 13. Jahrhundert bis auf die Steinoberfläche abgeschrubbt wurde. Dieser unverzeihliche Kahlschlag war nun schon rund achtzig Jahre her. Das Bistum Bamberg stand vor dem neunhundertsten Jubiläum seiner Gründung durch Kaiser Heinrich, und Prälat Weberling war beauftragt, eine große Sonderausstellung des Domschatzes vorzubereiten. Auch dafür betete er um Kraft und himmlischen Beistand.
Als er sein Gebet beendet hatte, stand Weberling auf und ging durch das Kirchenschiff zum Grab des Bistumsgründers, der auch sein Namenspatron war. Dort verneigte er sich und hob einen Kupferknopf auf, den augenscheinlich einer der zahlreichen Besucher am Tag verloren hatte. Dann betrachtete er einige Augenblicke die Darstellungen auf dem von Tilman Riemenschneider gestalteten Grabmal, auf dem Szenen aus dem Leben des heiligen Kaiserpaares Heinrich und Kunigunde zu sehen waren. Eine Darstellung zeigte die Legende der Seelenwägung. Wie oft hatte er sich dieses Bildnis schon angeschaut, die Figuren schienen vor seinen Augen lebendig zu werden.
An der Himmelspforte rang der Erzengel Michael mit dem Satan um die Seele des Kaisers. Die Dämonen der Hölle zerrten die Waage in Richtung Verdammnis. Doch dann warf der heilige Laurentius einen Kelch in die andere Waagschale. Das Pendel schlug um, und das Tor zum Himmel öffnete sich für den Kaiser.
Es war für Heinrich Weberling gleichermaßen ein Bild der Furcht und der Hoffnung. Es zeigte ihm, wie schmal der Grat war zwischen ewigem Heil in Gottes Angesicht und dem Leiden im Höllenfeuer. Dass auch Könige, Priester oder gar Bischöfe nicht vor der Verdammung gefeit waren, machte seit Jahrhunderten das Tympanon am prächtigen Fürstenportal mit seiner eindrucksvollen Darstellung des Weltgerichts an der nördlichen Langhausseite des Doms deutlich. Auch die Würde eines Domkapitulars war kein Freifahrtschein ins Himmelreich. Das wusste Prälat Weberling nur zu gut und sprach ein Stoßgebet um die göttliche Gnade in der Stunde seines Todes und dass der allmächtige Herr ihn vor einem jähen Ableben bewahre.
Er atmete einmal tief durch und ging dann weiter zum Westchor, wo er die steinernen Stufen emporstieg. Mit einem großen Metallschlüssel öffnete er eine schwere Tür aus Blech und trat durch einen fensterlosen Vorraum in den Segerer, wo der Domschatz aufbewahrt wurde. Der Raum, dessen Bezeichnung wohl eine Verballhornung des lateinischen Wortes Sacrarium war, maß etwa vier auf fünf Meter. Es standen viele Holzkisten und Kartons herum. Er betrachtete eine raumhohe Holzvitrine, hinter deren zweiundzwanzig Glastüren Kelche, Monstranzen, Medaillen, Kreuze, Engelsfiguren sowie ein hölzernes Modell des Doms ihr unbeachtetes Dasein fristeten. In einem breiten Schrank mit Schubladen befanden sich die Paramente, kostbare liturgische Gewänder. An einem Ständer hingen ein Turibulum sowie ein Naviculum, auch Weihrauchschiffchen genannt. Und wenn er in den gläsernen Schrein der Vitrine am Ende des Raumes geblickt hätte, dann hätte er sich vorstellen können, dass ihn die Schädel von Heinrich und Kunigunde aus ihren dunklen Augenhöhlen prüfend anblickten. Die Reliquien, die sich nicht mehr im Kaisergrab befanden, wurden hier in zwei mit Kupferblech verkleideten Ostensorien aufbewahrt. Diese stellten zwei Engel dar, die eine flache Muschelschale für die Kopfreliquiare hielten, welche auf mit weinrotem Samt bezogenen Kissen gebettet waren. Einmal im Jahr, beim Heinrichsfest im Juli, wurden die heiligen Häupter im Dom ausgestellt.
Der Segerer war ein etwas armseliger Ort, an dem die wertvollen Prunkstücke wie vergessene Relikte aus vergangenen Zeiten wirkten. Doch in diesem Jahr des Bistumsjubiläums sollte der Domschatz eine professionelle und angemessene Präsentation erhalten. So wünschte es das Domkapitel. Die Kostbarkeiten, zu denen auch die wertvollen Kaisermäntel von Heinrich und Kunigunde sowie ein Nagel vom Kreuz Jesu gehörten, sollten der Öffentlichkeit im Erdgeschoss im an den südlichen Kreuzgangsflügel angrenzenden Trakt gezeigt werden. Prälat Weberlings immer wieder mal geäußerte Idee, ein eigenes Diözesanmuseum einzurichten, war hingegen weiterhin ferne Zukunftsmusik. Er zweifelte daran, die Verwirklichung dieses Traums noch erleben zu dürfen.
Dass er nicht einmal mehr das nächste Morgengrauen erleben sollte, ahnte Weberling, als ihn der harte Schlag am Hinterkopf traf und er mit dem Gesicht nach vorne auf den historischen Steinboden fiel. Er spürte, wie warmes Blut über seine Stirn lief.
Er wollte schreien, doch seine Stimme erstickte.
Weberling betete: »Jesus, dir leb ich, im Leben und im Sterben.«
Der zweite Schlag war das Letzte, was er in diesem irdischen Leben fühlen sollte.
EINS
Ich stand fassungslos vor dem Gelben Sack im Keller des Mietshauses am Markusplatz und hielt den Holzstiel eines Fruchteises in der Hand, als sich mein Mobiltelefon mit dem allseits bekannten Standardklingelton meldete. Ich versuchte, das Handy mit der rechten Hand aus der Brusttasche meines Kurzarmhemdes zu fischen, ohne den klebrigen Eisstiel weglegen zu müssen. Mit einiger Akrobatik gelang es mir, den Anruf von einer mir unbekannten Bamberger Nummer anzunehmen und dabei den Packen Zeitungen unter dem Arm nicht zu verlieren.
»Horst Müller hier«, meldete ich mich.
»Grüß Gott«, hörte ich die Stimme eines älteren Herrn am anderen Ende der Leitung. »Ich bräuchd achd Boäh groba Brodwöschd und a Pfund Hackfleisch. Des gemischda.«
»Wird erledigt«, antwortete ich und drückte das Gespräch weg. Es geschah mindestens einmal pro Woche, dass ich einen Anrufer in der Leitung hatte, der bei der Telefonauskunft die Nummer der Metzgerei »Wurst Müller« verlangte und wegen undeutlicher Aussprache mit meinem Anschluss verbunden wurde. Ich hatte aufgehört, mich darüber zu ärgern oder gar in Erwägung zu ziehen, den Namen zu ändern oder mir wenigstens eine Geheimnummer zuzulegen. Vermutlich wunderte sich mein Namensvetter aus dem Fleischgewerbe regelmäßig, dass Kunden im Laden standen und bereit waren, auf »Weber’s Grillbibel« zu schwören, dass sie eine telefonische Grillwarenbestellung aufgegeben hatten, von der der Fleischer nicht das Geringste ahnen konnte.
Ich wandte mich wieder meinem Entsorgungsproblem zu. Dass sich ein Holzstab im gemeinschaftlich von allen Mietern genutzten Sack für Plastikabfälle befand, störte nicht nur mein ökologisches Gewissen, sondern vor allem meinen Anspruch an das Einhalten von Regeln und Vorschriften. Was war so schwer daran, die Aufschrift des Beutels zu lesen, wo eindeutig geschrieben stand, dass Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe und Schaumstoffe hineingehörten. Von Holz war hier nirgendwo die Rede. Seit der Einführung des Dualen Systems bei der Abfallentsorgung in Deutschland vor dreißig Jahren war eine ganze Generation herangewachsen, und immer noch gab es Menschen, die nicht wussten, dass die Verpackung einer Zahnbürste in den Gelben Sack gehörte, die Zahnbürste selbst aber nicht, weil sie kein Verpackungsmaterial war.
Ratlos stand ich mit dem Corpus Delicti im Müllraum, wo ein automatischer Lüfter dafür sorgte, dass man nicht sofort in Ohnmacht fiel, sondern etwa zwanzig Sekunden Zeit hatte, seinen Müll auf die blaue, braune oder graue Tonne zu verteilen beziehungsweise in den Gelben Sack zu entsorgen, bevor man das Bewusstsein verlor. Allerdings war die graue Restmülltonne, in die das Holz gehörte, heute geleert worden und stand noch oben vor der Haustür am Straßenrand. Dafür war die blaue Tonne mal wieder randvoll, obwohl das Altpapier erst in zwei Wochen geholt wurde. Der monatliche Entsorgungsrhythmus für die Papiertonne in einem Vier-Parteien-Mietshaus wäre für mich der einzige triftige Grund, über den Bezug eines E‑Papers nachzudenken.
Ich legte den Stiel, der wohl der Überrest eines Flutschfingers oder Dolomitis war, auf den Rand der Biomülltonne und warf den Stapel Zeitungen in die blaue Tonne, deren Deckel jetzt nicht mehr dicht geschlossen werden konnte. »Bamberger Reiter geht in Winterschlaf«, lautete die Schlagzeile auf der oben liegenden Ausgabe. Es war ein Artikel, in dem berichtet wurde, dass das berühmte Standbild wegen Bauarbeiten im Dom mehrere Wochen lang hinter einer schützenden Verkleidung verborgen sein werde. Die Zeitung war schon einen Monat alt.
Wieder läutete mein Handy.
Genervt drückte ich die grüne Taste und sprach: »Brodwöschd sind heute aus.«
»Wie bitte?«, hörte ich in der Leitung. »Ist das ein Codewort, Herr Kommissar?«
Ich schaute auf das Display. Eine unbekannte Nummer.
»Wer ist da?«, fragte ich. »Hier ist jedenfalls nicht Wurst Müller.«
»Hier ist Monsignore Momberg. Herr Kommissar, wir kennen uns. Sie erinnern sich vielleicht …«
Der Dompfarrer. Momberg wie Domberg. Ich hatte mit ihm vor einigen Jahren zu tun, als mehrere Honoratioren der Stadt anonyme Post mit geköpften Gartenzwergen bekommen hatten. Momberg hatte auch zu ihnen gehört. Vermutlich hatte er die Visitenkarte mit meiner Handynummer aufgehoben. Die Nummer war geblieben, auch wenn ich inzwischen mein jahrelang bewährtes, unzerstörbares Nokia-Gerät gegen ein neumodisches iPhone ohne Tasten und Antenne eintauschen musste, das jeden Abend neuen Strom aus der Steckdose brauchte.
»Ja, ich erinnere mich natürlich gut, Herr Pfarrer. Was kann ich für Sie tun? Hoffentlich kein Mord auf dem Domberg.«
»Wenn’s nur ein Mord wäre, Herr Kommissar.« Ich hörte Verzweiflung in seinem Seufzen. »Nein, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Etwas Unglaubliches.«
Wenn ein Geistlicher von etwas Unglaublichem sprach, dann musste wohl tatsächlich etwas Besonderes geschehen sein.
Ich schaute auf meine Tchibo-Armbanduhr und sagte: »Ich bin seit fünfundsiebzig Minuten nicht mehr im Dienst, Herr Pfarrer. Können Sie morgen früh in mein Büro in der Schildstraße kommen? Wenn es wirklich dringend ist, wählen Sie die Hundertzehn.«
»Ich bitte Sie!«, sprach Momberg in einem Tonfall, auf den ich am liebsten geantwortet hätte: »In Ewigkeit, amen.«
»Es ist eine etwas delikate Angelegenheit«, fügte der Dompfarrer leiser hinzu. »Ich möchte darüber nicht am Telefon reden. Und vor allen Dingen möchte ich nicht, dass irgendjemand davon erfährt und ein offizieller Vorgang daraus wird.«
»Wenn Sie die Polizei anrufen, wird natürlich ein offizieller Vorgang daraus, der als Allererstes ein Aktenzeichen bekommt«, belehrte ich den Geistlichen.
»Genau das ist der Grund, warum ich Sie persönlich anrufe, Herr Kommissar. Privat sozusagen. Sie müssen mir helfen. Ich bitte Sie. Außerhalb des offiziellen Dienstweges.«
Die Sekunde, die ich zögerte, deutete Momberg sofort als Zustimmung. »Danke, Herr Kommissar. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Vergelt’s Gott! Ich erwarte Sie vor der Marienpforte des Doms. Am besten jetzt gleich.«
»Na gut, weil Sie es sind«, sagte ich. Doch er hatte schon aufgelegt. Ich schaute auf meine Armbanduhr und seufzte, auch wenn ich nicht genau wusste, welches der Domportale die Marienpforte war. »Aber ich muss vorher noch etwas Wichtiges erledigen.« Ich verstaute das Handy und nahm den Holzstiel mit nach oben.
Im Erdgeschoss holte ich aus meinem Briefkasten das »Wobla«, die Monatszeitschrift der Polizeigewerkschaft, den Pfarrbrief des Seelsorgebereichs Bamberger Westen sowie einen Brief meines Vermieters, der vermutlich die jährliche Mieterhöhung ankündigte. Dann öffnete Frau Weimer die Wohnungstür, als hätte sie hinter ihrem Spion auf mich gelauert. Die alte Dame mit den weißen Haaren wedelte mit einem Packen Blätter.
»Schön, dass ich Sie zufällig sehe, Herr Müller!«
»Zufällig, jaja«, murmelte ich, um dann freundlich zu antworten: »Freue mich auch immer, Sie zu sehen. Geht’s Ihnen gut?«
Dies war eine rhetorische Frage. Denn Frau Weimer war, seitdem ich hier wohnte und ihre Einkäufe sowie das Wischen der Treppe übernahm, keinen einzigen Tag krank gewesen. Selbst die Coronainfektion, die sie sich beim Lungensport im Seniorenzentrum eingefangen hatte, war symptomlos an ihr vorbeigegangen, während der fünfzigjährige Sparkassenmitarbeiter aus dem zweiten Stock zwei Wochen auf der Intensivstation gelegen hatte.
»Danke, ich brauche mal wieder Ihre Hilfe, Herr Müller.«
»Müssen Sie Ihre Patientenverfügung aktualisieren?«
Das Regeln der letzten Dinge gehörte seit Jahren zu Frau Weimers liebster Freizeitbeschäftigung, ohne dass ihr Gesundheitszustand dazu den geringsten Anlass gegeben hätte.
»Nein. Es geht um die Liste.«
Wenn Frau Weimer von der Liste sprach, dann meinte sie die Namen der Personen, die zu ihrer Beerdigung einzuladen wären. Sie machte immer handschriftliche Änderungen, die ich dann auf dem Computer übernehmen musste. Die Liste wurde an drei verschiedenen Stellen aufbewahrt, eine außerhalb des Hauses, für den Fall eines Wohnungsbrandes.
»Ist wieder jemand gestorben, den wir streichen müssen?«, fragte ich und konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Nein, es ist diesmal etwas mehr zu tun. Ich habe bei allen Anschriften, falls vorhanden, die E‑Mail-Adresse ergänzt. Dann bekommen sie die Benachrichtigung noch schneller, wenn es denn so weit ist.« Als sie meinen Blick bemerkte, der sagte, das könnte noch zehn Jahre dauern, betonte sie gleich: »Es kann schon morgen so weit sein.«
»Ja, oder heute noch. Oder Sie überleben mich. Dann muss sich jemand anders um die Liste kümmern. Ich erledige das.«
»Vielen Dank, Herr Kommissar. Nehmen Sie das hier«, sagte sie und zauberte scheinbar aus dem Nichts eine Flasche mit brauner Flüssigkeit hervor. Ein handgeschriebenes Etikett wies den Inhalt in Sütterlinschrift als »Haselnußliqueur« aus.
»Danke vielmals, aber ich muss los. Die Pflicht ruft.«
***
Mit meinem Pedelec kam ich über die Residenzstraße mühelos auf dem Domberg an. Den Vornamen des Dompfarrers hatte ich vergessen, ein großer Heiliger war’s gewesen. Markus, Lukas, Johannes? Dafür konnte ich mich genau daran erinnern, dass er eine Haushälterin namens Frau Putzer hatte.
Ich sah den über siebzigjährigen Priester mit dem schmalen Gesicht und der spitzen Nase schon vor den Domstufen stehen und parkte meinen elektrischen Drahtesel vor den Mauern des Domkranzes unter einer Hinweistafel für eine Sonderausstellung im Diözesanmuseum.
»Oh Gott, Herr Pfarrer«, zitierte ich den Titel einer Fernsehserie aus den achtziger Jahren.
»Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie so schnell kommen konnten.« Monsignore Momberg streckte mir seine knochige Hand entgegen. Sein Gesicht war fast so weiß wie seine Haare. Umso schwärzer wirkte sein Priesteranzug. Am Revers war ein kleines silbernes Kreuz befestigt.
»Was ist passiert, das meine Hilfe erforderlich macht, Sie aber hindert, offiziell die Polizei zu rufen? Ich bin sehr gespannt.«
»Kommen Sie mit hinein, Herr Kommissar. Sie wissen vielleicht, dass wir den Dom zu Beginn der Fastenzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen hatten. Es wurden zwei Joche des Mittelschiffes eingerüstet, um hier Arbeiten am Gewölbe durchzuführen. Um während dieser Maßnahmen die Unversehrtheit des Reiters zu gewährleisten, wurde er mit einem Schutzgehäuse versehen.«
»Ja, davon habe ich in der Zeitung gelesen. Worauf wollen Sie hinaus?«
Momberg schaute sich um, ob niemand in der Nähe war. Dann öffnete er mit einem großen Schlüssel die versperrte Pforte und flüsterte: »Kommen Sie. Es darf uns niemand hören.«
»Sie werden mir jetzt nicht verraten, dass ein Einbrecher den Opferstock aufgebrochen hat, oder?«
»Sie werden gleich nicht mehr scherzen, Herr Kommissar.«
Momberg sperrte die Tür hinter uns wieder ab. Wir gingen durch eine weitere Doppeltür und einige Meter an den Propheten-Reliefs, am Grabmal von Erzbischof Friedrich von Schreiber sowie am Grabstein von Erzbischof Joseph von Schork vorbei. Der Dom, in dem sich tagsüber immer zahlreiche Touristen aufhielten und wo Führungen für einen pausenlosen Trubel sorgten, war gespenstisch still.
»Jetzt spannen Sie mich nicht länger auf die Folter. Was ist Schreckliches geschehen?«
»Schauen Sie hier!« Momberg deutete auf die große Holzverkleidung, auf der eine Fotografie des Bamberger Reiters in Originalgröße befestigt war.
»Ja, davon haben Sie bereits erzählt. Der Reiter wurde aus Sicherheitsgründen mit einem Schutzgehäuse versehen. Und?«
Momberg schwieg, hob mit beiden Händen das Holzgehäuse an und bewegte es einen halben Meter zur Seite. Mit einer Kopfbewegung forderte er mich auf, hinter das Gehäuse zu blicken.
»Verstehen Sie mich jetzt?«, fragte er, nachdem ich vorsichtig hinter die Verkleidung geschaut und mir staunend die Augen gerieben hatte.
Ich nickte.
Ich hätte mich weniger gewundert, wenn der Dompfarrer mir mitten im Dom eine jodelnde Giraffe mit Pudelmütze und Sonnenbrille gezeigt hätte.
Einige Augenblicke schauten wir uns schweigend an. Dann sprach ich die Worte aus, die einen eigentlich unvorstellbaren Vorgang beschrieben: »Man hat also den Bamberger Reiter gestohlen?«
Momberg nickte stumm und schloss die Augen, als könnte er damit für einen Moment das Ereignis ungeschehen machen.
»Setzen wir uns.« Er deutete auf die hinterste Bankreihe vor dem Kaisergrab. Dort nahmen wir Platz.
»Das müssen Sie mir erklären! Wie kann das geschehen? Der Reiter stand dort doch nicht auf dem Podest herum, sodass man ihn einfach mitnehmen könnte wie ein Gemälde, das an der Wand hängt. Der war doch fest eingemauert.«
»Der Reiter ist ein sogenanntes Hochrelief, das nicht direkt in den Pfeiler eingelassen ist, sondern an die Wand angemörtelt wurde. Aber Sie haben natürlich recht, man kann ihn nicht einfach so mitnehmen. Wer macht so etwas? Und warum?«
»Eine Entführung vielleicht?«, dachte ich laut nach. »Ich meine, es könnte jemand versuchen, ein Lösegeld zu erpressen. Welchen Wert hat der Reiter?«
»Was denken Sie?« Mombergs Gesichtsausdruck machte deutlich, für wie absurd er meine Frage hielt. »Er ist unbezahlbar!«
»Das ist natürlich klar. Aber es muss doch so was wie eine Versicherungssumme geben.«
»Man versichert immer den Wert, den eine Wiederbeschaffung kosten würde. Wie wollen Sie ein so bedeutendes Kunstwerk wiederbeschaffen?«
»Hm, verstehe. Und was ist mit dem Dom? Der muss doch auch mit einer Summe in der Vermögensbilanz des Bistums stehen.«
»Ja, der Dom steht im Vermögensbericht des Metropolitankapitels. Und zwar mit exakt null Euro. Weil er unverkäuflich ist.«
»Gut, das habe ich verstanden. Aber ein geraubtes Kunstwerk wäre ja schon wiederzubeschaffen. Deshalb liegt ja wohl eine Entführung am ehesten auf der Hand. Können Sie einen Zeitraum eingrenzen, wann der Reiter gestohlen wurde?«
»Als die Verkleidung aufgebaut wurde, war er definitiv noch da. Das war vor wenigen Wochen, am Faschingsdienstag. Danach hat wohl bis heute niemand hinter die Wand geschaut.«
»Aber Sie haben geschaut?«
»Zufällig, ja. Ich habe gesehen, dass hier an der Holzwand mehrere Schrauben gelockert sind. Als ich das überprüfen wollte, konnte ich durch den Spalt sehen, dass da etwas nicht in Ordnung war.«
»Nun gut, wenn wir davon ausgehen, dass wir es mit einem Verbrechen zu tun haben, warum wollen Sie nicht offiziell Anzeige erstatten? Wer ist denn hier der Hausherr, der Erzbischof?«
Momberg atmete tief durch. »Der Dom gehört dem Metropolitankapitel, vertreten durch den Dompropst, den Domdekan und den Summus Custos, das bin ich.«
»Summus Custos?«
»Der Domkustos ist der höchste Hüter der Kathedralkirche. Er koordiniert im Auftrag des Domkapitels in Zusammenarbeit mit der Dombauhütte die Aufgaben in und um den Dom.«
»Also auch Bauarbeiten?«
»Richtig. Und warum ich nicht die Polizei einschalten möchte, hat einen einfachen Grund. Wie Sie wissen, soll der Papst in diesem Jahr erstmals nach Deutschland kommen. Und es ist im Gespräch, dass er dabei auch auf eine vor einigen Jahren ausgesprochene Einladung hin Bamberg besuchen könnte. Anlass war damals der tausendste Jahrestag der Weihe der Stephanskirche durch Papst Benedikt VIII.«
»So oft kommt wohl nicht ein Papst nach Bamberg, obwohl ja jeder Tourist weiß, dass dort hinten das einzige Papstgrab nördlich der Alpen ist.« Ich deutete auf den Westchor, wo hinter dem Bischofsstuhl Papst Clemens II. begraben war, der bis zu seinem Tod im Jahr 1047 in Doppelfunktion auch Bamberger Bischof geblieben war.
»So ist es. Der letzte Papst, der im Bamberger Dom die Messe gefeiert hat, war Leo IX. im 11. Jahrhundert.«
»Es wird also höchste Zeit.«
»Genau. Um die Möglichkeiten für einen Papstbesuch in Bamberg auszuloten, ist derzeit der Kurienkardinal Aurelio García zu Gast. Es wäre schon ungeheuer peinlich, wenn er erfahren würde, dass wir nicht in der Lage sind, für die Sicherheit eines steinernen Reiters zu sorgen. Sie wissen, dass der Vatikan keinen Spaß versteht, wenn es um den Schutz des Heiligen Vaters geht.«
»Völlig zu Recht. Für den Papst hätten wir bei einem Besuch in Bamberg gewiss bessere Sicherheitsvorkehrungen als einen Holzverschlag. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Was genau kann ich für Sie tun? Ich bin Kriminalhauptkommissar und kein Privatdetektiv.«
»Ich weiß. Aber zumindest solange der Kardinal hier ist, würde ich gerne um höchste Diskretion bitten.«
»Wie lange ist dieser Kardinal denn hier?«, fragte ich.
»Das weiß ich nicht genau, ein paar Tage noch. Eine Woche?«
»Aber dann schalten Sie offiziell die Polizei ein. Und auch, falls sich vorher ein Erpresser melden sollte. Abgemacht?«
Momberg nickte. »Danke, dass Sie mir helfen.«
Ich seufzte. »Ob und wie ich Ihnen helfen kann, weiß ich noch nicht. Aber ich denke darüber nach.«
»Das ist sehr freundlich, Herr Kommissar. Eine Frage habe ich noch.«
»Ja?«
»Was ist das für ein Bratwurstcode, den Sie am Telefon verwendet haben?«
Ich musste schmunzeln und sagte: »Vergessen Sie das schnell wieder. Darüber darf ich nicht sprechen. Dienstgeheimnis.«
ZWEI
Am nächsten Morgen herrschte in unserem Büro im dritten Stock der Polizeiinspektion Alarmstufe Rot. Diesen Eindruck jedenfalls erweckten die hektisch blinkenden Warnanzeigen am Kaffeevollautomaten sowie meine Kollegin Paulina, die mindestens ebenso hektisch in dem Bedienungshandbuch blätterte, das ungefähr so dick war wie das Nürnberger Telefonbuch. Falls sich noch jemand an Telefonbücher erinnert.
»›Wenn das Ausrufezeichen rot leuchtet, ist die Abtropfschale und der Kaffeesatzbehälter nicht richtig eingesetzt.‹«
»Sind«, korrigierte ich, ohne dass sie reagierte. »Nicht ›ist‹.«
»›Wenn die Warnanzeige langsam blinkt, ist die Brühgruppe nicht richtig eingesetzt, oder der Heißwasserauslauf ist verstopft.‹« Sie blätterte auf die nächste Seite. »›Wenn die Wasseranzeige blinkt und die Espressotaste dauerhaft leuchtet, befindet sich Luft im System.‹ Aber hier leuchtet und blinkt alles gleichzeitig!«
Ich rührte in meinem Filterkaffee und blickte über meine randlose Brille. »Schon mal das AEG-Prinzip probiert?«
»AEG?« Paulina schaute mich fragend an. »Sie sind doch Rowenta-Fan. Und das hier ist eine Jura-Maschine.«
»Ausschalten. Einschalten. Geht wieder. AEG.«
»Tolle Idee, Horst. Ich hab schon dreimal den Stecker gezogen. Und ich brauche endlich einen Latte macchiato.«
»Vielleicht hat Ihre Maschine eine Laktoseintoleranz?« Sosehr ich meiner jungen Kollegin diese Errungenschaft der Technik gönnte, so sehr spürte ich auch immer eine gewisse Genugtuung, wenn das Hightechgerät, das fast so viel gekostet hatte wie ein Gebrauchtwagen und mit der Technik eines tragbaren Atomkraftwerks ausgestattet war, vor lauter Firlefanz seine Kernkompetenzen vernachlässigte und mehr Ärger als Nutzen brachte. Meine Rowenta hatte mich seit über zehn Jahren nicht im Stich gelassen, auch wenn sie nur ganz gewöhnlichen Filterkaffee produzierte.
»Sehr witzig!« Paulina wirkte leicht gereizt. »Sie wissen genau, dass ich keine Kuhmilch trinke. Aber das scheint hier nicht das Problem zu sein. Und bitte kommen Sie nicht wieder auf die Idee, mir in gnädiger Güte etwas von Ihrer –«
»Sagen Sie nicht wieder Plörre zu meinem Kaffee!«
»Mir egal, wie Sie diese flüssige Substanz in Ihrer Gewerkschaftstasse nennen. Moment mal. Ich glaub, ich hab’s!« Sie hatte noch mal umgeblättert. »Hier steht: ›Problem: Die Warnanzeige, die Wasseranzeige, die Kaffeesatzbehälteranzeige und die Kaffeeanzeige blinken gleichzeitig …‹«
»Ja?«
»›Ursache: Die Maschine ist defekt.‹«
»Oh!«
»›Lösung: Sie benötigen den Kundendienst.‹«
Ich schmunzelte, vermied es aber, mir jede Schadenfreude anmerken zu lassen. Paulina pfefferte das Handbuch verärgert in eine Schublade, wodurch das Sideboard, auf dem die Maschine stand, so sehr wackelte, dass die Packung Sojamilch umfiel und der dickflüssige Inhalt sich über der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift ›Die Kriminalpolizei‹ ausbreitete.
»Ist nicht schlimm«, rief ich beschwichtigend und sprang auf, um mit einem Spültuch zu verhindern, dass die Milch auf den Fußboden tropfte. »Ich hab das Heft schon gelesen.«
»Danke, Horst«, sagte Paulina und holte aus dem Kühlschrank eine Flasche Johannisbeersaft. »Kaffee wird total überbewertet.«
Der Satz klang aus ihrem Mund so überzeugend, als hätte sie gesagt: »Schminken macht hässlich.«
»Was haben Sie eigentlich mit Ihren Augenbrauen angestellt?«, wollte ich wissen.
Ihre Miene hellte sich auf. »Ach, Sie bemerken das? Das hätte ich nicht gedacht. Microblading. Sieht gut aus, oder?«
»Ja, schon. Etwas unnatürlich vielleicht. Aber interessant.«
»Danke auch, Horst. Sie sollten sich übrigens mal die Augenbrauen zupfen lassen, wenn ich das sagen darf. Oder haben Sie es inzwischen aufgegeben, in Ihrem Leben noch mal eine Frau kennenzulernen?«
»Lassen wir das lieber«, erwiderte ich. Seit meiner Scheidung vor weit über zehn Jahren pflegte ich das Klischee, dass ein Polizeibeamter ein einsamer Wolf und mit seinem Beruf verheiratet sein musste. Inzwischen war ich deutlich über fünfzig. Die Midlife-Crisis hatte ich schon lange hinter mir gelassen, und so was wie ein »zweiter Frühling« war nicht wirklich in Sicht, dafür hatte ich es mir im Spätsommer des Lebens bequem gemacht, bevor er fließend in den Frühherbst übergegangen war. Aber ich war nicht unzufrieden mit meinem Leben. Ich hatte zwei gut geratene erwachsene Kinder, einen spannenden Beruf im Kommissariat 1 der Bamberger Kripo und eine liebe, zwanzig Jahre jüngere Kollegin, mit der es nie langweilig wurde. Und jenseits der Arbeit holte ich mir meine Alltagsfreude bei einem Gläschen Eierlikör, einer »Derrick«-Folge auf DVD oder einer der zahlreichen Schlagersendungen im Fernsehen. Eine Frau konnte ich mir in dieser Konstellation nicht mehr vorstellen.
»Haben Sie die Mail von Dr. Goos schon gesehen?«, fragte Paulina. »Der Polizeidirektor lädt zu einer Besprechung zur Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für einen möglichen Papstbesuch. Da gibt es wohl Pläne, dass der Papst im Juli zum Heinrichsfest nach Bamberg kommt. Das hat uns ja gerade noch gefehlt.«
»Was meinen Sie? Die Konferenz oder den Besuch des Heiligen Vaters?«
»Ach, beides. Warum kümmert sich nicht das BKA um so was?«
Paulina hatte eine Allergie gegen alles Katholische, obwohl sie von ihrer polnischstämmigen, frommen Mutter auf den Namen Johanna Paulina getauft worden war. Hätte sie eine kleine Schwester, wäre deren Name vermutlich Johanna Paulina die Zweite.
»Was anderes, Paulina. Weil Sie doch so gut googeln können …«
Sie verdrehte die Augen. »Ist ganz einfach: Browser aufrufen, www, dann g, o, o, g, l, e, Punkt, d, e schreiben und ein Wort in den Suchschlitz eintippen. Und schon öffnen sich die Tore zu den endlosen Weiten des World Wide Web.«
»Jaja, aber Sie finden immer schneller das Richtige. Ich brauche ein paar Infos über den Bamberger Reiter. Und zwar nicht nur das, was in jedem Reiseführer steht.«
»Den Bamberger Reiter? Werden Sie jetzt zum Hobbykunsthistoriker? Oder machen Sie eine Fortbildung als Fremdenführer?«
Kurz überlegte ich, ob ich Paulina über die Hintergründe meines Interesses wirklich täuschen konnte. Dann kam ich aber zu der Überzeugung, dass ich sie einweihen musste. Und so berichtete ich ihr davon, was ich am Vorabend mit eigenen Augen im Dom gesehen oder, besser gesagt, nicht gesehen hatte.
»Das gibt’s doch nicht!«, war ihre einzige Reaktion. »Und der Dompfarrer will die Sache wirklich geheim halten?«
Ich erläuterte ihr den Zusammenhang mit der Visite des Kardinals zur Vorbereitung des Papstbesuches.
»Krasse Sache«, sagte Paulina und dachte kurz nach. »Könnte es eine Rolle spielen, welche Person auf dem Pferd dargestellt ist?«
»Kaum«, antwortete ich. »Denn diese Frage ist, soweit ich weiß, nicht mit letzter Sicherheit geklärt. Allgemein wird vermutet, dass es sich um den heiligen König Stephan von Ungarn handelt. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Thesen gibt.«
»Moment«, sagte Paulina und tippte auf ihrer PC-Tastatur. Kurz darauf hatte sie Erkenntnisse gewonnen. »Auf Wikipedia wird auch zuerst der heilige Stephan genannt, der Schwager von Kaiser Heinrich. Weil die Figur in einer Kirche aufgestellt und keine Grabfigur ist, müsse es ein Heiliger sein. Und wegen der Krone und des Baldachins müsse es ein König sein. Einer Legende zufolge galoppierte Stephan bei einem Bamberg-Besuch noch als Heide auf einem Pferd in den Dom. Zugleich könne das Pferd aber auch ein Symbol für die Ungarn sein, die man traditionell mit dem Reitervolk der Hunnen gleichsetzte.«
»Und gibt es noch andere Vermutungen?«, fragte ich.
»Ja. Es werden noch Philipp von Schwaben, ein namenloser Staufer oder ein Symbol für den Messias, der als König der Könige am Ende der Zeiten wiederkommt, genannt. Das hilft uns alles nicht weiter, oder?«
»Wissen Sie, was weiterhelfen würde? Ich lade Sie beim Bäcker Kerling gegenüber zu einem koffeinhaltigen Heißgetränk Ihrer Wahl ein. Damit Sie wieder Farbe ins Gesicht bekommen. Dieses Elend kann ich nicht länger anschauen.«
»Gute Idee, Horst. Vielleicht kann sich Wolfgang aus der EDV-Abteilung ja mal unseren –«
»Ihren!«
»Meinen Kaffeeautomaten anschauen.«
»Ich glaube auch, dass da ein Fachmann ranmuss. Vielleicht ist die Festplatte voll oder die Soundkarte kaputt, oder ein Brennstab muss ausgetauscht werden.«
»Haha.«
In meiner Sakkotasche entdeckte ich den inzwischen etwas zerknitterten Brief meines Vermieters. Ich öffnete ihn und sah sofort, dass es sich nicht um eine Mieterhöhung handelte.
In dieser Sekunde klopfte es an der Tür, die im selben Moment geöffnet wurde. Kommissariatsleiterin Veronica Stadel betrat, wie immer umgeben von einer zarten Duftwolke, die ich diesmal irgendwo im Bereich zwischen Orange und Vanille verortet hätte, den Raum mit den Worten: »Guten Morgen, es gibt Arbeit.«
»Der Papstbesuch? Wissen wir schon«, sagte ich eine Spur zu gelangweilt, um nicht unhöflich zu klingen.
»Der kann warten. Es gibt einen Leichenfund am Kranen. Die Kollegen vom Kriminaldauerdienst sind schon vor Ort.«
»Wieder einer, der beim Junggesellenabschied volltrunken in die Regnitz gesprungen ist?« Ein solcher Fall wäre rasch abgearbeitet und zu den Akten gelegt. Für Badeunfälle war es allerdings noch etwas zu früh im Jahr.
»Nein, es handelt sich um Tod durch Fremdverschulden zum Nachteil des Lehrstuhlinhabers für Kunstgeschichte.«
»Kunstgeschichte? Das trifft sich doch gut«, murmelte Paulina. Wir ignorierten den fragenden Blick unserer Vorgesetzten.
»Wir sind schon unterwegs«, sagte ich. Und leise zu Paulina: »Das Heißgetränk verschieben wir auf später.«
***
Immer wenn wir die Kollegen Frenz, Böhnlein und Isernhagen an einem Tatort trafen, witzelten wir wegen der Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen darüber, dass das FBI schon im Einsatz war. Dabei war KDD die korrekte Abkürzung für den Kriminaldauerdienst, der rund um die Uhr ausrückte und bei Verbrechen aller Art den sogenannten »Ersten Angriff« vornahm. Das hieß, dass wir schon viele wichtige Informationen erhielten, wenn wir am Tatort eintrafen, der in diesem Fall in einem rosafarbenen Backsteingebäude Am Kranen 10 lag.
Wir erreichten es durch die Pforte des benachbarten »Hochzeitshauses«, in dem die Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften untergebracht war. Das entsprechende Türschild wies darauf hin, dass die englische Sprache das griffigere Wort »Humanities« verwendete. Durch ein großzügiges Foyer gingen wir in ein dunkles Treppenhaus, wo ein Schild ohne englische Übersetzung mit den Worten »Fahrstuhl defekt« einen Fußmarsch in den dritten Stock befahl. An den Wänden hingen mehrere Tafeln, die über mehr oder weniger aktuelle Forschungsprojekte informierten, zum Beispiel »Mittelalterbilder und Denkmalpflege« oder »Kaisergewänder im Wandel«.
Die Leiche fanden wir hinter einer roten Bürotür am Ende eines schmalen Flurs im Dachgeschoss vor, wo Kriminalhauptmeister Frenz uns mit knappen Worten begrüßte: »Kein schöner Anblick. Ihr habt hoffentlich schon gefrühstückt. Die Aussicht nach draußen entschädigt aber. Dafür könnte man Eintritt verlangen.«
Der Tote lag vor einem stützenden Pfeiler mitten im Raum mit dem Rücken nach oben auf dem grauen Veloursteppichboden. Der Hinterkopf war blutverschmiert. Beim Fallen hatte das Opfer offenbar noch eine Stehlampe umgeworfen. Durch das kleine Fenster in der Dachschräge konnte man wahlweise nach links auf das Alte Rathaus oder geradeaus auf den Dom blicken, dessen Türme hinter einer Häuserfassade am Regnitzufer hervorspitzten. Der Büroraum selbst hatte niedrige Decken und war auffallend schlicht und zweckmäßig eingerichtet. An der Decke waren Neonlampen montiert.
Isernhagen ergänzte: »Der Tote war hier der Herr Professor. Paul Raback ist sein Name. Achtundfünfzig Jahre alt. Eine Konifere auf seinem Gebiet, wenn man seiner hübschen Assistentin glauben darf. Die hat ihn gefunden und sitzt nebenan.«
Isernhagens etwas nervige Marotte war es, Fremdwörter bewusst falsch zu benutzen. Deshalb gingen wir nicht darauf ein, dass er statt Konifere eigentlich Koryphäe meinte.
»Und weil ihr als Nächstes nach der Todesursache fragen werdet …« Böhnlein zeigte ein Blatt Papier, den Totenschein: »›Gehirnblutung und Schädelbasisbruch durch stumpfe äußere Gewalteinwirkung‹, hat der Notarzt aufgeschrieben. Diese Bronzeskulptur ist eindeutig die Tatwaffe.« Er deutete auf ein modernes Kunstwerk von der Größe eines Schuhkartons, bei dem ich erst auf den zweiten Blick erkannte, dass es sich um eine angedeutete Darstellung des Bamberger Reiters handelte. Daneben stand ein Nummerntäfelchen mit der Ziffer vier.
»Was noch interessant wäre«, sagte Isernhagen, »hier am Büro sind Einbruchspuren erkennbar, an der Haustür unten aber nicht. Fingerabdrücke Fehlanzeige. Der Täter trug vermutlich Handschuhe. Jetzt müsst ihr nur noch rauskriegen, was der Einbrecher hier klauen wollte.«
Ich schaute mich in dem Büro um. Überall lagen Bücher und Papierstapel sowie in Plastikheftern eingereichte Seminararbeiten von Studenten oder, wie man heute sagte, Studierenden. In einem hellen Holzregal, das die gesamte Länge des Raumes ausfüllte, standen Werke zu verschiedenen Themen, darunter auch ein Kunstlexikon mit zwei Dutzend Bänden sowie zahlreiche Ausstellungskataloge und Aktenordner. Daneben war eine Playmobilfigur zu sehen, die einmal mehr den Bamberger Reiter darstellte und zum tausendsten Domjubiläum als Sonderedition erschienen war. Ein Eckschreibtisch stand mitten im Raum, und auch auf einem runden Besprechungstisch lagen Dutzende Bücher, die den Markierungen zufolge aus der Staats- oder der Universitätsbibliothek entliehen waren. Es wäre kaum Platz für eine Kaffeetasse gewesen.
»Wir sprechen mal mit der Assistentin«, sagte ich zu Paulina.
Gemeinsam gingen wir in den Nebenraum. Die Frau Mitte zwanzig saß an einem Schreibtisch und hielt sich an einem Thermobecher fest. Sie hatte ihre langen blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und trug ein rotweiß gepunktetes Halstuch über einem eng geschnittenen schwarzen T‑Shirt.
Mit den Worten »Grüß Gott, Frau …« ging ich auf sie zu und streckte ihr die Hand entgegen.
»Rasch, Jenny. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Lehrstuhl und arbeite an meiner Promotion.«
»Sie haben die Leiche von Professor Raback gefunden?«, fragte ich. »Erzählen Sie bitte genau.«
Sie nickte und atmete tief durch. »Ja. Ich bin heute früh gegen neun Uhr ganz normal ins Büro gekommen. Als ich die Tür mit dem Transponder öffnen wollte, fiel mir gleich auf, dass etwas nicht stimmte. Paul, also der Professor, ist immer schon vor mir da. Ich rief also ›P… Herr Professor‹ durch die Tür. Aber niemand reagierte.«
»Sie können ruhig sagen, dass Sie Raback geduzt haben. Damit machen Sie sich nicht sofort verdächtig, Frau Rasch.«
Paulina und ich nannten uns beim Vornamen, sagten aber Sie zueinander. Das distanzlose »Du« unter nicht miteinander verwandten oder befreundeten Erwachsenen gehörte für mich eher auf Baustellen, in Rotlichtetablissements oder ins kriminelle Milieu. Aber offensichtlich war es auch in Akademikerkreisen verbreitet.
»Wir haben halt schon viele Jahre eng miteinander gearbeitet. Er ist mein Doktorvater … war. Was wird jetzt aus meiner Promotion?«
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich bin sicher, es gibt Regelungen für den Fall, dass der Doktorvater während der Promotion das Zeitliche segnet. Ist vermutlich nicht zum ersten Mal passiert. Die Tür hier oben war aufgebrochen, und unten ist Ihnen nichts aufgefallen? Das könnte bedeuten, dass der Mörder einen Schlüssel für das Haus, aber nicht für das Büro hatte.«
»Nicht zwangsläufig. Man kann durch die Kaffeebar unten am Kranen auch hier ins Gebäude gelangen.«
»Sagen Sie, Frau Rasch, wenn Sie so eng waren mit dem Herrn Professor, dann wissen Sie doch sicher, ob er Feinde hatte, die ihm nach dem Leben trachten könnten?«
Jenny Rasch dachte kurz nach. »Er hatte nicht nur Freunde an der Uni. Ich sag mal so, es gab schon ein paar Rivalen. Aber die würde ich nie des Mordes bezichtigen.«
»Was waren das für Rivalen?«, hakte Paulina nach.
»Professor Raback wollte voriges Jahr Dekan werden, er verlor aber die Kampfkandidatur gegen Professor Niedermeyer, einen Pathopsychologen. Das war eine kleine Schlammschlacht der beiden. Die haben sich nichts geschenkt. Es endete dann knapp für Niedermeyer. Paul kündigte anschließend an, sich um das Amt des Uni-Präsidenten zu bewerben. Darauf verbreitete Niedermeyer gezielt in der Presse das Zitat, dass man mit einer Kandidatur als Uni-Präsident unter Beweis stelle, dass man in Forschung und Lehre nichts mehr zu leisten gedenke. Er hielt ihm also zwischen den Zeilen vor, dass er eine Karriere in der Verwaltung anstrebte, weil er in der Wissenschaft nichts mehr erreichen konnte. Ich hielt das für alberne Sandkastenspiele von erwachsenen Männern.«
»War er in einer Partei aktiv?«, fragte ich, um ein politisches Motiv auszuschließen.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Er hat sich in den sozialen Netzwerken deutlich geäußert, wenn gegen Flüchtlinge gehetzt oder der Klimawandel geleugnet wurde und so was. In der Pandemie hat er die Maßnahmen der Regierung verteidigt. Dafür wurde er von einigen rechten Spinnern immer wieder angegangen. Einmal gab es eine sehr heftige Diskussion in einer Facebook-Gruppe, als über angebliche Nazi-Gemälde im Rathaus gestritten wurde. Ich habe das aber nicht im Einzelnen verfolgt, weil ich auf Facebook nicht unterwegs bin. Ich halte die sozialen Medien für Zeitverschwendung.«
»Was waren die Fachgebiete von Professor Raback?«, wollte ich wissen. »Worüber hat er zuletzt geforscht?«
Jenny Rasch ging wieder in das Büro des Professors und deutete auf den Bücherstapel auf dem Schreibtisch. Wir folgten ihr.
»Da sehen Sie, womit er sich gerade beschäftigt hat. Das sind alles Veröffentlichungen über den Bamberger Reiter.«
Paulina und ich blickten uns an.
»Was ist los?«, fragte sie, als sie unsere Reaktion bemerkte. »Habe ich etwas Falsches gesagt?«
»Schon gut«, sagte ich. Auf dem obersten Buch des Stapels lag ein Smartphone. »Das nehmen wir mal mit.« Ich packte das Handy in eine Plastiktüte. »Wissen Sie zufällig den PIN-Code? Das würde uns die Arbeit erleichtern.«
»Ja. Fünfundzwanzig null neun achtundneunzig.«
Ich schrieb die Ziffern in mein Notizbuch. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin schien gut informiert zu sein.
Ich nahm das oberste Buch auf dem Stapel in die Hand. Es hatte den Titel »Ungarische Jahrbücher« und war aus dem Jahr 1924. »Ungarn?«, fragte ich. »Forschte er darüber, wen der Reiter darstellte?«
»Ja, dieses Buch enthält einen Beitrag des früheren Bamberger Weihbischofs Adam Senger über den Reiter.«
»Und dieses Buch hat er auch gerade gelesen?«, fragte Paulina und griff zu einem alten Bildband mit dem Titel »Der Bamberger Dom und seine Bildwerke, aufgenommen durch Walter Hege«.