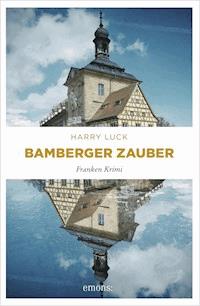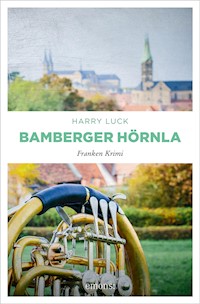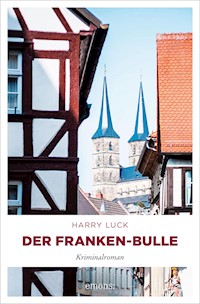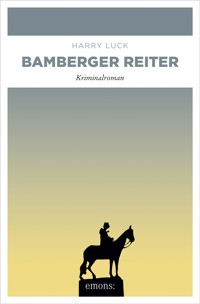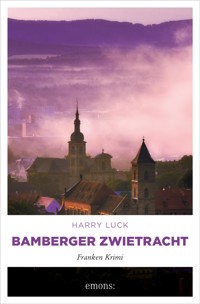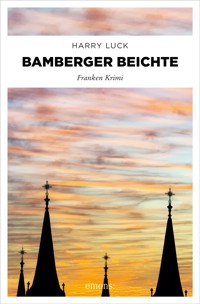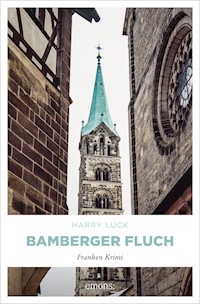
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Horst Müller und Paulina Kowalska
- Sprache: Deutsch
Ganz Bamberg spricht über den Hexenwahn, der hier vor vierhundert Jahren herrschte. Bei den Vorbereitungen zu einer Sonderausstellung wird das Grab eines Hexenkommissars geöffnet, auf dessen Familie ein Fluch liegen soll. Kurz darauf wird ein Lokalreporter ermordet, der über die Ausstellung schreiben wollte. In den Verdacht von Kommissar Horst Müller und seiner Kollegin Paulina Kowalska gerät eine Ärztin, deren Heilmethoden für manche an Magie grenzen – und die von ihren Gegnern "Die Hexe vom Jakobsberg" genannt wird . . .Bamberg zwischen Mord, Magie und Inquisition: ein spannendaugenzwinkernder Blick auf Hysterie und Hexenkult.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Harry Luck wurde 1972 in Remscheid geboren, wo er das journalistische Handwerk bei der Lokalzeitung erlernte. In München studierte er Politikwissenschaften und arbeitete als Redakteur und Korrespondent. Er leitete mehrere Jahre das Landesbüro einer Nachrichtenagentur, seit 2012 lebt er mit seiner Familie in Bamberg, wo er die Öffentlichkeitsarbeit des Erzbistums verantwortet. »Bamberger Fluch« ist sein zehnter Roman und sein zweiter Franken Krimi. Er veröffentlichte zudem zahlreiche Kurzgeschichten und humorvolle Sachbücher.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: iStockphoto.com/J-P-Steinhauf Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-998-1 Franken Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Gewidmet den unschuldigen Opfern von Dr.
Die peinliche Befragung
In Bamberg wurden die wegen Hexerei Verdächtigten nicht, wie die päpstliche Bulle und das kaiserliche Recht vorschrieben, zuerst als Ketzer vor das geistliche und dann das weltliche Gericht gestellt, sondern unmittelbar den weltlichen Räten übergeben.
Wenn der Verdächtigte sich nicht selbst der Hexerei anklagte und eine Reihe von verübten Schandtaten bekannte, wurde er peinlich befragt, das heißt der Tortur unterworfen. Diese begann mit dem Daumenstock, der die Daumen quetschte; dann folgte die Beinschraube oder der spanische Stiefel, wodurch Schienbein und Waden platt gedrückt, auch Knochen zersplittert wurden.
Die nächste Stufe war der Bock oder Zug, wo die Angeschuldigten mit zusammengebundenen Händen auf spitzen Stacheln sitzen mußten oder an den auf dem Rücken gebundenen Armen mit einem Seile in die Höhe gezogen und herabgeschnellt wurden. Auch wurde das Baden in Kalkwasser angewendet, ebenso die Schwefelfedern, indem brennender Schwefel auf den nackten Leib geträufelt wurde, unter den man brennende Federn hielt. Ferner wurde der Betstuhl, ein Brett mit kurzen, spitzen Hölzern, angewendet zum Daraufknien.
Oft wurde der Leib entblößt, um Hexenmale zu entdecken. Frauen wurden die Haare geschnitten und Drudenkittel angezogen, jüngere Frauen mit Ruten gepeitscht.
EINS
»Mein Name ist Müller. Horst Müller.«
»Sie waren noch nie bei uns?«, fragte mich die junge Sprechstundenhilfe mit dem schwarzen Pagenschnitt und dem Nasenpiercing.
»Ich hatte angerufen, weil mein Hausarzt im Urlaub ist. Ich komme wegen–«
»Wegen dem Heuschnupfen, ich sehe schon. Kasse oder privat?«
»Ja, ich komme wegen des Heuschnupfens«, korrigierte ich den fehlenden Genitiv. »Privat. Ich brauche eigentlich nur ein Rezept für meinen Spray.«
Als Beamter mit Beihilfeanspruch war die private Versicherung für mich die beste Wahl.
»Ich habe Ihnen ja schon am Telefon gesagt, dass ich Sie dazwischenschieben muss. Ohne Termin müssen Sie mit Wartezeit rechnen.«
Wartezeit war ein Begriff, der für mich als Privatpatient bei meinem Hausarzt am ZOB ein Fremdwort war. In der Praxis von Frau Dr.Hollerbeck, die sich über einem Töpferladen am Jakobsplatz befand, war ich noch nie gewesen. Aber mehrere Kollegen aus dem Kommissariat schwärmten so begeistert von ihr, dass ich den Urlaub von Dr.Wolfsberger und meine gleichzeitige Heuschnupfenattacke für einen Ausflug zum Jakobsberg nutzte.
»Das heißt?« Ich schaute auf meine Tchibo-Armbanduhr. Die Gleitzeitregelung erlaubte mir, bis spätestens neun Uhr fünfzehn meinen Dienst in der Kriminalpolizeiinspektion antreten zu können, ohne die Leiterin des Kommissariats eins, Frau Kriminalrätin Veronica Stadel, zu informieren.
»Eine Stunde kann’s schon dauern«, sagte der Pagenschnitt und erweckte den Eindruck, dass dies noch gutmütig geschätzt war. »Das Wartezimmer ist voll. Grippewelle, Sie wissen schon.«
»Aber können Sie mir das Rezept nicht schnell ausstellen? Nasonex heißt der Spray. Nehme ich schon seit Jahren.«
»Tut mir leid.« Die Assistentin blieb hartnäckig. »Frau Dr.Hollerbeck stellt grundsätzlich kein Rezept an Patienten aus, die sie nicht angesehen hat. Ich brauche dann noch Ihre Adresse und Ihre Unterschrift für die Rechnung. Nehmen Sie dies mit und gehen Sie dort ins Wartezimmer!«
Ich glaubte ihr ansehen zu können, wie sie ihre Machtposition auskostete. Sie schob mir ein Klemmbrett mit einem Formular und einem Kugelschreiber über den Tresen und deutete auf eine Glastür am Ende des Ganges, in dem Bambusstangen in Blumentöpfen als Deko-Elemente aufgestellt waren. Ich widerstand der Versuchung, meine Polizeimarke auf den Tresen zu knallen und zu sagen: »Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben!«
Holzstäbchen in kleinen Flaschen auf Glasregalen verströmten einen angenehmen blumigen Duft. Eine ältere Dame hinter mir nieste demonstrativ in meinen Nacken, um auf die Dringlichkeit ihres Praxisbesuchs hinzuweisen.
Hoffentlich hat sie auch Heuschnupfen und keine Influenza, dachte ich. Ich kapitulierte vor dem gepiercten Praxisdrachen und ging in das Wartezimmer, wo ich mich in einem der wenigen freien Clubsessel niederließ, die mich mehr an ein gemütliches Bistro erinnerten als an eine Arztpraxis. Auch die in Rottönen gestrichenen Wände irritierten mich. Beim Arztbesuch wollte ich die Farbe Weiß sehen, nicht nur beim Arztkittel.
Ich musste meine Kollegin, Kriminalmeisterin Paulina Kowalska, über meine Verspätung informieren. Ein Schild mit einem rot durchgestrichenen Mobiltelefon veranlasste mich, eine SMS auf Paulinas Diensthandy zu schicken, anstatt sie anzurufen. Ich lehnte diese Form der Daumenakrobatik eigentlich strikt ab. Aber dies war wohl ein Notfall.
»KOMMESPAETERWG.ARZT.HM.«
Das musste reichen.
Sekunden später erschien ihre Antwort in meinem Telefon, das tatsächlich noch ein Tastentelefon war und kein tragbarer Minicomputer in Zigarettenschachtelgröße: »Alles klar, bis später, Sie Klemper!P.«, lautete die Nachricht auf dem gelb erleuchteten Display.
Klemper? Was sollte das heißen? Hatte die automatische Worterkennung meiner Kollegin einen Streich gespielt? So wie bei mir immer »DROGEOSTERN« erschien, wenn ich »FROHEOSTERN« wünschen wollte? Das war unwahrscheinlich. Denn Paulina beherrschte die neuen Kommunikationsmittel im Gegensatz zu mir aus dem Effeff. Ihr würde es nicht passieren, dass sie einem Liebhaber versehentlich schrieb: »Bewegst du deinen Elefanten Körper zu mir«, obwohl sie »eleganten Körper« schreiben wollte. Allein die Tatsache, dass für mich dieser drahtlose WiFi-Bluetooth-Hashtag-Quatsch immer noch »neue« Technik war, bewies den jungen Leuten doch schon, dass ich mit meinen knapp fünfzig Lebensjahren bereits zum alten Eisen gehörte.
Ich war nicht der Einzige im Wartezimmer, der auf einem Mobiltelefon herumdrückte. Einige informierten vermutlich ihre Mitmenschen auf Twitter darüber, welche Symptome sie gerade plagten, und bekamen im Gegenzug Therapievorschläge in hundertvierzig Zeichen. Hashtag Gute Besserung. Andere verfolgten online die aktuellen Börsenkurse. Ich hatte vor Kurzem von einer Studie gelesen, nach der es inzwischen weltweit üblich war, auf dem Klo Facebook zu lesen, und dass manche Menschen schon nicht mehr wüssten, was sie sonst auf der Toilette machen sollten. Im Wartezimmer schien es sich ähnlich zu verhalten.
Ich war froh, dass mein altes Nokia nicht viel mehr konnte als telefonieren. Eine Taschenrechnerfunktion gab es auch noch und ein Spiel namens Snake, das meine Tochter Andrea manchmal spielte, wenn sie mich besuchte. Sie betrachtete das wohl als zeitgeschichtliche Forschung, um zu erfahren, wie man sich in der Steinzeit Kurzweil verschaffte. Als Teenie hatte sie vermutlich im Leben noch keine Wählscheibe gesehen, außer vielleicht im historischen Museum. Für wenige Wochen hatte ich auch mal ein dienstliches Smartphone, das ich aber jeden Abend zu Hause aufladen musste. Als ich die Stadel fragte, ob ich die dafür anfallenden Stromkosten dem Dienstgeber in Rechnung stellen könne, durfte ich mein altes Nokia wieder verwenden. Bis zur Einführung des Digitalfunks nutzten die meisten Polizeibeamten für die interne Kommunikation ihre Handys, weil die als abhörsicherer galten.
Ich griff zur neuen Ausgabe des »Stern«, die in der Mitte des Raumes auf einem runden Glastisch lag. Das Titelbild zeigte einen Ausschnitt aus einem bunten Gemälde mit hässlichen Frauen voller Warzen und mit Hakennasen, die auf Besenstielen durch die Luft ritten. Darüber stand in roten Buchstaben geschrieben: »Deutsche Walpurgisnacht– die Rückkehr des Hexenzaubers«. Wer in Bamberg lebte, war aus historischen Gründen für das Hexenthema sensibilisiert.
Ich schlug die Titelgeschichte auf, deren aktueller Aufhänger der Kinofilm »Hexensabbat« war, dessen bundesweiter Start unmittelbar bevorstand. Ich erinnerte mich daran, dass die Dreharbeiten vor etwa einem Jahr auch in Bamberg an historischen Schauplätzen stattgefunden hatten. Die Alte Hofhaltung war wochenlang gesperrt, der Verkehr über den Domplatz, auf dem Pferdemist das Kopfsteinpflaster überdeckte, war im Viertelstundentakt unterbrochen worden. Und draußen in Scheßlitz hatte man Scheiterhaufen aufgebaut und die Hexenverbrennungen authentisch in Szene gesetzt. Mich gruselte es beim Gedanken daran.
Der Artikel erstreckte sich über sechs Seiten und zeigte viele Fotos mit Ausschnitten aus dem Film, der das Schicksal einer Bamberger Bürgerstochter erzählte, die in die Hände der Hexenverfolger gefallen war. Aber auch Originalbilder waren abgedruckt, zum Beispiel ein Kupferstich, der das berüchtigte Bamberger Malefizhaus zeigte, in dem die brutalen Verhöre und Folterungen stattgefunden hatten, das nach dem Ende des Hexenwahns aber spurlos aus dem Stadtbild verschwunden war. In der Nähe wurde nur alljährlich zur Weihnachtszeit eine Bäckerei ausgerechnet zum »Hexenhäusla«.
Der Artikel war höchst spannend und anschaulich geschrieben. Ich vertiefte mich in die Lektüre, ohne im Einzelnen mitzubekommen, wie ein Patient nach dem anderen aufgerufen wurde. Ich erfuhr grausame Details über die Foltermethoden und die historischen Hintergründe über den als »Hexenbrenner« berüchtigt gewordenen Bamberger Fürstbischof Fuchs von Dornheim, der auch eine der Hauptfiguren im Film »Hexensabbat« war, dargestellt von einem Schauspieler, der mit einer Arztserie im ZDF bekannt geworden war und schon in meiner Lieblingskrimiserie »Derrick« in den achtziger Jahren einige Gastrollen gehabt hatte.
Mit den Worten »Herr Müller, bitte!« riss mich eine sanfte Stimme aus meiner fesselnden Lektüre.
Ich legte die Zeitschrift wieder auf den Glastisch.
»Bitte gehen Sie ins Sprechzimmer zwei«, sagte eine Arzthelferin.
Dann wurde ich zu Dr.Isabella Hollerbeck vorgelassen.
* * *
Ich schätzte Dr.Hollerbeck auf etwa fünfzig. Ihre kinnlangen, glatten Haare waren auf eine unnatürliche Weise schwarz. Sie trug keinen weißen Kittel, sondern einen violetten Hosenanzug. Mit ihren dunklen Augen sah sie mich durchdringend an, während sie auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch deutete. Sie blickte ernst und ließ keine Gefühlsregung erkennen.
Das Zimmer, in dem mich die Ärztin empfing, erinnerte mehr an einen gemütlich eingerichteten Salon als an ein Sprechzimmer. Rote Vorhänge vor den Fenstern dunkelten den Raum ab. An den Wänden hingen Aquarelle, die farbenfrohe Landschaften und Sonnenuntergänge zeigten. Ein leise plätschernder Steinbrunnen in der Mitte des Raums strahlte etwas Beruhigendes aus. Unter einem Fenster stand ein roter Plastikwichtel, der den Komponisten Richard Wagner verkörperte. Diese Figuren waren mal im Rahmen eines Kunstprojektes namens »Walk of Wagner« in Bayreuth massenhaft aufgestellt und schließlich für dreihundertfünfzig Euro das Stück zum Verkauf angeboten worden.
Ich schaute mich um und suchte nach der Quelle des Minzaromas, das dezent in der Luft hing, doch ich bemerkte nichts. Vermutlich Holzstäbchen in kleinen Flaschen, die irgendwo verborgen ein Wohlfühlaroma verbreiteten. Ich setzte mich auf den Stuhl, während Dr.Hollerbeck konzentriert meine Angaben aus der Patientenanmeldung überflog. Ich stellte mir vor, dass sie durchaus sympathisch und attraktiv wirken könnte, wenn sie einmal lächeln würde.
»Horst Müller, neunundvierzig Jahre alt. Kriminalbeamter.« Sie blickte auf. »Das ist ja interessant.«
»Es geht«, antwortete ich kurz und verzichtete auf die ausführliche Darlegung, dass der Berufsalltag eines oberfränkischen Kriminalpolizisten nichts mit dem gemein hatte, was man aus den sogenannten Franken-Krimis kannte, die sich wie eine Seuche verbreiteten und die verrücktesten Geschichten über unsere Arbeit erzählten. Auch der Franken-»Tatort«, den es seit einiger Zeit als Alibi-Veranstaltung des Oberbayerischen Rundfunks gab, war weit von dem entfernt, womit Tag für Tag die Bürozeiten eines Kripo-Sachbearbeiters gefüllt waren.
»Wir können es kurz machen«, sagte ich mit Blick auf die Uhr. »Ich brauche nur ein Rezept. Nasonex. Es ist wegen meines Heuschnupfens. Birkenpollen. Ich krieg das sonst immer von meinem Hausarzt, Doktor–«
Sie zuckte mit ihrem Kopf zurück und streckte dabei das Kinn nach vorne, als hätte ihr jemand eine Kopfnuss gegeben.
»Sie sprechen von Cortison!« Sie betonte es, als wäre die Rede von hochangereichertem Plutonium.
»Nasenspray halt«, sagte ich achselzuckend. Ich interessierte mich selten für die Zusammensetzung der Medikamente, die ich verschrieben bekam. Hauptsache, sie zeigten die erwünschte Wirkung.
»Sie wissen, wie ich arbeite?« Ihre Hand schwebte über einer kleine Armee von Glasfläschchen, die wie rote Zinnsoldaten mit spitzen weißen Helmen akkurat aufgereiht auf ihrem Schreibtisch standen. Alle hatten die gleiche Größe und waren mit rot-weißen Etiketten versehen. Wie Uniformen.
Dr.Hollerbeck wartete meine Antwort nicht ab. »Sie wollen doch Ihre Allergie behandeln und nicht nur die Symptome unterdrücken.«
Ich nickte automatisch, ohne zu wissen, worauf sie hinauswollte.
»Dann legen Sie sich mal hin, Herr Müller. Bleiben Sie, wie Sie sind. Auch die Schuhe behalten Sie bitte an!« Sie deutete auf eine Liege im hinteren Teil des Raumes. Ich legte mich zögerlich auf den Rücken, die Ärztin stellte sich hinter das Kopfende und forderte mich auf, ihr meine Hände entgegenzustrecken.
»Entspannen Sie sich! Machen Sie sich frei von allen Sorgen, lassen Sie sich ganz fallen.«
War ich jetzt versehentlich in einer Psychotherapie gelandet?
»Meine größte Sorge ist im Moment, zu spät zum Dienst zu erscheinen«, sagte ich. »Und diese Sorge könnten Sie mir ganz einfach nehmen, indem Sie mir ein Rezept…«
Sie zog mal am rechten, mal am linken Arm und forderte mich auf, ihr Widerstand zu leisten.
»Die Leber meldet sich als Erstes«, unterbrach sie mich, dann drückte sie auf mein Ohr.
»Wie bitte?« Bis auf ein gelegentliches Glas Eierlikör lebte ich relativ alkoholfrei. »Was machen Sie da überhaupt?«
»Schon mal was von Kinesiologie gehört, Herr Müller? Ich spüre energetische Ströme in Ihrem Körper, die zum Beispiel auf Unverträglichkeiten hinweisen. Sie müssen sich schon darauf einlassen. Das ist reine Physik.«
In diesem Moment spürte ich einen energetischen Strom, der durch meinen Körper fuhr. Es war ein Vibrieren, das über die Leber in den gesamten Unterleib ausstrahlte.
»Moment bitte.« Ich richtete mich auf und holte mein auf lautlos gestelltes Handy aus der Hosentasche. Eine SMS von Paulina.
»Wir müssen das Experiment mit chinesischer Physik leider an dieser Stelle abbrechen«, sagte ich nicht ohne Erleichterung, nachdem ich die Kurzmitteilung gelesen hatte. »Ich muss mich um einen Toten kümmern.«
Dr.Hollerbeck blickte mich fragend an.
ZWEI
Um zum Tatort zu gelangen, musste ich durch die Hölle gehen. Beziehungsweise fahren. Ich war mit meinem neuen E-Bike unterwegs, was mir bei der Strecke durchs Berggebiet mal wieder sehr entgegenkam. Es war gar nicht so leicht gewesen, bei meinem Fahrradhändler an der Löwenbrücke ein E-Bike mit Rücktrittbremse zu bekommen.
Ich verließ die Praxis am Jakobsplatz und schob das Rad die Maternstraße mit ihren pittoresken Häuschen entlang. Es war eine Einbahnstraße, und keines der mir entgegenkommenden Kraftfahrzeuge hielt sich an die vorgeschriebene, kaum messbare Höchstgeschwindigkeit von zehn Stundenkilometern. Doch Verkehrskontrollen gehörten nicht zu meinem Aufgabengebiet. Am Knöcklein radelte ich den Berg hinauf und dann den Unteren Kaulberg wieder hinunter. Dann passierte ich die Straße, die Hölle hieß. Hier residierte nicht der Leibhaftige, der Name war auf die mittelalterliche Bezeichnung »in der Hel« zurückzuführen, was so viel heißt wie »im entlegenen Winkel«.
Kurz hinter der Hölle erreichte ich die Obere Pfarre, wie die Kirche Unsere Liebe Frau allgemein im Volksmund hieß und deren Pfarrfest zum Leidwesen von katholischen Fundamentalisten augenzwinkernd »Höllenfest« genannt wurde.
Ich stellte mein elektrisches Fahrrad neben dem Eingang der Kirche vor einer steinernen Figurengruppe ab, die einen betenden Jesus Christus mit schlafenden Aposteln darstellte. Hellwach war hingegen der uniformierte Beamte, der mir gleich entgegenkam.
»Gestatten, POM Heidenreich. Gut, dass Sie so schnell kommen konnten, Herr Kommissar. Es sind schon alle sehr aufgeregt. Wegen der Leich–«
»Moment mal, Herr Kollege.« Ich reichte dem Polizeiobermeister zur Begrüßung die Hand. Heidenreich und Hölle, was sollte als Nächstes kommen? »Was ist hier überhaupt los?«, fragte ich. »In der Kurznachricht, die mir meine Kollegin geschickt hat, stand nur etwas von einer aus einem Grab verschwundenen Leiche. Ist Frau Kowalska schon hier?« Ich blickte mich um.
»Sie ist unterwegs, Herr Kommissar. Kommen Sie mit, hier ums Eck.«
Der Polizist ging vor, am Haupteingang und am Gebäude der Joseph-Stiftung vorbei an die hintere Längsseite der Kirche. Hier stand ein halbes Dutzend Personen um eine Öffnung im Boden, die wie eine Baugrube aussah. Ich begrüßte alle Anwesenden kurz und bat um Aufklärung darüber, warum meine Präsenz als Kriminalhauptkommissar desK1 hier erforderlich war.
Die einzige Frau in der kleinen Ansammlung kam auf mich zu und stellte sich als Dr.Bea Sommer, Leiterin des Diözesanmuseums, vor.
»Ich leite hier die Ausgrabung«, sagte sie. Sie war Anfang dreißig und hatte ein sehr charmantes Lächeln und strahlend blaue Augen. Ihre blonden Haare reichten bis zum Kinn. Sie trug eine dunkelgrüne Barbourjacke, Jeans und Turnschuhe. »Ich darf Sie bekannt machen? Das ist Herr Monsignore Johannes Momberg. Der Dompfarrer ist als Administrator derzeit auch für die Obere Pfarre zuständig und damit hier sozusagen der Hausherr. Herr Sven Bleibach, er steht dem Museum als externer Berater für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Und das ist Herr Benjamin Stelzer, Reporter vom ›Fränkischen Tag‹. Er berichtet über die Vorbereitungen zu unserer geplanten Sonderausstellung.«
»Und das ist Kriminalmeisterin Paulina Kowalska«, stellte ich meine Kollegin vor, die in diesem Moment um die Ecke kam.
»Guten Morgen allerseits«, sagte sie und verzichtete darauf, jeden einzeln zu begrüßen. Dann wandte sie sich an mich: »Haben Sie erfahren, worum es hier geht, Horst?«
Dass wir uns mit Sie und dem Vornamen ansprachen, hatten wir uns zu Beginn unseres gemeinsamen Arbeitslebens in der Bamberger Kriminalpolizeiinspektion angewöhnt und immer beibehalten. Es war der hanseatische Kompromiss aus meiner Devise, Beruf und Privates strikt zu trennen, und ihrer kumpelhaften Jeden-Duzer-Art, wie man sie sonst bei IKEA oder den unsäglichen Kaffee-für-unterwegs-Ausschankstellen kennt.
Ich zuckte mit den Schultern. »Frau Dr.Sommer und Herr Pfarrer Momberg wollten uns gerade von der geplanten Sonderausstellung berichten.«
»Der Beginn der Welle von Hexenprozessen jährt sich heuer zum vierhundertsten Mal«, sagte die Museumschefin. »Im Sommer 1616 begannen in Bamberg die ersten Prozesse, wohl unter dem Einfluss einer durch Dürre verursachten Missernte, der zahlreiche Seuchen folgten. Beides wurde den verurteilten vermeintlichen Hexen angelastet. Aus diesem Anlass planen wir im Diözesanmuseum eine Sonderausstellung, die sich mit den Tätern von damals beschäftigt. Über die Opfer ist schon zu Recht sehr viel gesprochen worden. Aber über die Täter ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Wir wollen der Frage nachgehen: Wie wird man zu einem Hexenkommissar, einem Malefizrichter oder gar zu einem Henker? Was macht es mit einem Menschen, wenn es sein Beruf ist, andere zu foltern oder gar hinzurichten? Waren das bestimmte Typen, oder hätte es jeden treffen können? Es gibt zu diesem Thema übrigens interessante Studien über Justizangehörige in den USA, die an der Vollstreckung der Todesstrafe beteiligt sind und aus beruflichen Gründen töten. Anstatt einen Scheiterhaufen anzuzünden, setzen sie die tödliche Injektion– nachdem sie die Einstichstelle des Todgeweihten paradoxerweise desinfiziert haben.«
»Ach ja? Das ist ja gruselig. Zu welchem Ergebnis kam diese Studie?«
»Das erstaunliche Ergebnis war, dass die meisten nicht mehr Symptome, zum Beispiel Depressionen, zeigten als die Allgemeinbevölkerung. Sie rechtfertigen sich damit, dass sie nur dem Gesetz folgten und der Gesellschaft einen Dienst leisteten. Sie müssen sich offenbar von ihren moralischen Standards lösen, um ohne psychischen Schaden solche Handlungen durchführen zu können. Sie entwickeln gedankliche Schutzmechanismen und leugnen die persönliche Verantwortung für ihr Tun. Haben Sie schon mal vom Milgram-Experiment gehört?«
Ich schüttelte den Kopf.
»In den sechziger Jahren untersuchte der US-Psychologe Stanley Milgram, in welchem Ausmaß sich Probanden an autoritäre Anweisungen halten. Die Teilnehmer sollten die Funktion von Lehrern übernehmen, die ihre Schüler bei falschen Antworten mit Elektroschocks bestrafen. Die Dosis steigerte sich bei jeder falschen Antwort: von fünfzehn Volt, was nur ein leichtes Kribbeln verursacht, bis zu vierhundertfünfzig Volt, was unweigerlich tödlich wirkt.«
»Das klingt nach einem Horrorfilm«, wandte ich ein. »Dieses Experiment fand doch nicht wirklich statt?«
»Doch«, entgegnete Bea Sommer. »Aber die Schüler waren nicht echt, sondern Schauspieler. Es gab keine Stromstöße, die Reaktionen wurden simuliert. Das Erschreckende: Alle Teilnehmer machten bis dreihundert Volt mit. Mehr, als aus der Steckdose kommt. Und fast zwei Drittel gingen bis zum Maximum. Milgram gelangte zu dem Schluss, dass Menschen töten, wenn sie von einer Führungsperson den Auftrag dazu erhalten. So ähnlich muss es sich auch bei den Scharfrichtern von damals verhalten haben. Trotzdem sind noch viele Fragen offen.«
So offen wie dieses Grab, dachte ich.
»Das fällt der Kirche aber früh ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen«, warf Paulina dazwischen. Ich rügte sie mit einem strengen Blick für diese unpassende Bemerkung.
»Wir haben als Kirche immer wieder keinen Zweifel daran gelassen, dass–«
»Schon gut, Herr Pfarrer«, unterbrach ich ihn freundlich. »Wir wollen endlich erfahren, worum es hier geht. Bitte, Frau Dr.Sommer.«
»Für die Sonderausstellung suchen wir überall in Bamberg und Umgebung in Kirchen, Archiven und Sammlungen nach Dokumenten und Gegenständen, die mit den Personen in Verbindung stehen, die damals an der Hexenverfolgung beteiligt waren. Angefangen beim gefürchteten Weihbischof Friedrich Förner und dem berüchtigten Fürstbischof Fuchs von Dornheim–«
»Dem Hexenbrenner«, sagte Paulina. »Um den geht es auch in diesem Film, der demnächst in die Kinos kommt.«
»Richtig«, sagte Dr.Sommer. »Wir wissen, dass dieser Film mit dem Titel ›Hexensabbat‹ mehr auf den Erfolg an den Kinokassen ausgerichtet ist und weniger an den historischen Tatsachen. Zu den Personen, die unsere Ausstellung behandelt, gehört auch der Hexenkommissar Dr.Ernst Vasoldt, der an vielen Prozessen beteiligt war. Erst seit Kurzem wissen wir, dass dieser Vasoldt hier in diesem Grab an der Oberen Pfarre begraben wurde.«
Ich sah an der Kirchenmauer ein Grabdenkmal, auf dem nur mit großer Mühe die Worte »Nihil adferimus– nihil auferimus« zu entziffern waren. Ein Name war nirgends zu erkennen.
»Nichts bringen wir her, nichts tragen wir hin«, übersetzte der Pfarrer. »Dieses Grab ist anonym. Bei den Vorbereitungen zu den Renovierungsarbeiten an unserer Pfarrkirche sind in unseren Archiven Dokumente aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass der genannte Ernst Vasoldt hier beigesetzt wurde. Sein Vater Karl Vasoldt war Kanzler des Fürstbistums. Nur deshalb wurde ihm wohl die Ehre zuteil, hier an der Kirchenmauer bestattet zu werden.«
»Sie müssen wissen, dass die alten Friedhöfe, die früher um die Pfarrkirchen herum lagen, nach 1800 aufgegeben wurden«, sagte Bea Sommer. »Nur hier an der Oberen Pfarre gibt es noch Substruktionen, die wohl als Grabkammern dienten. Aus den Dokumenten geht hervor, dass sich im Grab von Vasoldt auch Folterinstrumente befunden haben sollen sowie ein Schwert, mit dem der Scharfrichter einige Hinrichtungen vollzogen hat, wenn die Delinquenten einen Gnadenzettel erhalten haben.«
»Wie bitte?«, fragte Paulina. »Wieso wurden sie hingerichtet, wenn sie einen Gnadenzettel hatten?«
Bea Sommer lächelte etwas gequält: »Nun, die Gnade bestand darin, dass sie nicht auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leibe verbrannt, sondern mit dem Schwert geköpft wurden. Dieses besondere Privileg erteilte der Fürstbischof schriftlich. Das war dann der sogenannte Gnadenzettel.«
»Die Kirche hat schon damals nicht richtig getickt«, murmelte Paulina.
Monsignore Momberg hatte sie aber wohl gut verstanden und konterte: »Die Hexenverfolgung wurde vom Hochstift betrieben. Hier war der Fürstbischof als weltlicher Herrscher verantwortlich. Der Staat hat also gehandelt, nicht die Kirche.«
»Meinen Sie das ernst?«, fragte Paulina.
Immer wenn wir bei unseren Ermittlungen etwas mit Kirche oder geistlichen Würdenträgern zu tun hatten, nahm meine eigentlich sehr freundliche und umgängliche Kollegin eine fast aggressive Abwehrhaltung ein. Sie erwähnte dann auch immer gerne, dass ihre Mutter sie aus Verehrung für den polnischen Papst Johanna Paulina genannt hatte, sie die fromme »Johanna« aber mit ihrer Volljährigkeit und dem Austritt aus der Kirche aus Protest abgelegt hatte.
»Historisch und juristisch betrachtet, hat der Herr Pfarrer recht«, sagte Bea Sommer. »Deshalb ist es formal auch die falsche Adresse, wenn man heute die Kirche auffordert, um Vergebung zu bitten für das Unrecht der Hexenverbrennungen. Die richtige Adresse wäre der Freistaat Bayern als Rechtsnachfolger des Hochstifts.«
Paulina rollte die Augen und schien sich eine weitere Bemerkung zu verkneifen.
Ich betrachtete das Grabmal an der Kirchenmauer etwas genauer. Es bestand aus einem eiförmigen Kranz, an dessen unterer Seite ein Totenkopf aus leeren Augenhöhlen demütig zu Boden blickte.
»Wenn ich mir jetzt alles zusammenreime«, sagte ich mit Blick auf die offene Grube, »dann haben Sie das Grab geöffnet und keine sterblichen Überreste gefunden.«
»So ist es«, sagte Bea Sommer. »Und auch keine Grabbeigaben.«
»Ein leeres Grab ist nicht unbedingt ein Fall für die Kripo«, sagte ich und blickte POM Heidenreich fragend an.
»Als die Apostel damals ein leeres Grab gefunden haben, liefen sie herum und erzählten der ganzen Welt etwas von Auferstehung, anstatt die Polizei zu rufen«, sagte Paulina schnippisch.
»Wir wollen nicht behaupten, dass Ernst Vasoldt von den Toten auferstanden ist«, erwiderte der Pfarrer. »Gott bewahre uns davor!«
»In dem Fall wäre er wohl tatsächlich ein Fall für uns«, meinte Paulina. »Als vielfacher Mörder.«
»Das wäre allenfalls Beihilfe«, entgegnete ich. »Wenn ich Frau Dr.Sommer richtig verstanden habe.«
Ich musste laut niesen. Die Pollen. Und alle sagten der Reihe nach »Gesundheit«.
»So einfach ist das nicht.« Die Museumsleiterin strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht und klemmte sie hinter das Ohr. »Soweit wir wissen, sind zumindest am Anfang alle Handlungen gemäß den damals gültigen Rechtsvorschriften vorgenommen worden. Der Glaube, dass es Hexen gab, die mit dem Teufel buhlen und mit ihren Fähigkeiten Schaden anrichten und zum Beispiel Unwetter oder Dürre auslösen, war in der Bevölkerung als Tatsache verankert. Ebenso wurde ihre Verfolgung als notwendige Maßnahme betrachtet. Erst später sind die Prozesse aus dem Ruder gelaufen, die Rechtsvorschriften nicht beachtet oder nach Gutdünken ausgelegt worden. Letztlich war kein Bürger mehr davor sicher, als Hexe besagt und verbrannt zu werden. Übrigens egal, ob Mann oder Frau, Erwachsener oder Kind. Dabei hat Ernst Vasoldt, nach allem, was wir wissen, eine tragende und nicht sehr ruhmreiche Rolle gespielt. Seine Person soll neben den zwei Bischöfen von damals ein Schwerpunkt unserer Ausstellung sein. Da war es ein Glücksfall, dass wir von dieser Grablege erfahren haben.«
Der Reporter Stelzer machte sich eifrig Notizen in einem Block. Schräg hinter ihm stand Bleibach, der PR-Agent, und versuchte, möglichst unauffällig Stelzers Schrift zu entziffern und zugleich den Eindruck zu erwecken, als konzentriere er sich nur auf Frau Sommers Ausführungen. Weil er einen halben Kopf kleiner war als sie, musste er seinen Hals ordentlich strecken. Bleibach hatte rotbraune Haare und einen Mittelscheitel, er trug eine dunkle Plastikbrille und einen säuberlich getrimmten Kinnbart wie der alberne Gerichtsmediziner aus dem Münster-»Tatort«, der in meinen Augen eine von Gebührengeldern finanzierte öffentlich-rechtliche Beleidigung des Polizeidienstes darstellte. Ich wurde allmählich ungeduldig und wollte endlich erfahren, warum ich hier war.
»Über die Ausgrabung sollte ein großer Bericht imFT erscheinen«, sagte Bleibach. »Als Appetitmacher für die spätere Ausstellung. Deshalb sind Herr Stelzer und ich hier.«
»Sie müssen wissen«, sprach Dr.Sommer mit einem geheimnisvollen Unterton, »dass es eine Legende gibt, wonach über der Familie Vasoldt ein Fluch liegt. Der trifft jeden, der sich mit der Familie beschäftigt. Es sind eine Reihe mysteriöser Todesfälle im Umfeld der Vasoldts in den letzten Jahrhunderten verbürgt. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum die Grabstelle irgendwann anonymisiert wurde.«
Paulina machte unwillkürlich einen Schritt zurück. »Ein Fluch?«
»Für Hokuspokus sind wir nicht zuständig«, stellte ich sachlich fest. »Und auch wenn hier der Fall einer Grabschändung oder -plünderung vorliegen sollte, ist davon auszugehen, dass das Delikt inzwischen verjährt sein dürfte.«
Dr.Sommer nickte zustimmend. »Wussten Sie, dass die Zauberformel Hokuspokus eine Verballhornung der lateinischen Wandlungsworte aus der heiligen Messe sind? Hoc est enim corpus meum. Als das Grab freigelegt war und wir feststellten, dass es leer ist, haben wir das hier gefunden.«
Sie holte eine quadratische Dose aus Metall hervor, die sich in einem beigefarbenen Stoffbeutel befunden hatte. Sie war zerbeult, zerkratzt und verschmutzt. Vorsichtig öffnete Dr.Sommer das Behältnis. Ich erwartete einen Inhalt, der mindestens ebenso alt und lädiert war wie die Blechdose selbst.
Beim Öffnen entstand ein knarzendes Geräusch. Sie hielt die Dose schräg, sodass Paulina und ich hineinsehen konnten. POM Heidenreich schien schon zu wissen, was drin war.
»Ein Buch?«, fragte Paulina.
»Es handelt sich um eine alte Ausgabe des Looshorn«, erläuterte Dr.Sommer. »Ein Standardwerk über die Geschichte des Bistums Bamberg. Auch wenn dies eine sehr seltene Ausgabe des unter Wissenschaftlern weitverbreiteten Buches ist: Das ist nicht der Grund, weshalb wir die Polizei gerufen haben.«
»Ich sehe schon«, sagte ich, als ich erkannte, was sich noch in dem Kasten befand. »Neun Millimeter«, stellte ich mit einem Blick fest. »Eine Walther PPK.«
»Sieht aus wie eine Wehrmachtspistole aus dem Zweiten Weltkrieg«, konstatierte Paulina.
»Ja, und wohl eher nicht aus dem 17.Jahrhundert«, sagte ich. »Außerdem ist nicht anzunehmen, dass Herr Vasoldt, oder wer auch immer hier begraben war, mit dieser Waffe getötet wurde.«
Ich zog ein Paar Einweghandschuhe an, die ich aus der Innentasche meines Sakkos holte. Dann nahm ich die Pistole und betrachtete sie genau. Sie war recht gut erhalten, aber offenkundig nicht mehr funktionstüchtig. Ich ging nicht davon aus, dass sie seit dem Kriegsende hier vergraben war. Ich legte die Pistole wieder in die Dose zurück.
»Und das war alles, was sich in dem Grab befunden hat? Das ist wirklich etwas mysteriös. Das Buch ist wohl auch keine vierhundert Jahre alt, stimmt’s?«
»Johann Looshorn schrieb sein mehrbändiges Werk über viele Jahre und schloss es um 1910 ab«, erläuterte die Museumschefin. »Es handelt sich hierbei um den sechsten Band, der unter anderem die Zeit der Hexenverfolgung beschreibt.«
»Es wäre schon Hexerei, wenn Vasoldts Grab ein Buch beigelegt wurde, das erst dreihundert Jahre später geschrieben wurde.«
»Das Buch ist ein aus Museumssicht interessanter Fund, weil es von dieser frühen Auflage nur noch wenige Exemplare gibt. Die Polizei haben wir natürlich wegen der Waffe gerufen«, sagte Dr.Sommer und deutete auf den uniformierten Kollegen.
»Und ich hielt es für möglich, dass es sich hier um einen Hinweis auf ein Kapitalverbrechen handeln könnte«, sagte Heidenreich pflichtbewusst. Er war wohl immer noch unsicher, ob er korrekt gehandelt hatte, indem er die Kripo einschaltete.
»Vollkommen richtig«, sagte ich. »Es liegt hier auf jeden Fall Aufklärungsbedarf vor. Wir werden durch eine kriminaltechnische Untersuchung zweifelsfrei feststellen können, ob diese Pistole mit einem Tötungsdelikt zusammenhängt oder polizeilich registriert ist. Paulina, können Sie sich darum kümmern?«
»Geht klar«, sagte sie.
Dann meldete sich Bleibach zu Wort: »Herr Kommissar, vielleicht können Sie noch zwei Sätze für den Kollegen von der Presse sagen? Wie schätzen Sie diesen Fund ein? In welche Richtung wollen Sie ermitteln?«
Ich schaute zuerst Bleibach, dann Stelzer an, der bereits erwartungsvoll seinen Kuli in Schreibposition gebracht hatte.
»Sie schreiben erst mal gar nichts, junger Mann.« Ich versuchte, es nach einem Machtwort klingen zu lassen.
»Aber glauben Sie nicht«, schaltete sich Bleibach wieder ein, »dass es hier einen Zusammenhang mit dem Fluch der Vasoldts geben könnte?«
»Fürs Glauben ist allein der Herr Pfarrer zuständig«, erwiderte ich. »Für mich steht nur fest, dass hier der Anfangsverdacht vorliegt für…«
Ja, wofür eigentlich? Jemand hatte eine Kriegspistole in einem Grab verschwinden lassen. Das allein war möglicherweise allenfalls eine Ordnungswidrigkeit. Oder lag doch ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor? Ich war mir nicht schlüssig und blieb daher im Allgemeinen: »…für ein illegales Handeln. Ob das etwas mit dem unseligen Herrn Vasoldt zu tun hat, möchte ich erst mal bezweifeln. Sie haben doch eben gesagt, Frau Dr.Sommer, dass erst seit Kurzem bekannt ist, wer hier begraben liegt. Oder besser: lag.«
»Aber denken Sie nicht, dass die Öffentlichkeit informiert werden sollte?«
»Das überlassen Sie mal uns, Herr Bleibach«, sagte ich scharf. »Meine Kollegin kümmert sich jetzt um die Waffe, und Sie, Frau Dr.Sommer, werden mir sicher noch ein paar Fragen beantworten. Können wir hier irgendwo ungestört reden, vielleicht auch einen Kaffee trinken?«