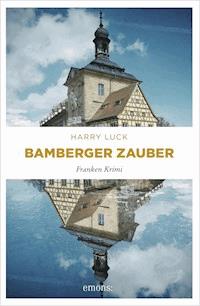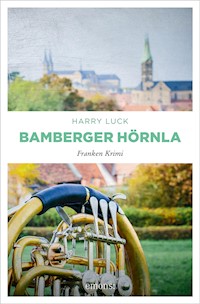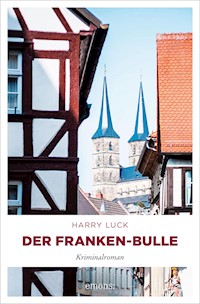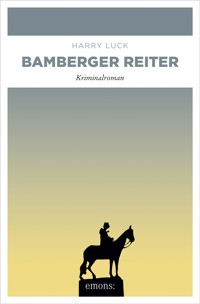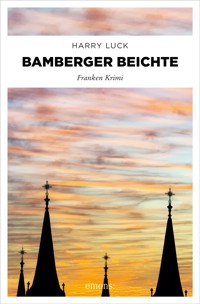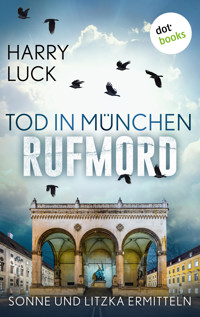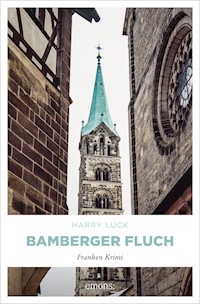4,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Fall für Sonne und Litzka
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine Weltstadt, die in Angst lebt: Der packende Kriminalroman »Tod in München – Angstspiel« von Harry Luck jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn der Besuch auf den Wiesn ein Spiel mit dem Tod bedeutet … Ein neuer Anschlag auf das größte Volksfest der Welt droht – werden sich die schrecklichen Ereignisse von 1980 wiederholen? Die Wiesn-Verantwortlichen sind nicht bereit, die Feierlichkeiten abzusagen, schließlich darf München nicht das Gesicht verlieren! Kommissar Jürgen Sonne und sein inoffizieller Partner, Sensationsreporter Frank Litzka, müssen ihre Ermittlungen heimlich und unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit führen. Doch was, wenn die Wahrheit die ganze Stadt einem Erdbeben gleich erschüttern könnte? »Ein dramaturgisch perfekt gebauter, gut recherchierter und fesselnder Krimi. Ein echter Page-Turner!« Süddeutsche Zeitung Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Tod in München – Angstspiel« von Harry Luck – der dritte Band der großen München-Krimireihe für Fans von Harry Kämmerer. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn der Besuch auf den Wiesn ein Spiel mit dem Tod bedeutet … Ein neuer Anschlag auf das größte Volksfest der Welt droht – werden sich die schrecklichen Ereignisse von 1980 wiederholen? Die Wiesn-Verantwortlichen sind nicht bereit, die Feierlichkeiten abzusagen, schließlich darf München nicht das Gesicht verlieren! Kommissar Jürgen Sonne und sein inoffizieller Partner, Sensationsreporter Frank Litzka, müssen ihre Ermittlungen heimlich und unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit führen. Doch was, wenn die Wahrheit die ganze Stadt einem Erdbeben gleich erschüttern könnte?
»Ein dramaturgisch perfekt gebauter, gut recherchierter und fesselnder Krimi. Ein echter Page-Turner!« Süddeutsche Zeitung
Über die Autorin:
Harry Luck wurde 1972 in Remscheid geboren, ist ausgebildeter Redakteur und studierte in München Politikwissenschaften. Er berichtete viele Jahre für verschiedene Medien über Politik, Kultur und Wirtschaft in München und Bayern. Heute lebt er mit seiner Familie in Bamberg, wo er an weiteren Kriminalromanen arbeitet und als Pressesprecher für das Erzbistum tätig ist.
Die Website des Autors: www.harryluck.de/
Der Autor im Internet: www.facebook.com/luck.harry und www.instagram.com/luck_harry/
Harry Luck veröffentlichte bei dotbooks auch seine Kriminalromane:
»Kaltes Lachen – Ein Fall für Schmidtbauer und van Royen« »Kaltes Spiel – Ein Fall für Schmidtbauer und van Royen«
»Tod in München – Rachelust. Der erste Fall für Sonne und Litzka«
»Tod in München – Schwarzgeld. Der zweite Fall für Sonne und Litzka«
»Tod in München – Machtbeben. Der vierte Fall für Sonne und Litzka«
»Tod in München – Rufmord. Der fünfte Fall für Sonne und Litzka«
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe Juli 2020
Dieses Buch erschien bereits 2005 unter dem Titel »Wiesn-Feuer« bei KBV.
Copyright © der Originalausgabe 2005 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kai Gathemann GbR
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock /Hunter Bliss Images / Andrey Tiyk / S. N. Ph
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-963-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tod in München 3« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Harry Luck
Tod in München – Angstspiel
Sonne und Litzka ermitteln
dotbooks.
Für Adrian
»Nach dem jetzt vorliegenden Ermittlungsergebnis ist festzustellen, daß Gundolf Köhler allein als Attentäter gehandelt hat.«
(Abschlussbericht des bayerischen Landeskriminalamtes zum Oktoberfest-Attentat am 26. September 1980)
***
»Nach dem Verbot zahlreicher rechtsextremistischer Organisationen seit 1992 entwickelten führende Neonazis das Konzept strukturloser Zusammenschlüsse. Dadurch sollten staatliche Gegenmaßnahmen erschwert werden. Bei diesen Kameradschaften gibt es weder eine formelle Mitgliedschaft noch Vorstandspositionen. Anführer ist meist ein engagierter Rechtsextremist, der es versteht, seinen Gefolgsleuten die den ideologischen Zusammenhalt stärkenden ›Feindbilder‹ zu vermitteln.«
(Verfassungsschutzbericht des bayerischen Innenministeriums für das Jahr 2003)
***
»Es gibt keine letztliche Klärung.«
(Ein nicht namentlich genannter Ermittler im Jahr 2019 zu den erneut aufgenommenen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft)
Prolog
Wäre er eine Runde länger Autoscooter gefahren. Hätte er sich an der Zuckerwattenbude nicht vorgedrängelt. Hätte sich das Riesenrad eine Runde länger gedreht. Hätte sein Vater nach der dritten Maß Bier nicht die Zeit vergessen und sich an die Vorschrift gehalten, dass Kinder um diese Zeit auf der Wiesn nichts mehr verloren haben. Dann wäre er nicht im falschen Moment am falschen Ort gewesen. Er und über zweihundert weitere Menschen, die am 26. September, um 21.21 Uhr, rechtzeitig vor Toresschluss dem Trubel entgehen wollten und sich dem Oktoberfest-Ausgang näherten.
Später wird er sich nur noch an eine große Stichflamme und einen Feuerball erinnern. Abgetrennte Arme und Beine werden durch die Luft geschleudert. Den entsetzlichen Knall können die meisten Opfer schon nicht mehr hören, weil ihnen bereits das Trommelfell zerfetzt wird, während die Flammen sie erreichen. Dann ein tödlicher Augenblick der Stille, bevor die ersten Sirenen ertönen.
Erst als er Stunden später auf der Kinder-Intensivstation im Krankenhaus München-Harlaching wieder zu sich kommt, erfährt er, was passiert ist. Eine Bombe ist auf dem Oktoberfest explodiert. Von den acht Toten, die zunächst gemeldet werden, erzählen ihm die Ärzte nichts. Die Zahl wächst später auf dreizehn an. Sein Vater und er haben das oft zitierte Glück im Unglück. Sie gehören zu den 218 zum Teil schwer Verletzten, die mit dem Leben davonkommen. Der Splitter der Bombe, der ihn an der Hand getroffen hat, hätte am Kopf tödlich wirken können. Trotz einer Notoperation können die Harlachinger Ärzte den kleinen Finger seiner linken Hand nicht retten und müssen ihn amputieren. Man wird ihm später aufmunternd sagen, dass er ja zum Glück Rechtshänder sei. Und das Oktoberfest wird er erst 25 Jahre später wieder betreten.
Seinem Vater zertrümmern die Splitter der britischen Mörsergranate mit einskommaneununddreißig Kilo Sprengstoff beide Beine. Er ist für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt.
Erstes Kapitel
Oberbürgermeister Heinz Körber hatte die Kellertür in seinem Reihenhaus in Pasing hinter sich fest geschlossen. Seine Frau war an diesem Abend wie jeden Dienstag mit ihren Freundinnen im Westbad: Sauna und Wellness inbegriffen. Sie würde nicht vor Mitternacht wieder zu Hause sein. Er hatte den laminierten Fußboden des Partykellers mit einer Plastikplane abgedeckt. Möglicherweise würde er eine Riesen-Sauerei verursachen, er hatte schließlich überhaupt keine Erfahrung. Hier würde ihn niemand sehen, er konnte sich nicht lächerlich machen. Das Fass hatte er sich am Nachmittag von seinem Großhändler ins Haus liefern lassen. Den Hammer, den man eigentlich Schlegel nannte, hatte er von seiner Sekretärin im Baumarkt kaufen lassen. Vor seinem Bauch trug er eine Küchenschürze seiner Frau. Körber schloss die Augen und stellte sich vor, von Millionen Menschen an den Fernsehschirmen beobachtet, den Schlegel zu schwingen. Er wusste, dass sein Vorgänger in den letzten Jahren nie mehr als drei Schläge gebraucht hatte. Er wusste aber auch, dass vor Jahrzehnten mal ein Oberbürgermeister sagenhafte 19 Schläge gebraucht und vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein unvorstellbares Desaster angerichtet hatte. Es würde der vielleicht wichtigste Moment in seiner bisherigen Amtszeit sein. Keine Rede im Stadtrat, kein Interview und kein Talkshow-Auftritt wurde in der Öffentlichkeit so beachtet wie das Anzapfen des ersten Bierfasses auf dem größten Volksfest der Welt.
Er setzte den Zapfhahn mit der linken Hand an und holte mit dem rechten Arm weit aus. Einmal, zweimal. Es spritzte leicht aus dem Fass. Dreimal, viermal. Es spritzte weniger. Fünfmal. Und nach einem kurzen Moment noch ein sechster Sicherheitsschlag hinterher. Flugs füllte er einen Liter Bier in eine mangels Maßkrug bereitgestellte Blumenvase, rief laut »O'zapft is!« und stellte sich den dazugehörigen Jubel der Massen vor.
Das hatte einigermaßen funktioniert. Bis zu seinem großen Auftritt waren es noch vier Tage. Jetzt fehlte nur noch die maßgeschneiderte Lederhose.
***
»Vorsicht, gefährliche Briefbombe«, rief Stefanie Schappert mit einem scherzhaft verschwörerischen Unterton und wedelte mit einem weißen Briefumschlag.
»Was ist?«, schrak Frank Litzka auf, der so in die Lektüre des Medium Magazins vertieft war, dass er die junge Volontärin gar nicht bemerkte, die sich seinem Schreibtisch im Großraumbüro der ATZ-Redaktion genähert hatte.
»Ein anonymer Brief, adressiert an die Lokalredaktion.« Sie blickte demonstrativ über die verwaisten Schreibtische. »Und außer dir, Flitzer, sehe ich hier im Moment keinen Lokalredakteur.«
Sie hatte Recht. Wegen der Sommerferien, die in diesen Tagen zu Ende gingen, waren die meisten der Redaktionsmitglieder mit schulpflichtigen Kindern noch verreist, was im nachrichtenarmen Sommerloch kein größeres Problem darstellte. Außer dem in drei Wochen beginnenden Oktoberfest, den beinahe obligatorischen Berichten über ausgebüxte Kängurus oder Krokodile und den Gerüchten der Klatschreporter um eine angebliche außereheliche Affäre eines als besonders fromm und katholisch geltenden Brauereibesitzers gab es derzeit kaum ein schlagzeilenträchtiges Thema in der Stadt. Sogar die Münchner CSU – sonst zu jeder Jahreszeit für einen Skandal gut – schlummerte in diesem Altweibersommer mit subtropischen Rekordtemperaturen ausnahmsweise friedlich vor sich hin.
Litzka legte die Zeitschrift zur Seite, in der er soeben in der Spalte »Personalien« gelesen hatte, dass die bisherige Washington-Korrespondentin der Süddeutschen nach ihrem Mutterschaftsurlaub als Außenpolitik-Chefin in die Münchner Zentralredaktion zurückkehren würde.
»Also gib her, Schappi«, sagte er zu der 24-jährigen Volontärin, die das heiße Wetter offenbar seit Wochen dazu nutzte, die Miniröcke und bauchfreien Tops aus ihrer Teeny-Zeit auszuführen. Doch leider waren ihr die Klamotten, in denen sie früher vielleicht tatsächlich mal sexy ausgesehen hatte, inzwischen ein paar Nummern zu klein geworden. Er vermied es daher, länger als nötig mit seinen Blicken an ihren Rundungen hängen zu bleiben, um ihr nicht das falsche Gefühl zu geben, sie würde mit ihrem Outfit in irgendeiner Form bei ihm ankommen.
Stefanie Schappert legte Litzka den Umschlag neben die schon fast leere Coca-Cola-Flasche auf den Schreibtisch, wo der Wind seines Tischventilators sofort drohte, das Papier hinwegzuwehen.
Er schaute auf die Uhrzeit, die unten rechts auf seinem Computerbildschirm eingeblendet war; alle Uhren an den Wänden des Verlagsgebäudes zeigten unterschiedliche Zeiten an, weshalb Redaktionskonferenzen nie pünktlich beginnen konnten. Es war kurz nach neun. »Jetzt schon?«, fragte er mit Blick auf den Umschlag. »Die Post kommt doch sonst erst gegen Mittag.«
»Ist abgegeben worden. Unten an der Pforte.«
»Hmm«, sagte Litzka und betastete den Umschlag, der handschriftlich mit Kugelschreiber adressiert war und keinen Absender trug.
»Du kennst die Vorschriften, wie wir mit verdächtigen Briefen umzugehen haben«, besserwisserte die junge Kollegin, deren Auftreten nicht nur Litzka immer wieder als etwas zu selbstbewusst und altklug erschien. Natürlich kannte er die Vorschrift, die im ganzen Verlag seit vielen Jahren galt und auf vergilbtem Papier an jedem Schwarzen Brett im Haus nachzulesen war. Damals war bei einem Münchner Fernsehsender eine an eine Moderatorin adressierte Briefbombe explodiert und hatte deren Assistentin verletzt. Seitdem hatte auch die ATZ ihre Mitarbeiter dazu verpflichtet, verdächtige Sendungen sofort der Polizei zu melden und keinesfalls eigenhändig zu öffnen. Allerdings hatte es in den letzten Jahren nie einen Anlass gegeben, diese Regelung anzuwenden.
»Was ist hieran verdächtig?«, meinte Litzka, der wegen seines Redaktionskürzels flitz seit Jahr und Tag in der Redaktion Flitzer genannt wurde, was er bei seinem Beruf als rasender Reporter durchaus als Ehrung empfand. »Da steht kein Absender drauf. Na und? Solche Briefe sind täglich in der Post. Es hat eben nicht jeder einen Absenderstempel daheim.«
Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Er war mal wieder froh, dass er nicht ihr Volontariatszeugnis zu schreiben hatte. Er betastete den Umschlag, hielt ihn vor das Licht seiner Halogen-Schreibtischlampe und stellte fest, dass der eindeutig nichts anderes enthielt als ein vermutlich harmloses Blatt Papier. »Wahrscheinlich einer dieser unsäglichen Leserbriefe mit rechtsradikalen Parolen«, murmelte er.
Doch die Volontärin war schon wieder an ihren eigenen Schreibtisch am anderen Ende des Großraumbüros verschwunden.
Vermutlich will sie sich vor der bevorstehenden Explosion in Sicherheit bringen, dachte er schmunzelnd. Da auf seinem Schreibtisch mal wieder kreatives Chaos herrschte und er keinen Brieföffner griffbereit hatte, nahm er eine Papierschere und riss den Umschlag auf. Heraus kam ein weißes Blatt ohne Briefkopf. Formlos bedruckt mit der leicht verwischten schwarzen Schrift eines Tintenstrahldruckers. Times New Roman, zwölf Punkt, sagte ihm sein typografisch geübtes Auge. Es waren nur vier Zeilen. Doch der Inhalt war tatsächlich hochexplosiv.
***
Hauptkommissar Jürgen Sonne schloss den Aktendeckel. Es war auch nach fast sieben Jahren bei der Münchner Mordkommission jedes Mal aufs Neue ein triumphierendes Gefühl, wenn er einen Mordfall abschließen, in der Kriminalstatistik unter der Rubrik »aufgeklärt« verbuchen und zur fast hundertprozentigen Aufklärungsquote des Dezernats beitragen konnte. Dies waren die Momente, in denen er die vielen Selbstzweifel vergaß und das Gefühl hatte, in einer Welt voller Mord und Totschlag für ein kleines Stück Gerechtigkeit gesorgt zu haben. Für die Aufklärung dieses Falles hatte seine MK4, die Mordkommission vier, die er seit anderthalb Jahren leitete, nicht einmal zwei Wochen gebraucht. Ein Obdachloser war im Stachus-Untergeschoss mit einer Schnapsflasche erschlagen worden – für eine Beute von fünfzehn Euro. Die Obduktion hatte zwar ergeben, dass die eigentliche Todesursache ein Hitzschlag in Verbindung mit einem Vollrausch gewesen war. Doch das konnte der Täter nicht wissen, der sich mit der Beute vermutlich die nächste Fusel-Ration finanziert hatte. Sonne und seine drei Kollegen von der MK4 – eine fünfte Planstelle existierte seit Jahren nur auf dem Papier und war nicht mehr besetzt worden, als ein Kollege pensioniert wurde – hatten tagelang in der brütenden Hitze im Obdachlosenmilieu ermittelt und zahllose Befragungen durchgeführt. Sonne bildete sich immer noch ein, dass im Vernehmungszimmer des Dezernats 11 eine Schnapsfahne zu riechen sei.
Er trank die Tasse Kaffee aus, die auf seinem Schreibtisch stand. Dann schälte er sich – wie jeden Tag um halb zehn – einen grünen Apfel. Sein oft turbulenter Tagesablauf brauchte gewisse Fixpunkte, die für ihn fast zu Ritualen geworden waren.
Sein Blick hing am Turm des Liebfrauendoms, den er von seinem Büro im Neubautrakt des Polizeipräsidiums in der Ettstraße aus sehen konnte, als Sherlock mit einem kurzen Anklopfen sein Büro betrat.
»Servus Sonne«, sagte der blonde Däne mit Münchner Zungenschlag, der eigentlich Gunnar Holmsen hieß, aber seit seinem ersten Tag im Morddezernat von allen nur Sherlock Holmsen genannt wurde. Er winkte mit einer grünen Akte. »Das hat mir Steini in die Hand gedrückt.« Nur in dessen Abwesenheit nannte er Kriminaloberrat Horst Steinmayr so. Denn allen Mitarbeitern war bekannt, dass der Leiter des Dezernats für Tötungsdelikte diese Koseform nicht gerne hörte.
»Sieht aus nach einem Rätsel aus der Rubrik ›Aktenzeichen XY ungelöst‹«, sagte Sonne und nahm Sherlock die Akte aus der Hand.
»Du sagst es. Der passende Fall zur Jahreszeit.«
Sonne öffnete den grünen Aktendeckel und sah das Porträtfoto einer sehr hübschen knapp zwanzigjährigen Frau. Auf dem Kopf trug sie einen Stoffhut in der Form eines Bierkruges. Sie lachte fröhlich in die Kamera. Es handelte sich um einen Bildausschnitt, und es war zu erkennen, dass auf dem ursprünglichen Foto noch zwei Menschen rechts und links von ihr gestanden hatten. Sie hatten sich alle in ausgelassener Stimmung gegenseitig die Arme über die Schulter gelegt.
»Erinnerst du dich an den Wiesn-Mord?«, wollte Sherlock wissen und bestätigte Sonne in seiner Vermutung, dass die nette Frau derzeit nicht mehr lächelte. Er blätterte um. Wie ein Schlag in die Magengrube traf ihn das Tatortfoto. Die Augen des Opfers waren im Schrecken des Todes weit aufgerissen. Flüchtig las er die Tatortangaben. Fundort: Isarauen am Fuß der Brücke zwischen Tierpark und Flaucher. Sonne kannte die Stelle, wo im Sommer oft bis spät in die Nacht hinein gegrillt wurde und wo sich tagsüber zahlreiche Sonnenanbeter bräunten. Fundzeit: 30. September 2006, 7.19 Uhr. Name des Opfers: Kischel, Marianne. Geboren am 8. August 1986. Sie war gerade zwanzig geworden, bevor sie jemand so zugerichtet hatte. Sonne sah auf dem Foto die blauen Würgemale an ihrem Hals.
Er war erschüttert. »Nein, damals habe ich noch in Köln Dealer eingelocht«, beantwortete Sonne die Frage seines Kollegen. »Aber wieso spricht man vom ›Wiesn-Mord‹? Der Flaucher ist nicht die Theresienwiese.«
»Blätter mal um. Marianne Kischel war Bedienung auf dem Oktoberfest. Und die Leser der ATZ hatten sie kurz zuvor zum Wiesn-Madl des Jahres gewählt. Sie hatte am Abend zuvor noch auf der Wiesn gekellnert.«
Sonne sah einen Zeitungsartikel, der fein säuberlich mit Tesastreifen auf einem DIN A4-Blatt aufgeklebt war.
»Der Fall hat damals für großes Aufsehen gesorgt. Ich war zwar auch noch nicht hier bei der Kripo, kann mich aber trotzdem an die Zeitungsberichte erinnern«, sagte Holmsen.
»Ein Sexualmord?«
»Möglich. Aber das ist nie endgültig bewiesen worden. Fest steht nur: Wenn der Täter die Frau vergewaltigen wollte, dann hat sie sich so heftig gewehrt, dass es ihm nicht gelungen ist.« Nach einem Moment fügte er hinzu: »Dafür hat er sie vermutlich im Kampf erwürgt. Der Täter ist nie gefasst worden.«
»Das weißt du jetzt aber nicht alles aus den Zeitungsberichten von früher, oder?«
»Nein, nein. Ich war so frei und habe bereits einen Blick in die Akte geworfen. Steini ist schon ein Witzbold, uns den Fall ausgerechnet jetzt zur Wiesn-Zeit wieder vorzulegen.«
»Wenn wir den Mord pünktlich zum Oktoberfest aufklären, wäre das doch ein gutes Timing. Martin Brandt in der Pressestelle würde das sicher gefallen. Gab es verwertbare DNA-Spuren?«
»Steht ganz am Schluss der Akte. Man hat unter den Fingernägeln der Toten Hautpartikel gefunden, aus denen ein DNA-Muster erstellt wurde. Allerdings hat der Datenbankabgleich keine Treffer ergeben.«
»Das heißt also«, murmelte Sonne, »der Täter ist weder vor noch nach dem Mord einschlägig auffällig geworden.«
»Wie wär's mit einem Massengentest«, schlug Holmsen feixend vor. »Wir laden einfach alle Wiesn-Besucher von 2006 zur Speichelprobe vor.«
Sonne verzog den Mund zu einem bösen Grinsen: »Der größte Massengentest aller Zeiten. Mit sieben Millionen Verdächtigen. Wenn's weiter nichts ist.« Sein Blick fiel wieder auf das Foto der Ermordeten. Er stellte sich einen besoffenen, stinkenden Wiesn-Besucher vor, der im Vollrausch über die zierliche Frau herfällt, um sie zu vergewaltigen. Angewidert sagte er mehr zu sich selbst: »Wir müssen dieses Schwein kriegen.«
***
Eine gute halbe Stunde später hatte sich die Redaktion im Konferenzraum versammelt. Viele Stühle blieben wegen der Ferienzeit leer, im schwarzen Ledersessel am Kopfende des Besprechungstisches saß wie immer Chefredakteur Wolfgang Lohmann, der – ebenfalls wie immer – ohne ein Wort der Begrüßung mit der Blattkritik begann und dabei diesmal für seine Verhältnisse recht positive Worte für den Aufmacher über die angebliche Schoberl-Affäre fand.
Litzka hatte den anonymen Brief mit der bedruckten Seite nach unten vor sich liegen. Immer noch war er sich unsicher, ob er ihn überhaupt erwähnen solle. Denn entweder handelte es sich ja um einen üblen Scherz oder um die Hammer-Story, die mit einem Schlag das Sommerloch vergessen machen würde.
»Dafür, dass es immer noch keinen Beweis dafür gibt, dass dieser fromme Brauerei-Heini da eine heiße Nummer am Laufen hat, ist die Story passabel geschrieben. Aber es wird Zeit, dass wir die Sache endlich mal hart kriegen.« Es war allen bekannt, dass das große Konkurrenzblatt eine fünfstellige Summe für den Informanten geboten hatte, der den ersten handfesten Beweis dafür lieferte, dass der Besitzer der traditionsreichen Klosterbräu-Brauerei, Kilian Schoberl, es mit der ehelichen Treue nicht so genau nahm. Das wäre im Grunde kein Skandal gewesen, wenn Schoberl nicht auch noch ehrenamtlicher Vorsitzender des Kolpingwerk-Diözesanverbands gewesen wäre und damit im ganzen Freistaat als der oberbayerische Vorzeige-Katholik gegolten hätte.
»Es wäre doch schön«, fuhr Lohmann fort, »wenn wir der Konkurrenz mit den vier Buchstaben ein Schnippchen schlagen und die Schoberl-Story als Erste bringen könnten«.
Alle nickten behutsam, denn Lohmann war ein Chef, der sich in Konferenzen nur ungern mit Gegenmeinungen auseinandersetzte. Den Namen der »Bild«-Zeitung nahm er grundsätzlich nie in den Mund.
»Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir nicht irgendwann eine Verleumdungsklage am Hals haben«, warnte Peter Hilfringhaus, der Politikchef. »Wenn sich die ganze Affäre als Luftnummer entpuppt, geht der Schuss gewaltig nach hinten los.«
»Erstens sind wir ein Boulevardblatt und nicht die Tagesschau«, erwiderte Lohmann, während er an seiner Pfeife herumfingerte, »zweitens ist das ein Aufregerthema, über das die Leute reden. Egal, ob was dran ist oder nicht. Und drittens gibt es kein Alternativthema. Wir können ja schließlich nicht wochenlang Geschichten über die Rekordhitze oder die neue Geisterbahn auf dem Oktoberfest bringen.« Dann brummelte er: »Oder hat irgendjemand hier vielleicht eine andere Zeile für morgen?«
Alle blickten betreten auf die Tischplatte, in der Hoffnung, nicht angesprochen zu werden.
Litzka dachte eine Sekunde nach, dann wagte er einen Vorstoß. »Also, ich hätte da vielleicht was. Ich habe heute einen anonymen Brief ...«
»Flitzer, du weißt genau, dass wir keine anonymen Leserbriefe drucken«, fiel ihm Lohmann ins Wort. Obwohl Litzka inzwischen 29 Jahre alt war und damit seit seinem ersten Schulpraktikum bei der ATZ zwölf Jahre vergangen waren, blieb Lohmann immer noch beim Du. Litzka hatte schon oft überlegt, dass er ihn eigentlich mal zurückduzen müsse.
»Lassen Sie mich doch erst mal ausreden, Herr Lohmann«, sagte er in einem Anflug von Übermut. »Ich gebe zu: Ich kann nicht ausschließen, dass das hier ein übler Scherz ist. Wenn aber nicht, dann geht heuer auf dem Oktoberfest eine Bombe hoch. Und das ist jetzt nicht im übertragenen Sinne gemeint.«
»Wie bitte?«, fragte Lohmann. »Was soll das heißen?« Auch die anderen blickten ihn neugierig an.
Litzka schob seine kleine, randlose Brille zurecht. »Ich lese vor: ›Dies ist kein Spaß. Auf dem Oktoberfest ist ein Anschlag geplant. Die Bombe soll am 26. September explodieren. Es wird viele Tote und Verletzte geben. Ich wiederhole: Das ist kein Spaß.‹ Anstelle einer Unterschrift steht hier: ›Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich meinen Namen nicht nennen kann.‹«
Zunächst waren alle Redaktionsmitglieder sichtlich geschockt über das, was Litzka ihnen vorgelesen hatte.
Lohmann fand als Erster die Sprache wieder: »Ist heute der 1. April oder soll das ein verspäteter Faschingsscherz sein?«
»Also, nach einer Taliban-Drohung sieht das nicht aus«, blödelte Hilfringhaus und Litzka kicherte unhörbar.
»Wir sollten auf jeden Fall die Polizei einschalten«, schlug Stella Schulze-Wagenknecht, die Kulturchefin, vor.
»Damit die dann eine Pressemitteilung rausgibt und alle anderen die Story auch haben?«, konterte Litzka.
»Aber wir können doch nicht aufgrund eines anonymen Briefes die ganze Stadt und Millionen Wiesn-Besucher in Panik versetzen«, gab Otmar Altmeier zu bedenken, der für Wirtschaft verantwortlich zeichnete.
»Altmeier hat Recht«, sprach Lohmann. »Unsere journalistische Verantwortung gebietet es, diese Drohung – und um nichts anderes handelt es sich hier ...«
»Das klingt weniger nach einer Drohung als nach einer Warnung«, warf Litzka dazwischen.
»... diese Drohung nicht voreilig und ungeprüft zu veröffentlichen.«
»Ungeprüft?«, Litzka schüttelte den Kopf. »Wie wollen Sie das denn bitteschön überprüfen? Wollen Sie eine Umfrage bei allen Terroristen und Bombenlegern starten?« Er bemerkte, dass er seinen Ton vielleicht eine Nuance zu forsch gewählt hatte.
Doch Lohmann reagierte mit Ignoranz und fuhr fort: »Bevor auch nur eine Zeile aus diesem Brief in unser Blatt wandert, müssen wir den Oberbürgermeister informieren. Ich werde das persönlich in die Wege leiten.« Es war kein Geheimnis, dass Lohmann und Oberbürgermeister Heinz Körber langjährige Schafkopffreunde waren. Als Körber vor einem Jahr noch als SPD-Spitzenkandidat bayerischer Ministerpräsident werden wollte, hatte Lohmann ihn mit allen nur denkbaren und undenkbaren publizistischen Mitteln unterstützt – natürlich vergeblich im tiefschwarzen Freistaat. Nach der unvermeidlichen Niederlage bei der Landtagswahl war Körber dann jedoch mit großer Mehrheit zum Nachfolger des populären und beliebten Münchner OB gewählt worden. Litzka fragte sich insgeheim, wie die Berichterstattung der ATZ aussähe, wenn nicht Schoberl, sondern Körber eine Sex-Affäre nachgesagt würde. Na ja, er dachte nicht länger darüber nach.
»Mir fällt da etwas auf«, meldete sich die Volontärin Stefanie Schappert zu Wort. »Der 26. September ist der Jahrestag des Bombenanschlags auf das Oktoberfest.«
Natürlich! Warum war ihm das nicht selbst sofort aufgefallen. Litzka erinnerte sich nur ganz schwach an das schreckliche Ereignis. Er ging damals in Milbertshofen in den Kindergarten des Autokonzerns BMW, bei dem sein Vater am Fließband stand. Die grausigen Szenen von der Oktoberfestbombe waren die ersten Fernsehbilder, an die er sich noch bewusst erinnern konnte. Oft hatte er den Gedenkstein am Haupteingang des Oktoberfestgeländes gesehen. Mehrmals hatte er auch schon über die jährliche Gedenkfeier auf der Theresienwiese berichtet.
»Wir könnten aber auf jeden Fall eine umfassende Serie über den Jahrestag des Anschlages starten«, schlug Litzka vor. Seine Idee stieß bei allen auf positive Resonanz. »Man könnte mit Zeitzeugen reden, Terrorexperten, Interview mit dem Innenminister und so weiter ...«
»Sehr gut, Flitzer«, lobte Lohmann. »Du nimmst die Sache in die Hand. Aber unser Top-Thema bleibt auf jeden Fall die Sex-Affäre um Schoberl.«
Litzka las noch einmal den Brief. Bis zum angekündigten Anschlag waren es noch 21 Tage.
Zweites Kapitel
Kai Walbrecht öffnete eine Dose Klosterbräu-Bier in seiner Anderthalb-Zimmer-Wohnung im Karl-Marx-Ring in Neuperlach. Sein Gesicht war rot angelaufen, und er schwitzte. Die Hitze machte ihm zu schaffen, die vielen Treppenstufen bis zu seiner Bude im vierten Stock ebenfalls. Das Haus im Plattenbaustil machte seiner Adresse alle Ehre. Hätte er es sich aussuchen können, wäre er nie in diese Straße in der Münchner »Ostzone« gezogen. Doch nach seiner Lehre als Chemielaborant und einem Fließbandjob in der Halbleiterproduktion bei Siemens war er vor einigen Jahren arbeitslos geworden, sodass eine Wohnung in Schwabing oder Bogenhausen wohl für immer ein unerfüllbarer Traum bleiben würde. Ausgerechnet Karl Marx. Dass es in einer bayerischen Stadt überhaupt eine solche Straße gab, war schon unfassbar. Ein Prachtboulevard war der Karl-Marx-Ring nicht gerade. Es gab hier keine Opernhäuser, Boutiquen oder Luxus-Hotels. Dafür ein Wohnheim für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, eine Kindertagesstätte, ein Billig-Hotel, ein Qigong-Zentrum und ein Heizwerk der Stadtwerke. Es gab auch einen Friedrich-Engels-Bogen, eine Bert-Brecht-Allee und eine Tucholskystraße in Perlach. Kai vermutete, dass auch Gerhart Hauptmann, Annette Kolb und Oskar Maria Graf, nach denen Straßen in der Gegend benannt waren, irgendwelche linke Helden waren. Kurt Eisner, das wusste er, war mal nach dem Ersten Weltkrieg Chef der Sozialisten in Bayern gewesen. Und Jude. Auch seinen Namen trug hier eine Straße.
Vor ihm lag der Inhalt seines Briefkastens. Ein Schreiben von der Bundesagentur für Arbeit, eine Ankündigung des Heizungsablesers und eine Rechnung der Autowerkstatt für das Auswechseln eines Ersatzteils, von dessen Existenz er bislang nichts gewusst hatte. 250 Euro, das war ein Zehntel dessen, was er für den Kadett mal bezahlt hatte. Und das Geld, das ihm sein Onkel für diesen geliehen hatte, war bis heute nicht zurückgezahlt. Er steckte sich eine selbstgedrehte Zigarette an, nahm einen letzten großen Schluck aus seiner Bierdose und rülpste laut. Er musste auf niemanden Rücksicht nehmen, hatte noch nie mit jemandem zusammengelebt, geschweige denn eine Freundin gehabt, obwohl er schon dreißig Jahre alt war. In der Schule hatten sie ihn immer nur »Tonne« oder »Specklippe« genannt. Seine Mutter starb, als er zwölf war. Sein Vater wurde Alkoholiker. Das Jugendamt holte ihn daher aus der elterlichen Wohnung am Hasenbergl und steckte ihn in ein Internat, wo er den Realschulabschluss machte. Er war kein schlechter Schüler gewesen, aber ein Einzelgänger. Daran hatte sich in seinem Leben erst vor einigen Monaten etwas geändert.
Er ging zu seinem CD-Radio-Kassetten-Kombigerät, das in einem Billy-Regal von IKEA neben einem Stapel alter Hustler-Hefte stand, und legte eine CD von Störkraft ein. Das hörte man in der Szene, in der er sich erstmals so angenommen fühlte, wie er war.
Wut, Stolz in jedem Mann. Blut und Ehre für dein Vaterland ...
Kai Walbrecht ließ sich rücklings auf sein ungemachtes Futonbett fallen. Er hatte Kopfschmerzen. Das Wetter. Der Föhn. Sein Blick fiel auf die roten Ziffern des Radioweckers, der neben seinem Bett stand und seit Jahren auf Gong 96,3 eingestellt war.
Wir werden die Tränen unserer Ahnen rächen und werden vereint die letzte Flut entbrechen ...
13.44 Uhr. Noch Zeit genug, sich routinemäßig bei der Arbeitsagentur vorzustellen und sich dann rechtzeitig im »Sendlinger Hof« mit D.D. und den anderen zu treffen. Vorher würde er sich im McDonald's im PEP noch einen BigMäc ziehen. Früher hatte er oft Döner gegessen. Doch das war lange vorbei.
Überall seh ich Ausländermassen. Das kann nicht Deutschland sein. Nein!
***
»Kein Wort darf an die Öffentlichkeit gelangen!«
Heinz Körber war erst ein halbes Jahr im Amt des Münchner Stadtoberhauptes. Seine Aufregung vor seiner Oktoberfest-Premiere wäre auch ohne Bombendrohung groß genug gewesen. Schließlich schaute die ganze Welt alljährlich auf die Theresienwiese, wenn der Oberbürgermeister das erste Fass Wiesn-Bier anstach und mit dem traditionellen Ruf »O'zapft is« das größte Volksfest der Welt eröffnete. Sein Vorgänger hatte nach zehn Amtsjahren nie mehr als drei Schläge fürs O'zapfen gebraucht. Jeder Münchner Oberbürgermeister fürchtete nichts mehr als Fotos in der Weltpresse, auf denen er vollgespritzt mit einem Hammer in der Hand gegen Bierfontänen aus dem Fass ankämpfte. Doch jetzt wurde ihm Angst und Bange beim Gedanken daran, dass in seinem ersten Amtsjahr eine Katastrophe auf der Wiesn geschehen könne. Oder dass das Oktoberfest sogar aus Furcht vor einem Anschlag abgesagt würde. Er legte den Brief zur Seite, den Chefredakteur Lohmann ihm gefaxt und den er jetzt in der kleinen kurzfristig einberufenen Runde in seinem Amtszimmer im Rathaus am Marienplatz verlesen hatte. Angesichts der Hitze hatten die Herren ihre Jacketts ausgezogen und über ihre Stuhllehnen gehängt.
»Wir müssen mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften für eine sichere Wiesn sorgen«, betonte Körber und zupfte dabei nervös an seinem schwarzen Vollbart. Die Krawatte hatte er etwas gelockert.
»Sicher, das werden wir«, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Rainer Heisinger. »Seit den Anschlägen vom 11. September haben wir jedes Jahr eine Hochsicherheitswiesn gehabt. Da wird auch heuer nichts passieren. Vierzehn Kameras haben wir installiert. Dagegen ist Big Brother ein Kindergarten. Und zusätzlich zu den uniformierten Kräften der Wiesn-Wache sind zahlreiche Beamte in Zivil unter den Festgästen. Wir sind mit 300 Mann vor Ort.«