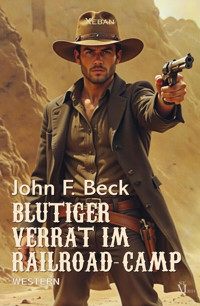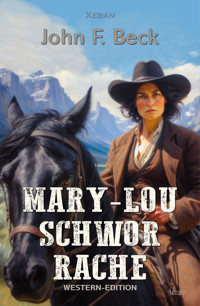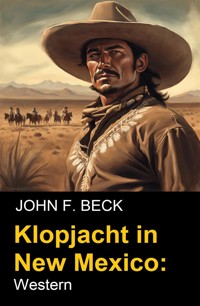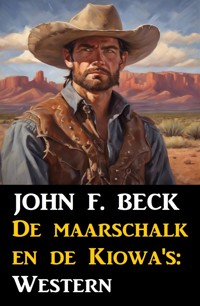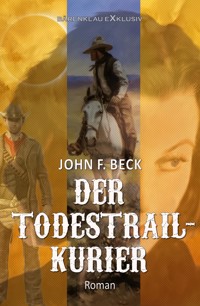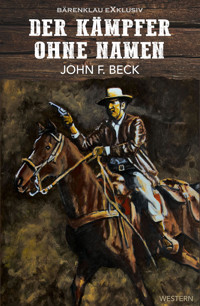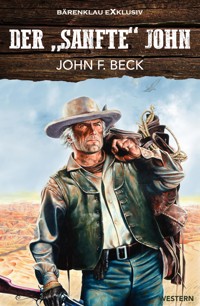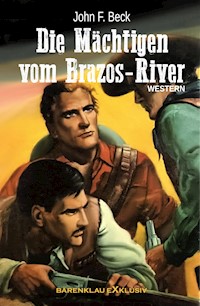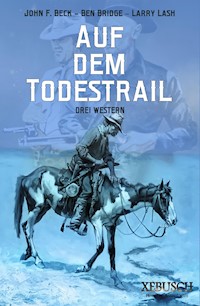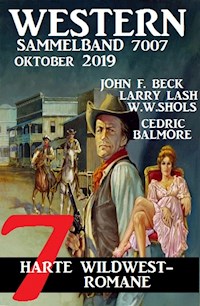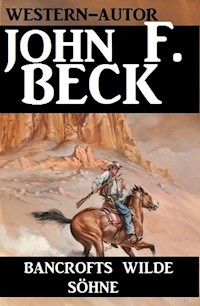
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Western von John F. Beck Der Umfang dieses Buchs entspricht 127 Taschenbuchseiten. Die Söhne von Tom Bancroft spielen ein falsches Spiel. Sie beschuldigen Chad, den ehemaligen Sattelgefährten ihres Vaters, des Mordes und des Diebstahls von 40 000 Dollar. Tom Bancroft glaubt seinen Söhnen, und für Chad Kelly geht es plötzlich um den eigenen Hals.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Bancrofts wilde Söhne
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bancrofts wilde Söhne
Western von John F. Beck
Der Umfang dieses Buchs entspricht 127 Taschenbuchseiten.
Die Söhne von Tom Bancroft spielen ein falsches Spiel. Sie beschuldigen Chad, den ehemaligen Sattelgefährten ihres Vaters, des Mordes und des Diebstahls von 40 000 Dollar. Tom Bancroft glaubt seinen Söhnen, und für Chad Kelly geht es plötzlich um den eigenen Hals.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER FIRUZ ASKIN
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Mit schussbereiten Gewehren duckten sich die Männer hinter den Felsblöcken am Schluchteingang. Schweiß perlte auf ihren angespannten Gesichtern. Die Dunkelheit vor ihnen war von einer tödlichen Drohung erfüllt. Das ferne Geheul eines Coyoten klang wie Hohngelächter. Jim McDunn, der große blonde Vormann der Bancroft-Ranch, warf einen düsteren Blick auf die mit Geld gefüllten Satteltaschen neben dem nur noch schwach glosenden Feuer.
„Gib dir keine Mühe, Jefford!“, rief er. „Ich weiß, dass du mit deinen Killern dort draußen herumschleichst. Ihr verdammten Kerle seid hinter uns her, seit wir Silver City verlassen haben. Aber ihr werdet uns nicht erwischen. Wir pumpen jeden voll Blei, der sich näher als zehn Yard an uns heranwagt.“
Stille. Der Coyote war verstummt. Die Nacht glich einer schwarzen, erdrückenden Mauer, die sich immer enger um das einsame Camp schloss. Dann kam ein leises Lachen aus der Finsternis.
„Nervös, Vormann? Keine Bange, wir wollten nicht eure Skalps, sondern nur das Geld. Rück den Zaster ‘raus, dann verschwinden wir.“
„Den Teufel tu ich!“ McDunns lassonarbige Fäuste umspannten hart die Winchester 73. „Komm her, wenn du die Dollars willst. Dann wirst du schon sehen, was dir blüht.“
„Wünsch dir das lieber nicht, Kuhtreiber. Keiner von euch würde es überleben. Binde die Taschen mit dem Geld auf ein Pferd und schick es zu mir herüber. Was sind schon vierzigtausend Piepen gegen euer Leben, he?“
Das erneute spöttische Lachen zerrte an den Nerven der Bancroft-Reiter. Larry, Tom Bancrofts jüngster Sohn packte den großen Vormann am Arm. „Jefford blufft nicht! Der ist in ganz New Mexico bekannt dafür, dass er nie mit leeren Händen abzieht. Der hat bestimmt noch irgendeinen verdammten Trumpf im Ärmel. Tu, was er verlangt, Jim! Gib ihm das verfluchte Geld!“
McDunns hartliniges, verwittertes Gesicht zuckte herum. „Bist du verrückt? Dein Glück, dass der Boss dich nicht hört! Wenn Jefford, dieser Bastard, das Geld für die zweitausend verkauften Longhorns kassiert, würde das den Ruin für eure Ranch bedeuten. Menschenskind, Larry, es geht nicht um ein paar lumpige hundert Dollar, sondern um die runde Summe von vierzigtausend! Jahrelang hat euer Vater auf dieses Geld gewartet, um die Ranch endlich richtig hochzubringen.“
„Zum Teufel mit der Ranch!“, knurrte Larrys älterer Bruder Jess, ein hagerer Mann mit einer Narbe auf der linken Wange. „Ich kann das nicht mehr hören. Immer geht es nur um die Ranch, um die verdammten Rinder! Wir hatten ja nicht mal Zeit, in Silver City tüchtig auf die Pauke zu hauen. Nein, wir mussten gleich wieder in die Sättel, kaum dass wir die Herde verkauft hatten. Damit Dad nur ja nicht zu lange auf uns warten muss – oder vielmehr auf den Zaster. Die Ranch hochbringen? Noch mehr Weideland und Kühe? Ich hab die Schnauze voll davon. Ich denk nicht dran, dafür meinen Skalp gegen Ringo Jefford und seine Bande zu riskieren.“
McDunns Mundwinkel verkniffen sich. Er starrte die Söhne seines Ranchers brennend an. „Verdammt noch mal, für wen macht der Boss denn das alles? Für wen rackert er sich die Seele aus dem Leib, he? Habt ihr vergessen, dass die Ranch, das Land, die Rinder eines Tages euch und eurem Bruder Will gehören werden?“
„Eines Tages!“ Jess Bancroft spuckte aus. „Wenn wir grau, sattellahm und halbtot geschunden sind, was? Vorausgesetzt, wir kommen hier mit heiler Haut davon. Du bist ein Narr, Jim. Du tust ja fast so, als sei es dein Zaster.“
„Ich hab hier das Kommando. Der Boss verlässt sich darauf, dass ich den Herdenerlös auf den Cent genau bei ihm abliefere. Jefford bekommt die Bucks nur über meine Leiche.“ Sein Blick bohrte sich wieder in die Dunkelheit. „He, Jefford, du Hundesohn, du wartest umsonst. So billig bekommst du die Beute nicht.“
Ringo Jeffords lässige Stimme klang jetzt eine Spur schärfer. „Wie du willst, Cowboy. Vorwärts, Amigos, beweisen wir diesem Strohkopf, dass er keine Chance hat.“
Verschwommene Geräusche sickerten aus der Nacht: Hufgestampfe, Leder knarrte, das Klirren von Metall. McDunn schob entschlossen den Winchesterlauf über eine Felskante.
„Lasst sie ‘rankommen! Schießt erst auf mein Zeichen! Nur ruhig, Jungs, wir haben genug Munition, um einen ganzen Indianerstamm aufzuhalten.“
Die Männer atmeten gepresst. Anfangs waren die Bewegungen in der Finsternis vor ihnen mehr zu ahnen, als richtig zu sehen. Dann schälten sich allmählich schwarze Reitergestalten aus der Nacht. Die Banditen ritten lässig und ohne auf Deckung zu achten heran, so, als könnte ihnen keine Kugel etwas anhaben.
„Jetzt!“, zischte der Vormann. „Gebt es ihnen!“
Die Finger an den Abzugsbügeln krümmten sich. Es klickte nur metallisch. Einer der Cowboys fluchte erschrocken. Ein Zucken jagte über McDunns Miene. Blitzschnell betätigte er den Repetierbügel, zielte auf den vordersten schemenhaften Reiter und drückte wieder ab. Nichts!
Jeffords spöttisches Gelächter erfüllte die Nacht. Keuchend warf sich McDunn herum. „Zu den Pferden!“
„Zu spät!“, meldete sich Jess‘ eisige Stimme beim Feuer. „Du hättest tun sollen, was Larry dir vorschlug. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Jim.“
McDunn und die beiden anderen Cowboys der Bancroft-Ranch starrten den hageren Ranchersohn in fassungslosem Entsetzen an. Jess hatte einen Fuß auf die prall mit Geldscheinen gefüllten Ledertaschen gestellt. Er hielt die Winchester im Hüftanschlag. Die Mündung deutete auf den Vormann. Im blass-roten Schein der niedrig züngelnden Flammen glich Jess‘ von Narben gezeichnetes Gesicht mit den tiefliegenden Augen einer Teufelsmaske. Larry trat neben ihn. Sein junges bleiches Gesicht war von derselben grausamen Entschlossenheit erfüllt wie die Miene seines Bruders.
„Nein!“ Das Wort kam wie ein heiseres Stöhnen aus McDunns Kehle. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. „Um Himmels willen, Jungs, ihr könnt doch nicht …“
„Doch, Jim!“, unterbrach Jess ihn hart. „Wir haben die Patronen in euren Gewehren präpariert, und wir werden auch dafür sorgen, dass niemand erfährt, was hier geschehen ist …“
Ehe McDunn eine Bewegung machen konnte, stach ein Feuerstrahl aus Jess Gewehr. Der Vormann prallte rücklings gegen die Felsendeckung. Die Winchester entglitt ihm. Ächzend presste er beide Hände gegen die Brust. Zwischen seinen Fingern quoll Blut hervor. Jess schoss nochmals, und McDunn stürzte, als sei ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Der Mann rechts von ihm hatte seinen Karabiner weggeworfen und versucht, den Revolver zu ziehen. Jetzt fiel er ebenfalls. Steif wie ein Brett kippte er vornüber. Larry Bancrofts Kugel hatte ein hässliches Loch in seine Stirn geschlagen.
Der dritte Weidereiter rettete sich mit einem verzweifelten Sprung in die Dunkelheit auf der anderen Seite der Felsklötze. Aber das Klappern der Hufe auf dem steinigen Grund war schon zu nahe. Jess schrie: „Aufgepasst! Lasst ihn nicht entkommen, sonst fliegt alles auf!“
Pferde wieherten und schnaubten, Steine kollerten, dann ging alles im Krachen mehrerer Revolver unter. Der langgezogene Schrei dazwischen klang nur wie ein schwaches fernes Echo. Gleich darauf zügelte Ringo Jefford seinen hochbeinigen Rapphengst neben dem niedrigen Campfeuer. Mit seinem dunkel gestreiften Anzug, der Kragenschleife und dem flachkronigen schwarzen Hut sah Jefford wie ein Berufsspieler aus. Ein 38er Remington Revolver ruhte in seiner nervigen Rechten. Sein schmales, gut geschnittenes, aber kaltes Gesicht zeigte keine Regung. Nur das Funkeln in seinen dunklen Augen schien sich zu verstärken, aber daran konnten auch die Flammen schuld sein.
„Erledigt!“, sagte er knapp. „Habt ihr das Geld?“
Jess schwang die prall gefüllten Ledertaschen auf die Schulter. Die Narbe auf seiner Wange leuchtete wie ein Kreidestrich. Ein wildes Grinsen spannte seine dünnen Lippen. „Genug für uns alle! Wir werden uns drüben in Mexiko verdammt schöne Tage machen, was, Ringo? Larry und ich kehren nie mehr auf die Ranch zurück. Kein Mensch wird ahnen, dass Tom Bancrofts Söhne mit der berüchtigten Jefford-Bande unter einer Decke stecken.“
Er lachte rau und laut. Die kaltäugigen, schwerbewaffneten Reiter, die hinter Jefford zwischen den Felsen auftauchten, grinsten. Lässig hob der schlanke, dunkel gekleidete Bandenboss die Schultern.
„Worauf wartet ihr noch? Steigt auf die Pferde. Wir teilen erst, wenn wir auf der anderen Seite der Grenze sind.“
2
„Chad!“ Der verzweifelte Aufschrei der jungen, schwarzhaarigen Frau hallte in den hitzeflimmernden Hügeln, die sich rings um die kleine Ranch ausdehnten. Keuchend versuchte sich die hübsche Mexikanerin aus dem Griff der harten Fäuste zu befreien. Doch der hochgewachsene wie ein Cowboy gekleidete Mann, dessen Wangen von blonden Bartstoppeln bedeckt waren, lachte nur heiser. Wilde Gier glitzerte in seinen graugrünen Augen.
„Da hab ich ja ‘ne richtige kleine Wildkatze erwischt, was? So viel Feuer im Blut, das gefällt mir, Muchacha. Warte, ich werde dich schon zähmen, du Biest! Versuch nur ja nicht, mir die Augen auszukratzen, sonst holt dich der Teufel!“
Seine Fäuste umklammerten die Handgelenke der jungen Frau wie Schraubstöcke. Er presste sie heftig an sich. Die Nähe ihres biegsamen, sich windenden Körpers machte ihn noch verrückter. Unter seinen Stiefeln knirschten die Scherben des Tonkrugs, mit dem die Mexikanerin ihm zuvor frisches, klares Quellwasser zum Trinken angeboten hatte. Der staubbedeckte Cayuse des Blonden war hastig an einem Vordachpfeiler des niedrigen, mit Erdschollen gedeckten Ranchhauses festgeleint.
„Chad!“, schrie die Frau wieder.
Ihre Gegenwehr erlahmte allmählich. Entsetzen flackerte in ihren mandelförmigen braunen Augen.
„Schrei nur!“, keuchte der Halunke, während er ihre Arme nach hinten zwang. „Er hört dich ja doch nicht. Er ist irgendwo weit draußen auf der Weide. Seine verdammten Rinder gehen ihm ja über alles, genau wie meinem Oldman. Gib es auf, Puppe! Hier sind wir ganz allein und niemand.
„Irrtum, Will! Wenn du sie nicht auf der Stelle loslässt, schieße ich dir eine Kugel durch den Kopf, ohne dass es mir hinterher leid tut!“
Die metallisch klingende Stimme riss Tom Bancrofts zweitältesten Sohn herum. Der große, breitschultrige Mann, dessen wettergegerbtes Gesicht auf kein bestimmtes Alter schließen ließ, war lautlos wie ein Indianer zwischen den Kreosotbüschen an der Hüttenecke aufgetaucht. Das gleißende Sonnenlicht versilberte den langläufigen Frontiercolt in seiner rechten Faust. Der Mann stand so unbeweglich wie ein Felsblock, und genauso hart und unerschütterlich wirkte er auch. Eiseskälte schimmerte in seinen blauen Augen.
„Du hast geglaubt, ich merke nicht, wie du schon seit Tagen hinter mir her spionierst, Will, was? Als ich heute deine Fährte auf meinem Land entdeckte, da wusste ich, wohin du reiten würdest. Ich kenne dich doch, dich und deine Brüder! Weiß Gott, euer Vater hätte bessere Söhne verdient! Lass Conchita endlich los, wenn du nicht willst, dass ich abdrücke!“
Will Bancroft wirbelte halb herum, so dass die Frau, die er noch immer festhielt, zwischen ihm und dem Mann mit dem Colt stand. In seinem hageren Gesicht zuckte es.
„Das wagst du nicht, Kelly!“, keuchte er. „Du kennst meinen Vater. Er würde dich am nächstbesten Ast aufknüpfen lassen, auch wenn ihr mal Seite an Seite geritten seid. Steck das verdammte Schießeisen weg, Kelly. Du erreichst ja doch nichts damit.“
Chad Kelly atmete tief durch. Das schweißüberströmte verkniffene Gesicht des Schurken, der die junge Mexikanerin als Schutzschild vor sich hielt, brannte sich unauslöschlich in sein Gehirn. Die backofenheiße Stille über der kleinen Ranch wurde zur drückenden Last. Mit einer zähflüssigen Bewegung schob Chad den 45er Colt ins Holster, das er wie die meisten Rindermänner hoch an der Hüfte trug.
„Du hast recht, Will“, sagte er schwer. „Du bist es nicht wert, dass deinetwegen meine Freundschaft mit Tom in die Brüche geht. Ich brauche keinen Colt, um mit dir fertig zu werden.“
Mit steinerner Miene ging er langsam auf den jungen Bancroft zu. So groß und schwer er auch wirkte, seine Bewegungen besaßen die Geschmeidigkeit eines Löwen. Statt der landesüblichen hochhackigen Boots trug Chad Kelly Stiefel mit flachen Absätzen ohne Sporen. Eine Weile war nur das Malmen des heißen Sandes unter seinen Sohlen zu hören. Will stieß die Frau plötzlich heftig zur Seite. Seine Rechte senkte sich klauenartig über den Revolverkolben. Die Waffe hing tief auf seinem Oberschenkel, genau wie bei seinen Brüdern Jess und Larry. Chad wusste, dass Bancrofts Söhne sich nicht zu Unrecht eine Menge auf ihre Schießfertigkeit einbildeten. Aber das zählte jetzt nicht, nicht nach allem, was hier geschehen war. Unbeirrt ging er weiter auf den langsam Zurückweichenden zu.
„Mach keinen Quatsch, Kelly! Bleib stehen! Ich warne dich!“
Die Worte schienen an einem Felsen abzuprallen. Nie hatte Will Bancroft ein so steinernes, unheimliches Antlitz gesehen. Ob er wollte oder nicht, er wich vor dem Herankommenden immer weiter zurück, bis er das Rundholz eines Stützpfeilers zwischen den Schulterblättern spürte. Da erst erwachte Will aus seiner Trance.
„Zum letzten Mal, Kelly: Bleib mir vom Leib!“ Seine Rechte schraubte sich um den Revolvergriff.
„Chad!“, rief Conchita mit zitternder Stimme. Sie wollte zu ihrem Mann laufen.
„Bleib, wo du bist!“ Der ungewohnt scharfe Ton bannte sie fest. Für einen Augenblick hatte sie das Gefühl, dass dort ein Fremder auf Will Bancroft zumarschierte, ein Mann ohne Nerven, ohne Mitleid, eine furchteinflößende Gestalt.
„Narr, verdammter!“, knirschte Will. Sein Sixshooter flog aus dem Holster, so schnell, dass das Auge kaum folgen konnte.
Chad war schneller. Aus dem sonst eher ein wenig schwerfälligen Smallrancher war plötzlich ein katzenhaft geschmeidiger Kämpfer geworden. Sein Colt blieb an seinem Platz. Stattdessen zuckte Chads linke Stiefelspitze hoch und erwischte Wills Handgelenk. Der Ranchersohn brüllte, mehr vor Wut, als vor Schmerz, als seine Waffe in hohem Bogen davonwirbelte. Dann blieben ihm die Flüche in der Kehle stecken. Chad war bei ihm, und seine schwieligen, harten Fäuste besaßen die Wucht von Dampfhämmern.
Bancroft flog wie ein Stoffbündel mehrere Schritte weit in den Sand des Ranchhofes. Keuchend wälzte er sich herum, kam mit hassverzerrter Miene auf die Beine – und wurde schon wieder getroffen, dass ihm Hören und Sehen verging. Als er diesmal mühsam den Kopf hob, waren Chads staubverkrustete Stiefel dicht vor ihm. Langsam tastete sich Wills flackernder Blick an der reglosen Gestalt seines Feindes hoch.
„Nur weiter!“, sagte Chad kalt. Nicht einmal sein Atem ging schneller, und seine Fäuste hingen locker herab. „Wenn ich mit dir fertig bin, du Lump, wirst du dich hüten, jemals wieder deine dreckigen Pfoten nach meiner Frau auszustrecken. Los, worauf wartest du? Wolltest du mich nicht töten?“
Wills Revolver lag nur wenige Schritte entfernt am Boden. Bancrofts Sohn schleuderte sich herum, streckte die Hand nach der Waffe aus. Mordgier glühte in seinen Augen. Wieder kam Chad ihm zuvor. Sein Stiefeltritt warf Will über den im Staub liegenden Revolver. Im nächsten Moment hatten sich Chads Hände in das Baumwollhemd des jungen Burschen gekrallt. Scheinbar ohne jede Mühe riss er ihn hoch. Ihre Gesichter waren einander ganz nahe. In diesem Augenblick war Will nahe daran, vor Schreck laut aufzuheulen.
Da klang dumpfer Hufschlag hinter dem Smallrancher auf. Conchita stieß einen leisen Schrei aus. Bancroft krächzte: „Jetzt bist du geliefert, Kelly! Jube, Ben, Cole, los zum Teufel, schnappt ihn euch! Macht ihn fertig!“
Chad Kelly stieß Will so hart zurück, dass er wieder im Staub landete. Geduckt fuhr der breitschultrige Rinderzüchter herum. Reiter mit breitrandigen Hüten, dornenzerkratzten Chaps und flatternden Halstüchern jagten auf zottigen Pferden heran, als wollten sie ihn unter den Hufen zermalmen. Zweien von ihnen konnte Chad ausweichen, der Gaul des dritten rammte ihn. Chad stürzte, spürte Sandkörner zwischen den Zähnen und einen dumpfen Schmerz an der rechten Schulter. Er wollte hoch, aber da waren sie schon über ihm. Wie Raubkatzen waren sie von den Sätteln auf ihn herabgesprungen.
Ringsum wallte Staub, stampften Hufe, wieherten Pferde. Chad sah die verzerrten rauen Gesichter wie durch Nebelschwaden. Wütend schlug er um sich. Conchita schrie, doch ihre Stimme wurde von Wills hasserfülltem Gelächter übertönt.
„Nur nicht so zimperlich, Jungs! Gebt es ihm tüchtig! Er hat‘s verdient!“
„Schluss, verdammt nochmal!“ Die peitschende befehlsgewohnte Stimme trieb die Kerle auseinander. Hufe schaufelten näher. „Will, zum Teufel, was geht hier vor?“
Chad blutete aus mehreren Schürf- und Platzwunden, aber er fühlte keinen Schmerz. Seine zornige Erregung klang nur langsam ab. Er musste sich erst den Staub und Schweiß aus den Augenwinkeln wischen, ehe er den hageren, hoch im Sattel aufgerichteten Mann richtig sah. Tom Bancrofts Söhne hatten mit ihrem Vater nur der Gestalt nach Ähnlichkeit. In seinem kantigen Ledergesicht gab es kein wildes, raubtierhaftes Lauern. Seine hellgrauen durchdringenden Augen waren frei von jeder Hinterhältigkeit. Sein schmaler Mund verriet Härte, doch da waren auch Spuren von Bitterkeit und Einsamkeit, die in den messerscharfen Falten seines Gesichts nisteten. Es war lange her, dass Chad mit diesem um zwanzig Jahre älteren Mann Bügel an Bügel geritten war, aber nichts aus jener Zeit, als sie noch frei wie der Wind gelebt hatten, war vergessen. Vor allem jener Tag nicht, an dem Tom Bancroft seinen jungen Sattelpartner unter Einsatz des eigenen Lebens aus der Umzingelung einer skalphungrigen Apachenbande herausgehauen hatte. Jetzt blickte er Chad nur flüchtig an, um sich zu überzeugen, dass ihm nichts weiter passiert war.
„Hast du Dreck in den Ohren, Will? Ich hab dich was gefragt!“ Es war die herrische Stimme eines Mannes, der sich daran gewöhnt hatte, dass andere sich vor ihm duckten – auch seine eigenen Söhne.