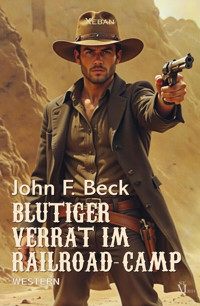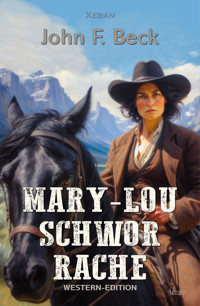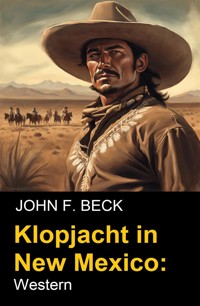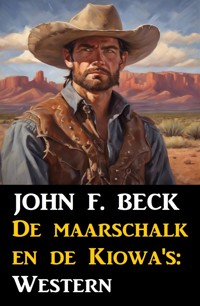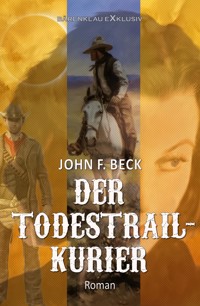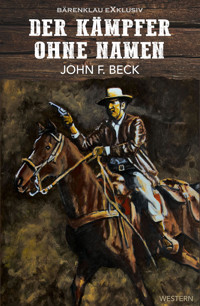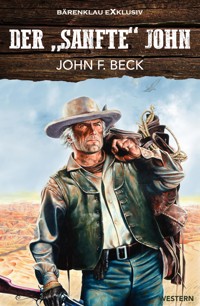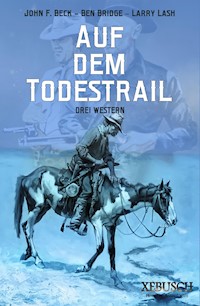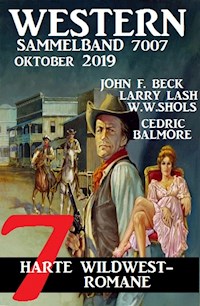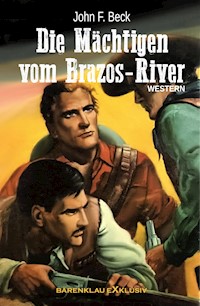
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Larry Flynn kommt völlig ahnungslos in das Longhorn-City-County am Brazos-River. Er ist nur ein junger Cowboy auf einsamem Trail. Das einzig Auffallende an ihm: der alte Bisbee-Colt, den er ziemlich tiefgeschnallt am Gürtel trägt.
Unvermutet macht er sich zum Kämpfer für die Gerechtigkeit. Schuld daran sind der Tod eines wehrlosen Mannes und der Terror, der von der Keanford-Sippe ausgeübt wird. Vergeblich wehrt sich der Sheriff von Longhorn-City gegen den übermächtig wirkenden Rancher-Clan, und so kommt es, dass Larry Flynn schließlich ganz alleine dasteht. Manchmal weiß er selbst kaum, warum er diesen Kampf gegen den Keanford-Terror zu seinem eigenen macht. Aber irgendwie hängt es mit seiner eigenen Geschichte zusammen …
Die Männer, gegen die er antreten muss, sind die gefährlichsten Kämpfer am ganzen Brazos-River. Und nichts im Longhorn-City-County geschieht ohne ihren Willen.
Nur der Jüngste der Keanford-Sippe, Bent, ist anders als seine grausamen Brüder Chad und Ringo und anders als sein sturer Vater Wayne. Aber kann Bent irgendetwas ausrichten?
Ein furchtbarer Showdown in Longhorn City droht. So oder so bringt dieser Endkampf die Entscheidung darüber, ob fortan Recht und Gesetz das County regieren oder aber Willkür und Terror.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
John F. Beck
Die Mächtigen vom Brazos-River
Western
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Klaus Dill mit Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Antje Ippensen
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Mächtigen vom Brazos-River
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Über den Autor
Das Buch
Larry Flynn kommt völlig ahnungslos in das Longhorn-City-County am Brazos-River. Er ist nur ein junger Cowboy auf einsamem Trail. Das einzig Auffallende an ihm: der alte Bisbee-Colt, den er ziemlich tiefgeschnallt am Gürtel trägt.
Unvermutet macht er sich zum Kämpfer für die Gerechtigkeit. Schuld daran sind der Tod eines wehrlosen Mannes und der Terror, der von der Keanford-Sippe ausgeübt wird. Vergeblich wehrt sich der Sheriff von Longhorn-City gegen den übermächtig wirkenden Rancher-Clan, und so kommt es, dass Larry Flynn schließlich ganz alleine dasteht. Manchmal weiß er selbst kaum, warum er diesen Kampf gegen den Keanford-Terror zu seinem eigenen macht. Aber irgendwie hängt es mit seiner eigenen Geschichte zusammen …
Die Männer, gegen die er antreten muss, sind die gefährlichsten Kämpfer am ganzen Brazos-River. Und nichts im Longhorn-City-County geschieht ohne ihren Willen.
Nur der Jüngste der Keanford-Sippe, Bent, ist anders als seine grausamen Brüder Chad und Ringo und anders als sein sturer Vater Wayne. Aber kann Bent irgendetwas ausrichten?
Ein furchtbarer Showdown in Longhorn City droht. So oder so bringt dieser Endkampf die Entscheidung darüber, ob fortan Recht und Gesetz das County regieren oder aber Willkür und Terror.
***
Die Mächtigen vom Brazos-River
1. Kapitel
Die Frau stand in der Türe des kleinen, niedrigen Ranchhauses und horchte auf die Hufschläge, die direkt auf das kleine Anwesen zukamen. Es waren rasende, wilde Hufschläge. Der Mann, der dort ritt, preschte dahin, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Die Frau in der Tür des kleinen, mit Stroh und Erdschollen gedeckten Ranchhauses konnte den Reiter nicht sehen. Die grasbewachsenen Hügel, die sich ringsum erhoben, verdeckten ihre Aussicht. Aber ihr Gesicht drückte unverhüllte Sorge aus.
Es war ein schmales Gesicht, in dem ein Leben voller Arbeit, Strapazen und Härte seine unverkennbaren Zeichen hinterlassen hatte. Und jetzt, da die Sorge dunkle Schatten um die Augen malte, jetzt wirkte dieses Gesicht noch älter, als die Frau tatsächlich war.
Es war noch früh am Morgen. Die Sonnenstrahlen besaßen noch keine Wärme und leckten wie unsicher und zögernd über die niedrigen, einfachen Gebäude der Small-Ranch hin. Zwischen dem Stall und dem Wohnhaus stand ein alter, klappriger Ranchwagen. Im Corral weideten zwei struppige, magere Cowboypferde. Irgendwo hinter dem Ranchhaus, verdeckt durch einen Hügelkamm, muhte langgezogen eine Kuh. Es war das einzige Geräusch, das sich in das herkommende wilde Hufgetrappel mischte.
Die hagere Frau wischte ihre mageren Hände an der grauen, geflickten Schürze ab. Es war eine Bewegung, die ihre Unsicherheit und Sorge verriet. Ihre farblosen, bangen Augen waren unverwandt auf den Hügelrücken gerichtet, auf dem der näherkommende Reiter auftauchen musste. Das Dröhnen der Hufe war jetzt so nahe, dass es fast das hungrige Muhen der Kuh übertönte.
Die Lippen der Frau pressten sich zusammen. Im nächsten Moment aber öffneten sie sich wieder, und ein tiefer Seufzer kam aus ihrem Munde.
Auf dem Hügelkamm war der Reiter aufgetaucht. Er verlangsamte das Tempo des Pferdes keineswegs. Tief geduckt saß er im Sattel – ein hagerer, schnurrbärtiger Mann mit einem verwitterten Gesicht, dessen Haut wie altes, runzeliges Leder wirkte.
Er jagte im Galopp den Hang herab – geradewegs auf den sonnenlichtüberspülten Ranchhof zu. Das Pferd schnaubte und keuchte, und vor seinen Nüstern flockte weißgelber Schaum, der gegen die Hemdsärmel des Reiters geweht wurde. Ein Netz von Schweißperlen überzog das Fell des Tieres. Und auch das Gesicht des Mannes war von Schweiß bedeckt. Es sah aus, als hätte er sich zwei Hände voll Wasser ins Gesicht geschüttet und die Tropfen davon hingen noch an den herabgebogenen Enden seines buschigen Schnurrbartes.
»Fred!«, stieß die Frau tonlos hervor. »Um Gottes willen, Fred, was ist geschehen?«
Ihre Augen wurden groß und weit, und ihr ohnehin farbloses Gesicht wurde bleich wie eine frisch gewaschene Leinwand. Ihre Worte gingen im Hämmern der Pferdehufe unter. Der Mann galoppierte am Corral entlang, bog um den alten, klapprigen Ranchwagen und brachte dann das keuchende, abgehetzte Pferd zum Stehen.
Die Flanken des Tieres zitterten. Es ließ den Kopf hängen, sodass die Nüstern fast den gelben Sand des Hofes berührten. Der hagere Mann ließ sich aus dem Sattel rutschen.
»Ellen!«, keuchte er. »Ellen, ich brauche sofort ein frisches Pferd – hörst du? Ich muss weiter. Ich muss sofort …«
Die Frau verließ den Eingang des Hauses. Sie trat auf den Mann zu, mit dem sie die Hälfte ihres bisherigen Lebens geteilt hatte.
»Fred! Was ist geschehen?« Ihre Stimme zitterte leicht, obwohl sie sich um Festigkeit bemühte.
»Sie sind hinter mir her!«, keuchte der Mann und wischte mit dem Handrücken über seine schweißglänzende Stirn. Er lehnte müde gegen das abgehetzte Pferd, das noch immer den Kopf hängen ließ und sich nicht rührte.
»Wer?«, fragte die Frau.
»Die Keanfords!«, antwortete der Mann. »Es kommt sonst wohl niemand in Frage!« Er holte tief Atem und schaute seine Frau gerade an.
»Ich muss fliehen, Ellen! Sie dürfen mich nicht erwischen. Sei so gut und hole mir den Braunen aus dem Corral. Ich sattle inzwischen den Gaul ab und …«
»Warum, Fred?«, fragte Ellen Newton leise, und die blanke Angst flackerte jetzt in ihrem Blick. »Warum sind sie hinter dir her?«
Fred Newton begann bereits die Sattelgurte zu lösen. Er hob kaum den Kopf, als er antwortete:
»Ellen, dies ist nicht der rechte Zeitpunkt für Erklärungen. Sie sind mir hart auf den Fersen. Wenn du dich nicht beeilst, dann …« Er brach ab und schwieg bedeutungsvoll. Seine Frau verlor kein Wort mehr. Sie eilte auf das Stangentor des Corrals zu. Und das Morgensonnenlicht hauchte einen gelben Schimmer über ihr bleiches, besorgtes und abgehärmtes Gesicht.
Newton sattelte das Pferd ab. Er war noch nicht fertig damit, als die Stalltüre aufgestoßen wurde. Ein schlanker, junger Mann in Cowboykleidung lehnte sich gegen den Türrahmen, schaute erstaunt zu dem Klein-Rancher herüber und fuhr mit einer Hand durch das wirre, blonde, ungekämmte Haar. Sein Hemd war noch nicht zugeknöpft, und den Patronengurt mit dem baumelnden Revolver daran hielt er in der Linken. Es war auf den ersten Blick zu erkennen, dass der junge, blonde Mann vor wenigen Minuten noch geschlafen hatte. Ein paar Strohhalme an seiner Kleidung verrieten, dass sich sein Nachtlager drinnen im warmen, dämmrigen Stall befunden hatte.
»Guten Morgen, Newton!«, rief er, und seine Stimme besaß einen hellen, frischen Klang. »Was ist denn schon los, so früh am Morgen? Sie sind ja geritten, als ob der Teufel hinter Ihnen her wäre!«
Der Small-Rancher nahm den Sattel vom Rücken des erschöpften Pferdes, warf ihn zu Boden und begann dann, das Tier mit seinem Halstuch abzureiben. Er sah dabei über die Schulter zum Stalleingang hin.
»Sie sollten besser wieder in den Stall gehen«, sagte er heiser. »Es wäre nicht gut, wenn man Sie hier finden würde. Glauben Sie mir!«
»Ich verstehe nicht«, murmelte der junge, blonde Weidereiter erstaunt.
Erst jetzt bemerkte er, dass die Frau des Ranchers ein Pferd aus dem Corral holte. Sie schloss das Gatter hastig hinter sich und führte dann den Braunen eilig über den Hof auf ihren Mann zu. Der hob jetzt den Sattel auf, spähte mit gerunzelter Stirn zu dem Hügelrücken, über den er kurz vorher gekommen war, und sagte dann zu dem jungen Mann, der im Stalleingang lehnte:
»Sie sollten auf meinen Rat hören, Flynn!«
Der Cowboy schaute den schnurrbärtigen Small Rancher forschend an, blickte dann zu der bleichen, besorgten Frau hin und zuckte die Schultern.
»Wie Sie meinen, Newton! Ich will nicht …«
Er sprach den Satz nicht zu Ende. Er hatte ebenfalls zu dem Hügelkamm hingeblickt. Und dort tauchten jetzt die Reiter auf. Klar und scharfumrissen hoben sie sich gegen den Hintergrund des hellen Morgenhimmels ab. Sie waren zu dritt, und sie ritten, ohne anzuhalten, den Hang herab und auf den Hof der kleinen Ranch zu.
Fred Newton hatte eben dem Braunen, den seine Frau an den Zügeln hielt, den Sattel auf den Rücken gelegt. Er fuhr herum, als er das Hufepochen hörte, und seine hagere, knochige Gestalt wurde steif und reglos, als er die drei Reiter sah, die rasch herankamen.
»Mein Gott!«, flüsterte seine Frau brüchig. »Da sind sie schon!«
Für eine Weile war nichts zu hören als das Klopfen der Pferdehufe. Dann verstummte es. Nur wenige Yards von dem Rancher-Ehepaar entfernt, hielten die drei Reiter an. Ihre Blicke waren drohend auf Newton gerichtet, und ihre Hände lagen griffbereit auf den Kolben ihrer tiefgeschnallten Colts.
»Du warst nicht schnell genug, Newton!«, sagte der größte von ihnen hart.
Er war ein wahrer Hüne von Gestalt. Die mächtigen Schultern, die breite Brust und die langen, muskulösen Arme verrieten eine wilde, vernichtende Kraft. Das Gesicht war breit, derb geschnitten und besaß einen breiten Mund, dessen Lippen so schmal wie ein Messerrücken waren. In den grauen Augen lag ein herrischer, unversöhnlicher Glanz. Der Mann mochte vielleicht sieben oder achtundzwanzig Jahre alt sein. Ein Strom von Härte, Kraft und Unduldsamkeit ging von ihm aus. Der Reiter, der rechts von ihm hielt, war fast ebenso groß, aber nicht so breit und wuchtig gebaut. Er war sehnig und schmal, und das betonte noch seine Größe. Wie der Hüne, so besaß auch er dunkles Haar und graue Augen. Und diese Augen waren denen des Hünen zum Verwechseln ähnlich. Die gleiche Härte und Selbstherrlichkeit lagen in ihnen. Und obwohl das Gesicht dieses Mannes nicht breit, sondern hager und scharfgeschnitten war, konnte man doch eine Ähnlichkeit mit dem Antlitz des Hünen erkennen – eine Ähnlichkeit, die zeigte, dass diese beiden Männer Brüder waren. Brüder, von denen der eine wie ein muskelbepackter Bär, der andere wie ein sehniger Tiger wirkte!
Der dritte Reiter war kleiner. Er war stämmig, breitschultrig und besaß ein nichtssagendes Gesicht mit Augen, die im Sonnenlicht einen grünlichen Schimmer zeigten. Alles was an ihm auffiel, war die Tatsache, dass er den Colt ziemlich tiefgeschnallt trug. Das traf zwar auch auf die beiden Brüder zu – aber bei ihnen wurde diese Tatsache mehr durch ihre imposante körperliche Erscheinung verdeckt.
»Well«, sagte jetzt wieder der Große, »dein Spiel ist verloren, Newton! Schnall dein Eisen ab und nimm dann die Hände hoch! Versuch keinen Trick – du würdest es sonst bereuen, das verspreche ich dir.«
Fred Newton stand noch immer völlig unbeweglich. Nur seine Augen lebten. Ihr Blick flitzte gehetzt von einem der Reiter zum anderen.
»Ihr habt kein Recht …«, begann er. Doch der dunkelhaarige Hüne machte eine scharfe Handbewegung und brummte gereizt: »Recht? Wir werden dir zeigen, wie viel Recht wir haben, Newton! Los, schnall endlich ab, mein Freund! Dann kommst du mit uns, und dann wirst du sehen, wie groß das Recht ist, das wir besitzen. Los, los!«
Die hagere Frau mit dem bleichen Gesicht ließ die Zügel des struppigen Braunen los und stellte sich neben ihren Mann.
»Was wollt ihr von Fred? Warum hetzt ihr ihn wie ein Stück Wild?«
Der Mann mit dem hageren, scharfgeschnittenen Gesicht verzog die dünnen Lippen.
»Wissen Sie das wirklich nicht, Missis Newton? Nun, gut – ich will es Ihnen sagen: Ihr Mann ist ein Viehdieb! Das ist es! Und wir werden …«
»Das ist nicht wahr!« Die Stimme der Frau klang schrill und angstvoll.
Der Sehnige beugte sich ein wenig im Sattel vor.
»Sie werden mich doch keinen Lügner nennen wollen, Madam. Ich bin Ringo Keanford – vergessen Sie das nicht! Und der Große hier ist mein Bruder Chad! Ed Stedloe, den Vormann unserer Ranch, kennen Sie ja auch, nicht wahr? Also, Madam, Sie werden uns doch nicht einer Lüge bezichtigen wollen, hm? Ich sagte, Ihr Mann ist ein Viehdieb – und das ist so. Wenn Sie klug sind, dann halten Sie den Mund und mischen sich nicht weiter ein, verstanden?«
Er hatte ganz ruhig, beinahe sanft gesprochen. Aber gerade das verriet seine Gefährlichkeit.
Die Ranchersfrau hatte ihre mageren Hände in die graue, geflickte Schürze verkrampft und starrte Ringo Keanford aus geweiteten Augen an.
»Well, Newton!«, brummte jetzt wieder der Hüne. »Wie lange wollen Sie uns noch warten lassen?«
»Geht zum Teufel!«, brach es heiser über Newtons Lippen. »Ich werde nicht mit euch reiten!«
»Dann müssen wir es hier auf Ihrer Ranch erledigen, Mann!«, zuckte Chad Keanford ungerührt die mächtigen Schultern.
»Ist es Ihnen lieber, wenn Sie vor den Augen Ihrer Frau gehängt werden?«
Ellen Newton unterdrückte einen kurzen, erschrockenen Aufschrei.
»Hängen?«, keuchte sie. »Ihr wollt Fred hängen? Mein Gott, wer gibt euch das Recht dazu?«
»Ruhig, Ellen, ruhig!«, sagte der hagere, schnurrbärtige Small-Rancher rau. »Du kennst sie doch, nicht wahr? Aber ich sage dir, Ellen – ich bin unschuldig. Wenn sie mich aufknüpfen, dann hängen sie einen Unschuldigen.«
»Unschuldig! Dass ich nicht lache!«, stieß Chad Keanford grimmig hervor. »Wir haben dich auf frischer Tat ertappt, Newton! Und wir wissen, was wir zu tun haben! Wir dulden keine Rinderdiebe in diesem County!«
»Auf frischer Tat ertappt?«, schnaufte Newton schwer. »Ihr seid verrückt geworden! Was kann ich dafür, dass sich ein paar von euren Rindern auf mein Weideland verirrten? Ihr solltet mir eigentlich dankbar sein, dass ich sie zurücktreiben wollte auf euren Grund und Boden. Nein, aber ihr haltet mich für einen Rustler – nur weil ich ein armer Small-Rancher bin! Und ihr maßt euch sogar an …«
»Halt den Mund, Newton!«, brummte der Hüne. »Du hast unsere Rinder getrieben, und das genügt! Du bist ein dreckiger Viehdieb, und für einen solchen gibt es nur den Strick! Ich zähle jetzt bis drei, und dann liegt dein Revolver am Boden, verstanden?«
»Du irrst dich, Chad Keanford!«, sagte Newton langsam. Er trat einen Schritt zur Seite, sodass seine Frau nicht mehr direkt neben ihm stand.
Sie machte eine hastige Bewegung.
»Fred!«, rief sie schrill. »Was willst du tun?«
»Nur ruhig, Ellen! Bleib, wo du bist! Sie sollen mich nicht lebendig bekommen, diese Schufte!«
»Hoh!«, lächelte der sehnige, scharfgesichtige Ringo Keanford dünn. »Du willst kämpfen, Newton? Du gegen uns? Du bist ein Narr! Verstehst du überhaupt, mit einem Schießeisen richtig umzugehen, heh?«
»Ihr werdet es sehen!«, presste Fred Newton hervor. »Fangt nur an!«
»Rechne nur nicht damit, dass wir dich gleich töten werden, Newton!«, lächelte Ringo Keanford grausam. »So einfach machen wir das nicht! Du weißt, wie gut wir schießen. Wir alle. Chad, Ed Stedloe und auch ich. Wir werden dich nur kampfunfähig machen, Newton. Vielleicht schießen wir dich in die Schulter, vielleicht in die Beine. Jedenfalls wirst du dem Strick nicht entgehen – wenn du darauf hoffst. Das möchte ich nur noch klarlegen!«
»Oh, ihr Schurken! Ihr gemeinen Schurken!«, rief Ellen Newton verzweifelt. Sie wollte vorwärts, direkt auf die drei Reiter zu. Aber da trieb Ed Stedloe, der Vormann, seinen Gaul voran und versperrte ihr den Weg.
In diesem Augenblick machte sich der junge, blonde Weidereiter bemerkbar, der bisher in der offenen Stalltüre gestanden und alles beobachtet hatte. Keiner der drei Reiter hatte ihn gesehen. Sie alle hatten nur auf Newton und dessen Frau geblickt.
Der Cowboy aber hatte inzwischen seinen Revolvergurt umgeschnallt, trat jetzt aus dem dämmrigen Eingang des Stalles auf den sonnenhellen Ranchhof hinaus und sagte mit völlig ruhiger Stimme:
»Einen Augenblick, Gentlemen, ich werde auch ein bisschen mitmischen in diesem Spiel!«
Die Köpfe der drei Reiter fuhren herum. Überraschung malte sich sekundenlang auf ihren Gesichtern ab. Dann fragte der hünenhafte Chad Keanford schroff:
»Wer sind Sie? Was wollen Sie hier?«
»Mein Name ist Larry Flynn«, antwortete der blonde, junge Cowboy, und seine Stimme war fest und kühl. »Ich bin unterwegs nach Westen, und Mister Newton war so freundlich, mir für diese Nacht Unterkunft zu gewähren. Das ist alles. Genügt Ihnen diese Auskunft?«
Er stand jetzt mitten auf dem Hof. Der breitrandige Stetson baumelte an einer dünnen, geflochtenen Windschnur auf seinem Rücken, und das blonde Haar glänzte in der Morgensonne wie pures Gold.
»Flynn!«, keuchte Fred Newton hastig. »Halten Sie sich hier raus! Seien Sie vernünftig!«
Ringo Keanford zeigte wieder ein dünnes, freudloses Lächeln. »Da hören Sie es, Mister! Sie sollten Newtons Rat befolgen. Wenn Sie tatsächlich ein Fremder in diesem County sind, dann geht Sie diese Sache nichts an.«
»Hm«, hob Larry Flynn kurz die Schultern. »Ich bin anderer Meinung. Wenn ein Mann zusieht, wie ein anderer unschuldig gehängt oder niedergeschossen wird – dann ist er ein Schuft! Und ich hab’ etwas gegen Schufte. Verstehen Sie mich?!«
»Ich verstehe nur, dass Sie ein Narr sind, wenn Sie sich wirklich hier einmischen!«, knurrte Chad Keanford wild. »Sie kennen uns noch nicht – und das ist ein großer Fehler. Vielleicht gibt es Ihnen Aufschluss, wenn ich Ihnen sage, dass nichts in diesem Lande ohne unseren Willen geschieht. Das sollte Ihnen zu denken geben, Cowboy! Und jetzt verschwinden Sie!«
Die Reiter hatten sich leicht vornüber gebeugt. Ihre Hände krümmten sich über den Kolben der Colts. Die Keanford-Brüder starrten Larry Flynn an. Ed Stedloe dagegen ließ Newton nicht aus den Augen. Sie schienen sehr gute Kämpfer zu sein, die sich ihrer Sache vollkommen sicher waren.
Der junge Cowboy, der sich Larry Flynn nannte, wirkte gegen sie harmlos. Er stand lässig im Sonnenschein und schien gar nicht den Ernst der Lage erfasst zu haben. Der Blick seiner blauen Augen war ruhig, und nur der festgefügte Mund ließ eine gewisse Härte erkennen.
»Ich sehe nicht, dass einer von euch den Sheriffstern trägt!«, sagte er. »Und deshalb seid ihr nicht berechtigt, irgendwie gegen Newton vorzugehen – auch wenn er tatsächlich ein Viehräuber wäre. Allerdings nehme ich an, dass er wirklich nur euer Vieh auf eure Weide zurücktreiben wollte. Und es war sein Pech, dass ihr ihn dabei überraschtet.«
»Wollen Sie uns belehren, Flynn?«, brummte Chad Keanford, und eine steile Falte erschien zwischen seinen Augenbrauen. »Sie sprechen ja so, als ob Sie Newton schon lange kennen würden – nicht bloß seit gestern Abend. Vielleicht stecken Sie mit ihm unter einer Decke, he?«
»Mit euch ist wirklich nicht zu reden«, schüttelte Larry den Kopf. »Ihr solltet lieber reiten!«
»Was?«, dehnte Chad Keanford überrascht. »Sie wagen es, so mit uns zu sprechen? Wir sind die Keanfords, Mann, und …«
»Sture, eingebildete Kerle seid ihr – das ist alles«, sagte Larry Flynn ganz ruhig.
Ed Stedloe sog scharf den Atem ein. Chad Keanford fluchte dumpf. Und der sehnige Ringo Keanford trieb sein Pferd ein paar Schritt auf den jungen, blonden Cowboy zu. Larry veränderte seine lässige, fast unbekümmerte Haltung nicht im Geringsten.
»Um Gottes willen, Flynn!«, ächzte Fred Newton. »Schwingen Sie sich sofort auf Ihren Gaul und reiten Sie, so rasch Sie können!«
»Warum denn?«, lächelte Larry Flynn beinahe freundlich. »Sie sind doch nicht wirklich schuldig?«
»Darum geht es doch gar nicht mehr, Flynn!«, seufzte der knochige, hagere Rancher. »Es ist wirklich ein Fehler, dass Sie diese Burschen nicht kennen. Die Keanford-Sippe ist die große Macht in diesem Lande. Und niemand …«
»Und niemand kann sich uns entgegenstellen«, vollendete Ringo Keanford hart. »Yeah, so ist das. Ich gebe Ihnen noch eine Chance, Flynn: Tun Sie, was Newton sagte! Nehmen Sie Ihren Gaul und reiten Sie! Und lassen Sie sich niemals mehr in diesem Land am Brazos River sehen. Was mit Newton geschieht, können Sie ohnehin nicht ändern. Wir denken nicht daran, einen Viehdieb zu schonen!«
»Entweder seid ihr völlig skrupellos«, sagte Larry, »oder vollkommen blöde. Ihr macht euch zu Mördern, wenn ihr Newton hängt.«
»Sie wollen wirklich Streit, Flynn, das sehe ich jetzt!«, dehnte Ringo Keanford.
»Nein, keineswegs. Ich will lediglich Newton helfen. Das Mindeste, was ihr tun müsst, ist, ihn vor einen Sheriff bringen. Das Mindeste, hört ihr? Und dafür werde ich mich einsetzen.«
Zum ersten Mal ließ sich jetzt der stämmige Ed Stedloe vernehmen. Er besaß eine laute, unangenehme Stimme und rief: »Worauf warten wir eigentlich noch?«
»Yeah!«, nickte der hünenhafte Chad Keanford. »Ed hat recht. Wir wollen …«
Er sprach nicht zu Ende und langte zum Colt. Und fast gleichzeitig mit ihm taten es auch sein Bruder Ringo und der Vormann. Sie hatten ihre Waffen erst halb aus den Holstern, als sie erstarrten. Eine schwarze, kreisrunde Revolvermündung war auf sie gerichtet. Und der Bisbee-Colt in Larry Flynns Rechter wankte kein bisschen. Larry hatte so schnell und flüssig gezogen, dass man kaum mit den Augen hatte folgen können.
»Nun, wollt ihr nicht weitermachen? Habt ihr gedacht, nur ihr würdet schnell mit dem Schießeisen sein? Ihr habt euch geirrt, nicht wahr?«
»Oh!«, ächzte Fred Newton. »Sie sind ja gar kein Cowboy, Flynn. Sie sind ja ein Revolvermann – ein richtiger, verteufelter Revolvermann!«
»Irrtum, Newton«, schüttelte Larry Flynn den Kopf. »Ich bin kein Gunman und will nie einer sein. Ich bin ein einfacher Weidereiter, nichts anderes. Und dass ich mit dem Eisen so schnell bin – well, das ist Zufall. Ich habe es geerbt. Jawohl. Es ist das einzige Erbe, das ich von meinem Vater übernommen habe.«
Während seiner letzten Worte zog ein Schatten über sein schmales Gesicht. Und er sah plötzlich nicht mehr so jung und so harmlos aus. Die Bitterkeit in seiner Miene ließ ihn älter und auch härter erscheinen. Aber dann verschwand der Schatten wieder. Und nur in seinen blauen, wachsamen Augen blieb ein Rest von Bitterkeit. Er schaute die drei Reiter an und sagte:
»Jetzt seid ihr an der Reihe, die Gurte abzuschnallen. Los, lasst mich nicht warten!«
»Flynn!«, knurrte Chad Keanford und seine grauen Augen glitzerten. »Flynn, das werden Sie noch bitter bereuen. Sie machen sich zum Helfer eines Rinderdiebes. Wenn Sie nicht sofort Ihr Eisen wegstecken, werden Sie bald zusammen mit Newton an einem Ast baumeln!«
»Das werden wir sehen«, zuckte Larry leicht die Schultern.
»Schnallt jetzt die Gurte ab!«
Ed Stedloe und Ringo Keanford blickten den dunkelhaarigen Hünen an. Sie zögerten. Ihre Hände lagen noch immer auf den Kolben der Colts.
»Wir sind zu dritt!«, murmelte Stedloe düster. »Und er ist allein. Newton zählt nicht. Der versteht nicht viel vom Schießen. Also?«
Chad Keanford nagte an seiner Unterlippe und starrte den jungen Cowboy abschätzend an.
»Rechnet nur nicht falsch!«, lächelte Larry grimmig. »Ihr habt gesehen, wie schnell ich zog. Mit dem Treffen bin ich nicht schlechter. Bevor ihr eure Eisen draußen habt, habe ich mindestens zwei von euch erwischt. Wenn ihr dieses Risiko eingehen wollt – bitte!«
Der hünenhafte Chad Keanford ließ einen Laut hören, der an das wütende Brummen eines verwundeten Grizzlybären erinnerte.
»Was geschieht mit Newton?«, fragte sein Bruder Ringo mit schmalen Lippen. »Wollen Sie ihm tatsächlich zur Flucht verhelfen?«
»Er wird nicht fliehen – denn er ist unschuldig!«, erwiderte Larry fest. »Ich werde mit ihm nach Longhorn City zum Sheriff reiten. Dort könnt ihr dann eure Anklage vorbringen. Klar?«
Die Keanford-Brüder tauschten einen raschen Blick miteinander. Dann nickte Chad.
»Schön! Schnallen wir ab, Leute!«
Er löste vorsichtig die Schnalle seines patronengespickten Revolvergurts und ließ ihn in den Sand des Hofes fallen. Ringo und Ed Stedloe folgten diesem Beispiel. Ihre Gesichter waren finster und verrieten, wie sehr sie sich bemühen mussten, ihre Wut zu unterdrücken. Als die Waffen neben den Pferden lagen, fragte Chad Keanford heiser: »Können wir jetzt reiten?«
»Yeah, das könnt ihr«, nickte Larry Flynn.
»Und Sie bringen Newton tatsächlich in die Stadt?«
»Sicher!«
»Well, es wird sich herausstellen. Aber eines sage ich Ihnen noch, Flynn: Sie werden es bereuen, uns in Ihren Colt schauen gelassen zu haben. Sie werden es so sehr bereuen wie Sie noch niemals etwas bereut haben.«
Nach diesen wilden, grimmigen Worten lenkte Chad Keanford seinen Gaul herum.
»Kommt, Männer«, brummte er heiser.
Sie ritten davon, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen.