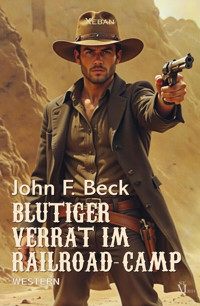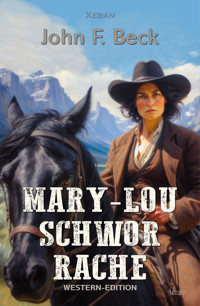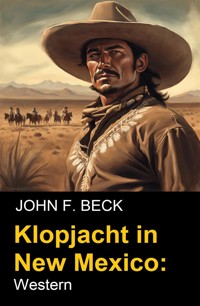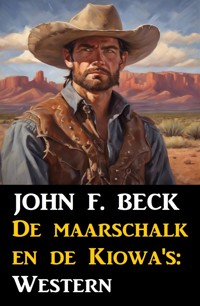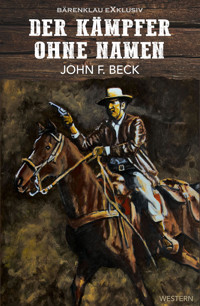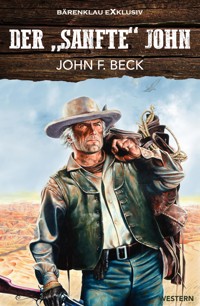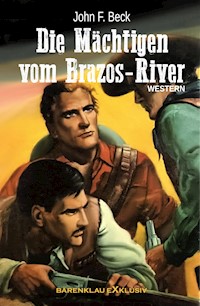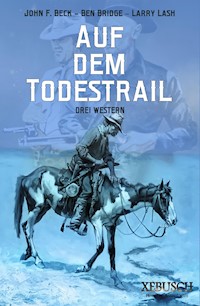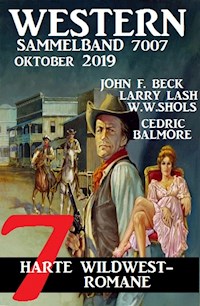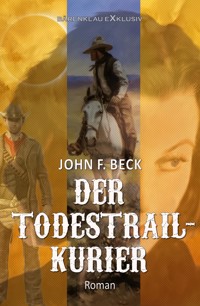
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der junge Clint Randall ist Pony-Express-Reiter. Der Job ist hart und gefährlich. Doch er liebt diesen Job, auch wenn er noch nicht weiß, dass eine harte Prüfung auf ihn wartet. Er wird von Indianern und skrupellosen weißen Banditen gejagt und wird eines Tages eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat.
Wer sind die wahren Schuldigen und kann er seine Unschuld beweisen? Seine Gegner wollen ihn vernichten – mit allen Mitteln…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
John F. Beck
Der Todestrail-
Kurier
Western-Roman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Sandra Vierbein
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren, es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv, 13.07.2023.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Der Todestrail-Kurier
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Eine kleine Auswahl der bereits veröffentlichten Western-Romane des Autors John F. Beck
Das Buch
Der junge Clint Randall ist Pony-Express-Reiter. Der Job ist hart und gefährlich. Doch er liebt diesen Job, auch wenn er noch nicht weiß, dass eine harte Prüfung auf ihn wartet. Er wird von Indianern und skrupellosen weißen Banditen gejagt und wird eines Tages eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat.
Wer sind die wahren Schuldigen und kann er seine Unschuld beweisen? Seine Gegner wollen ihn vernichten – mit allen Mitteln …
***
Der Todestrail-Kurier
1. Kapitel
Der bärtige Prospektor trug einen blutgetränkten Kopfverband. »Wenn du weiterreitest, mein Junge, schaffst du keine zehn Meilen! Sie werden dich ebenso erwischen, wie sie droben am Battle Creek meinen Partner erledigt haben!« Sein Gesicht war noch von dem Grauen gezeichnet, das hinter ihm lag. Keuchend wies er mit seiner Sharps auf den pfeilgespickten Packsattel neben den erschöpfen Maultieren, die beim Ziehbrunnen standen. »Sie waren zwei Tage und zwei Nächte hinter mir her. Zwischen hier und Carson City wimmelte es von aufständischen Rothäuten. Da kommt kein Weißer mehr durch.« Der von den Pferdehufen aufgewirbelte Staub hing noch über der einsamen Station. Der junge Mann, an den der Bärtige sich gewandt hatte, schraubte den Verschluss seiner Wasserflasche zu. Er war mittelgroß, schlank und drahtig. Blondes Haar ringelte sich unter seinem breitkrempigen Hut hervor. Der weißgraue Staub der Alkalihochebene von Nevada bedeckte das schmale Gesicht und die einfache Reitertracht. Die Bewegungen des Jungen waren geschmeidig und zielstrebig. Seine blauen Augen blickten furchtlos.
Er nahm die Mochila, eine aus mehreren getrennten Boxen bestehende lederne Posttasche vom Sattel des Pferdes, auf dem er eben gekommen war. Der Stationshalter hatte schon ein frisches Sattelpferd bereitgestellt. Auf dessen Rücken schwang der Blonde nun die Mochila. Danach überprüfte er die Trommel seines 36er Navy Colts.
»Vielen Dank für die Warnung, Mister!«, nickte er dem Erzsucher zu. Und mit zum Abschied erhobener Hand zum Stationshalter: »Bis morgen, Ben! Drück mir die Daumen!«
Er landete mit einem gekonnten Sprung, ohne die Steigbügel zu benutzen, auf dem frischen Pony. Ein schriller Ruf, ein paar Fersenstöße gegen die Weichen, und schon galoppierte das Tier davon.
Der vor den Indianern geflüchtete Goldgräber konnte gerade noch zur Seite springen. Staub hüllte die niedrigen Gebäude ein. Als er sich verzog, war der Reiter nur mehr ein Punkt auf einer schon ziemlich weit entfernten Bodenwelle. Die Hitzeschleier schienen ihn aufzusaugen.
Das Trommeln der Hufe verhallte. Kopfschüttelnd wandte sich der Prospektor an den Stationer.
»Ich hab ja schon gehört, dass diese Burschen vom Pony Express wahre Teufelskerle sein sollen. Aber für die Paiutes wird er nur ein Weißer mehr sein, den sie wie ’nen Hasen jagen. Sie hätten ihn nicht reiten lassen dürfen, Harper.«
Harper hob die knochigen Schultern an. »Den kann nur eine gutgezielte Kugel stoppen! Für den und die anderen Jungs vom Pony Express ist der Wahlspruch von Russell, Majors und Waddell so was wie ein Gesetz, das um jeden Preis erfüllt werden muss. Die Post muss durch! Dafür reiten sie. Und es hat bis jetzt auch noch jedes Mal geklappt.«
»Bis jetzt waren die Paiutes auch nicht auf dem Kriegspfad«, brummte der Bärtige. »Nein, Harper, ich bin sicher, Sie sehen diesen verrückten Jungen nie wieder! Nicht lebend jedenfalls! Wie heißt er übrigens?«
»Clint Randall. Wieso?«
Der Prospektor spuckte in den heißen Staub. »Sie sollten den Namen zur Warnung für alle, die nach ihm kommen, auf ein Kreuz schreiben, Harper, und daruntersetzen: Gestorben für den Pony Express!«
2. Kapitel
Acht Meilen westlich der Whitehorse Station waren sie plötzlich da. Sie hielten auf dem salbeibedeckten Kamm eines langgestreckten Hügels. Viel zu nahe, dass Clint Randall noch eine Chance hatte, sein zähes Pony aus der Reichweite ihrer einschüssigen Gewehre zu manövrieren.
Sie waren zu dritt. Bronzehäutige, nur mit Lendenschurz und Mokassins bekleidete Krieger auf scheckigen Mustangs. Zwei mit erbeuteten Gewehren, einer mit Pfeil und Bogen bewaffnet. An ihren Gürteln hingen außerdem Tomahawk und Messer. Bunte Stirnbänder hielten ihr strähniges Haar. Wahrscheinlich waren es Späher, die zu einem der Kriegstrupps gehörten, die nach dem großen Council am Pyramid Lake das dünnbesiedelte Land auf der Skalpjagd durchstreiften. Sie waren jäh zur gefährlichen Bewährungsprobe für die erst Wochen zuvor gegründete Postreiterverbindung zwischen St. Joseph am Missouri und San Francisco am Pazifischen Ozean geworden.
Ein halber Kontinent lag zwischen diesen Städten. Eine Wildnis wogender Prärien, schroffer Gebirgszüge und wasserloser Wüsten, die von den Stafettenreitern der Firma Russell, Majors and Waddell in knappen zehn Tagen durchquert wurde. Für Clint Randall sah es nun jedoch so aus, als sei das Ende seines Trails bereits hier, acht Meilen westlich von Ben Harpers Whitehorse-Station, gekommen.
Clints Brauner war diese Strecke in stetigem Tempo dahingejagt. Sein Fell war noch so trocken wie am Anfang. Seine kräftigen Lungen pumpten mit der Gleichmäßigkeit eines Blasebalgs. Nicht umsonst besaß der Pony Express die besten fünfhundert Pferde, die zwischen dem Old Man River und der Pazifikküste aufzutreiben gewesen waren. Pferde, die mit besonderem Kraftfutter verpflegt wurden und von denen es hieß, dass sie mühelos jedem nur von Gras ernährtem Indianermustang davonliefen.
Nur – solange zwei Gewehre und ein auf der Sehne hegender Pfeil den jungen Expressreiter bedrohten, war das kein Trumpf für ihn. Das Land um ihn war deckungslos. Zwischen Whitehorse und der nächsten Station am Simpson Rock gab es keinen Menschen, auf dessen Hilfe er rechnen konnte. Er stoppte.
Mit zusammengebissenen Zähnen blickte er starr auf die drei Paiute Krieger.
Ihre Gesichter wirkten steinern, als sie ihre Mustangs den Hang herabtrieben. Staubwölkchen wallten unter den dumpf pochenden Hufen empor. Es waren junge, kräftig gebaute Krieger, der Jüngste etwa so alt wie Clint, achtzehn im Höchstfall. Clints Brauner schnaubte nervös. Der Geruch von ranzigem Bärenfett, mit dem die Indianer ihre nackten Oberkörper eingerieben hatten, behagte ihm offenbar nicht. Clint hatte einen Kloß in der Kehle.
Sein Colt hing mit dem Kolben nach vorn an seiner linken Hüfte. Aber er wusste, dass er ein toter Mann war, wenn er jetzt die Hand nur in die Nähe der Waffe brachte. Die beiden Gewehrmündungen starrten ihn wie Todesaugen an. Der dritte Paiute ließ den Kriegsbogen sinken, als Clint wie versteinert im Sattel verharrte und die Stunde verwünschte, in der auf die Idee gekommen war, sich im Office von William H. Russell als Pony-Express-Reiter zu bewerben.
Sie kamen bis auf vier Schritte heran. Als sie die dicken Schweißtropfen auf seiner Stirn bemerkten, begannen sie zu grinsen. Clints Gedanken rasten. Bevor er etwas unternehmen konnte, trieb der Krieger mit der Kette aus Grizzlyzähnen seinen Pinto noch näher. Mit der Sharpsmündung schob er Clints Stetson nach hinten. Clints weizenblondes Haar leuchtete in der Sonne.
»Guter Skalp.« Der dünne Mund des Indianers verzog sich zu einem noch breiteren Grinsen. »Wie Skalp von Squaw …« Er schaute sich nach seinen Begleitern um. Alle drei lachten kehlig.
»Hört zu, Freunde«, keuchte Clint. »Ihr habt das Kriegsbeil ausgegraben, um eure Jagdgründe zurückzuerobern, auf denen sich die weißen Gold- und Silbersucher angesiedelt haben. Ich bin keiner von denen! Ich will kein Krümchen von eurem Land, nur …«
Er verstummte, als er den Stahl der Sharpsmündung an der Kehle spürte. Die Augen des Kriegers glühten wie Kohlen.
»Kein Bleichgesicht Freund von Paiute. Du reden aus Angst vor Skalpmesser, Gelbhaar. Du Feigling.«
Sie lachten wieder. Der mit der Grizzlyzahnkette ließ das Gewehr sinken. Clint las sein Todesurteil in den Augen des Mannes. Er presste die Lippen zusammen. Jedes weitere Wort war vergeudet. Es gab nur mehr eines: den Colt ziehen, schießen und sterben! Wochenlang hatte Clint mit der Waffe geübt, aber noch nie auf einen Menschen geschossen. Der Pony Express war für ihn das große Abenteuer gewesen. Es hatte ihn mit Stolz erfüllt, zu denen zu gehören, die an der großartigen Leistung teilhatten, einen halben unbesiedelten Kontinent zu Pferd zu überbrücken. Nun, den Tod vor Augen, besaß das alles eine ganz andere Bedeutung. Ja, er hatte Angst. Die Indianer sahen es. Sie weideten sich daran. Und genau das war die Chance.
»Du Ponyreiter«, stellte der Anführer in seinem gebrochenen Englisch fest. »Du viel schnell auf Pferd. Du zeigen, wie schnell du auf Füßen. Du laufen, Gelbhaar! Wenn du schnell genug, behalten Skalp …« Grausamer Spott funkelte in seinen Augen.
Clint ballte die Fäuste. »Geh zum Teufel!«, knirschte er in jähem verzweifeltem Zorn. »Wenn ihr mich töten wollt, tut es gleich!«
Der Lauf der Sharps zuckte. Clint brachte gerade noch den Kopf zur Seite. Der Schlag erwischte seine linke Schulter mit einer Wucht, die ihn vom Pferd schleuderte. Heftiger Schmerz durchglühte ihn. Für Sekunden war er unfähig, sich zu bewegen.
Hufe stampften neben ihm. Wie von weither kam wieder die gutturale Stimme des Paiute. »Du laufen, Gelbhaar!«
Clint wälzte sich mühsam herum. Seine vom Körper verdeckte Rechte umschloss den Kolben des Navy Colts. In der Drehung riss er die Waffe unter der fransenbesetzten Antilopenlederjacke hervor. Er lag auf der linken, noch wie gelähmten Schulter, als er schoss.
Die Kugel traf den Anführer der Kundschafter mitten in die Stirn. In der hitzegesättigten Stille, die wie ein Panzer auf dem öden Land lag, klang das Krachen der Detonation wie ein Kanonenschuss. Clint stemmte sich rasch auf die Knie, sah das Gewehr an der Schulter des zweiten Kriegers und feuerte nochmals. Der Paiute sank lautlos nach vorn auf den Pferdehals. Als der Mustang erschreckt zur Seite tänzelte, stürzte er leblos herab.
Clints Sechsschüsser war bereits ein Stück nach links geschwenkt. Die qualmende Mündung deutete auf den jüngsten Krieger, der keine Zeit mehr gefunden hatte, die Bogensehne erneut zu spannen. Die Hufe seines braunweiß gefleckten Pferdes waren wie am Boden festgeklebt. Clint und der Indianer starrten sich an.
Für die Länge eines Atemzugs flackerte die Angst in den Augen des Roten, nun ebenfalls von Clints tödlichem Blei vom Pferd gefegt zu werden. Dann versteinerte seine Miene, seine Schultern spannten sich. Clint stemmte sich hoch. Sein Finger blieb am Abzug. Mit einer heftigen Bewegung, die zeigen sollte, wie wenig er den Tod fürchtete, warf der Paiute den Bogen weg.
Dann rief er Clint etwas in seiner Stammessprache zu. Eine wilde, aber auch verzweifelte Herausforderung war in seiner Stimme. Als Clint nicht reagierte, drehte er halb den Kopf und spuckte aus. Die Hitze kam Clint auf einmal noch viel drückender vor. Der Geruch des Pulverrauchs, der noch in der stickigen Luft hing, erfüllte ihn mit Ekel.
»Hau ab!«, schrie er. »Spiel nicht den Helden, du Narr!«
In den Augen des jungen Indianers war Verständnislosigkeit. Misstrauisch zog er seinen Pinto mit gestrafften Zügeln mehrere Yards rückwärts. Er wagte nicht, Clint den Rücken zuzukehren. Erst als der Expressreiter seinen Colt halfterte, warf er jäh seinen Pinto herum und preschte davon. In einer Staubwolke verschwand er über dem Höhenkamm, auf dem die Paiutes zuvor so unvermittelt dem Weißen den Weg versperrt hatten.
Clint wusste, dass es jetzt nur mehr eine Frage der Zeit war, bis der Haupttrupp, zu dem der Krieger gehörte, seiner Fährte folgte. Aber er hatte einfach nicht auf den wehrlosen Gegner schießen können. Benommen stolperte er zu seinem Pferd. Sein Blick mied die beiden Toten, die zwischen den dürren Grasbüscheln lagen. Seine Knie zitterten. Eine Weile musste er sich am Sattelknauf festhalten. Er dachte flüchtig an die Bibel in der Satteltasche. Mister Majors hatte darauf bestanden, dass sie zur Ausrüstung jedes Expressreiters ebenso gehörte wie die Ersatztrommel für den Navy Colt.
Stattdessen griff Clint nun lieber zur Wasserflasche. Er trank, um den bitteren Geschmack in seiner Mundhöhle loszuwerden. Danach fühlte er sich ein wenig besser. Er hatte zum ersten Mal um sein Leben gekämpft. Und er würde es wieder tun, wenn man ihn dazu zwang.
Sein Ritt war kein prickelndes Abenteuer mehr, sondern eine Frage des Überlebens. Er schwang sich in den Sattel. Es wäre sinnlos gewesen, die Toten ohne Werkzeug begraben zu wollen. Die Stammesgefährten würden sich um sie kümmern – und um ihn! Clint spähte aus zusammengekniffenen Augen in die flimmernde Dunstschicht am westlichen Horizont.
Noch zwölf Meilen waren es zur Station am Simpson Rock. Dort würde er ein frisches Pferd für die letzte Tagesetappe zur Cold Spring Station übernehmen. Bereits eine halbe Stunde später entdeckte er die Staubwolke auf seiner Spur. Vor dem wolkenlosen Nevadahimmel wuchs sie rasch höher.
3. Kapitel
Die Staubwolke war auch noch da, als Clint Randall nach einem Nonstop-Galopp von zwölf Meilen den Simpson Rock erreichte. Doch von den Gebäuden am Fuß des rotschimmernden Felsmassivs waren nur mehr die rußgeschwärzten Lehmziegelmauern übrig. Rauch schwelte über den eingestürzten Trümmern. Die Korralzäune waren niedergerissen, die Pferde fort. Die skalpierten, blutüberströmten Leichen des Stationers und seines dunkelhäutigen Stallhelfers waren mit Stricken an vom Feuer versengte Pfosten gebunden.
Die Angst sprang Clint plötzlich wieder an. Aber es war nicht so sehr die Furcht um die eigene Haut, sondern die Besorgnis, dass es achtzehn Meilen westlich von hier auf der Cold Spring Station vielleicht schon ebenso aussah. Der alte Sam Jefford lebte dort ganz allein mit seiner Tochter. Nicht auszudenken, wenn die Paiutes sein Anwesen bereits ebenfalls gestürmt hatten, und Susan ihnen in die Hände gefallen war!
Hier konnte Clint nicht mehr tun, als die Toten losschneiden und sie mit einer steinbeschwerten Decke vor den am Himmel aufgetauchten Bussarden schützen.