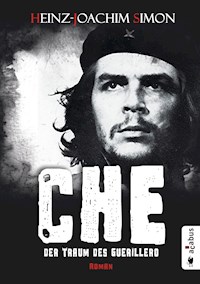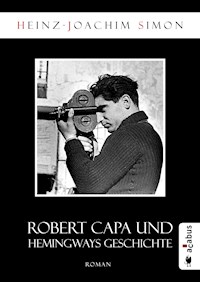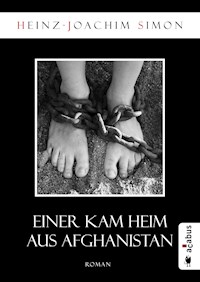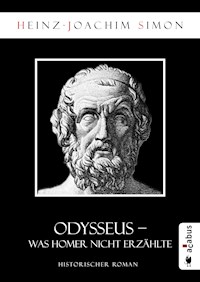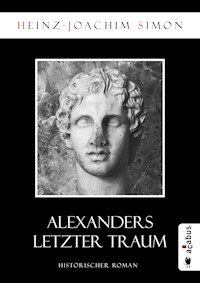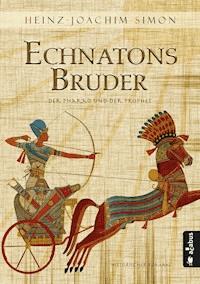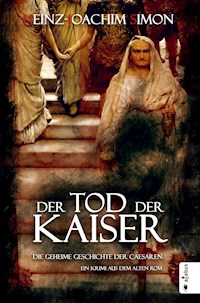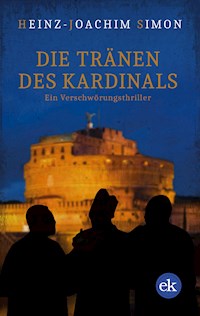Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Palästina zur Zeit Jesu. Der vor den Römern nach Ägypten geflohene Barabbas erfährt, dass in Nazareth der Messias erschienen sein soll und kehrt zurück. Er schließt sich Widerstandkämpfern gegen die Besatzer an und wird ihr Anführer. Jesus zieht in Jerusalem ein. Anstatt den Kampf um Freiheit anzuführen, predigt er jedoch Vergebung und Nächstenliebe - Barabbas und seine Kämpfer beginnen an Jesus zu zweifeln. Die Prophezeiung, dass Gott im zu Hilfe eilen wird, erfüllt sich nicht. Beide werden verhaftet. Beim Prozess ertrotzt die von seinen Anhängern durchsetzte Menge Barabbas' Freilassung - Jesus aber wird gekreuzigt. Barabbas ruft nun das ganze Land zum Widerstand gegen Rom auf. Nach anfänglichen Erfolgen werden er und seiner Männer in einer Bergfestung eingekesselt. Hinter den Golanhöhen kommt es schließlich zum letzten Kampf mit den römischen Verfolgern. Heinz-Joachim Simon bietet mehr als die Lebensgeschichte des Barabbas: -Wie sah die Welt des frühen Christentums aus? - Sind religiöse Wahrheiten historisch widerlegbar? - Woher kommt der Hass auf Juden? - Können Anhänger verschiedener Religionen friedlich zusammenleben? Ein historischer Roman voller großartiger Bilder, Leidenschaften, packender Dynamik und mit aktueller Brisanz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 990
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
… es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und das Reich hat kein Ende.
Daniel, 7.13
Bewahre stets Ithaka in deinen Gedanken. Dort anzukommen ist dein Ziel. Aber beeile dich auf der Reise nicht. Besser, dass sie lange Jahre dauert. Dass du als alter Mann erst vor der Insel ankerst, reich an allem, was du auf diesem Weg erworben hast. Ohne die Erwartung, dass Ithaka dir Reichtum schenkt.
Konstantinos Kevafis
Erster GesangDer Erzähler erklärt sich
1
Jerusalem brennt. Dies steht am Anfang, obwohl es damit endete. Aber seit die Römer den, der sich der Menschensohn nannte, ans Kreuz geschlagen hatten, lief es darauf hinaus.
Dort, wo er die Stadt wusste, stieg eine Rauchsäule in den Himmel, wie eine Zeder vor ihm stehend, und es erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten – er, Jeschua Barabbas, hatte es von dem Gekreuzigten selbst gehört –, kein Stein würde auf dem anderen bleiben. Die Römer plünderten den Tempel.
Nicht von Jesus will ich berichten, sondern von seinem Gegenbild. Er, der Jerusalem brennen sah, war so etwas wie eine Nachgeburt, ein Zwilling des Phyrros, des Königs der Molosser, der die Römer mächtig in Verlegenheit brachte und so oft siegte, dass er schließlich erschöpft aufgeben musste. Doch dies trifft es nur halb, denn eigentlich passte er bereits damals nicht mehr in unsere Zeit, sondern gehörte eher zu den Mythen um Achilleus, Odysseus und den anderen Archäern, die nach Ruhm trachteten und einzig ihr Heldentum im Sinn hatten, und so kann man Jeschua Barabbas vielleicht noch der Alexanderlegende zurechnen. Ein Mann der Tat also, einer, der sich sein Reich aus den Völkern herausschneidet. Und beinahe wäre es ihm auch gelungen.
Daran erkennt Ihr schon, dass ich im griechischen Geist aufgezogen worden bin. Nach dem Lesen der Anabasis des Xenophon kam mir der Gedanke, niederzuschreiben, was mir mein Vater erzählt hat. Nicht, um mit Xenophon zu wetteifern, sondern um mir Klarheit zu verschaffen, was im Leben meines Vaters wirklich passiert ist und warum er zeit seines Lebens behauptete, dass die Götter mit Jeschua Barabbas genauso gespielt hätten wie mit dem vielgeprüften Odysseus und ihm sein Königreich nicht hätten stehlen dürfen.
Doch nicht mein Vater steht im Mittelpunkt, sondern der Mann, der bei den Christen nur eine Randfigur ist. Was ich erzähle, kann man mit Fug und Recht als die Passionsgeschichte des Jeschua Barabbas bezeichnen.
Mein Name ist Hermelaos, der Sohn des Postus. Alles, was ich hier schildere, weiß ich von meinem Vater, der zusammen mit Jeschua Barabbas den Römern trotzte. Vieles erfuhr ich auch von den Christen selbst, so von den Anhängern eines gewissen Paulus, den die Römer enthauptet haben. Zweifellos ein großer Mann, der Jesus Christus neu erfand und aus ihm das machte, was viele Griechen, aber auch Römer in Jesus einen Gott sehen ließen.
Mein Vater erzählte mir die Geschichte des Jesus allerdings anders, und er war schließlich im Gegensatz zu Paulus dabei gewesen. Mein Vater kannte sogar Petrus und Jakobus, den Bruder des Jesus. Judas, den die Christen einen Verräter nennen, war übrigens meines Vaters Freund. Oh ja, ich kenne die Schriften der Christen, die seit einigen Jahren im Umlauf sind. Sie enthalten so viele Widersprüche und Unwahrheiten, wie ein Hund Flöhe hat, kein Wunder, dass die Gestalt Jesu unter einem Nebel verborgen bleibt.
Ich bin ein skeptischer Mensch, ich glaube nicht daran, dass die Cäsaren zu Göttern werden, und auch den Mysterienkulten vermag ich nichts abzugewinnen. Wenn man mich in den Tempeln sieht, dann nur deshalb, weil ich kein übles Gerede haben und mit meinen Nachbarn in Frieden leben will. Doch das Leben und Wirken des Jesus von Nazareth erfüllt mich mit Ehrfurcht und Staunen: Er hat etwas Neues und Unerhörtes in die Welt gebracht, und deshalb wundert es mich nicht, dass er so viele Anhänger gefunden hat. Was mich aber außerordentlich erstaunt, ist die Tatsache, dass die Botschaft Jesu Ansprüche stellt, die die Menschen unmöglich erfüllen können. Trotzdem bekennen sich immer mehr Menschen zu ihm.
Seine Anhänger nannten Jeschua Barabbas Fürst der Donnersöhne, ein treffendes Gegenbild, das ihn besser erfasst als die wundersame Gestalt in den Evangelien von Markus und Konsorten, denn die Geschichten kann man nur glauben, wenn man glauben will, und das ist noch das Beste, was ich darüber sagen kann.
Für die Christen ist Jeschua Barabbas weder ein Held noch ein König. Sie bezeichnen Jesus als den Messias, und obwohl mein Vater dies anzweifelte, glaube ich trotzdem, dass einiges dafür spricht, dass er es tatsächlich war, obwohl es die Juden bis heute vehement bestreiten. Sie warten immer noch auf ihren König, was zwischen Juden und Christen schon zu bösem Blut geführt hat: Die Anhänger Christi nennen das jüdische Volk, also sein Volk, Gottesmörder, was, wie wir noch sehen werden, eine Verkehrung der Tatsachen ist und eine heuchlerische Lüge, die noch viel Ärger verursachen wird. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass sie sich bei den Römern und Behörden einschmeicheln wollen.
Ich habe nichts gegen die Christen, obwohl das, was sie die größte Geschichte der Menschheit nennen, nicht zu dem passt, was ich über die Ereignisse vor der Zerstörung des Tempels durch Titus in Erfahrung gebracht habe.
Für Pontius Pilatus war Jesus ein Aufständischer. Was die Christen in Antiochia, Ephesus, Korinth und Rom natürlich bestreiten, sie nennen ihn einen Gottessohn, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Aber selbst Markus, wenn er überhaupt so hieß, behauptete nicht, dass Jesus ein Gott war, davon sprach nur Paulus.
Paulus ist Jesus nie persönlich begegnet. Ich weiß, jeder Christ erzählt einem die Geschichte, die ihm, Paulus, auf dem Weg nach Damaskus widerfahren ist. Nun ja, solche Halluzinationen hatten auch schon andere. Wir wissen doch, was davon zu halten ist. Hunderte haben Stein und Bein geschworen, gesehen zu haben, dass Cäsar Augustus in einer Wolke zum Himmel aufgefahren ist. Der Mensch kann sich alles, aber auch wirklich alles einbilden. Ich habe mit Menschen geredet, die Paulus gekannt haben, und was sie mir von ihm erzählten, hört sich alles sehr schön an. Wenn ich nicht hier bei Salernum eines der schönsten Güter besäße und nicht Dutzende von Schiffen in Ostia, sondern das Schicksal der Sklaven teilte, würde ich sicher auch Gefallen an den Briefen des Paulus finden. Denn zweifellos haben die Christen ein Herz für die Erniedrigten dieser Welt. Wäre ich Christ, müsste ich meinen letzten Mantel mit den Armen teilen, von meinen Gütern ganz zu schweigen. Da lässt es sich mit den Göttern Jupiter, Apollo oder Artemis allemal besser auskommen. Doch will ich gern anerkennen, dass dieser Paulus ein Cäsar des Geistes war. Was er aus dieser kaum beachteten Geschichte am äußersten Ende des Imperiums gemacht hat, die dem Kaiser nicht einmal zu Ohren kam und dessen Sekretär auch nicht sonderlich beschäftigte, macht ihn in meinen Augen zu einem großen Mann.
Ihr werdet merken, dass Paulus trotzdem nicht mein Held ist, nicht einmal Jesus, sondern der, der vergessen im Schatten des Nazareners steht und dessen Taten Markus und seine Kollegen Jesus zuschreiben. Das Leben des Jeschua Barabbas wurde von ihnen bewusst oder unbewusst totgeschwiegen oder verfälscht.
Die Ereignisse liegen lange vor der Zerstörung Jerusalems. Leider gibt es keine Berichte über den Prozess, den Pontius Pilatus gegen die beiden führte. Nur aus den Schriften der Christen ist bekannt, dass der Präfekt die Juden zwischen Barabbas und Jesus entscheiden ließ und danach seine Hände in Unschuld wusch. Ich frage Euch: Seit wann lässt sich ein römischer Statthalter vorschreiben, was er zu tun hat? Aber nehmen wir ruhig an, dass etwas Ähnliches passiert ist. Nicht, dass die Vermutung aufkommt, dass ich, der Sohn eines Griechen mit hellenischer Bildung, ein Judenfreund wäre. Dennoch kann ich mich der weit verbreiteten Ansicht, sie seien ein verworfenes Volk, das nur überall Unruhe verbreitet, nicht anschließen. Die Juden sind ein tapferes Volk. Ich wollte, wir Griechen hätten uns so hartnäckig gegen die Römer gewehrt. Aber dazu hatten wir nicht mehr die Kraft und diese Unbedingtheit, und so wurden wir zu Römerlein, und die wahren Römer blickten auf uns herab und schimpften uns Friseure und Masseure, obwohl sie von uns alles übernommen haben, was aus diesen Bauern gebildete Menschen macht. Sie sind zweifellos das diebischste Volk der Erde. Sie haben uns alles gestohlen. Selbst unsere Seelen.
Ein halbes Leben habe ich mich mit Jeschua Barabbas und Jesus Christus auseinandergesetzt, sodass ich manchmal selbst glaube, der Fürst der Donnersöhne zu sein. Lest also, welch wundersames Leben er durchlitt.
Jerusalem brennt. Damit will ich beginnen.
Zweiter GesangDas Antlitz der Nemesis
2
Als er die Rauchsäule sah, die ihn das Schicksal der Stadt ahnen ließ, war er bereits ein Greis, dennoch war er rüstig, eine aufrechte, Ehrfurcht gebietende Gestalt. Das Alter hatte ihm die Behändigkeit genommen, aber nur wenig von seiner Kraft. Sein Verstand hatte nicht gelitten, und immer noch galt sein Wort viel im Rat zu Gamala.
Beim Anblick des brennenden Jerusalems dachte er zurück an die Tage, als man ihn den Fürsten der Donnersöhne nannte.
Vierzig Jahre war es her, dass Jesus für ihn ans Kreuz geschlagen worden war. Seine Haut war welk geworden, seine Lenden spendeten kein Leben mehr, und nun musste er auch noch erfahren, dass das Untier siegte und die Römer vollendeten, was sich mit dem Tod Jesu bereits angekündigt hatte.
Von denen, die mit Jesus durch Galiläa gezogen waren, lebte kaum noch jemand. Erst nannten sie ihn Rabbi und Meister und schließlich Messias, und doch verstanden sie ihn nicht, schließlich waren sie, von Judas einmal abgesehen, alle nur einfache Fischer und Bauern. Doch er, Jeschua, war mit seinen Irrtümern noch viel weiter gegangen. Dabei kannte er Jesus von Kindesbeinen an, und trotzdem war er ihm fremd geblieben. Er sah seine Qual in Gethsemane, seine Enttäuschung, danach zweifelte er an ihm und verließ sich lieber auf sich selbst, wobei auch nicht mehr dabei herauskam als brennende Häuser und eine Menge Toter. Nun brannte Jerusalem. Auch Jeschua war einmal Herr dieser Stadt gewesen, auch damals hatten Rauchsäulen die Sonne verdunkelt. Aber es änderte nichts. Zwar sammelte er noch einmal die Donnersöhne und kämpfte gegen das Untier, kämpfte gegen die Legionen, doch er unterlag.
Die Macht der Wölfin blieb ungebrochen. Vespasian herrschte in Rom über den Erdkreis, ein verbrauchter, geiziger Mann, der die Kloaken besteuerte. Josephus Flavius, der Sohn des Matthias, ein Jude auch er, aber ein Speichellecker und Abtrünniger, nannte Vespasian einen Messias und machte aus dem grobschlächtigen Bauern ein Wunder, das Gottes Wort erfüllt. Vespasian ist nicht der Messias, den die Propheten Sacharja und Jesaja angekündigt haben. Auf den warten die Juden bis heute und vielleicht bis in alle Ewigkeit. Jesus kann es auch nicht gewesen sein, denn Jesus hatte nicht gesiegt, wie die Schrift es voraussagte.
Hatte er, Jeschua Barabbas, zu wenig aus seinem Leben gemacht? Dies fragte sich der alte Mann, als er zur Rauchsäule sah, zu dem rotgoldenen Licht, das über die Berge tanzte. Du hättest nicht weggehen dürfen, warf er sich vor. Aber was wäre daraus geworden? Noch mehr Leid, noch mehr Tote, und du hattest damals schon genug Menschen enttäuscht, deswegen gingst du mit dem Gold, das du Pilatus abgenommen hattest, fort aus Galiläa, verschwandest aus dem Weltgeschehen und nanntest dich Jehuda ben Hillel, nicht weil du mit dem großen Hillel verwandt gewesen warst, sondern weil dir nichts Besseres einfiel und es ein guter jüdischer Name war, und du wurdest zum Bauern, der seine Weinberge pflegte, und zum Züchter, und deine Pferde siegten in Alexandria und Antiochia. Du hast zwei Söhne gezeugt und viele Töchter, und deren Kinder sind dir eine Freude. Doch seit du aus Galiläa geflüchtet bist, treibt dich ein Gefühl des Verlustes um.
Er seufzte. Auch mit seinem Weib Rebecca hatte er es gut getroffen. Voller Zärtlichkeit dachte er an ihr braunes kleines Gesicht mit den geheimnisvoll grüngrauen Augen, die mit Liebe auf ihm ruhten.
Er, Jeschua Barabbas, Herr der Donnersöhne, hatte bei vielen Frauen gelegen und nie Skrupel gehabt, seinem Körper zu geben, was er verlangte, und obwohl er schon viele Frauen enttäuscht hatte und umgekehrt von vielen Frauen getäuscht worden war, blieben doch bis auf die unerfüllte Liebe zu Maria aus Magdala nur angenehme Erinnerungen zurück. Rebecca war die Frau seines Lebens geblieben. Selbst als ihr Leib schon runzelig geworden war, blieb sie für ihn doch immer das Mädchen, das zu ihm auf den Berg gekommen war.
Wieder flackerte ein Licht am Horizont auf, gefolgt von weiteren Rauchsäulen am Himmel.
»Sie zerstören die Stadt des Herrn!«, sagte Jakobus, sein Ältester, der hinter ihn getreten war und ihm seine Rechte auf die Schulter legte; tastend suchte er nach ihr und drückte sie.
»Sie zerstören den Tempel«, flüsterte Jeschua mehr zu sich als zu seinem Sohn.
Er wusste, dass ein Blatt der Geschichte umgeblättert wurde und etwas Unwiederbringliches versank, und das Gefühl der Ohnmacht schüttelte ihn, denn einst war sie seine Stadt gewesen. Jawohl, Jeschua Barabbas, der Sohn des Schmieds Abbas, der sein Geschlecht auf David, den Heldenkönig, zurückführen konnte, hatte einmal die Stadt Jerusalem in seinen Besitz gebracht. Er stammte aus dem Hause David, so hatte es ihm der Vater immer wieder erzählt und Bethlehem, die Geburtsstätte Jesu, als Geburtsort angegeben.
Dies blieb nicht die einzige Parallele.
Jerusalem brannte, und nun war wirklich höchste Not, und Gott hätte sein Wort einhalten und den Messias schicken können. Doch kein Donner war zu hören, kein Berg tat sich auf und kein Abgrund riss die Römer in die Tiefe.
»Wir können hier nicht bleiben«, sagte Jakobus, und der alte Mann nickte traurig und wünschte sich seine Behändigkeit zurück.
Ich habe gefehlt damals, dachte der alte Mann. Aber ich glaubte, das Richtige getan zu haben. Ich war kein Räuber, wie die Christen behaupten, sondern ein Kriegsherr gegen Rom.
»Es wird Zeit, Vater!«, drängte der Sohn.
Er senkte den Kopf und folgte dem Sohn hinunter ins Wadi ins Haus des Nahum, der einst in Sepphoris dabei gewesen war und der ihn, selbst ein alter Mann, freudig in seinem Haus empfing und ihn reichlich bewirtete.
Jeschua war mit dem Sohn aus der Dekapolis gekommen, weil er sehen wollte, ob sich erfüllte, was prophezeit worden war, dass also die Macht der Fremden an den Mauern Jerusalems zerschellte. Aber Jerusalem brannte. Die Römer würden das Allerheiligste betreten, und frevlerische Hände würden den Gründungsstein berühren und die Menora und die Schaubrote ergreifen, den Tempelschatz plündern und das Volk fortführen, so wie einst die Assyrer und Babylonier. Sie würden, wie es Römersitte war und sie es in Karthago getan hatten, Salz auf die Ruinen streuen, und nur der Wind würde in den leeren Mauern wispern. Er ballte die Hände zu Fäusten und fluchte dem Alter und der Zeit.
Auf dem mit Palmen gesäumten Weg kam ihm Nahum mit seinen Söhnen entgegen. Er legte Jeschua die Hand auf die Schulter und zog ihn an sich. Über ihre Gesichter liefen Tränen.
»Ja, es ist geschehen«, sagte Jeschua. »Jerusalem brennt. Der Tempel ist in der Gewalt der Ungläubigen, und Er ließ es zu. Er ließ es zu!«, wiederholte er, legte die Hand auf die Stirn und sah klagend zum Himmel.
»Wo bleibt Er? Warum lässt Er nicht die Berge bersten?«, schrie er, und der Freund riss sich das Tuch vom Kopf, warf es zu Boden und trampelte auf die Goldschnüre.
»Verflucht seien sie, die Römer. Verflucht. Dreimal verflucht!«
Der Wind hob das Tuch auf und wehte es fort, in die Glyziniensträucher hinein.
»Ich bin zu spät gekommen«, klagte Jeschua.
»Was hättest du tun können? Selbst damals hast du ihnen weichen müssen. Und heute, alt und verbraucht, wie wir sind, kann man uns kaum als Kämpfer gebrauchen«, erwiderte Nahum.
»Mit ihnen sterben«, flüsterte Jeschua und straffte sich, er sah sich wieder auf den Zinnen Jerusalems, er, die Hoffnung des Volkes.
»Das ist doch Unsinn!«, widersprach Amos, Nahums ältester Sohn, ein breitschultriger Mann mit abgearbeiteten Händen und dem wettergegerbten Gesicht eines Landmannes, der sich mit dem Boden auskannte und für den nichts anderes zählte als das, was der Ernte nutzte; er hatte für die Wolkenreiterei der Alten nicht viel übrig. »Ihr seid alte Männer. In Jerusalem wird genug gestorben! Wir müssen von hier verschwinden. Am Morgen kam die Nachricht, dass die Römer herankommen. Sie werden keinen Unterschied machen zwischen denen, die gegen sie gekämpft haben, und denen, die nicht trügerischen Träumen nachjagen. Sie werden uns alle in die Sklaverei führen, wenn sie unserer habhaft werden.«
»Ja, fliehen wir«, stimmte Jeschua mit müder Stimme zu. »Meine Enkel erwarten mich in Gamala. Sie brauchen mich. Jedenfalls eine Weile noch.«
Schweigend kehrten Jeschua und Nahum Arm in Arm zum Haus zurück, wo die Knechte bereits die Wagen beladen und die Esel und Ochsen vorgespannt hatten.
»Und wieder müssen wir in dem Land, das uns verheißen war, vor den Feinden fliehen!«, sagte Jeschua bitter.
»Der Herr prüft uns«, antwortete Nahum.
Voller Trauer blickte er auf das Haus, auf die voll beladenen Wagen und erzählte, wie er in das Wadi gekommen war und das Land urbar gemacht hatte, erzählte von der braunen fruchtbaren Krume, die das weißgelbe Korn schenkte, von den Weinstöcken an den Hängen und von der Geburt der Söhne, vom Tode des Weibes im Kindbett. Hier im Wadi hatte er die aufregenden Tage vergessen können, als er als Donnersohn und Gefolgsmann Jeschuas durch Galiläa streifte und den Römern als Gottesstreiter widerstand, und nun mussten sie weichen vor den Söhnen der Wölfin.
»Ist das die Strafe, weil wir töteten? Weil wir uns anmaßten, in Seinem Namen zu töten? Haben wir Unrecht getan, Jeschua?«, fragte Nahum.
»Wir taten es in Seinem Auftrag, so wie die Propheten es vorausgesagt hatten.«
»Du warst nicht der Messias!«, sagte Nahum stirnrunzelnd.
»Stimmt. Ich war es nicht«, gab Jeschua seufzend zu. »Aber als Jerusalem in meiner Hand war und das Volk meinen Namen rief, habe ich gehofft, dass ich es dem Volk sein könnte.«
»Warum ist Er nicht gekommen? Er ist uns verheißen!«
»Ja, Er ist uns verheißen. Die Nazarener behaupten, dass Er unter uns war.«
»Er war da, und wir haben es nicht bemerkt? Du meinst doch nicht etwa diesen Jesus aus Nazareth?«
»Ich hielt mich lange Zeit für sein Schwert.«
»Richtig. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber er wurde gekreuzigt.«
»Ja, und die Nazarener sagen, dass er wieder auferstanden ist.«
»Na ja. Oder hast du ihn danach gesehen?«
»Nein«, gestand Jeschua. »Ich habe ihn gesucht, aber nicht gefunden.«
Langsam verließ die Karawane das Wadi. Als sie die letzten Palmen der Allee erreichten, ertönte von den Bergen ein Widderhorn. So war es verabredet, wenn Gefahr im Anzug war. Schon Abraham hatte das Horn gehört und später Josef, Saul und David, und es hatte große Siege, aber auch Niederlagen eingeleitet und endete immer damit, dass Menschen starben.
»Das ist Aron!«, erklärte Nahum. »Ich habe ihn auf den Bergen mit drei Knechten postiert.«
Er rieb sich nervös den Arm, der sonst mit Gebetsriemen umwickelt war. Ganz offensichtlich machte er sich Sorgen.
Brennende Pfeile stiegen jetzt auf. Sieben Lichter mit dunklen Schwänzen verglühten über den braungelben Hängen.
»Es sind sieben Mann, die auf unser Wadi zureiten.«
»Das wäre notfalls zu schaffen«, sagte Jakobus, der hinter ihnen auf dem Wagen stand, ein groß gewachsener Mann, größer noch als der Vater, jedoch mit schwarzem dichtem Haar und Bart und zugewachsenen Augenbrauen und mit der kühnen Nase dessen, der ihn gezeugt hatte. Jeschua griff, ohne sich umzudrehen, nach seiner Hand und drückte sie als Zeichen der Liebe und Dankbarkeit. Es tat gut, einen solchen Sohn zu haben, und er dankte Gott dafür. Er tat es nicht oft genug. Er wusste es nur zu gut und seufzte. Wenn Jeschua in Glaubensdingen nicht den Eifer, die Unbedingtheit und Strenge zeigte, die ihm einst der Vater und die Mutter vorgelebt hatten, so deswegen, weil er ein wenig griechisch war. Er hielt sich an manche Gebote, aß koscher, aber die Sabbatgesetze hielt er nicht immer streng genug ein. Auch jetzt im Alter, wo er, wie abzusehen war, bald vor den Herrn treten würde, war er kein Frömmler, sondern hatte sich einen offenen Geist bewahrt, der die Vorzüge anderer Völker durchaus erkennen konnte und die Schönheit einer Statue oder das Kunstwerk eines Phidias zu schätzen wusste.
»Wir sind doppelt so viele wie die Hunde. Die sollen uns mal besser in Ruhe lassen!«, fuhr der Sohn fort.
Er ist so ungestüm, wie ich einst war, dachte Jeschua und schmunzelte. Auf diesen Sohn konnte er stolz sein.
»An Zahl sind wir ihnen überlegen«, bremste Jeschua Jakobus’ Eifer, »aber es sind Römer und kampferprobte Soldaten. Titus, der Sohn des Kaisers, ist mit den besten Legionen nach Jerusalem gezogen. Hoffen wir lieber, dass es nicht zum Kampf kommt.«
Sie hatten das Tal verlassen und fuhren durch eine Ödnis. Die Sonne stand hoch, und die Esel und Ochsen schnaubten empört.
»Ich habe meine Schleuder dabei«, sagte Jakobus grimmig.
Jeschua nickte, als hätte er dies erwartet; von meinem Fleisch, dachte er.
Sie waren auf der Straße nach Jericho, im Flimmern der Hitze sahen sie sieben Punkte tanzen. Die Glut des Tages schmerzte die Augen.
»Vielleicht sind wir zu unwichtig für sie«, hoffte Nahum. »Schaut sie nicht an, wenn sie vorbeikommen. Beugt euren Kopf und schaut nach unten!«, rief er dem eigenen Gefolge zu.
»Jerusalem brennt. Es hat sich lange gewehrt. Wir müssen damit rechnen, dass sie trunken sind vor Gier und Hochmut«, sagte Jeschua düster.
»Hat Er uns verworfen?«, fragte Jakobus bang; hatte Er, der Einzige, der den Vätern das Land Kanaan gegeben hatte, der das Volk immer wieder geprüft, geschlagen, durchgewalkt und es dennoch dem Bunde gemäß Seiner Liebe versichert hatte, ihnen diese Liebe entzogen? »Vielleicht will Er einen neuen Bund. So etwas Ähnliches hat mir Jesu Bruder einmal gesagt. Jesus selbst soll davon gesprochen haben.«
»Warum? Unser Herr ist ein verlässlicher Gott«, sagte Nahum.
»Darauf haben nicht einmal die Pharisäer eine Antwort. Doch die Frage, was wir tun, wenn sie uns frech kommen, scheint mir jetzt die wichtigere Frage zu sein«, entgegnete Jeschua und wies auf die Straße.
Es waren sieben Reiter, sie waren jetzt deutlich auszumachen. Ihre Helme und Harnische blitzten im Sonnenlicht, als würde Mars samt Gefolge ihnen persönlich entgegenkommen.
»Apoll ist nicht an ihrer Seite!«, kommentierte Jeschua trocken.
Oh ja, er kannte die griechischen Götter, von Kindheit an war er bewandert in ihren Riten und Mysterien, schließlich war Sepphoris nicht weit von Nazareth entfernt und ein Kleinod griechischer Lebensart – inmitten einer barbarischen Umgebung, wie es selbst die Juden in Judäa empfanden. Er kannte die Tempel in Sepphoris, die ihn schon als Knabe magisch angezogen hatten, nicht weil er die Götter der Griechen anbetete, sondern weil ihn die Schönheit der Säulen und Statuen und der familiäre Umgang der Griechen mit den Göttern faszinierten. Er gehörte zu den Juden, die ein wenig griechisch angekränkelt waren, was sich später in Gamala auch durchaus als nützlich herausstellte, wenn er im Rat der Stadt über den Bau von Tempeln zu Ehren Apolls oder Aphrodites mit zu entscheiden hatte. Er mochte die griechische Art, und wenn sein Geburtsort in der Dekapolis gelegen hätte, wäre er sicher noch mehr zum Griechen geworden, aber ungeachtet dessen hielt er unerschütterlich den Glauben an den einzigen Gott hoch, und diese Mischung machte ihn den Römern ebenbürtig. Er hatte jedenfalls keine Hemmungen, die Römer am Sabbat anzugreifen. Doch diese Zeiten lagen vierzig Jahre zurück.
Die Römer kamen im schnellen Galopp heran. Sorgenvoll blickte er auf die Seinen, denn im Gegensatz zu seinem Sohn sah er ihre Zahl als gering an. Er wünschte sich erneut in die Zeit zurück, als Galiläa befreit war und das Volk ihn Fürst nannte und, mehr noch, ihn zu den Sternen hob und in den Synagogen die Worte des Sacharja zitiert wurden:
Tochter Zion freue dich sehr,
und du, Tochter Jerusalem, jauchze!
Siehe, dein König kommt zu dir.
Ein Gerechter und ein Helfer, arm
und reitet auf einem Esel und
einem jungen Füllen der Eselin.
Das mit dem Esel hatte er nicht hinbekommen, das hatte ein anderer getan. Aber wenn es schon ein Reittier sein musste, hätte er sich ohnehin für ein Pferd entschieden. Warum sollte ein König armselig daherkommen, zumal als Gesandter des Herrn? Niemand konnte sich den großen Alexander auf einem Esel vorstellen.
Die Reiter waren jetzt nah genug, um zu erkennen, dass ein Centurio sie anführte. Stolz wie ein Hahnenkamm wippte der rote Haarbusch seines Helms im Angalopp.
Jakobus bewegte sich hinter ihm.
»Ich habe einen Stein in die Schleuder gelegt«, sagte er heiser.
»Lass ihn in der Schleuder. Auch König David hätte gegen diese Krieger nicht zum Wurf ausgeholt.«
»Mit Gott werden wir siegen.«
»Mit Gott schon. Aber wissen wir, was Gottes Wille ist?«
»Wir werden uns nicht abschlachten lassen!«, widersprach der Sohn mit schönem Mut.
Er ist ein guter Mann geworden, dachte Jeschua stolz. Ein Kämpfer, der mit der Schleuder umzugehen weiß. Er hatte es ihm beigebracht, so wie sein eigener Vater es ihm beigebracht hatte. Doch diese Fertigkeit hatte er immer zu den geringeren gezählt. Um ein Anführer der Donnersöhne zu werden, hatte er sich mehr beibringen müssen, nicht nur die Schwertkunst, sondern auch die sorgfältige Planung, den schnellen Entschluss und das sichere Urteil über das einzukalkulierende Risiko. Aber das war gewachsen. Gott sei Dank hatte der Sohn bisher nicht so unruhige Zeiten durchlebt wie er.
»Wir kämpfen nur, wenn es sein muss!«, wies er den Sohn zurecht.
»Hoffen wir, dass es nicht sein muss«, unterstützte ihn Nahum. »Vielleicht sind es Kuriere, die nur die Übergabe einer Botschaft im Sinn haben.«
»Das glaube ich nicht. Seit wann missbraucht man einen Centurio als Kurier?«, fragte Jeschua.
Inzwischen hatten die Reiter sie erreicht. Gebieterisch hob der Centurio den Arm. Sofort parierten die Römer die Pferde. Unruhig scharrten die Tiere mit den Hufen. Staub stieg von der Straße auf.
»Schert euch beiseite! Eure Wagen versperren uns den Weg!«, schrie der Centurio.
Es waren Willkür und Hochmut, die ihn so schreien ließen, denn es war genug Platz für die Reiter, an ihnen vorbeizuziehen.
Dieses männlich harte Gesicht mit den kalten, zwingenden Augen und der kühnen Nase kam Jeschua bekannt vor, und doch kam er nicht darauf, wo er den Mann schon einmal gesehen hatte, geschweige denn wer er war. Schließlich schrieb er die Vertrautheit seiner Einbildung zu.
Auf einen Wink Nahums folgten die Knechte der Aufforderung des Centurios und lenkten die Wagen von der Straße auf das steinige Feld, begleitet von dem Spott der Soldaten.
»Habt ihr Wein?«, fragte ein breitschultriger Soldat mit böse glitzernden Augen in dem aufgedunsenen Gesicht.
Fordernd streckte er ihnen die fleischige Pranke entgegen, eine Pratze, die zu töten gewohnt war. Seine großen fauligen Zähne unterstrichen den rohen Eindruck. Auf Nahums Wink sprang einer der Knechte vom Wagen und reichte ihm eine Amphore. Der Soldat grunzte zufrieden, zerbrach das Siegel und reichte die Amphore mit ehrerbietigem Kopfnicken an den Centurio weiter, der daraus mit vollen Zügen trank, bevor er sie dem Legionär zurückgab. Dieser schüttete gierig den Wein in sich hinein, wobei ein Teil auf die Rüstung troff. Rülpsend reichte er die Amphore weiter und wischte sich mit feister Gebärde den Mund ab. Wenn sie als Kuriere unterwegs gewesen wären, hätten sie jetzt weiterziehen können. Doch sie gaben ihren Pferden nicht die Zügel frei.
»Der Wein war gar nicht mal schlecht. Erstaunlich, dass dieses Geschmeiß etwas von Wein versteht!«, rief der Centurio seinen Leuten zu. »Ist dies der Weg nach Tiberias?«, wandte er sich abrupt an Jeschua. »In diesem verdammten Land führt doch verdammt noch mal keine Straße dorthin, wo sie hinführen soll.«
Er sprach Griechisch, die Sprache, die jeder halbwegs gebildete Mensch verstand, denn die ganze Welt verständigte sich auf Griechisch. Latein sprachen nur die Sadduzäer, die schließlich ihre Gründe hatten, sich mit den Römern gemein zu machen.
»Die Straße ist schon richtig. Sie führt bald durch das Jordantal und über Jericho zum See Genezareth, an dessen Ufer Tiberias liegt. Aber Ihr habt noch einen langen, beschwerlichen Ritt vor Euch, und es gibt keine Herbergen, die einem Römer angenehm sind«, sagte Jeschua mit zuvorkommendem Lächeln.
»Die Straße ist in keinem guten Zustand«, setzte Nahum eifrig hinzu.
»Dieses Pack ist einfach zu faul, ordentliche Straßen zu bauen. Dauernd müssen sie den Gott ohne Namen anbeten. Kein Wunder, dass sie nichts fertigbringen!«, hetzte der feiste Legionär und blickte Beifall heischend zu seinem Anführer. Auch dem Centurio schien die Unterbrechung Spaß zu machen. Begehrlich betrachtete er die drei voll beladenen Wagen und Nahums weiblichen Anhang, dessen Kleidung verriet, dass er kein armer Mann war.
»Wo wollt ihr Geschmeiß denn hin?«, fragte er mit verächtlicher Miene.
»Nach Jericho«, sagte Nahum demütig, ängstlich zu den anderen Wagen schielend, denn die lüsternen Blicke des Centurios waren ihm nicht entgangen.
»Was ist auf den Wagen?«, fragte der Centurio und richtete sich in amtsmäßiger Pose auf dem Pferd auf, offensichtlich, um seine Überlegenheit zur Schau zu stellen. »Habt ihr Waffen versteckt?«
»Aber nein. Bestimmt nicht. Wir sind Landmänner. Unter uns sind keine Krieger.«
»Warum wollt ihr fort von eurem Land?«
»Wir haben Angst!«, mischte sich Jeschua ein. »Wir haben Furcht vor dem Gräuel des Krieges.«
»Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Man erhebt sich nicht gegen die von den Göttern gewollte Obrigkeit. Du hast Angst vor dem Gericht, alter Mann!«, sagte der Centurio höhnisch und tätschelte dabei sein unruhig tänzelndes Pferd.
Sein Brustpanzer mit dem Gorgonenhaupt glitzerte tückisch und bedrohlich.
»Ich würde diesem Pack kein Wort glauben!«, rief der dicke Legionär ihnen hämisch entgegen und ritt dicht an einen der Wagen heran.
Er zeigte auf ein Mädchen von besonderem Liebreiz, eine Enkelin Nahums.
»Die gefällt mir! Schöne Weiber haben die Juden, das muss man ihnen lassen. Viel zu schön für diesen Auswurf!«
Lüstern lauerte er auf das Einverständnis des Centurios, das dieser grinsend mit einem Nicken erteilte.
»Alle runter von den Wagen! Die Männer entladen die Kisten, und die Frauen stellen sich auf der anderen Seite der Straße auf!«, brüllte der Centurio.
»Wenn noch Wein da ist, dann her damit!«, kreischte begeistert ein anderer Legionär, der durch seine eingeschlagene Nase alles andere als friedfertig aussah.
Nahum blickte zu Jeschua und erwartete, dass der einstige Anführer der Zeloten auch jetzt noch einen Ausweg wusste und wie vor vierzig Jahren den Römern durch List und Mut immer noch überlegen war. Noch hoffte Jeschua indes auf ein gutes Ende und machte eine beschwichtigende Geste.
Nahum befahl den Knechten, den Befehl des Centurio zu erfüllen, und bald war die Straße mit Truhen und Kisten gepflastert, auf die sich die Legionäre stürzten. Vor allem auf die Weinamphoren hatten sie es abgesehen. Während des Trinkens starrten sie auf die Frauen und Mädchen, die eng aneinander gedrängt am Straßenrand standen. Breitbeinig, sich in den Hüften wiegend ging der Feiste zu ihnen, riss ihnen die Tücher vom Kopf und schnalzte mit der Zunge.
»Bis auf die drei alten Scharteken sind alle jung und nicht übel und mit ordentlichen Brüsten ausgestattet!«, rief er seinem Centurio zu. »Einige von ihnen scheinen sogar noch nicht zugeritten zu sein.«
Der Centurio lachte roh, sah nach dem Sonnenstand und wies auf eine Felsgruppe hinter den Frauen, nicht unweit der Straße, die Schatten warf und die er für sein Vorhaben wohl als geeignet ansah.
»Die Weiber und den Wein dort zu den Felsen!«, knurrte er, und seine Männer sahen grölend zu, wie Nahums Knechte die Amphoren zu den Felsen trugen.
Die Legionäre banden ihre Pferde an die Wagen und trieben die Frauen mit blanker Waffe zu den Felsen, wobei sie ihnen mit der flachen Klinge auf ihr Gesäß schlugen und unflätig spotteten.
Jakobus rührte sich neben ihm. Jeschua wusste, dass er hinter Nahums Rücken die Schleuder zurechtgelegt hatte, und er berührte seine Hand.
»Nein, noch nicht!«, flüsterte er und schüttelte den Kopf. »Tut es nicht! Ihr versündigt euch!«, rief er dann dem Centurio zu. Seine große, eben noch leicht gebeugte Gestalt straffte sich, und sein Blick loderte, wie es Nahum einst in Sepphoris oder auf dem Berg bei Tell Hazor an ihm gesehen hatte, und seine Angst nahm ab. Der alte Mann war immer noch Jeschua Barabbas.
»Mars ist mächtiger als euer Gott. Der Sieger bekommt die Weiber. Ihr Juden hättet euch nicht gegen Rom wenden sollen«, rief der Centurio mit lauerndem Blick, und seine Soldaten wunderten sich, dass er dem Geschmeiß überhaupt eine Antwort gab.
Die Augen des Alten zeigten weder Furcht noch Demut. Ungeduldig warteten die Soldaten auf die Zustimmung des Centurio, ihrer Gier frönen zu dürfen. Schon griffen sie nach den Brusttüchern der Frauen, die mit weißen Gesichtern und flehenden Augen zu ihren Männern sahen, zu Nahum und seinen Söhnen, den Brüdern und Schwägern. Vor allem auch zu der hohen Gestalt des Jeschua, denn natürlich kannten sie die Legenden, die Erzählungen über diesen Mann und erwarteten nun, dass er diesen gerecht wurde.
Jeschua sprang vom Wagen und hielt dem Römer in friedlicher Gebärde die Hand entgegen.
»Lasst uns ziehen. Niemand von uns hat ein Schwert gegen euch erhoben. Kein Kämpfer ist unter uns. Auch ihr habt vielleicht Frauen und Schwestern. Verschont unsere Weiber.«
»Schwestern ist gut!«, grölte der Feiste. »Solche Schwestern sind mir gerade recht.«
Seine Pranke zerriss das Kleid der Jüngsten, der Enkelin des Nahum. Sie schrie und ihr Leib leuchtete weiß und zart in der Klarheit der Jugend.
»Nehmt euch das, was dem Sieger gehört«, forderte der Centurio mit wölfischem Lachen seine Leute auf.
»Lasst ab, sage ich! Lasst die Frauen in Ruhe!«, donnerte Jeschua, und Nahum glaubte, Jeschuas Stimme aus einer anderen Zeit zu hören.
»Hört euch den Alten an!«, rief der Plattnasige. »Jetzt wird der auch noch frech.«
»Irgendwie kommt mir der Kerl bekannt vor«, sagte mit unruhigem Blick der Centurio; auch Jeschua suchte immer noch nach einem Gesicht, das ihn an die kühne, fast edel zu nennenden Nase des Centurios, den feinen Schnitt der Wangenknochen und den Adlerschwung der Augenbrauen über den kalten grauen Augen erinnerte.
»Wir haben euch doch nichts getan!«, jammerte Nahum und hob klagend die Hände zum Himmel, zerrte an seinen Kleidern und rief die Gnade des Herrn an.
Der Centurio lachte und ging steifbeinig auf die Frauen zu, wohl um seinen Männern bei der Untat ein Beispiel zu liefern und sich mit dem Recht des Anführers die Schönste zu nehmen.
»Ihr solltet besser tun, was mein Vater sagt!«, schrie Jakobus erregt.
»Was greint der denn noch herum?«, brüllte der Feiste, sich zu den Wagen umdrehend, und zog dabei dem weinenden Mädchen die Hände von den nackten Brüsten.
Jakobus trat pfeilschnell aus Nahums Deckung, schwenkte die Schleuder, wie er es vom Vater gelernt hatte, und traf mit der schweren Bleikugel den Legionär mitten ins Gesicht. Das hässliche Geräusch brechender Knochen war zu hören.
Mit einem dumpfen Laut stürzte der Soldat zu Boden. Einen Moment war alles wie erstarrt, selbst die Zeit schien anzuhalten. Alle schauten auf den reglos daliegenden Soldaten. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Der Centurio griff fluchend zu seinem Gladius, dem Kurzschwert der Legionäre. Mit wenigen Schritten war er bei Jakobus und stieß diesem die Klinge voller Wut und Kraft in den Leib.
Während er versuchte, den Gladius aus dem Körper zu ziehen, sah Jeschua die aufgerissenen Augen des Sohnes und das Blut auf dessen Gewand. Er zog einen Dolch und stieß blitzschnell und mit geübter Hand die Klinge zwischen Brustpanzer und Helmriemen in die Kehle des Centurios. Sich den Hals haltend, sank der Centurio zusammen, die Augen weit aufgerissen, als könne er nicht fassen, dass dieser Alte ihm den Tod gegeben hatte. Plötzlich hatten selbst die Knechte Knüppel, Forken und Sicheln in den Händen, besannen sich auf ihre Überzahl und drangen auf die Römer ein, die, überrascht von der wütenden Wucht und dem Tod ihres Centurio, geradezu überrumpelt wurden. Zwei Legionäre wurden Opfer des Zorns der Männer, daraufhin flüchtete der Rest, von Steinwürfen verfolgt, in die Ödnis.
Jeschua beugte sich über seinen Sohn. Jakobus lag mit ausgestreckten Armen gegen das Holzrad des Wagens gelehnt am Boden, seine Augen waren weit offen, und aus seinem Mund sickerte Blut. Jeschua zerriss das Gewand des Sohnes auf und stieß bittere Klagerufe aus. In seinem Kopf blitzte das Bild des Mannes auf, den man den Messias genannt hatte, er sah ihn am Kreuz hängen, sah die Frauen den Leichnam in die Tücher hüllen. Oben am Ende des Holzes stand Jesus, König der Juden. Immer wenn er in Not war, erschien ihm dieses Bild. Er weinte, wiegte den Leichnam in seinen Armen und haderte mit seinem Gott. War der tote Sohn die Antwort auf seine Verfehlungen und Anmaßungen?
Er fühlte Nahums Hand auf seinen Schultern.
»Das Tier hat ihn umgebracht!«, flüsterte Jeschua, von Schmerz geschüttelt.
»Was für ein Frevel!«, krächzte Nahum.
»Warum lässt Gott das zu? Er war ein guter Sohn. Er liebte den Herrn und achtete das Gesetz. Mehr, als ich es je tat. Vielleicht ist es das. Er zahlt für meine Schuld.«
Jeschua erhob sich stöhnend und drehte sich nach dem toten Centurio um, löste den Helm von dessen Kopf und schrie auf.
»Er sieht dir ähnlich. Er sieht aus, wie du einst ausgesehen hast in den Tagen der Donnersöhne«, flüsterte Nahum schaudernd.
»Was geschieht mit mir?«, rief Jeschua, fiel auf die Knie und wiegte sich wie die Gläubigen im Tempel. Er sah in die Ferne, wo sich im flimmernden Licht der Wüste die geflohenen Römer in drei winzige Punkte auflösten.
»Es ist das Gesicht desjenigen, der sich in Jerusalem und Galiläa Fürst der Donnersöhne und Messias nennen ließ«, flüsterte Jeschua.
»Ein Zufall!«, kam ihm Nahum zu Hilfe. »Eine Laune der Natur.«
»Ja, ein Zufall«, nahm Jeschua hastig den Trost an.
Sein Blick fiel auf die Hand des Centurio. Als er den Ring sah, traf es ihn wie Rutenschläge. Ein Schrei entrang sich seiner Kehle. Er kannte den Ring. Oh ja, er kannte ihn nur zu gut. Den gleichen Ring trug Cassius, den er einst Freund genannt hatte, bis seine römische Herkunft sie schied. Es war der Ritterring der Cornelier, jenes Geschlechts, das die größten Römer hervorgebracht hatte, den Sieger über Hannibal und andere, die Roms Größe dienten, auch wenn sie inzwischen zu einem bedeutungslosen Stamm herabgesunken waren. Schon lange stellten die Cornelier keine Senatoren mehr.
Der Vorhang riss mit einem die Luft zerschneidenden Geräusch. Es gab keinen Zweifel: Er, Jeschua, hatte nicht nur einen Sohn verloren, sondern auch einen Sohn getötet.
3
Schon in Ur und Eridu, in den alten Städten Chaldäas, hat man über den Gott Hadad geklagt, und was unsere griechischen Götter im Olymp anstellen, lässt auch nicht auf Verlässlichkeit schließen. Sie treiben es mit uns, wie sie wollen. Klein und armselig sind wir Menschen, selbst wenn wir Purpur tragen oder Reichtümer angehäuft haben oder, wie Jeschua, als Freiheitskämpfer gerühmt wurden. Wir alle müssen Schmerz erfahren und Not und Angst und nun, als alter Mann, als er geglaubt hatte, dass ihm nicht mehr viel widerfahren könne und er mit allen Prüfungen durch sei, die ihm der Herr auferlegen konnte, musste er noch eine bestehen, die härter war als alle vorangegangenen. Die Vergangenheit kam zurück und rächte sich auf eine Art, die er nie erwartet hatte und auch nicht erwarten konnte, weil er niemals erfahren hatte, dass seine Liebe zu der Schwester des Cassius nicht folgenlos geblieben war. Aus dem Dunkel war die Frucht seiner Lenden getreten, und er hatte sie nicht erkannt, genauso wenig wie der Centurio weder den Vater noch den Halbbruder erkannt hatte.
In jeder ordentlichen Tragödie hätte jetzt der Chor hervortreten und Jeschuas Schicksal beklagen müssen, sein Leid, seine Schuld und seine Sühne. Aber Tragödien wurden in diesem Land, zumindest auf der Bühne, nicht oft aufgeführt, wenn man von Sepphoris, Cäsarea und einigen anderen Städten einmal absah, die überwiegend von Griechen oder griechisch denkenden Juden bevölkert waren. Denn dies war das Land des einzigen Gottes, und Er hatte in der Vergangenheit nicht daran gespart, Seine Ansprüche an Israel zu zeigen. Und es bewahrheitete sich, dass ein heiler Krug geprüft wird und nicht ein gesprungener.
Jeschua hatte keine Schuld daran, dass er nicht von der Frucht seiner Lenden wusste, denn zu der Zeit war er längst im fernen Kusch gewesen. Durch Herkunft, Tradition und die Macht der Konventionen hatte diese Liebe von Anfang an keine Zukunft, und dies hätten sowohl Helena als auch Jeschua wissen müssen. Zumal er sich gegen das Gesetz verging. Man legt sich nicht zu einem Weib, das anderen Göttern huldigt, und dieses uralte Gebot hatte er, dem Drang der Lenden nachgebend, mit der Unbedachtheit der Jugend verletzt. Und jetzt lag das Ergebnis vor ihm im Staub.
Schluchzend zog er den Ring ab, und nun fielen seine Tränen auch auf diesen Toten.
Nahum umfasste Jeschuas Arm und richtete ihn auf.
»Du glaubst, dass …«
»Ja. Du siehst doch sein Gesicht. Und der Ring bestätigt es.«
»Dann hast du …«
»Ja. Zwei Söhne verloren.«
»Was für ein schlimmer Tag!«, flüsterte Nahum und strich über Jeschuas Gesicht. »Du musst stark sein, mein Fürst.«
»Wie stark soll ich denn noch sein?«
»Wir müssen sie begraben.«
»Ja. Begraben wir sie. Zusammen. Dort.«
Mit zitternder Hand deutete er hinüber zu den Felsen, vor denen die drei anderen Römer lagen. Die Knechte nahmen seinen Sohn Jakobus auf und den anderen Sohn, der ihm fremd war, den Centurio, und schlugen mit Äxten ein Loch in den Boden vor den Felsen und betteten dort die Toten zur Ruhe. Daneben schlugen sie ein weiteres Loch in die Erde, in das sie die toten Römer hineinlegten, und sie schütteten Erde auf beide Gräber und legten Steine darauf, damit keine Tiere die Leichen aus den Löchern zerren konnten. Vor den zwei Gräbern sprach Nahum die Gebete, doch Jeschua betete nicht. Er war gefangen in den Erinnerungen an die erste Liebe, und in seinem Herzen war die Finsternis des Schmerzes.
»Wir müssen weiter. Die Römer werden mit Verstärkung zurückkommen«, sagte Nahum.
»Ja. Geht nur. Geht!«, stimmte Jeschua tonlos zu.
»Kommst du nicht mit?«
»Nein. Ich gehe nach Cäsarea.«
»Was willst du bei den Gottlosen?«
»Um für das hier einzustehen«, sagte Jeschua, öffnete die Hand, in der der Ring lag, und sah dabei hinaus auf das rotbraune Land und den Staubwirbel in der Ferne. Es konnte ein Zeichen sein oder auch nicht. Es war ihm egal.
»Du wusstest nicht, wer er war«, versuchte Nahum ihn zu trösten.
»Macht es das weniger schlimm? Ich muss vor ihr, der Mutter, Rechenschaft ablegen.«
»Du bist ohne Schuld. Er tötete deinen Erstgeborenen.«
»Er, der Centurio, war mein Erstgeborener.«
»Die Wege des Herrn …«
»Das kann ich bezeugen. Unergründlich sind sie, wahrhaftig. Es geschah am Anfang meines Weges!«, sagte Jeschua stöhnend und rieb sich das brennende Gesicht. Er sah das Mädchen vor sich in jener Nacht im Garten des Prätoriums zu Jerusalem. Er sah Cassius’ hassverzerrtes Gesicht, und wieder hörte er seinen mörderischen Schwur. Später, viel später, als er bereits Rebecca zur Frau genommen hatte, kam ihm die Kunde von Helenas Heirat mit einem römischen Hauptmann.
Nach der Nacht im Garten des Prätoriums hatte er die Römerin ihrem Heidentum überlassen müssen und sie und den Liebesschwur vergessen. Sie war wohl zu stolz gewesen, ihn daran zu erinnern, und der Sohn wuchs als Römer auf.
»Du kannst nicht allein nach Cäsarea gehen. Es ist Krieg, und du bist ein alter Mann. Ich werde dir Samuel mitgeben.«
Nahum winkte seinen Jüngsten heran und legte ihm beide Hände auf die Schultern.
»Du bist die letzte Frucht meiner Lenden, und ich liebe dich und ich weiß, dass du deinen Vater ehrst. Gehe mit Jeschua. Ich war sein Gefährte in meiner Jugend, und eine Zeit lang waren wir die Hoffnung des Volkes. Ich werde diese Zeit immer in Ehren halten. Ich will, dass du ihm dienst, wie ich ihm gedient habe. Begleite ihn nach Cäsarea und kehre anschließend mit Gottes Hilfe zu mir nach Jericho zurück, wo wir bei meinem Bruder Hosea Zuflucht nehmen.«
Der Sohn küsste die Hand seines Vaters und versprach zu tun, was ihm aufgetragen wurde. Mit Wehmut beobachtete Jeschua den Abschied. Die Liebe zwischen den beiden und der Schmerz ließen ihn aufschluchzen. Doch dann fasste er sich und nickte den beiden zu. Es war gut, einen Begleiter zu haben. Mit Zuneigung sah er auf Nahums Sohn, der dem Vater und dem älteren Bruder so unähnlich war, von kleiner Statur und stämmig, mit kurzen Beinen und einem breiten Gesicht mit listigen Augen unter einer kurzen Stirn, über der sich rote Locken kräuselten. Nahum hatte ihm stolz erzählt, dass er stark wie Samson sei und Steine zu heben vermochte, die sonst zwei Männer verlangten. Die Jugend und die Kraft konnten ein Ausgleich zu seinem Alter sein. Dankbar drückte er Nahums Hand.
»Ich werde ihn wie einen Sohn annehmen und ihn dir mit Gottes Hilfe gesund zurückschicken«, versprach Jeschua und blickte zu den Steinhügeln vor den Felsen.
Der Hals war ihm wie zugeschnürt. Er holte den Stecken vom Wagen und sein Reisebündel, und Samuel schulterte einen Sack mit Brot und Wasser, Feigen und getrockneten Weintrauben. Hungern würden sie nicht.
Als sie sich verabschiedeten, stand in ihren feuchten Augen die unausgesprochene Frage, ob sie einander wiedersehen würden. Jerusalem brannte, und niemand wusste, was die Römer ihrem Volk noch antun würden. Sie küssten sich auf ihre faltigen Wangen und befahlen einander in Gottes Obhut. Unter Segensrufen trennten sie sich.
Jeschua und Samuel nahmen den Weg durchs Gebirge nach Bet-El und wanderten viele Tage. Sie gingen durch Samaria und sahen die Gräuel, die brennenden Dörfer, die weinenden Witwen und die erschrockenen, fragenden Augen der Kinder. Oft mussten sie sich vor Patrouillen der Römer verstecken und Umwege machen, und manchmal war Jeschua so entkräftet, dass sie einen Tag ruhen mussten. Dies geschah dann im Schatten eines Felsens oder, wenn sie es besser trafen, in einem Tal mit Schatten spendenden Palmen, unter denen sie ihr Brot und die Feigen essen konnten.
Auf Samuels eifrige Fragen erzählte Jeschua von den alten Tagen, in denen er mit Nahum den Römern widerstanden hatte und sie als Räuber gejagt wurden und immer wieder entkamen.
»Sie haben euch nie bekommen!«, sagte Samuel zufrieden und voller Stolz auf den Vater, dem er nun nacheifern wollte.
»Wir waren ihnen lange Zeit immer einen Schritt voraus und schlugen dort zu, wo sie es nicht erwarteten.«
»Ihr wart wie Judas Makkabäus, als er den Antiochius schlug mit Hilfe des Herrn!«, begeisterte sich Samuel.
»Ein wenig von ihm hatten wir schon«, stimmte Jeschua zu. »Wir pflanzten wieder die Standarte der Makkabäer auf und brachten Furcht unter die Römer und die Knechte des Herodes Antipas. Und wir nahmen den Steuereintreibern das ab, was sie dem Volk abgepresst hatten.«
»Und gabt es dem Volk zurück. Ich wollte, ich wäre dabei gewesen.«
Am siebten Tag erreichten sie die Stadt Cäsarea, einzig erbaut, um die Macht der Römer zu demonstrieren, und allen Rechtgläubigen ein Gräuel, erbaut von einem, der sich Freund des Kaisers nannte und dafür die Verachtung des Volkes in Kauf nahm und den Frevel weitertrieb. In den Schriften der Juden steht das Wort Gottes geschrieben und sein Gebot, nur ihn zu lieben, doch auf den Plätzen in Cäsarea standen die Statuen des Kaisers um weiße marmorne Tempel, in denen man vor bunten Altären Jupiter, Adonis, Osiris und Isis Opfer brachte.
»Unrein«, flüsterte Samuel, als sie vom Berggipfel auf die Stadt sahen, und Jeschua erinnerte sich daran, dass über Jerusalem, der Stadt des Herrn, die Rauchsäulen wie die Zedern des Libanon standen.
Grün lag das Land vor ihnen, und die Palmen bewegten sich im Morgenwind, und dahinter lagen weiß in gleißender Pracht die Paläste der Römer und Griechen. Dahinter erstreckte sich das unendlich weite Meer.
Cäsarea, von Herodes dem Großen erbaut, wie ihn die nannten, die vom Glauben der Väter abgefallen waren, war eine Stadt der Griechen, und es fehlte nicht an griechischer Art. So gab es ein Theater, kleiner zwar als in Alexandria, und doch war es ein Zeichen des Siegeszuges hellenischen Geistes. Seit Alexanders Zeiten lag die Hand der Fremden schwer auf dem Land des Herrn.
Sie stiegen hinab in die Ebene und gingen an den säulengeschmückten Häusern vorbei zum Markt, einem rechteckigen, von Arkaden umsäumten Platz, in deren Schatten es angenehm zu wandeln war. Jeschua war lange nicht mehr in Cäsarea gewesen und erkannte die Stadt kaum wieder. Er besaß genug Bildung, um anzuerkennen, dass hier ein Kleinod griechischer Baukunst entstanden war, und es fiel ihm schwer, sich der Schönheit der Statuen zu entziehen und der Grazie der Tempel. Mit tränenden Augen dachte er an den Tempel des Herrn zu Jerusalem, aus dem die Römer mittlerweile wohl die Menora und die Schaubrote fortgeschafft hatten. Das Allerheiligste war entweiht.
Die Stadt hatte sich am Meer entlang aus den Mauern hinaus entwickelt. Sie gingen durch schier endlose Straßen mit prächtigen Villen, fragten nach dem Haus des Longinus und bekamen lange keine Antwort. Ein schieläugiger alter Mann musterte sie mit unangenehmer Neugier und gab ihnen schließlich Bescheid.
»Doch, doch. Ich kenne das Haus des Longinus. Einst war er Hauptmann der Wache in Jerusalem. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Seine Familie lebt aber noch hier.«
»Seine Frau lebt also noch?«
Der Alte zuckte mit den Achseln. »Das ist anzunehmen, denn die Frauen leben länger als wir Männer. Man weiß hier in der Stadt nicht viel über sie. Das Haus liegt hinter dem Palast des Tetrarchen, direkt am Meer. Ein schöner Besitz.«
»Hoffentlich ist sie nicht fortgezogen«, sorgte sich Samuel.
Jeschua schüttelte den Kopf. Daran wollte er nicht denken, und doch peinigte es ihn. Er wusste nicht, ob er noch die Kraft aufbringen würde weiterzuziehen, vielleicht sogar in ein anderes Land, nach Rom gar, um sie dort aufzusuchen. So viele Tage hatte er nicht mehr vor sich.
»Gehen wir zu ihrem Haus«, sagte er, und sie ließen den schieläugigen Mann stehen. Die Angst ließ Jeschua nun schneller ausschreiten. Er wollte Rechenschaft ablegen.
Schon bald standen sie vor dem prächtigen Anwesen, dessen Mauern mit Marmorplatten verkleidet waren. Ein Palast, der dem Geschlecht der Cornelier alle Ehre machte. Offensichtlich hatte sich hier eine stattliche Mitgift Ausdruck geschaffen, denn ein einfacher Hauptmann war weder in der Lage, ein solches Haus zu erbauen, noch ein solches zu führen.
Samuel verabschiedete sich von Jeschua und versprach, in einer nahen Herberge auf diesen zu warten. Jeschua indes wollte Helena allein gegenübertreten und die Nachricht überbringen.
Jeschua ließ den Türring auf die kupferbeschlagene, mit Reliefs ausgekleidete Tür fallen, deren gräuliche Szenen fremden Göttern und Heroen huldigende Gestalten zeigten, den schnellfüßigen Hermes, den die Leier spielenden Apoll und den schildbewehrten Achilleus. Oh ja, er kannte die Strophen der Ilias und der Odyssee und die Irrfahrt des Listenreichen. Jeschua, der Jude, nannte Homer groß. Es gab unter denen, die sich nach dem Gesetz richteten, nicht viele wie ihn.
Noch einmal schlug der Klöppel gegen das kupferbeschlagene Tor. Lange Zeit tat sich nichts. Hinter sich hörte er die Karren, die zum Hafen fuhren, die Rufe der Kutscher und das stetige Raunen der betriebsamen Hafenstadt.
Ob sie tatsächlich fortgezogen waren? Jeschua blieb jedoch hartnäckig, nahm den Stab und schlug ihn kräftig gegen das Tor, und es hallte, als würden Kriegsknechte Einlass begehren.
Endlich hörte er schlurfende Schritte, ein Riegel wurde zurückgezogen, und knarrend öffnete sich das kupferne Tor, als sei es schon lange nicht mehr aufgetan worden.
Ein altes Gesicht sah ihm misstrauisch und verärgert entgegen.
»Ich möchte zur Herrschaft!«, sagte Jeschua.
»Hier gibt es nur eine Herrin«, erwiderte der Diener, der, obwohl er am Hals den Sklavenring trug, abschätzig die einfache Kleidung des Fremden taxierte, um deutlich zu machen, dass dieser keine zuvorkommende Behandlung verdiente.
»Dann führe mich zu deiner Herrin!«, fuhr ihn Jeschua zornig an.
»Wen darf ich melden?«, fragte der Diener, nun vorsichtiger geworden.
»Sag ihr, dass Jeschua bittet, vorgelassen zu werden.«
»Jeschua wer?«
»Das genügt ihr allemal. Sag ihr einfach, dass Jeschua um Einlass bittet.«
Daraufhin schloss der Diener die Tür, ohne ihn in die Halle zu bitten. Als er wieder zurückkam, verbeugte er sich, wie es der Sitte entsprach, und ließ ihn in die Vorhalle eintreten, die kühl war und in deren Mitte ein Springbrunnen den Aufenthalt angenehm machte. Der Diener ging ihm voraus und führte ihn in einen paradiesischen Garten, in dem unter Palmen Hibiskus und Glyzinienbüsche wuchsen. Dahinter lag das Meer.
Am Ende des Gartens, vor dem schmalen Strandstreifen, erwartete ihn in einem kleinen Pavillon eine hohe Gestalt in einem weißen Kleid.
Jeschua verhielt seinen Schritt. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Die Angst vor der Rechenschaft schüttelte ihn, und er dachte wieder an jene Ereignisse in einem anderen Garten, als er jung und stark gewesen war und ihm ihre Götter gleichgültig gewesen waren, aber auch das Verbot des Herrn, nicht bei den Frauen der Philister zu liegen. Er schämte sich nun, Helena mit den Spuren des Alters entgegenzutreten, die zwar seinen Enkeln Achtung abnötigten, die Geliebte der frühen Tage aber erschrecken mussten, hatte sie ihn doch in der Blüte seiner Jugend erlebt.
Als er nähertrat, gewahrte er zuerst ihr weißes Haar. Ihr Gesicht war faltig, aber ihre Augen hatten immer noch den leuchtenden Glanz von damals.
Sie breitete die Arme aus, und er war bei ihr, und sie hielten sich lange umfangen.
»Jeschua. Jeschua Barabbas! Mein schrecklicher Held!«, flüsterte sie, löste sich aus seinen Armen und hielt sein Gesicht fest und las in ihm, las in jeder Falte, las in dem grauen Haar und in der Mattigkeit der Augen. Sie lächelte schmerzlich. »Die Zeit hat uns kräftig durchgeschüttelt, mein Lieber.«
»Das hat sie wohl. Doch deine Augen haben immer noch den Glanz wie in jenen Tagen in Jerusalem.«
»Wie viel Schreckliches ist seitdem geschehen«, sagte sie seufzend. »Aber du siehst immer noch aus, als wärst du der Herr eines Königreiches, zwar ein alter Fürst, aber immerhin ein Fürst«, setzte sie mit scheuem Lächeln hinzu.
»Ein Mann, der sich bescheiden musste!«, wehrte er ab.
»Ein Mann, der klüger geworden ist?«, fragte sie mit stolzem Lächeln, als wäre er ihr Eigentum, als würde sie eine kostbare Statue betrachten, die nach widrigen Zeitläufen zwar angeschlagen ist und Risse aufweist, aber immer noch die Kunstfertigkeit eines Meisters zeigt.
»Klug? Nein. Bescheiden. Herrscher über ein paar Weinberge und Felder und Besitzer eines Gestüts. Das ist alles. Barabbas ist vergessen. Und nun bin ich alt und wäre froh, wenn du einen Sessel bringen lassen würdest, damit sich meine zitternden Knie beruhigen.«
Sie klatschte in die Hände, und Diener eilten herbei und brachten nach ihrer Weisung gleich darauf die Sessel und einen Tisch und stellten Wein und Gebäck zurecht, und sie setzten sich. Jeschua wusste nicht, wie es weitergehen und wie er ihr das Unglück berichten sollte. Er sah über die Glyziniensträucher, in denen ein Schwarm Vögel lärmte, hinweg auf die gegen den Strand rollenden Wellen.
»Schön hast du es hier. Es freut mich, dich hier in so angenehmer Umgebung leben zu sehen«, sagte er unbeholfen und brach ab, und sein Gesicht senkte sich auf die Brust. Er dachte an das Blut, das geflossen war und von seinem Blut war, und an das andere Blut, das wohl auch sein Blut war und weswegen er Rechenschaft ablegen musste, und drückte die Faust an den Mund und sah ihr mit Furcht und Qual entgegen.
»Was hast du, Jeschua? Was bedrückt dich so?«, fragte sie, besorgt über seine offensichtliche Verzweiflung und Not.
»Was weißt du aus Jerusalem?«, fragte er, um Zeit zu gewinnen, um sich selbst wieder aufzurichten und die Festigkeit zurückzuerlangen.
»Das, was alle wissen. Jerusalem ist gefallen. Der Krieg ist vorbei«, hörte er sie flüstern, als könne diese Nachricht nur geflüstert weitergegeben werden und kein lautes Wort vertragen. »Kein Stein soll mehr auf dem anderen sein.«
»So hat er doch Recht behalten.«
»Ja, Jesus hat Recht behalten.«
Er wusste, wen und was sie meinte. Für ihn war Jesus von Nazareth auch nicht mehr Jeschua, auch er nannte ihn wie die Griechen: Jesus Christus, woran ein gewisser Paulus mit seinen Briefen und Predigten einen nicht geringen Anteil hatte. Aus Jeschua, dem Messias, wurde so unter den Nazarenern Jesus Christus, seien sie nun Juden oder Hellenen.
»Du weißt von ihm?«
»Ja, Longinus hat mir viel über ihn erzählt und von dem Tag, als ihm der Prozess gemacht wurde und er ihn ans Kreuz schlug und sich der Himmel verdunkelte.«
»Dein Mann hat mich einst gerettet.«
»Ich weiß. Er gab dir zurück, was er dir schuldete. Leben für Leben, so sagte er mir.«
»Er ist ein guter Soldat. Ich habe ihn geachtet. Und er glaubte nun, dass …«
»Ja. Dass Jesus der Messias war und gestorben und wieder auferstanden ist und wiederkommen wird, am Ende der Tage.«
»Jesus ist spurlos verschwunden. Ich habe ihn damals gesucht.«
»Ja. Aber Longinus glaubte, dass er wiederkommen wird. Sein Tod war ein Zeichen der Liebe. Euer Gott hat seinen Sohn zu uns geschickt, um unsere Sünden auf sich zu nehmen.«
»Und du glaubst das?«
»Longinus glaubte das«, wich sie aus.
»Wo ist er?«
»Er ist von uns gegangen.«
»Das tut mir leid.«
»Ja. Wo lebst du jetzt?«, fragte sie, ganz offensichtlich das Thema wechselnd.
»In der Fremde, bei den Griechen, und mein Name ist nicht mehr Jeschua Barabbas.«
»Dann ist es gut. Dort müsstest du sicher sein. Der Tempel der Juden wird nie wieder aufgebaut werden. Es wird ein schreckliches Unglück über euer Volk kommen.«
»Noch mehr Unglück ist kaum möglich!«
»Ich habe gehört, dass sie alle Juden aus Israel vertreiben wollen.«
»Alle? Nein. Das ist …«
»Doch. Ihr sollt zerstreut werden über den Erdkreis.«
»Sie übertreffen sich in ihrer Grausamkeit immer wieder selbst«, flüsterte er schockiert.
»Du hast deinen Beitrag dazu geleistet, dass die Römer die Juden so hassen.«
»Das ist lange her.«
»Und das ist gut so. Jedenfalls bist du außerhalb Palästinas in Sicherheit.«
»Was wird aus unserem Volk?«, fragte Jeschua und sah sie ratlos an.
Der Tempel war ein Haufen zerbrochener Steine, die man beweinen konnte, aber würde Gott ohne seine Heimstatt und in der Fremde weiterhin am Bund festhalten?
»Wir leben in einer Zeitenwende. Vielleicht hatte Longinus Recht, und Jesus von Nazareth weist nun einen neuen Weg«, sagte sie mitfühlend und legte ihm die Hand aufs Knie, und er ergriff sie und streichelte die welke Haut. »Wie ist es dir ergangen? Erzähl, hast du geheiratet und Kinder?«
Er zuckte zusammen. Es war soweit, nun musste er Rechenschaft ablegen. Er griff in die Tasche seines Haluk und tastete nach dem Ring. Nein, noch war es nicht soweit, noch konnte er es nicht.
»Ich hatte zwei Söhne, und meine Töchter und Enkel sind die Freude meines Lebens.«
»Du hattest? Was ist mit deinen Söhnen?«
»Mein Jakobus wurde vor einigen Tagen ermordet.«
»Du Armer!«, flüsterte sie und drückte seine Hand. »Wie hat es sich zugetragen?«
»Es geschah auf der Straße nach Jericho. Ein Centurio tötete ihn.«
»Was für ein Unglück«, flüsterte sie. »Und warum bist du erst jetzt zu mir gekommen, nach so vielen Jahren? Longinus wusste, dass du die Liebe meiner Jugend bist und ich lange Zeit auf dich gewartet habe. Aber du kamst nie, und deswegen gab ich dem Drängen meines Vaters nach. – Nun greif doch zu. Trink von dem Wein. Nimm von dem Gebäck! – Du trauerst um deinen Sohn und um Jerusalem, nicht wahr? Es ist viel, was du ertragen musst. Ich kenne eure Liebe zu dem Tempel. Ihr werdet von nun an ohne Jerusalem leben müssen.«
»Solange es noch einen Juden gibt, wird Jerusalem Bestand haben und in unserem Herzen sein. Das Gesetz wird zu unserem Tempel werden.«
»Was seid ihr für ein seltsames Volk. So viele Völker sind Rom untertan und nehmen es hin. Viel größere Völker erkennen die Macht des Kaisers an und ihr seid nur wenige und wehrt euch am längsten. Alle haben wir besiegt.«
»Alle? Varus hat in Germanien eine andere Erfahrung gemacht«, erinnerte er an den Feldherrn, der einst auch Tausende von Juden abschlachten ließ und dann später in den Wäldern Germaniens mit seinen Legionen den Tod fand.
»Publius Quinctilius Varus war ein Dummkopf!«
»Ein hochmütiger, grausamer Mensch auf jeden Fall. Schade, dass Germanien so weit weg ist. Was würde passieren, wenn sich die Germanen mit uns zusammentäten und wir von Osten und sie von Westen ins Imperium einfielen?«
»Ein seltsamer Gedanke. Aber das wird nicht geschehen. Niemals! Roms Macht ist auf ewig begründet. Der römische Frieden hält die Welt zusammen.«
»So spricht eine Römerin.«
»Eine Cornelierin zudem!«, sagte sie mit feinem Lächeln.
»Wer weiß, was der Schoß der Zukunft noch birgt.«
»Daran erkenne ich meinen Jeschua«, sagte sie mit mildem Spott. »Immer noch hängst du Träumen nach. Selbst jetzt, wo Jerusalem zerstört ist.«
»Nichts ist ewig. Denk an Alexanders Reich. Denk an Karthago.«